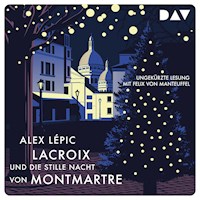14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Lacroix
- Sprache: Deutsch
Dass Docteur Obert an einem Samstagmorgen in aller Früh bei Lacroix Sturm klingelt, verheißt nichts Gutes. Am Vortag hat der Gerichtsmediziner im Restaurant Train Bleu in der Gare de Lyon ein Gespräch belauscht, das ihm keine Ruhe lässt. Zugegeben, ein Glas Roten hatte er sich schon genehmigt, aber dass im Separee hinter ihm ein Mann sein Gegenüber mit einem Mord im TGV nach Reims beauftragt – das hat sich Obert doch nicht eingebildet! Statt mit seiner Frau Dominique über die bunte Marktstraße zu flanieren, macht Lacroix sich auf den Weg ins Bahnhofsrestaurant. Ein herrlich altmodischer Ort, aus einer Zeit, zu der Reisen noch etwas Besonderes war. Doch es ist Eile geboten: Acht TGV verkehren täglich zwischen Reims und Paris. Bei einer Geschwindigkeit von über dreihundert Stundenkilometern bleiben dem Commissaire und seinem Team je nur sechsundvierzig Minuten, um unter zweitausend Reisenden das potenzielle Opfer zu finden und den Mord zu vereiteln. Seine Ermittlungen führen Lacroix in das älteste Champagnerhaus der Welt, wo er mit einem dunklen Familiengeheimnis konfrontiert wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alex Lépic
Lacroix und der Auftragsmord im TGV
Sein achter Fall
Roman
Kampa
Der blaue Zug
1
Er kannte Docteur Obert seit Jahrzehnten als gepflegten, unterhaltsamen und stets gefassten Mann. Deswegen war Lacroix überrascht, als er ebenjenen Obert an diesem Samstagmorgen auf der Straße unterhalb seines Fensters stehen sah, nachdem sein Sturmklingeln ihn und seine Frau lange vor ihrer üblichen Aufstehzeit aus dem Bett geworfen hatte. Entgegen seiner Natur öffnete der Commissaire noch unangekleidet das Fenster und lehnte sich über die schmiedeeiserne Brüstung, um einen genaueren Blick auf den Gerichtsmediziner werfen zu können.
Was er sah, beunruhigte ihn: Die Augen des frühmorgendlichen Besuchers lagen tief in den Höhlen, er war blass und trat unruhig von einem Fuß auf den anderen, er trug keine Fliege, und seine Anzugjacke war falsch geknöpft. Alles in allem wirkte er wie ein Mann, der die Fassung verloren hatte.
»Docteur«, rief Lacroix aus dem Fenster, »was gibt’s?«
»Kann ich raufkommen, Lacroix? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan.«
Der Commissaire warf Dominique, die sich hinter ihm rasch in einen Morgenmantel hüllte, einen Blick zu. Er schüttelte den Kopf und rief herunter: »Ich komme zu Ihnen, Docteur.«
»Was ist denn mit ihm?«, wollte seine Frau wissen. Sie hatte den Gerichtsmediziner nicht gesehen, aber offenbar schon am Klang seiner Stimme erkannt, dass etwas nicht stimmte.
»Ich werde es gleich erfahren«, entgegnete Lacroix, »wenn ich wiederkomme, dann frühstücken wir.« Noch während er den Satz aussprach, spürte er, dass er nicht wirklich daran glaubte. Obert war keiner, der andere im Morgengrauen störte oder leichtfertig um Hilfe bat.
Rasch zog der Commissaire sich an und stiefelte die Treppen hinunter. Er öffnete die Tür, und der kühle Herbstwind schlug ihm entgegen. Der Docteur stand vor dem Haus, genau wie eben, und schaute noch immer leicht schräg nach oben zum Fenster. Sein Blick senkte sich erst, als Lacroix direkt vor ihm stand.
»Oh, Verzeihung, Commissaire, ich war so in Gedanken.« Er riss die Augen auf, als wäre er eben aus einem Traum wachgerüttelt worden.
»Wenn Sie mich ›Commissaire‹ nennen, Docteur, dann stimmt etwas ganz und gar nicht. Kommen Sie, gehen wir hier herüber.«
Er hakte den Mann – wieder nicht seiner Art entsprechend – unter und führte ihn geschwind über die noch menschenleere Einkaufsstraße ins kleine Café du Marché, das zu dieser frühen Stunde als Einziges schon geöffnet hatte. Auf der Terrasse saß nur ein Mann mit Hut unter einem Heizpilz, Lacroix setzte sich an den am weitesten entfernten Tisch. Er machte eine Geste in Richtung Bar und hörte von drinnen: »Deux cafés, sofort.«
»Und jetzt raus damit, Docteur, was hat Sie um den Schlaf gebracht?«
»Es ist … wie soll ich sagen? Ich glaube ja selbst, dass es Unfug ist. Jedenfalls habe ich das den ganzen gestrigen Nachmittag über geglaubt. Ich stand an meinem Sektionstisch und sagte mir immer wieder: Obert, das ist doch Unfug. Das hast du doch nur falsch verstanden, sagte ich. Heute Nacht kamen dann aber die bösen Gedanken, und ich habe mich stundenlang in meinem Bett hin- und hergewälzt, weil die Worte mir nicht aus dem Kopf gegangen sind.«
Lacroix atmete einmal tief durch. Dem Docteur war nur schwer ein verständlicher Satz zu entlocken, aber die Unruhe in seinen Augen beunruhigte auch den Commissaire vom bloßen Hinsehen. Langsam und beharrlich sagte er: »Können Sie mir sagen, um welche Worte es eigentlich geht, mein Lieber?«
Der Wirt kam und stellte die beiden Tassen vor ihnen ab. Der Gerichtsmediziner begann sogleich wie manisch, den imaginären Zucker in seinem café zu verrühren.
»Sie haben recht, Lacroix, ich sollte von vorn anfangen. Wie Sie wissen, gelüstet es mich ab und an nach einer längeren Mittagspause. Das Institut liegt ja nicht weit entfernt von der Gare de Lyon, man kann fußläufig dorthin gelangen. Gestern war so ein Tag, und ich genoss die Aufmerksamkeit des vorzüglichen Oberkellners Philippe im Train Bleu. Das Mittagsmenü dort ist wirklich ausgezeichnet und die Preise bei Weitem räsonabler als am Abend. Ich saß also an meinem liebsten Tisch, von dem aus man einen wunderbaren Blick auf den Gastraum hat. Man beobachtet die Menschen so gern, wenn man ihnen sonst nur nach ihrem Ableben begegnet, verstehen Sie, Commissaire?«
»Bitte, fahren Sie fort«, sagte Lacroix. Er trank seine Tasse mit dem kräftigen Espresso aus, blieb dabei aber hochkonzentriert.
»Das Menü begann mit dem limettenmarinierten Oktopus auf Kichererbsen. Einfach phantastisch. Ich war sehr früh dran und fühlte mich ganz schön allein in dem großen Raum. Das Restaurant war noch fast leer, nur hinter mir hatten zwei Gäste schon ihr Essen vor sich, frühe Reisende, dachte ich. Ich habe überhaupt nicht auf sie geachtet. Was für ein Ärger.«
Lacroix konnte fast nicht mehr an sich halten, so ausschweifend und langatmig war die Schilderung des Gerichtsmediziners.
»Als die Hauptspeise kam, war das Restaurant dann schon gut gefüllt, und es herrschte großer Lärm. Ich hatte mir ein kleines Glas Roten gegönnt, deshalb dachte ich hinterher, ich müsste mich in meiner Weinlaune verhört haben. Und dennoch war mir, als hätte ich die beiden tiefen Stimmen hinter mir gut herausfiltern können. Es fing damit an, dass ich das Wort ›töten‹ hörte.«
Der Commissaire hielt den Atem an. Nun kamen sie also zum Kern der Geschichte.
»Von dem Moment an habe ich mich besonders auf die Stimmen konzentriert. Wie gesagt, es war sehr laut, und ich wollte ja nicht aufstehen, zu dem Tisch gehen und fragen: ›Bonjour, sagen Sie mal, wen wollen Sie im Zug nach Reims töten?‹«
»Ging es darum, Docteur?«, fragte Lacroix ungläubig und spürte sein Herz in der Brust schlagen. »Hat das jemand gesagt? Jemand soll im Zug nach Reims getötet werden?«
»Hören Sie, Commissaire …«
»Docteur Obert«, unterbrach der ihn, »ich weiß, Sie werden mir jetzt gleich sagen, Sie hätten sich bestimmt verhört und das sei alles ›Unfug‹. Doch ich bitte Sie voller Vertrauen, sprechen Sie einfach weiter. Ich kenne Sie nun schon so lange und weiß: Wenn Sie wegen eines Details alarmiert sind, dann kann ich dem trauen. Und da wir nun schon einmal hier zusammensitzen, bitte ich Sie, genau wiederzugeben, was Sie gehört haben.«
2
Das Déjeuner des Docteur Obert
Die Lammkeule provenzalischer Art war außen scharf angebraten und innen noch blutig-zart, der Maître hatte ihm eben direkt am Tisch auf dem Holzbrett eine dicke Scheibe abgeschnitten. Der Braten galt als die Spezialität des Hauses. Dazu hatte die Küche ein cremiges Gratin dauphinois geschickt. Genussvoll aß er den ersten Bissen, als der Kellner an den Tisch trat und ihm das zweite Glas vom roten Chinon servierte.
»Merci«, murmelte Docteur Obert, doch der junge Mann in schwarzer Weste und Fliege war schon wieder verschwunden. Er hörte Geld klimpern, offenbar beglichen die Reisenden hinter ihm ihre Rechnung. Docteur Obert kostete vom Wein, der perfekt mit dem Lamm harmonierte, und verschluckte sich auf einmal an einem Stück Fleisch, hustete kräftig, und genau in dieser Schrecksekunde hörte er hinter sich im nächsten Séparée das Wort: »… töten.«
Er war wie vom Donner gerührt und versuchte, sich auf seiner mit dunkelblauem Stoff bezogenen Sitzbank möglichst unbemerkt umzudrehen. Doch der Tisch hinter ihm lag außerhalb seines Sichtfeldes. Er wandte sich wieder dem Essen zu, seine Konzentration aber verblieb im anderen Séparée. Nur Wortfetzen wehten herüber, einzelne Worte, die Oberts Hände erzittern ließen. Vielleicht lag es auch an der Härte in dieser Stimme, sie klang irgendwie animalisch. Er spürte kalte Schauer über seinen Rücken laufen.
»… nimmt den Zug nach Reims … das älteste Haus … Montag … gute Gelegenheit … im Zug töten.«
Im Zug töten. Er stieß gegen sein Glas, als er diese Worte hörte, und es kippte um und landete mit einigem Klirren auf dem Teller. Der gute Bordelais verteilte sich über die weiße Tischdecke, und auch die Mahlzeit war verdorben. Er spürte die Blicke der Restaurantgäste an den Tischen ringsum, am liebsten wäre er im Boden versunken. Sofort war der Kellner wieder da, reichte ihm zwei Stoffservietten und nahm das Glas vom Tisch.
»Alles in Ordnung, Monsieur Obert?« Nun kam auch Philippe, der alte Oberkellner, dazu. »Sie sehen etwas blass aus.«
Nicht meinen Namen, dachte Obert erschrocken und zog den Kopf ein.
»Ich lasse Ihnen sofort einen neuen Braten bringen, Docteur«, versicherte Philippe, während sein junger Kollege die Tischdecke abzog. Als die beiden verschwunden waren, hob wieder das allgemeine Gemurmel an, und er wagte es, sich noch einmal vorsichtig umzuschauen.
Nein, dachte er. Und sprang auf. Er schob sich aus der Bank heraus und schaute in das nächste Séparée. Es war leer. Sie waren weg. Gegangen. Offenbar hatten sie das Chaos am Nachbartisch genutzt, um sich schnell und unauffällig aus dem Staub zu machen.
Oder …
Nur schwerfällig drängte der Gedanke sich ins Bewusstsein des Gerichtsmediziners: Oder hatte er einfach alles nur missverstanden und sich jetzt das schönste Déjeuner für eine Räuberpistole verdorben?
Aber er hatte die Worte so deutlich vernommen …
»Philippe, mon cher«, rief er durch den Raum, und der Oberkellner eilte mit sorgenvollem Blick herbei. »Es tut mir leid, ich fühle mich nicht wohl. Kannst du das Lamm wieder abbestellen? Ich komme nächste Woche zurück.«
»Bien sûr, cher Docteur. Aber bei Ihnen ist alles in Ordnung?«
»Alles gut, merci. Nur die viele Arbeit, nehme ich an. Ich bin ganz schön durch den Wind.«
»Ja, das Verbrechen schläft nicht. Es schläft nie.« Der Oberkellner nickte eifrig und half dem Docteur in seinen Mantel.
Obert starrte noch eine Weile auf die grüne Sitzbank, auf der der Mann mit der finsteren Stimme gesessen hatte. Als Philippe sich umdrehte, nahm er kurzerhand die zwei kleinen Wassergläser vom Tisch, die noch nicht abgeräumt worden waren, und steckte sie in seine Manteltasche.
3
»Das heißt, Sie haben die Gläser, und wir haben damit zumindest Fingerabdrücke von diesen Männern?«
»Na ja … ich bin mir vor dem Restaurant wahnsinnig dumm vorgekommen und habe nach einem Mülleimer Ausschau gehalten.«
»Mais non!«, rief Lacroix aus und ließ fast die Espressotasse fallen – seine dritte seit dem Beginn der Erzählung.
»Aber ich habe dann doch beschlossen, sie mitzunehmen. Es war so ein Gefühl.«
Der Commissaire atmete auf. »Eine sehr weise Entscheidung. Konnten Sie schon etwas daran feststellen?«
»Wo denken Sie hin? Ich habe die Gläser ganz hinten in meinen Büroschrank gestellt, weil ich meinen Ohren eben nicht getraut habe. Doch die Nacht hat mich eines Besseren belehrt. Und jetzt bin ich hier.«
»Ich muss sagen: Ich teile Ihre Sorge. Auch wenn ich hoffe, dass das alles nur ein dummer Scherz ist.«
»Es klingt doch wie ein dummer Scherz, oder? Was meinen Sie, Commissaire?«
»Nehmen wir mal an, es wäre keiner. Was haben wir dann? Einen Mann. Der nach Reims fährt.«
»Es könnte auch eine Frau sein.«
»Sie haben recht, Docteur, Sie haben recht«, grummelte Lacroix und kratzte sich an der Stirn. »Wenn wir der Zeitangabe Glauben schenken, dann fährt er am Montag? Das wäre übermorgen. Und es geht um ein Haus … das älteste Haus. Was kann das bedeuten?«
»Das älteste Haus von Reims?«
»Ergibt das Sinn? Wir werden sehen. Und der Mord soll im Zug stattfinden. Das ist nicht gerade wenig.«
»Ich finde, das ist gar nichts. Wissen Sie, wie viele Züge täglich nach Reims fahren?«
»Mehr als zehn, nehme ich an«, sagte Lacroix schulterzuckend. »Das wird ein hektischer Montag, fürchte ich.«
»Aber warum sollten die beiden sich darüber in aller Öffentlichkeit unterhalten?«
»Nun, so öffentlich war es doch gar nicht. Lange vor der Mittagszeit, der resto war fast leer, das Gespräch schon fast zu Ende, als sie ankamen. Und Sie konnten nicht einen einzigen Blick auf die Männer werfen?«
»Unverzeihlich, ich weiß, Commissaire.«
Lacroix schüttelte den Kopf.
»Machen Sie sich keine Vorwürfe, Docteur. Ich würde sagen, Sie gehen jetzt noch einmal nach Hause und legen sich ins Bett, und wir treffen uns um elf Uhr beim Train Bleu. Dann stecken die Mitarbeiter dort in den Vorbereitungen. Ich würde als Erstes gern mit Ihrem Philippe sprechen. Vielleicht kannte er die Gäste ja.«
4
»Es ist unser Wochenende, so komm doch mit«, bat er,und Dominique lächelte ihn an. »Seit du das Rathaus leitest, haben wir doch nur die Wochenenden …«
»Ich weiß, du meinst es lieb, mon commissaire, aber ich sehe doch, wenn du Blut geleckt hast. Du würdest unser Essen nicht genießen, sondern wärst im Kopf längst woanders. Also tu mir den Gefallen, geh deiner Räuberpistole nach, und ich werde uns ein paar Blumen kaufen und danach Brigitte treffen. Die kommt heute aus Saint-Cloud in die Stadt. In Ordnung?«
»Denkst du wirklich, es ist eine Räuberpistole?«
»Eine Unterhaltung über einen Auftragsmord im Train Bleu? Das klingt mir schon gewaltig nach Hitchcock.«
Dominique hatte recht. Er würde sich ohnehin nicht konzentrieren können und ihnen beiden den Tag verderben. Lacroix zog die Stirn in Falten und verfiel in das grüblerische Schweigen, für das er auf dem Polizeirevier und in seinen eigenen vier Wänden bekannt war.
Eine Stunde später zog er allein los. Es war immer noch vor zehn, doch als er aus der Haustür auf die Rue Cler trat, kam ihm ein steter Strom von Menschen entgegen. Auf der Terrasse des Café Central saßen jetzt dicht gedrängt Paare und Familien, die Croissants und Omeletts frühstückten. Beim Blumenladen standen die Leute Schlange, genau wie beim Fischhändler gegenüber. Er liebte diese Wochenendstimmung auf der Marktstraße, und es fiel ihm schwer, sich nicht davon anstecken zu lassen.
Lacroix hatte das Bedürfnis, nachzudenken. Also mied er den lauten Boulevard Saint-Germain und wich stattdessen auf die Seine-Quais aus, auf denen am Vormittag weniger Gedränge herrschte. Der Himmel über der Stadt strahlte in einem tiefen Blau, doch das klare Wetter hatte die Temperaturen über Nacht abstürzen lassen. Lacroix fror in seinem dünnen Sommermantel; er hätte doch schon zum Übergangsmantel greifen sollen. Auch seinen Hut vermisste der Commissaire. Dafür steckte er sich unter dem Pont Alexandre III die erste Pfeife des Tages an und ging dann gemessenen Schrittes am Wasser entlang, auf dem die Sonne tanzte. Nur einige Jogger überholten ihn und ein paar Fahrradfahrer, und Lacroix hielt sich immer auf der linken Seine-Seite gen Osten, stieg kurz vor der Île de la Cité die Rampe hinauf und ging dann entgegen dem Straßenverkehr über die Stadtinsel.
Nachdenklich betrachtete er den legendären ehemaligen Sitz der Pariser Kriminalpolizei und seufzte dabei schwer. 36, Quai des Orfèvres: Die dicken Mauern vis-à-vis Notre-Dame, wo Simenon schon seinen Maigret hatte ermitteln lassen, standen zwar noch, aber sie hatten ihre Bedeutung verloren. Die Brigade Criminelle hatte inzwischen ein hochmodernes gläsernes Gebäude im Norden der Stadt bezogen, nahe der Stadtautobahn, des Périphérique, das aussah wie der Sitz eines großen Konzerns. Die Funktionalität hatte wieder einmal eine alte Pariser Legende begraben, so waren die Zeiten heute. Kopfschüttelnd ließ er die Baustelle um die Kathedrale rechts liegen und ging am nördlichen Seineufer hinüber zur Île Saint-Louis. Er durchquerte die ruhigen kleinen Wohnstraßen derer, die sich das Leben in der absoluten Mitte der Stadt noch leisten konnten oder wollten. Auch hier gab es, in bester Lage, kleine Handwerksbetriebe und sogar eine alte Autowerkstatt. Selbst das zentralste Paris trug noch Spuren des alten Lebens in der berühmtesten Stadt der Welt. Nicht alles war verloren gegangen. Noch eine Seine-Querung, zur Linken die Bastille, und dann war es nicht mehr weit. Schon aus der Ferne sah er auf der großen Turmuhr der Gare de Lyon, dass er die Dauer seines Fußmarschs richtig eingeschätzt hatte. Es war zwei Minuten vor elf Uhr. Und er hatte jetzt einen klaren Kopf und fühlte sich durch die Bewegung gut durchgewärmt. Vor dem Bahnhofsportal lief Docteur Obert schon unruhig auf und ab.
Als sie sich vorhin voneinander verabschiedet hatten, war der Arzt ruhiger gewesen, deshalb hatte Lacroix gehofft, dass er seine alte Gelassenheit wiedergefunden hatte. Doch weit gefehlt. Schon eilte der Gerichtsmediziner auf ihn zu und nahm ihn an seine Seite.
»Kommen Sie, Commissaire, kommen Sie, man hat oben gerade die Tür geöffnet. Wir werden also nachfragen können.«
Zusammen betraten sie die große Bahnhofshalle. Auf den Gleisen erkannte Lacroix aus der Ferne einige Schnellzüge, die sich bereit machten für ihre Fahrt durchs Land. Hier an der Gare de Lyon fuhren die TGVs in Richtung Süden und Südosten ab, in die Provence, nach Nizza und natürlich auch nach Lyon. Einige Reisende standen, wie er es auf Bahnhöfen oft beobachtete, orientierungslos herum, während es den anderen, die sich mit ihren Koffern wie eine Stampede durch die Menge drängelten, nicht schnell genug gehen konnte. Die typische Bahnhofsmelodie der SNCF knarrte aus den Lautsprechern: Dip-dip-didip … Manchmal summte er sie, wenn sie mit dem Zug aus der Normandie zurückkamen, sogar zu Hause noch.
Obert konnte es kaum abwarten. Er hatte schon die halbe Treppe erklommen und sah ungeduldig zu Lacroix hinab. Das Train Bleu lag in der ersten Etage des Bahnhofs und entsprach so gar nicht dem Typus einer heutigen Bahnhofsgaststätte. Vielmehr stammte es aus den Zeiten, als Reisen noch etwas ganz Besonderes gewesen war. Und genauso war auch das Interieur ganz anders, als man es heute von einer Bahnhofsgaststätte erwartet hätte. Es wirkte eher, als wäre man zum Essen ins Château Versailles eingeladen, musste der Commissaire, der ewig nicht mehr hier gewesen war, wieder einmal zugeben.
Sein Staunen hielt einige Augenblicke an: das Staunen über die Höhe des Raums, über die gewölbte Deckenkonstruktion mit den unglaublichen Wandgemälden, über das Blattgold, das jede Oberfläche zierte, und über die riesigen Kronleuchter, die über dem noch menschenleeren Saal funkelten. Die großen Fensterfronten gingen zu beiden Seiten hinaus: auf den Bahnhofsvorplatz und zu den Zügen. Auf dieser Seite konnte man das Gewusel beobachten wie in einem alten Kino: die Menschen, die sich schnell bewegten, Koffer, die hin- und hergezogen wurden – eine einzige große Stummfilm-Szene, weil alle Geräusche von den dicken Teppichen, den Vorhängen und der klassischen Musik hier drin verschluckt wurden.
Die Kellner standen in einer kleinen Runde, als hielten sie eine Besprechung ab.
Lacroix trat Docteur Obert versehentlich in die Hacken, weil der plötzlich im Mittelgang stehen blieb und sich hektisch umwandte.
»Mir ist noch was eingefallen, Commissaire, auf dem Weg hierher.«
»Ja?«
»Ich habe nur die Stimme des einen Mannes gehört. Der andere, der hat gar nicht gesprochen. Der hat immer nur zustimmend gemurmelt, das klang ganz merkwürdig.«
»Meinen Sie, er war stumm?«
Obert suchte im Gesicht des Commissaire nach einem Hinweis, dass er zum Narren gehalten wurde.
»Docteur Obert«, ertönte da die Stimme eines hageren älteren Herrn mit schwarzer Fliege und schwarzer Weste über dem gestärkten weißen Hemd. Er kam auf sie zugeeilt, die Arme ausgebreitet. »War alles in Ordnung gestern? Geht es Ihnen besser?«
»Philippe, merci, ja, es ist alles wieder in Ordnung. Es lag auch gar nicht an Ihrem Essen, beileibe nicht. Wir sind … sozusagen dienstlich hier. Das ist …«
»Commissaire Lacroix«, fiel Philippe ihm ins Wort, »verzeihen Sie, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe, herzlich willkommen im Train Bleu. Eine Ehre, Sie hier bei uns zu haben. Ihre Frau … ich muss Ihnen sagen: Ich bin wirklich begeistert von unserer neuen Bürgermeisterin.«
Lacroix nickte freundlich. Lob für Dominique war ihm angenehmer als Lob für sich selbst. »Möchten Sie einen Tisch für zwei?«
»Haben Sie vielen Dank, Monsieur. Zuerst würden wir gern mit Ihnen sprechen. Dann verstehen Sie auch besser, warum unser beider Freund«, er wies auf Obert, »gestern etwas unpässlich war.«
Der Maître des Train Bleu musste ein diskreter, ja verschwiegener Mann sein, der Beruf verlangte, jeglicher Neugier abzuschwören – und doch glaubte der Commissaire jetzt ein Leuchten in Philippes Zügen zu bemerken, eine gewisse Fiebrigkeit.
»Natürlich«, sagte er, »folgen Sie mir. Ich lese alles über Ihre Fälle, Commissaire Lacroix. Ich hätte nicht gedacht, dass ich je die Gelegenheit bekäme, Ihnen bei einem behilflich zu sein.«
Sie ließen sich, einander gegenüber, auf zwei blauen Lederbänken an einem Tisch nieder. Obert rückte dicht an Lacroix heran, als wollte er sich seiner versichern.
»Nun, noch hoffen wir, dass es gar nicht zu einem Fall kommt. Gestern aßen mit Docteur Obert noch zwei weitere Gäste in Ihrem Restaurant. Es war sehr früh am Mittag. Sagen Sie, haben Sie die Männer zufällig bedient?«
»Nein, leider nicht. Das war ein junger Kollege von mir, Jean-Pierre, der heute seinen freien Tag hat. Ein junger Vater, er arbeitet nur unter der Woche.«
»Verstehe. Würden Sie uns die Adresse Ihres Kollegen geben?«
»Natürlich. Ich suche sie Ihnen gleich heraus.« Philippe wollte eben aufstehen, aber Lacroix hielt ihn zurück.
»Aber gesehen haben Sie die Herren natürlich trotzdem?«
»Ja, bien sûr. Ich begrüße jeden, der das Train Bleu betritt.«
»Kannten Sie die Gäste?«
»Leider muss ich das verneinen, Commissaire. Ich bin mir sogar sicher, sie nie zuvor gesehen zu haben.«
»Was hatten die Herren denn zum déjeuner?«
»Hm, da muss ich eine Kassenabfrage machen, das geht nur im Büro. Nach dem Mittagsgeschäft kann ich nach nebenan gehen und Ihnen die Rechnung dann am Nachmittag ins Büro faxen. Aber ich weiß, dass sie bar bezahlt haben. Kreditkartendaten haben wir also keine.«
»Das hatte ich auch nicht erwartet. Aber es macht nicht unwahrscheinlicher, dass wir es vielleicht doch mit einem neuen Fall zu tun haben«, sagte Lacroix. Heutzutage zahlten die meisten Menschen mit Karte, wer immer noch Bargeld dabeihatte, machte sich dadurch nicht weniger verdächtig.
»Was war denn mit den beiden Herren, Commissaire?«
Obert beugte sich über den Tisch und setzte zu sprechen an, doch Lacroix legte ihm die Hand auf den Unterarm. »Mein lieber Freund hat eine Unterhaltung mitangehört, die uns einen Hinweis auf ein eventuell bevorstehendes Verbrechen geliefert hat. Aber mehr kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, bedaure.«
»Ach was, na, wie ich immer sage: Das Verbrechen schläft nicht.«
»Können Sie die Gesichter der beiden Männer beschreiben?«
»Ich denke nicht«, erwiderte der Philippe. »Ich hatte gestern selbst Tischgäste, und wir waren sehr gut besucht, mittags und abends je hundertfünfzig Gäste, da habe ich keine klare Erinnerung, so leid es mir tut.«
»Gut, Monsieur, ich danke Ihnen vielmals«, sagte Lacroix. »Ach, gibt es hier oben eigentlich Videoüberwachung?«
»Commissaire, für Sie wäre es gut, aber wir haben viele prominente Gäste, wir sind der Diskretion verpflichtet. Allerdings ist der Bahnhof überwacht, wie Sie wissen. Sie sollten es also bei Ihren Kollegen probieren.«
»Das werden wir. Ich danke Ihnen.« Lacroix wollte sich erheben, doch Philippe hielt ihn mit einer ausladenden Geste zurück.
»Ich kann nicht zulassen, dass Sie unser Restaurant an einem Wochenende zu dieser Uhrzeit verlassen, ohne hier gegessen zu haben. Und Ihnen, Docteur, sind wir auch noch eine Hauptspeise schuldig. Also lehnen Sie sich zurück, ich serviere Ihnen sofort den Plat du Jour. Der Mensch muss auch mal pausieren, oder, Commissaire?«
Darauf fiel Lacroix beim besten Willen keine Erwiderung ein.
5
Noch vom Restaurant aus hatte er im Commissariat angerufen. Philippe war etwas näher am Telefon stehen geblieben, als statthaft gewesen wäre. Aber Lacroix hatte seine Assistentin Jade Rio ohnehin nur gebeten, den jungen Kellner von zu Hause abzuholen und aufs Revier zu bringen. Rio war diejenige, die an diesem Wochenende auf Bereitschaft im Büro saß.
Der Maître hatte sich geweigert, ihr Geld anzunehmen.
Nachdem er sich vor dem Bahnhof von Docteur Obert verabschiedet hatte, trat der Commissaire den Weg in Richtung Boulevard Saint-Germain an. Die kühle Luft tat ihm gut, denn das Kotelett vom Duroc-Schwein mit dem Gratin dauphinois lag ihm doch etwas schwer im Magen. Die Köche im Train Bleu geizten weder mit Butterschmalz noch mit Sahne. Die kleine Flasche Sancerre hatte ihr Übriges getan.
An der Seine flogen die Möwen ganz dicht über seinen Kopf hinweg. Ob es heute noch Regen geben würde? Vom Boulevard bog er ab in die Rue Montagne Sainte-Généviève, die steil bergan in Richtung Panthéon führte. Sein Ziel lag aber ganz am Anfang der langen, engen Straße auf der rechten Seite: der graue Betonbau aus den sechziger Jahren, ein bunkerartiger Kasten mit kleinen Fenstern, der das Commissariat der fünften und sechsten Pariser Arrondissements beherbergte. Die beiden Polizisten, die den Zugang zum Revier bewachten, öffneten schnell das Metalltor und salutierten schon, als Lacroix noch weit entfernt war. Immer wieder hatte er versucht, das den Wachen abzugewöhnen, aber irgendwann kapituliert. Ständig kamen neue junge Leute von der französischen Polizei, die ihren Dienst in der Hauptstadt versehen wollten. Im Wartebereich in der Eingangshalle war jeder Stuhl besetzt, das Wochenende war Hochzeit für Taschendiebe, und so waren viele aufgebrachte Stimmen in noch mehr verschiedenen Sprachen zu hören. Er fühlte mit der Polizistin, die all diese Beschwerden bearbeiten musste.
Angesichts der hohen Kalorienzufuhr beim déjeuner