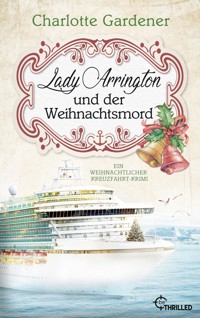5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Mary Arrington
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Diese Kreuzfahrt steht unter keinem guten Stern.
Krimiautorin Lady Mary Arrington stellt ihren neuesten Roman vor - und wo ginge das besser als auf der Queen Anne? Mit von der Partie ist diesmal auch Marys Lektor Mr Bayle, der sich nicht gerade als seetauglich erweist und sich auch noch permanent mit Kapitän MacNeill in die Haare kriegt. Und als hätte Mary mit den beiden Streithähnen nicht schon alle Hände voll zu tun, muss sie sich außerdem mit ehrgeizigen Astronomen, dubiosen Sterndeutern sowie deren Anhängern herumschlagen und stolpert schließlich noch über zwei Leichen. War es Mord? Mary stürzt sich in die Ermittlungen, doch ihr läuft die Zeit davon. Kann sie den Täter vor der anstehenden Sonnenfinsternis überführen und eine weitere Katastrophe verhindern?
Band 5 der gemütlichen Kreuzfahrt-Krimi-Reihe um die charmante Hobbyermittlerin Lady Arrington.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Über dieses Buch
Krimiautorin Lady Mary Arrington stellt ihren neuesten Roman vor – und wo ginge das besser als auf der Queen Anne? Mit von der Partie ist diesmal auch Marys Lektor Mr Bayle, der sich nicht gerade als seetauglich erweist und sich auch noch permanent mit Kapitän MacNeill in die Haare kriegt. Und als hätte Mary mit den beiden Streithähnen nicht schon alle Hände voll zu tun, muss sie sich außerdem mit ehrgeizigen Astronomen, dubiosen Sterndeutern sowie deren Anhängern herumschlagen und stolpert schließlich noch über zwei Leichen. War es Mord? Mary stürzt sich in die Ermittlungen, doch ihr läuft die Zeit davon. Kann sie den Täter vor der anstehenden Sonnenfinsternis überführen und eine weitere Katastrophe verhindern?
Charlotte Gardener
Lady Arrington und der dunkle Schatten des Mondes
Ein Kreuzfahrt-Krimi
1
»Mr. Bayle?«
Mary klopfte ein weiteres Mal.
»Mr. Bayle, machen Sie doch bitte auf!«
»Ich bedauere, meine verehrte Mrs. Arrington«, drang es durch die Tür der Piccadilly Suite. »Dazu sehe ich mich nicht in der Lage.«
Seine Stimme klang schwach und weinerlich. Doch war es typisch für ihn, dass er es selbst in angeschlagener Verfassung nicht an Höflichkeit fehlen ließ.
»Sie haben schon so viel verpasst«, sagte Mary. »Das Auslaufen von Miami, die Durchquerung des Panama-Kanals, den Landgang in Panama-Stadt. Da habe ich ein wunderschönes Viertel voller Kolonialbauten und Kirchen besichtigt, eine Ruinenstadt, wirklich eindrucksvoll, und das Biomuseo in einem architektonisch faszinierenden Gebäude. Es wird auf unseren kommenden Stationen noch zahlreiche solcher tollen Sehenswürdigkeiten geben. Da können Sie doch nicht die gesamte Reise in Ihrer Kabine verbringen.«
Kunst und Kultur waren bei Mr. Bayle für gewöhnlich ein wirkungsvolles Lockmittel. Dieses Mal verfing es nicht.
»Bei allem Respekt, meine hochgeschätzte Mrs. Arrington – da bin ich anderer Meinung. Ich habe keinerlei Absicht, diese Räumlichkeiten in absehbarer Zeit zu verlassen.«
Es war ein schwieriges Unterfangen gewesen, ihn überhaupt zu dieser Kreuzfahrt zu überreden. In gewisser Weise war er freilich auch auf Marys vorherigen Reisen mit der Queen Anne zugegen gewesen, durch Videotelefonate, bei denen er ihr beratend zur Seite gestanden und ihr hilfreiche Informationen geliefert hatte. Dadurch hatte er entscheidend zur Aufklärung der Verbrechen beigetragen, die sich an Bord ereignet hatten. Allerdings hatte er bis dato nicht einmal in Erwägung gezogen, jemals selbst einen Fuß auf das von ihm als ›Todeskutter‹ geschmähte Schiff zu setzen. Alle dahingehenden Vorschläge hatte er empört von sich gewiesen. Um ihn endlich dazu zu bringen, hatte es eines besonderen Anlasses bedurft. Mary hoffte, dieser habe seine Zugkraft nicht verloren.
»Das würde bedeuten, dass Sie auch meine Lesung versäumen. Das wäre zu schade, wo sie doch einen so wesentlichen Anteil an der Entstehung und Vollendung dieses Werks hatten.«
Als Marys Lektor beim Verlag Fitch & Finnegan hatte Mr. Bayle diesen Anteil in Form von Durchsichten, Korrekturen und Verbesserungsvorschlägen erbracht. Als ihr langjähriger Freund hatte er sie zudem unentwegt und unermüdlich bestärkt und angetrieben, den Krimi zum Abschluss zu bringen. Marys Meinung nach durfte er bei der Buchvorstellung nicht fehlen. Er hatte das ebenso gesehen und mehrfach seine Vorfreude darauf zum Ausdruck gebracht – bis Mary zum ersten Mal erwähnt hatte, dass die Buchvorstellung auf der Queen Anne stattfinden sollte. Da der Roman stark von Marys Erlebnissen auf dem Schiff inspiriert war, schien ihr das folgerichtig. Mr. Bayle hatte das zwar zugegeben, sich jedoch mit Händen und Füßen gegen seine Teilnahme an dieser Veranstaltung – und somit der Reise – gewehrt. Er mochte nicht nur keine Kreuzfahrtschiffe, er mochte Schiffe schlechthin nicht, und Gleiches galt für das Meer. So britisch er mit seiner Vorliebe für Earl Grey und Shakespeare und seiner Königinnentreue sein mochte, in dieser Hinsicht lief sein Charakter dem seines Heimatlandes entgegen, das immerhin einst eine gewaltige Seemacht gewesen war. Wenn die Bevölkerung aus Landratten wie Mr. Bayle bestanden hätte, wäre vermutlich kein einziger Engländer jemals von seiner Insel heruntergekommen. Zunächst hatte er mit der ihm eigenen steifen Sachlichkeit allerhand mehr oder weniger stichhaltige Argumente angeführt, warum sein Aufenthalt an Bord absolut undenkbar war. Dann, weil Mary nicht lockerließ, hatte er in zahlreichen stundenlangen Diskussionen mit zunehmender Verzweiflung nach Ausflüchten gesucht. Mit einer Mischung aus Engelsgeduld und Unnachgiebigkeit hatte Mary seine Sorge vor Schiffbruch, Piratenüberfällen und, ganz vorn auf seiner Liste, lärmenden Pauschaltouristen entkräftet, bis Mr. Bayle irgendwann keine Wahl mehr gehabt hatte, als klein beizugeben.
Jetzt sah es aus, als wäre ihre mühsame Überzeugungsarbeit umsonst gewesen.
»Das wäre zwar sehr schade«, kam es durch die Tür. »Allerdings wäre auch niemandem damit gedient, wenn ich während dieser Veranstaltung meiner Übelkeit erliege, mit allen damit verbundenen unschönen Folgen. Wenn ich mich übergeben müsste, könnten böswillige Literaturkritiker dies als Reaktion auf vermeintlich mangelnde Qualität Ihres Werkes anführen. Dafür möchte ich nicht verantwortlich sein.«
»Vielleicht sollten wir ihn in Ruhe lassen«, meinte George MacNeill, der neben Mary stand. Seine makellos saubere und faltenfrei gebügelte Uniform bildete wie immer einen Kontrast zu seinem wettergegerbten Gesicht mit dem dichten Vollbart. »Wenn es ihm wirklich so schlecht geht.«
Mary hatte gehofft, dass Mr. Bayle nach Überwindung seines Widerstands an der Kreuzfahrt nicht nur nichts auszusetzen haben, sondern sie sogar genießen würde. Schließlich hatte sie dafür gesorgt, dass er sie in höchstem Komfort verbringen würde. Sie hatte die Piccadilly Suite für ihn gebucht, die direkt neben ihrer eigenen Unterkunft, der Trafalgar Suite, auf Deck 10 lag, weit entfernt von den Pauschaltouristen, vor denen ihm so grauste. Sie hatte sichergestellt, dass die Bars seinen schottischen Lieblingswhisky vorrätig hatten und den Stewart angewiesen, ihm jeden Morgen eine Kanne Earl Grey und Scones mit Marmelade und Clotted Cream, jeden Nachmittag seine geliebten Gurkensandwiches zu servieren, damit er sich selbst fern von Großbritannien wie zu Hause fühlte. Alles vergeblich. Seit dem ersten Tag der Reise verschmähte er die Speisen mit dem Hinweis, er behalte nichts davon im Magen, und nahm nur trockenen Zwieback und Kamillentee zu sich. Marys wiederholte Angebote, ihn auf dem Schiff herumzuführen oder auf einem der Außendecks frische Luft zu schnappen, was ihm sicher gutgetan hätte, hatte er allesamt ausgeschlagen. Stattdessen hatte er sich in seiner Suite verschanzt. Vorher hatte er immerhin noch die Tür geöffnet. Jetzt verweigerte er sogar das.
Bei all dem hatte Mary zunächst geglaubt, es handele sich um einen Vorwand, begründet in Mr. Bayles Angst, beim ersten Schritt aus seiner Unterkunft von einer Horde Passagiere aus den unteren Klassen überfallen zu werden, die ihn in ein knallbuntes Hawaii-Hemd stecken, ihm einen Cocktail mit Schirmchen aufnötigen und ihn zu einer Polonaise um den Pool zwangsverpflichten würden. Nachdem er sich allerdings im Laufe weniger Tage in einen Schatten seiner Selbst verwandelt hatte, blass, mit eingefallenen Wangen und Tränensäcken, hatte sie eingesehen, dass er ihr einen derart leidvollen Zustand sicher nicht vorspielte, sondern ihn tatsächlich, wie er behauptete, eine handfeste Seekrankheit überkommen hatte. Wobei sie an der Vermutung festhielt, dass nicht allein stürmischer Seegang dafür verantwortlich war. Ein riesiges Schiff wie die Queen Anne wurde selbst von hohen Wellen nicht spürbar durchgeschüttelt. Sie glaubte, dass es zumindest zu einem Teil Nervosität und Anspannung, vielleicht gar eine milde Form von Panikattacke war, was ihrem Lektor so zusetzte. Sie machte sich Vorwürfe. In ihrem Eifer, ihn zu dieser Reise zu bewegen, hatte sie Mr. Bayle gegen seinen Willen in eine Umgebung verpflanzt, die viel zu weit außerhalb seiner Komfortzone lag (die im Wesentlichen aus seinem Arbeitszimmer bestand). Es hätte sie nicht gewundert, wenn sie eines Morgens auf ihren Balkon getreten und Mr. Bayle dabei ertappt hätte, wie er eines der Rettungsboote zu Wasser ließ, um auf eigene Faust die Rückfahrt um die halbe Welt anzutreten, natürlich in seinem (wenig seetauglichen) Tweedanzug, den abzulegen er sich trotz des beständigen Sonnenscheins beharrlich weigerte. Aber zu Fluchtversuchen schien ihm die Kraft zu fehlen.
»Ich denke, wir sollten noch nicht aufgeben«, sagte sie leise zu George, damit Mr. Bayle sie nicht hörte. »Diese Fahrt wird schließlich noch einige Tage dauern. Zum einen wäre es wirklich eine Schande, wenn er noch weitere unserer Stationen verpassen würde, Ecuador, Peru, Chile, und nichts außer dem Inneren seiner Suite zu sehen bekäme. Außerdem: Dass er einen Punkt erreicht hat, an dem er nicht einmal mehr die Tür öffnet, ist eine alarmierende Entwicklung.«
»Er will halt für sich sein. Das ist doch verständlich, wenn er nicht auf der Höhe ist.«
»So einfach ist es bei ihm nicht. Glaub mir, ich kenne ihn. Wenn wir ihn jetzt vollkommen sich selbst überlassen, wird er noch tiefer in sein Elend sinken. Dann kriegen wir ihn gar nicht mehr da raus, bis er wieder englischen Boden unter den Füßen hat.«
Sie sprach wieder lauter, auch wenn sie es langsam anstrengend fand, sich durch eine geschlossene Tür zu unterhalten.
»Sollen wir Sie nicht vielleicht doch auf die Krankenstation bringen oder den Schiffsarzt kommen lassen?«
Mr. Bayle hatte dies schon mehrfach abgelehnt. Mary hatte es ihm nicht verdenken können. Der berüchtigte Chief Medical Officer Dr. Germer war nicht gerade als einfühlsamer Mediziner bekannt, der sich aufopfernd um seine Patienten kümmerte. Als Fachgebiet hatte der füllige Österreicher mit der orangenen Haartolle das Einschmeicheln bei gutbetuchten Passagierinnen der höheren Klassen gewählt, von denen er sich die Erlösung von geringfügigen Beschwerden fürstlich entlohnen ließ. Des Weiteren war er höchstens auf die Verführung seiner Sprechstundenhilfe spezialisiert, was dem Begriff ›Bettmanieren‹ in diesem wenig medizinischen Kontext eine besonders unappetitliche Note verlieh. Statt Patienten von Übelkeit zu heilen, war er Marys Meinung nach eher dazu geeignet, dieses und andere Leiden durch seine permanente Enzianschnapsfahne und den Moschusduft seines Deos hervorzurufen, das an der Eindämmung seines Schweißgeruchs kläglich scheiterte. Zudem hätte der arme Mr. Bayle aufgrund seiner engen Verbindung zu Mary – die Germer nach zahlreichen Auseinandersetzungen zuwider war – wohl kaum auf eine Vorzugsbehandlung hoffen dürfen. Aber wenn es mit Germers fachlichen Kenntnissen auch nicht weit her war, hätten sie vielleicht ausnahmsweise dazu gereicht, ihrem angeschlagenen Lektor wirkungsvolle Tabletten gegen seine Unpässlichkeit zu verabreichen.
»Unter keinen Umständen«, rief er. »Nach allem, was ich über diesen Quacksalber erfahren habe, würde ich mich niemals an ihn wenden, wenn ich nicht wenigstens Beulenpest und feuchte Lepra gleichzeitig hätte.«
»Gib es auf, Mary.« George legte ihr eine Hand auf den Arm. »Es bringt nichts, ihn zu bedrängen.«
Mary seufzte.
»Vielleicht hast du recht. Wir kommen besser später wieder.«
Einen letzten Versuch wollte sie allerdings unternehmen.
»Hören Sie, Mr. Bayle. Wir gehen dann also. Ich wollte Sie allerdings noch wissen lassen, dass der Kapitän hier bei mir ist. Er findet es sehr bedauerlich, dass er Sie nicht kennenlernen kann und, ich natürlich auch.«
Erst herrschte Schweigen hinter der Tür. Es schien ein betroffenes Schweigen zu sein, sofern sich das bei einem Schweigen bestimmen ließ. Dann erklang ein verlegenes Räuspern. Es zeigte Mary, dass ihre Taktik gute Chancen hatte, aufzugehen. Es war eine etwas gemeine Taktik, mit der sie Mr. Bayle in eine Zwickmühle brachte. Obwohl sie mit ihm schon lange zusammenarbeitete und mit George schon geraume Weile liiert war, hatten diese beiden Männer, die so wichtige Rollen in ihrem Leben spielten, einander noch nie zu Gesicht bekommen. Dies nachzuholen war ein weiterer Grund dafür gewesen, dass Mary Mr. Bayle auf dieser Reise dabei haben wollte. Er wusste, dass der Kapitän ihr Lebensgefährte war und wie viel es ihr bedeutete, sie miteinander bekannt zu machen. Dadurch geriet er in ein Dilemma. Wenn er sich auch am liebsten von Gott und der Welt abgeschottet hätte – seine Erziehung erlegte ihm Höflichkeit und gesellschaftlich einwandfreies Betragen auf. Es hätte sich nicht gehört, diese Begegnung zu verweigern. Mary konnte geradezu spüren, wie er hinter der Tür in innerem Widerstreit stand. Ihren kleinen Trick rechtfertigte sie vor sich dadurch, dass sie Mr. Bayle unter keinen Umständen in seiner Suite bei Tee und trocken Brot versauern lassen durfte und dieses Manöver nur zu seinem Besten war.
Es hatte Erfolg. Zögerlich öffnete Mr. Bayle die Tür. Er trug nicht etwa einen Pyjama oder einen Bademantel, wie man es bei einem Kranken erwartet hätte. Stattdessen war er in einen grauen Tweedanzug gekleidet, in den er sicherlich in der kurzen Zeit nicht mal eben hineingeschlüpft war. Auch sein Haar, akkurat gekämmt, hatte er bestimmt nicht auf die Schnelle gerichtet. Seine Haltung war alles andere als schlaff, sondern kerzengerade wie immer. Seine Prinzipien als britischer Gentleman zwangen ihn, in jeder Lage ein ordentliches Erscheinungsbild abzugeben, und übertrumpften damit jede körperliche Schwäche. Lediglich sein leicht grünlicher Teint verriet sein Unwohlsein.
»Wenn das so ist, meine verehrte Mrs. Arrington, werde ich all meine verbliebenen Kräfte dafür aufbringen, Ihnen diese Enttäuschung zu ersparen.«
»Da bin ich Ihnen ungeheuer dankbar«, sagte Mary. »Es ist mir eine ganz besondere Freude, Sie einander vorzustellen. Meine Herren ...«
Sie trat zur Seite, sodass die beiden Männer, zwischen denen sie sich eben noch befunden hatte, nun einander gegenüberstanden, Mr. Bayle in der Suite, George auf dem Korridor. Doch Mary kam nicht dazu, ihre Namen auszusprechen.
2
»Fischkopf MacNeill?«, rief Mr. Bayle, und sein Gesicht wurde noch ein paar Nuancen grüner.
»Snobby Bayle?«, rief George ebenso ungläubig.
Mary war so daran gewöhnt, ihn mit ›Mr. Bayle‹ anzusprechen, dass ihr gar nicht eingefallen war, George gegenüber im Vorhinein seinen Vornamen zu erwähnen. Und andersherum hatte sie vor Mr. Bayle stets Georges Nachnamen ausgelassen. Sonst wäre den beiden schon früher aufgegangen, dass sie an Bord das Wiedersehen mit einem alten Bekannten erwartete. In diesem Fall hätten sie wohl beide darauf verzichtet, war es doch offensichtlich, dass es sich nicht um ein freudiges Wiedersehen handelte. Jedenfalls fand sich weder auf Georges noch auf Mr. Bayles Gesicht ein Lächeln. Im Gegenteil. Beide starrten einander grimmig an, als stünden sie, statt einander herzlich als alte Freunde in die Arme zu fallen, kurz davor, aufeinander loszugehen. Vielleicht hätten sie es sogar getan, wenn Mary nicht dabei gewesen wäre.
»Könnte mir einer der Herren vielleicht freundlicherweise erklären, woher Sie einander kennen – und was es mit der schlechten Stimmung auf sich hat, die zwischen Ihnen herrscht?«
Mr. Bayle war der Erste, der das stumme Starr-Duell der Beiden unterbrach und Mary ansah.
»Gewiss doch, meine hochverehrte Mrs. Arrington«, rief er.
Er war so erregt, dass nicht einmal seine tiefsitzende britische Steifheit ihn davon abhalten konnte, die Stimme zu heben und wild Richtung George zu gestikulieren. Sein Gesicht wechselte seine Farbe von Grünlich zu Hochrot. Die Erregung schien ihm neue Kraft zu verleihen und ihn seine Krankheit vorübergehend vergessen zu lassen.
»Der Grund für die schlechte Stimmung, durch die Sie zu meinem tiefsten Bedauern in Mitleidenschaft gezogen werden, beruht darauf, dass ich einen fatalen Fehler begangen habe, als ich dieses Schiff betrat. Sie haben meine Befürchtungen und Vorbehalte stets als unbegründet und übertrieben abgetan. Jetzt haben Sie mir selbst den Beweis dafür geliefert, dass sie nicht nur nicht übertrieben waren – es ist alles noch schlimmer, als ich dachte. Niemals hätte ich mich zu dieser Reise überreden lassen, wenn ich geahnt hätte, dass auf dem Todeskutter dieser ungehobelte Hafenlakai das Kommando führt.«
George machte drohend einen Schritt auf ihn zu.
»Den Hafenlakai nimmst du sofort zurück, du eingebildeter Fatzke.«
»Bitte, George, bitte, Mr. Bayle.«
Mary schob sich wieder zwischen die beiden. Das Letzte, was sie wollte, war, dass ihr Lektor und ihr Lebensgefährte sich vor ihren Augen prügelten.
»Worum auch immer es hier geht, ich bin sicher, es gibt keinen Grund zum Streiten. Wir können wie Erwachsene miteinander reden.«
»Ich fürchte, da irrst du dich gleich doppelt, Mary«, sagte George. »Es gibt sehr wohl einen Grund zum Streiten, einen gewaltigen sogar. Und ein Gespräch unter Erwachsenen kann man schlecht führen, wenn einer der Beteiligten ein Schnösel ist, dem die Arroganz aus allen Poren quillt.«
»Und der andere ein Grobian, der nicht einmal die simpelsten Benimm-Regeln beherrscht.«
»Immerhin bin ich kein Papa-Söhnchen, das mit einem goldenen Löffel im Hintern geboren wurde.«
»Nein, denn dann wüsstest du dich vielleicht wenigstens zu benehmen. Aber auch wenn du dir die prächtigste Uniform anziehst«, er wies an George herab, »ändert sich nichts daran, dass darin ein Neandertaler steckt.«
»Ich mach dir gleich den Neandertaler, du verzogener ...«
»Meine Herren, darf ich vorschlagen, dass wir alle zur Ruhe kommen. Es muss doch nicht sein, dass ...«
Aber Mary kam nicht mehr zu Wort.
»Wenn ich gewusst hätte, dass du das bist«, rief George, »hätte ich dafür gesorgt, dass du nicht in dieser Suite untergebracht wirst. Ich hätte dich unter Deck im Lager einquartiert.«
»Natürlich. Es passt zu dir, deine Passagiere wie Vieh einzusperren, dem du nicht ein Mindestmaß an Achtung entgegenbringst.«
»Geschieht dir recht, dass du seekrank wirst. Typisch für einen Waschlappen wie dich.«
»Wenn mich etwas seekrank macht, dann bist du es. Du hast dich wirklich kein bisschen geändert. Leider!«
Mr. Bayle wandte sich an Mary, die aufgegeben hatte und der Auseinandersetzung hilflos beiwohnte.
»Ganz ehrlich, meine liebe Mrs. Arrington, bei allem Respekt und aller Freundschaft, die uns verbindet: Es ist mir schleierhaft, wie ein gebildeter, anständiger Mensch sich mit einem solchen ... Oger abgeben kann. Nun haben Sie bitte die Güte, mich zu entschuldigen. Mir wird gerade wieder so richtig übel.«
Er knallte ihnen die Tür vor der Nase zu — allerdings erst, nachdem er das ›Bitte nicht stören!‹-Schild an die Klinke gehängt hatte.
»Mr. Bayle«, rief Mary. Vergeblich. Diese Tür, wusste sie, würde sich so bald nicht wieder öffnen.
Sie wandte sich an George.
»Wärst du so nett, mir zu erklären, was da gerade geschehen ist?«
George wich ihrem Blick aus. So aufgebracht er eben noch gewesen war, so verlegen wirkte er jetzt.
»Entschuldige, Mary. Ich wollte nicht, dass es so aus dem Ruder läuft. Ich habe mich mitreißen lassen. Ich war einfach nicht darauf vorbereitet, ihn hier zu sehen, auf meinem Schiff.«
»Ich nehme deine Entschuldigung an, George. Sofern du sie auch Mr. Bayle vorbringst.«
George machte eine düstere Miene und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Eher lade ich den Klabautermann auf einen Rum ein.«
Mary wusste, dass George trotzig sein konnte. So verbohrt hatte sie ihn jedoch noch nie erlebt.
»Dann verrat mir wenigstens, woher ihr euch kennt und was zwischen euch vorgefallen ist. Vielleicht kann ich vermitteln, damit sich alles einrenkt.«
George schüttelte den Kopf.
»Daraus wird nichts, Mary. Der Schaden ist angerichtet und lässt sich nicht beheben.«
»Was für ein Schaden?«
George versank in das dunkle Brüten, das Mary an ihm kannte. Es war ein Zustand, in dem er schwer zu erreichen war.
»Das war ...«
»Ja?«
Er seufzte und blickte auf seine Hände, grob von Jahrzehnten harter Arbeit.
»Tut mir leid, Mary. Aber manche Geschichten sollte man nicht wieder aufwärmen. Da kommt nichts Gutes bei raus.«
»Es scheint mir, als hättet ihr diese Geschichte soeben aufgewärmt. Ihr habt sie geradezu zum Kochen gebracht.«
»Na ja, ich ... Wir ... Ich muss zurück auf die Brücke.«
Er schien zu überlegen, ob er Mary einen Kuss geben sollte. Aber die Gefahr, dass sie ihn verweigerte, schien ihm wohl zu groß. Mit dieser Einschätzung lag er richtig. Mary hatte nicht vor, ihn für sein kindisches Verhalten auch noch zu belohnen. Er murmelte einen Abschiedsgruß, ließ Mary stehen und ging den Korridor hinab.
Mary blieb allein vor der Piccadilly Suite, ratlos über das, was sich abgespielt hatte. Statt Mr. Bayle zum Verlassen seiner Kabine zu bewegen, musste sie nun davon ausgehen, dass er sich vollkommen zurückziehen würde. Statt die zwei Männer, die ihr viel bedeuteten, zusammenzubringen in der Hoffnung, sie würden sich gut verstehen, vielleicht sogar Freunde werden, hatte sie zwei Streithähne aufeinander losgelassen – und stand zwischen ihnen, ohne auch nur zu wissen, warum.
3
In der Grand Lobby herrschte eine quirlige Stimmung. Die Halle selbst strahlte wie immer eine gediegene Atmosphäre aus, mit ihrer Galerie, den Emporen und geschwungenen Treppen, ihren klassisch anmutenden Säulen und dem hoch über allem prangenden Bronzerelief des Schiffes. Auch die ruhig plänkelnde Musik, die ein Pianist aus seinem Flügel zauberte, trug dazu bei. Aber die Leute, die sich hier eingefunden hatten, waren von einer beinahe kindlichen Aufregung eingenommen. Mary spürte sie sofort, als sie aus dem Aufzug trat. Sie kannte diese Aufregung, empfand sie sogar selbst. Sie stellte sich immer ein, wenn die Queen Anne nach mehreren Tagen und Nächten auf offener See einen Hafen anlief und die Passagiere das Schiff zu einem Landgang verließen.
Natürlich waren jene Tage und Nächte an Bord niemals langweilig. Es gab unzählige Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben, von denen die Pools und der Wellness-Bereich, die Minigolf-Anlage, das Casino, die Bibliothek, Restaurants, Bars und der Nachtclub nur einige waren. Dazu kam das abwechslungsreiche Bordprogramm, das auf einer großen Tafel in der Lobby aufgelistet war. Neben Marys Buchvorstellung, Theaterstücken, Konzert- und Tanzveranstaltungen würde es dieses Mal etwa eine Reihe wissenschaftlicher Vorträge zur Geschichte und Kultur der jeweiligen besuchten Länder geben, gehalten von einem renommierten Universitätsprofessor und Südamerika-Kenner mit jahrzehntelanger Erfahrung. Am größten und in der Mitte der Tafel war zudem eine ganz besondere Vorführung angekündigt: Im Planetarium, der neuesten Attraktion an Bord, würde an mehreren Abenden eine ›Reise durch die Galaxie‹ stattfinden, geleitet von einer Sternenforscherin, die für die Entdeckung eines Kometen vor einigen Jahren in astronomischen Kreise hohe Bekanntheit, ja Berühmtheit erlangt hatte.
Es war kein Zufall, dass das Planetarium ausgerechnet auf dieser Kreuzfahrt eingeweiht wurde. Es war perfekt dafür geeignet, die Passagiere auf das einzustimmen, was vielen als das Highlight einer ohnehin spektakulären Reise galt. In einigen Tagen, wenn die Queen Anne in San Antonio, Chile, vor Anker lag, würde eine Sonnenfinsternis stattfinden. Wie sehr die Leute an Bord diesem Ereignis entgegenfieberten, zeigte sich nicht nur daran, dass sie eines der Hauptgesprächsthemen war, sondern auch daran, dass die Vorführungen im Planetarium – die heute Premiere feiern würden – bereits restlos ausgebucht waren. Bis zur Sonnenfinsternis versprachen auch die übrigen Stationen der Reise Abenteuer, zum Beispiel in Peru die Besichtigung von Tempelanlagen oder, was unmittelbar bevorstand, ein Eintauchen in die Kultur Ecuadors. So faszinierend es sein mochte, sich in einem Vortrag über diese Länder und ihre Eigenheiten zu informieren – es ging nichts darüber, sie selber zu besuchen. Die kribbelnde Vorfreude darauf war es, was die Grand Lobby – und Mary – gerade füllte.
Ursprünglich hatte sie gehofft, diesen Ausflug zusammen mit Mr. Bayle zu unternehmen. Aber einerseits befand er sich nach seiner Begegnung mit George garantiert in noch schlechterer Verfassung als vorher – körperlich und geistig – und wäre sicherlich nicht dafür zu haben. Andererseits wäre er momentan sowieso nicht ihre erste Wahl als Begleiter. Das galt auch für George. Beide Männer hatten sich nicht gerade wie reife Erwachsene verhalten. Ihr Streit beschäftigte Mary noch und sie wusste, sie würde sich damit auseinandersetzen müssen. Aber das hieß nicht, dass sie sich von den beiden Kindsköpfen die Reise verderben lassen musste. Ein wenig Ablenkung war jetzt genau das Richtige.
Auf ihrem Weg zum Ausgang hatte sie die Lobby beinahe durchquert, als in der Nähe eine Stimme erklang.
»Sie! Ja, Sie meine ich, die britische Dame.«
Es war eine hohe Stimme, beinahe quietschend. Von ihrem Klang her konnte Mary nicht zuordnen, ob sie einer Frau oder einem Mann gehörte. Sie blieb stehen und schaute sich um. Nun erkannte sie, dass der Besitzer der Stimme ein Mann war, dessen Körper nicht nur eine Kopflänge weiter als die meisten der Anwesenden in die Höhe strebte, sondern sich auch zu allen übrigen Seiten raumgreifend ausbreitete. Dies galt auch für sein blondes Haar, das sein Gesicht gleich einer Löwenmähne rahmte. In starkem Kontrast dazu stand der dünne Schnauzbart, der wirkte, als sei er mit einem feinen Stift über seine Oberlippe gezeichnet worden. Er trug ein rotblau kariertes Sakko, bei dem es Mary vor den Augen flimmerte, wenn sie zu lange hinsah. Er kam auf sie zu.
»Haben Sie die Güte und schenken mir ein paar Minuten Ihrer kostbaren Zeit.«
Für Mary gehörte es zu den größten Vergnügungen, die mitunter skurrilen Gestalten kennenzulernen, die sich auf dem Schiff tummelten. In dieser Hinsicht sah der Mann vielversprechend aus.
»Gerne«, sagte sie und ging ihm einen Schritt entgegen. »Sofern Sie mir freundlicherweise verraten, woher Sie wissen, dass ich Britin bin?«
Wirklich verwunderlich fand sie es nicht. Mr. Bayle war seine Nationalität in Erscheinung und Betragen so deutlich anzusehen, als hätte er sich eine Flagge mit dem Union Jack über die Schultern gehängt. Mary war sicher, dass auch sie einem aufmerksamen Beobachter gewisse Hinweise auf ihre Herkunft lieferte, durch ihre Kleidung, ihre Handtasche, vielleicht gar die Art, wie sie sich bewegte und spätestens wenn sie sprach durch ihren Akzent. Sie pflegte ihn zwar nicht so stark, ja liebevoll wie Mr. Bayle. Dennoch musste er für den Kenner unüberhörbar sein. Ihre Frage zielte daher weniger auf die Antwort selber ab als darauf, was ihr Gesprächspartner durch seine Erklärung über sich preisgeben würde.
Er lächelte, als hätte er das Geheimnis der Sphinx gelüftet.
»Das ist Teil meines Berufs«, erklärte er. »Wer in die Zukunft sehen möchte, muss auch einen klaren Blick für die Gegenwart haben. Gestatten Sie, mich Ihnen vorzustellen – es sei denn, eine Vorstellung ist nicht nötig.«
»Bedauerlicherweise«, erwiderte Mary, »bin ich persönlich nicht mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet. Deshalb würde es mir, fürchte ich, schwerfallen, Ihren Namen zu erraten.«
»Nun ja, um mich zu kennen, gnädige Frau, braucht man keine übernatürliche Begabung. Ein Fernseher genügt vollkommen. Ich hatte das Vergnügen, in verschiedenen Sendungen aufzutreten, unter anderem den Shows der weltweit beliebtesten Talkmaster.«
»Es tut mir leid. Ich schaue höchstens die Nachrichten und ziehe ansonsten dem Fernsehen für gewöhnlich ein Buch vor. Sie werden also nicht darum herumkommen, sich mir auf althergebrachte Weise vorzustellen.«
Falls diese Feststellung Unmut in ihm hervorrief, ließ er es sich nicht anmerken.
»Sehr gerne, Madam.« Er vollführte eine gekonnte Verbeugung. »Magnus Bartoldi aus Monaco. Hocherfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen.«
»Mary Elizabeth Arrington.«
Sie schüttelten einander die Hand.
»Bartoldi, sagen Sie?«, fragte Mary. »Das kommt mir bekannt vor. Ist das nicht der Name einer wohlhabenden monegassischen Industriellenfamilie?«
»Da haben Sie recht.«
Es freute ihn sichtlich, dass sie zumindest diesen Zusammenhang erkannt hatte.
»Ebenso wohlhabend wie einflussreich, wenn ich das anfügen darf. Allerdings bin ich in die Geschäfte nicht eingebunden – so gern mein werter Vater auch gesehen hätte, wenn ich in seine Fußstapfen getreten wäre. Ich bin so etwas wie das schwarze Schaf meiner Familie. Dies zeigte sich bereits in meinen Jugendjahren, als sich bestimmte außergewöhnliche Eigenschaften an mir bemerkbar machten.«
Mary wartete, dass er weiterspräche. Aber er tat es nicht und es war deutlich, dass er seinerseits auf eine entsprechende Aufforderung wartete.
Mary erbarmte sich.
»Ich nehme an, diese Eigenschaften bestanden darin, in die Zukunft blicken zu können, wie Sie eben andeuteten?«
»Diese Formulierung geht ein bisschen weit«, sagte er, »ist aber im Grunde zutreffend. Wichtig ist mir dabei, darauf hinzuweisen, dass ich nicht etwa eine Art Medium bin, niemand, der Visionen hat oder gar mit Geistern kommuniziert.«
»Da bin ich froh«, sagte Mary. »Geister, Gespenster, Kobolde und Dämonen wären nicht unbedingt die Begleiter, die ich mir auf dieser Kreuzfahrt gewünscht hätte.«
Bartoldi überging ihren Kommentar.
»Sehen Sie, ich bin vielmehr ein Handwerker, ein Forscher und Experte auf dem Gebiet der Astrologie, einer leider noch von viel zu vielen Zweiflern und Skeptikern verkannten Wissenschaft. Als Sternleser und Sterndeuter bin ich, wie schon erwähnt, viele Male im Fernsehen aufgetreten. Zudem darf ich mich rühmen, vielen berühmten Persönlichkeiten, etwa Schauspielern und Politikern, als Horoskopist gedient zu haben, ein Begriff, den ich übrigens selbst geprägt habe.«
Was erklärte, dass Mary ihn noch nie gehört hatte.
»Hat Ihre Anwesenheit an Bord«, erkundigte sich Mary, »mit der anstehenden Sonnenfinsternis zu tun?«
»Ganz recht«, antwortete Bartoldi. »Für Anhänger meiner Profession hat dieses Ereignis natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Die Gelegenheit, live zu erleben, wie sich die Gestirne in einer derart seltenen Konstellation zusammenfügen, darf ich mir nicht entgehen lassen. Abgesehen davon finde ich dadurch auf diesem Schiff ja viele Gleichgesinnte, die meine kosmische Begeisterung teilen. Viele von ihnen kennen mich, da ich auf diesem Gebiet so etwas wie eine Ikone bin. Dementsprechend habe ich schon zahlreiche Anfragen bekommen, in denen ich um die Erstellung eines persönlichen Horoskops gebeten werde. Insofern ist dies für mich weniger eine Urlaubs-, als vielmehr eine berufliche Reise. Wenn Sie möchten, liefere ich Ihnen gerne eine Kostprobe meiner Fähigkeiten.«
Mary dachte an die Horoskope, die ihre Hauswirtschafterin Greta ihr morgens aus ihren heißgeliebten Klatschzeitschriften vorlas und die mit ihren vagen Prophezeiungen – ›eine Herausforderung erwartet Sie‹ oder ›Ihre Geduld wird auf die Probe gestellt‹ – immer so gestaltet waren, dass ihre Vorhersagen zumindest zum Teil geradezu zwangsläufig eintreffen mussten.
»Vielen Dank, Mr. Bartoldi. Für mich ist das nichts. Ohne Ihnen und Ihrer Wissenschaft zu nahe treten zu wollen – statt Sterne zu lesen, halte ich mich lieber an Bücher oder Zeitungen. In denen steht zwar nicht die Zukunft, dafür ist der Informationsgehalt in der Regel verlässlich.«
»Sind Sie ganz sicher? Wollen Sie nicht wissen, ob Ihnen aufregende Erlebnisse und bereichernde Begegnungen bevorstehen?«
»Da ich mich auf einer Kreuzfahrt entlang des südamerikanischen Subkontinents befinde«, erwiderte Mary, »gehe ich stark davon aus, dass mir aufregende Erlebnisse bevorstehen. Aus diesem Grund unternimmt man schließlich eine solche Reise, nicht wahr? Falls nicht, würde ich mein Geld zurückverlangen. Ein Blick auf den Zeitplan gibt mir sogar Aufschluss darüber, wann mir welche dieser Erlebnisse bevorstehen. Weitere Informationen möchte ich gar nicht unbedingt. Alles zu genau zu erfahren, würde dem Ganzen das Abenteuerliche nehmen, denken Sie nicht?«
»Gewiss. Auf der anderen Seite kann es fatal sein, seinem Schicksal blindlings entgegenzulaufen. Ich habe die Sternenkonstellation für die kommenden Tage und Nächte eingehend studiert. Wenn Sie mir Ihr Geburtsdatum und Ihren Geburtsort nennen würden, könnte ich ...«
Mary wollte ihn unterbrechen. So unterhaltsam das Gespräch mit einem selbsternannten Hellseher auch sein mochte, und so interessiert sie auch daran gewesen wäre, die Zukunft zu erfahren – diese Quelle schien ihr dafür dann doch etwas zu unzuverlässig. Abgesehen davon zog es sie von Bord, um die Stadt zu erkunden, an der sie angelegt hatten. Bevor sie jedoch dazu kam, Bartoldis wiederholtes Angebot abzulehnen, schnitt ihm jemand anders das Wort ab.
»Schenken Sie seinem Schwachsinn bloß keinen Glauben. Er behauptet, in den Sternen die Wahrheit zu erkennen. Tatsächlich wird er Ihnen nur das Blaue vom Himmel herunterlügen – mit schrecklichen Folgen.«
Dieses Mal war es eindeutig eine Frauenstimme. Das passende Gesicht dazu kriegte Mary jedoch nicht zu sehen. Die Dame hatte gesprochen, ohne stehen zu bleiben und war schon an ihnen vorüber. Nur für eine Sekunde erblickte Mary sie von hinten, eine schlanke Gestalt in einem blauen Kostüm, deren strahlend rotes Haar ihr bis weit auf den Rücken wallte. Dann war sie zwischen den anderen Passagieren verschwunden.
Bartoldi schaute ihr grimmig nach. Doch so schnell, wie es verschwunden war, kehrte das Lächeln auf seine Lippen zurück.
»Hören Sie nicht hin«, sagte er. »Wie Sie sich denken können, habe ich viele Neider. Das ist bei meinem Beruf leider unvermeidlich.«
»Wer war denn das?«
Er machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Niemand. Absolut niemand. Also, mein Angebot an Sie steht. Wenn Sie möchten, erstelle ich Ihnen gerne Ihr persönliches Horoskop. Obwohl ich schon sehr viele Anfragen erhalten habe, würde ich Sie noch unterbringen.«
»Gegen ein gewisses Entgelt, nehme ich an«, sagte Mary.
Bartoldi neigte den Kopf.
»Qualität, meine Dame, ist nun einmal nicht umsonst zu haben. Aber was ist schon Geld gegen einen Blick in die eigene Zukunft? Ein geringer Preis für unschätzbares Wissen. Sie dürfen auch gern an meiner Sternstunde teilnehmen. Dort können Sie mir Fragen stellen, die ich mithilfe der Gestirne beantworten werde. Dafür ist allerdings eine Voranmeldung vonnöten. Überlegen Sie es sich. Es ist eine einmalige Gelegenheit. Wer weiß, ob wir uns noch einmal wiedersehen.«
»Ich hätte gedacht, wenn jemand das wüsste, dann Sie.«
Er lächelte, schien jedoch wenig angetan von ihrer kleinen Spitze.
»Wenn Sie mich dann entschuldigen würden?«, fuhr Mary fort. »Ich sehe in meiner näheren Zukunft eine Stadtbesichtigung, die ich ungern länger aufschieben würde und ...«
Sie verstummte, als sie Mr. Bayle entdeckte, der in einem geradezu panischen Sprint durch die Grand Lobby hastete. Ausnahmsweise vernachlässigte er seine Manieren und scherte sich wenig darum, ob er Leute, die ihm im Weg waren, beiseite rempelte oder ihnen mit dem Rollkoffer, den er hinter sich herzog, über die Füße fuhr oder gegen die Schienbeine stieß.
»Mr. Bayle«, rief sie und winkte ihm zu. »Was tun Sie denn?«
Aber ebenso wenig wie Mr. Bayle sich um die verärgerten Blicke und Bemerkungen kümmerte, die er auf sich zog, reagierte er auf Marys Zuruf. In seinem Bestreben, so schnell wie möglich den Ausgang zu erreichen, schien er ihn – und sie – nicht einmal wahrgenommen zu haben.
»Auf Wiedersehen, Mr. Bartoldi. Ich wünsche Ihnen alles Gute – auch wenn es Ihnen bei Ihrem Geschäftsmodell weniger um die Sterne zu gehen scheint als vielmehr darum, dass sie als Sterntaler auf Sie herabregnen.«
Sie ließ ihn stehen und nahm die Verfolgung auf. Durch ihre regelmäßigen Besuche im Fitnessstudio war sie besser in Form als Mr. Bayle, der zudem durch seinen Koffer gebremst wurde. Somit gelang es ihr, ihn kurz vor dem Ausgang einzuholen. Sie fasste ihn am Arm und brachte ihn zum Stehen.
»Wo wollen Sie hin?«
Er fuhr herum. Er schien ganz und gar nicht begeistert, sie zu sehen. Mary fragte sich, ob sein fluchtartiger Ausbruch auch den Zweck gehabt hatte, ein Zusammentreffen wie dieses zu vermeiden.
»Wo ich hin will? Was denken Sie denn? Ich will runter von diesem gottverdammten Schiff.« Er gestikulierte Richtung des Stegs, der die Queen Anne mit dem ecuadorianischen Festland verband. »Ich werde mich in das nächstbeste Taxi setzen, mich zum Flughafen bringen lassen und nach England zurückkehren, wo ich hingehöre.«
Mary machte sich Vorwürfe. Diese Wendung hätte sogar Bartoldi vorhersehen können. Ihr war sie entgangen, obwohl eine solche Übersprungshandlung von Mr. Bayle zu erwarten gewesen war.
»Beruhigen Sie sich, mein hochverehrter Mr. Bayle. Für solche extremen Maßnahmen besteht doch kein Anlass.«
»Dieser Anlass besteht zweifellos. Als wäre die anhaltende Seekrankheit nicht schon schlimm genug. Der Todeskutter, der seinen Namen wirklich mehr als verdient, steht auch noch unter dem Kommando eines Barbaren. Statt Kreuzfahrtkapitän hätte er lieber direkt Pirat werden sollen, und zwar nicht die freundliche Sorte mit Papagei auf der Schulter. Nein, Mrs. Arrington. Diese Kreuzfahrt ist für mich beendet.«
Er setzte sich in Bewegung. Vorbei an einem der Offiziere, der das Aussteigen überwachte, erreichte er den Steg. Mary blieb dicht an ihm dran.
»Ich verstehe, dass diese Reise nicht so verläuft, wie Sie sich das gewünscht hätten.«
»Das können Sie laut sagen«, sagte er über die Schulter.
»Aber es lässt sich sicherlich eine Lösung finden. Bitte, Mr. Bayle. Sie sind doch sonst niemand, der das Feld räumt, ohne alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben.«
Sie verließen den Steg. Als sie festen Boden unter den Füßen hatten, blieb Mr. Bayle für einen Moment stehen.
»Wissen Sie, wie kurz davor ich gerade bin, es dem Papst gleichzutun, mich auf die Knie zu werfen und die Erde zu küssen?« Er deutete mit einem Schaudern auf die Queen Anne. »Um nichts in der Welt werde ich auf dieses Ungetüm zurückkehren. Machen Sie es gut, Mrs. Arrington. Wir sehen uns zu Hause!«
Mit diesen Worten zog er seinen Koffer zu einem der Taxis, die am Kai auf Fahrgäste warteten.
Mary spielte ihren letzten Trumpf.
»Wollen Sie mich wirklich bei meiner Lesung im Stich lassen?«
Er zögerte, die Hand schon am Türgriff des Wagens. Mary sah, wie er innerlich mit sich kämpfte. Dann aber schüttelte er den Kopf.
»Ich bedauere, meine geschätzte Mrs. Arrington. So gern ich auch dabei wäre, unter den gegebenen Umständen sehe ich mich dazu nicht imstande. Alles Gute für den Rest Ihrer Reise!«
Dann stieg er ein, zog die Tür zu und erteilte dem Fahrer Anweisungen. Der startete den Wagen. Mr. Bayle vermied es, Mary noch einen Blick zuzuwerfen, und starrte stur geradeaus. Mary blieb nichts übrig, als zuzusehen, wie das Taxi mit ihrem Freund davonfuhr. Ihr Landgang in Ecuador, schien es ihr in Erinnerung an Bartoldi, stand unter keinem guten Stern.
4
Mary versuchte, sich die Stimmung nicht verderben zu lassen, während sie Manta erkundete, eine lebendige Hafenstadt von mittlerer Größe, die bereits vor der Zeit der spanischen Eroberung im 16. Jahrhundert gegründet worden, aber mit ihren schicken Hochhäusern längst in der Moderne angekommen war. Es fiel Mary schwer, nicht an Mr. Bayle zu denken, während sie über die Promenade Malecon Ecenico spazierte, auf der mehrere Thunfisch-Statuen von Mantas wichtigstem Wirtschaftszweig zeugten. Obwohl sie sich alle Mühe mit Mr. Bayle gegeben hatte, machte sie sich Vorwürfe, sich nicht besser um ihn gekümmert, einfühlsamer auf ihn eingegangen zu sein. Ohne eine Antwort zu finden, grübelte sie darüber nach, wie sie seinen Aufbruch hätte verhindern können, und weder El Murcielago, Mantas beliebtester Strand, mit seinen Fischern, Schwimmern und Kitesurfern, noch das Banco Central Museum mit seinen Keramiken aus der präkolumbianischen Hunanca-Manteno-Zeit konnten sie von diesen trüben Gedanken befreien. Ohne rechtes Interesse betrachtete sie das Panama-Hat-Girl, das Standbild einer jungen Frau in blauer Bluse und langem gelbrotem Rock, die dabei war, einen der berühmten Hüte zu flechten. Der Fisch und die Meeresfrüchte, die sie in einem Hafenrestaurant aß, hätten frischer nicht sein können und wollten ihr doch nicht recht schmecken. Mr. Bayle hatte sich kindisch verhalten. Dennoch tat es ihr leid, dass er so plötzlich abgereist war. Sie fand es schade, dass ihr Lektor nicht bei ihrer Lesung zugegen sein wollte, und sie vermisste ihren Freund.
Nach einer Weile erreichte sie den Marktplatz. Er war stark belebt. Eine Reihe von Buden und Ständen war hier aufgebaut. An einigen konnte man Erfrischungen kaufen, etwa Kokosnüsse, noch grün, die von dem Händler mit einer Machete aufgeschlagen wurden, sodass man das Kokoswasser direkt aus der Nuss trinken konnte. Wer Hunger hatte, konnte ihn mit einer Ceviche stillen, einem traditionellen Gericht, für das roher Fisch und Meeresfrüchte kleingeschnitten und in einem Tigermilch genannten Sud mariniert wurden. Ansonsten gab es Humitas, eine in die Blätter eines Maiskolbens gewickelte Maispaste, Bolones aus grünen Bananen und verschiedene Fleischgerichte, darunter auch Cuy, Meerschweinchen, das in Ecuador als Delikatesse galt.
Mary hatte keinen Hunger mehr und wenn, hätte sie ihn nicht unbedingt mit gebratenem Nagetier stillen wollen. Andere Stände, an denen sie vorüberkam, boten Kleidung feil, wobei neben Hemden und Hosen natürlich auch Panama-Hüte nicht fehlen durften. Sie wurden von mehreren Männern und Frauen an Ort und Stelle geflochten, sodass man erst der Herstellung zusehen konnte, bevor man sich für eine Kopfbedeckung entschied. An weiteren Buden ließ sich Kunsthandwerk erstehen, Keramikschalen oder geschnitzte und bemalte Tierskulpturen. In der Nähe der Buden hatte sich eine Gruppe von Musikern in farbenfrohen Gewändern aufgestellt und untermalte die fröhliche Atmosphäre mit heiteren Klängen aus ihren Rondadoras, den Panflöten, die, wie Mary vorher in ihrem Reiseführer gelesen hatte, das Nationalinstrument des Landes waren.
Abgesehen von Einheimischen, die den Markt besuchten, hatten sich auch viele der Kreuzfahrtpassagiere hier eingefunden. Mary wusste, dass Tourismus für Manta sehr einträglich war, und sicherlich wussten die Händler, wann eines der großen Schiffe einlief. Aber nichts von all dem hier wirkte wie eine folkloristische Kulisse, die man auf die Schnelle für die ausländischen Gäste hochgezogen hatte. Es wirkte echt und tat Mary gut. Die Musik, das südamerikanische Spanisch, das um sie herum gesprochen wurde, der Geruch der Garküchen, das Gefühl der Fremde halfen ihr, ein wenig den Kopf frei zu kriegen. Sie kaufte sich eine Kokosnuss, setzte sich auf eine der Bänke, die rund um den Platz unter Bäumen standen, und beobachtete das Treiben. Ihre Anspannung fiel von ihr ab. Mr. Bayle war ein erwachsener Mann. Sollte er eben tun, was er für richtig hielt. Sie würde mit ihm reden, wenn sie wieder zu Hause war. Bis dahin würde sie jeden Augenblick dieser Reise genießen und sie würde sofort damit anfangen. Es war der perfekte Ort dafür. Das einzige Ärgernis waren die Mücken, die gerade hochaktiv waren. Alle paar Augenblicke landete eines der kleinen Biester auf Marys bloßen Armen, sodass sie mit der freien Hand danach schlagen musste. Aber wenn das alles war, würde sie damit klarkommen. Ein paar Stiche würden sie nicht umbringen.
Eine der Buden, sah sie nun, hatte auffallend viel Zulauf. Die Ecuadorianer schenkten ihr nur oberflächliche Aufmerksamkeit. Aber etliche von Marys Mitpassagieren drängten sich darum. Die meisten waren ziemlich leicht als Pauschaltouristen zu erkennen, für die quietschbunte Hemden, Shorts und Gummischlappen so etwas wie die offizielle Uniform darstellten. Was genau sie anzog, konnte Mary aus dieser Entfernung nicht erkennen. Soweit sie bestimmen konnte, ging es ihnen um eine Art Anhänger oder Amulett, für das sie dem Händler ihre Geldscheine in die Hand drückten und die sie sich anschließend um den Hals hängten. Einige präsentierten sich dann ihren Freunden, scherzend und lachend. Andere wiederum trugen das Schmuckstück mit einem feierlichen Ernst. Eine Frau, die eines ergattert hatte, überquerte den Marktplatz und kam dabei an Mary vorbei.
»Entschuldigen Sie bitte«, rief Mary. »Darf ich Sie etwas fragen?«
Die Frau blieb stehen. Sie war dicklich, dabei nicht fett, hatte eine hellbraune Dauerwelle und trug knallbunte Kleidung.
»Na, aber sicher.«
Sie kam mit einem offenen Lächeln näher.
»Worum geht es?«, fragte sie mit einem starken Akzent, aus dem Mary die Südstaaten der USA herauszuhören meinte.
»Um diesen Anhänger, den Sie um den Hals haben. Es sieht aus, als seien die ziemlich begehrt.«
»Das?«
Sie hielt Mary den Anhänger hin, der an einem Lederband befestigt war. Jetzt konnte Mary erkennen, dass es sich tatsächlich um ein Amulett handelte, achteckig und aus Holz gefertigt. Sonnen, Monde und Sterne waren hineingeschnitzt.
»Na, da ist doch bald diese Sonnenfinsternis. Manche munkeln, dass dann die Welt untergeht. Angeblich wird das von diesem Maya-Kalender vorausgesagt. Diese ... Autsch.«
Sie schlug sich mit der flachen Hand auf den Unterarm, wo offenbar eine Mücke sie erwischt hatte.
»Teuflische kleine Biester.«
Sie betrachtete ihre Hand. Sie war leer, weder Blut noch ein zerschlagenes Insekt klebten daran. Sie schüttelte den Kopf.
»Wie auch immer ... Diese Anhänger sollen helfen, den Weltuntergang abzuwenden. Wenn nur genügend Menschen sie tragen, werden wir verschont, heißt es.«
Sie lachte. Es war ein volles Lachen voller echter Freude, das dazu einlud, mit einzufallen.
»Ist das nicht ein köstlicher Hokuspokus?«
Mary lächelte und wedelte ihrerseits eine Mücke fort, die zur Landung ansetzen wollte.
»Das ist auf jeden Fall ein guter Grund, sich eines zuzulegen.«
»Nicht wahr?« Sie neigte sich Mary vertrauensvoll zu, als wollte sie vermeiden, dass andere der Schiffsreisenden sie hörten. »Um ehrlich zu sein, ich glaube überhaupt nicht an solchen Mumpitz.«
»Da bin ich Ihrer Meinung«, sagte Mary. »Angeblich hat dieser Kalender doch schon mehrmals den Weltuntergang vorhergesagt, und eingetreten ist er bekanntermaßen nie.«
»Genau. Eine totale Spinnerei. Ein Märchen für Abergläubische. Wobei man bei den vielen Mücken glatt anfangen könnte, daran zu glauben. Biblische Plagen und so. Jedenfalls, man muss da ein bisschen vorsichtig sein.« Sie blickte rüber zu der Bude und den Leuten, die davor anstanden. »Die meisten finden das lustig. Aber einige nehmen das richtig ernst und sind beleidigt, wenn man darüber Witze macht.«
»Ja, wenn es um ihre Überzeugungen geht, können manche Menschen ziemlich empfindlich sein. Aber sagen Sie, Mrs. ...«
»Patricia Cormier aus Lafayette, Louisiana.«
Sie verkündete ihre Herkunft wie einen Adelstitel.
»Sehr erfreut. Mary Arrington. Was ich sagen wollte, Mrs. Cormier ...«
»Bitte nennen Sie mich Trish oder Trisha. Das machen alle.«
»In Ordnung, Trish. Wenn Sie das für Aberglauben halten, warum ...«
»... trage ich dann eins von den Dingern? Na, selbst wenn ich nicht glaube, dass der Weltuntergang bevorsteht, ist es doch besser, auf der sicheren Seite zu sein, nicht wahr?«
Sie schickte wieder ihr schallendes Lachen über den Marktplatz.
»Außerdem ist das ein Heidenspaß. Wissen Sie, ich mache zum ersten Mal eine Kreuzfahrt. Da will ich sie voll und ganz ausschöpfen und alles mitnehmen, was dazugehört. Ich habe mich schon für sämtliche Vorträge und sonstigen Veranstaltungen angemeldet und werde mir selbstverständlich keinen einzigen Landgang entgehen lassen.«
Sie fasste den Marktplatz in einer weiten Handbewegung.
»Das ist alles fantastisch. Dazu die tollen Leute, die an Bord sind. Ein berühmter Wissenschaftler, eine echte Sternenforscherin und dann auch noch ein Sterndeuter, ein Horoskopist namens Bartoldi. Ist das nicht irre?«
»Ja. Ich hatte bereits das Vergnügen, ihn kennenzulernen.«
»Ich werde mir auf jeden Fall mein Horoskop von ihm anfertigen lassen. Den Spaß gönne ich mir. Wer weiß? Vielleicht steht mir ja eine rosige Zukunft bevor und ich werde bald den Mann meiner Träume treffen.«
»Das wäre möglich«, sagte Mary. »Natürlich nur, wenn wir alle den Weltuntergang überleben.«
Trish lachte und tippte auf ihr Amulett.
»Ich leiste ja meinen Beitrag. Das sollten Sie auch tun. Oha!«
Sie streckte den Finger aus.
»Wo wir gerade von den Berühmtheiten an Bord sprechen. Da ist Dr. Kvietkauskas.«
Mary folgte ihrem Fingerzeig und erspähte jene rothaarige Dame in dem blauen Kostüm, auf die sie in der Grand Lobby einen kurzen Blick erhascht hatte. Dieses Mal schien sie es weniger eilig zu haben. Sie blickte sich ruhig um, während sie über den Marktplatz schritt. Das Klischee schrieb rothaarigen Menschen eine besondere Heißblütigkeit zu. Kvietkauskas strahlte eher Kühle und Sachlichkeit aus. Ein schmaler junger Mann mit eingezogenen Schultern und schwarzem Pottschnitt schleppte ihr eine Tasche hinterher. Sie war so schwer, dass er sie mit beiden Händen fassen musste und Gefahr zu laufen schien, von ihr zur Seite umgerissen zu werden.
»Dr. Kvietkauskas?«, fragte Mary.
»Dalia Kvietkauskas aus Vilnius, Litauen. Die Sternenforscherin. Eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Sie hat sogar selbst einen Stern entdeckt, wussten Sie das?«
»Bisher nicht.«
»Oh ja, eine Sensation. Wie es heißt, reist sie nach Chile, um eine begehrte Stelle am Paranal-Observatorium in der Atacama-Wüste anzutreten. In Fachkreisen geht das Gerücht um, sie hätte noch eine weitere bahnbrechende Entdeckung gemacht. Aber bisher hält sie das noch geheim und wartet auf den richtigen Zeitpunkt, es zu verkünden. Heute Abend wird im Planetarium zum ersten Mal ihre ›Reise durch die Galaxie‹ stattfinden. Ich freue mich schon ungeheuerlich darauf.«
Sie schaute zu der rothaarigen Dame hinüber wie eine Teenagerin zu einem Popstar. Dann zog sie ihr Handy hervor.
»Sie scheint gerade nicht beschäftigt. Ich werde Sie bitten, ein Foto mit mir zu machen. Drücken Sie mir die Daumen, dass Sie Ja sagt.«
»Mache ich«, sagte Mary.
Schmunzelnd über den Eifer der Amerikanerin sah sie zu, wie Trish Cormier über den Platz lief, wobei es ihr gelang, gleichzeitig behäbig und mädchenhaft leicht auszusehen. Schon von Weitem rief sie den Namen der Forscherin. Diese wandte sich ihr zu und Mary sah, wie die beiden miteinander sprachen. Zunächst schien sie wenig erfreut. Aber Trishs überbordende Herzlichkeit schmolz sogar ihre Kühle und sie nickte. Trish schaute sich nach einem Hintergrund um und entschied sich für die Musiker, passend, fand Mary, hatte sie doch somit noch etwas typisch Ecuadorianisches im Bild. Sie bugsierte die Forscherin sachte in die gewünschte Position und stellte sich neben sie. Dann streckte sie ihren Arm mit dem Handy aus, um das Selfie aufzunehmen. Kvietkauskas lächelte zwar in die Kamera, aber es wirkte ein wenig gezwungen, und sie schien erleichtert, als das Foto aufgenommen war. Umso unangenehmer schien es ihr zu sein, als Trish kopfschüttelnd auf das Handy wies – das Selfie war offenbar nicht gelungen – und sie sich ein weiteres Mal aufstellen musste. Dieses Mal gelang es. Trish Cormier steckte ihr Telefon ein und sprach mit dem jungen Mann, der bisher teilnahmslos mit der Tasche danebengestanden hatte. Er zuckte die Schultern und blickte Kvietkauskas an. Trish hielt ihm fordernd die Hand hin. Mary fragte sich, was sie von ihm verlangen mochte. Schließlich schien er einzusehen, dass er gegen Trishs Beharrlichkeit nicht ankommen würde. Er zog sein eigenes Handy hervor und reichte es ihr. Sodann posierte er mit Kvietkauskas ebenfalls vor den Musikern, die ihr Spiel derweil fortsetzten. Trish winkte die beiden noch ein wenig zur Seite und einen Schritt zurück, bevor sie sie ins Visier nahm. Mary hörte sie rufen.
»Hier kommt das Vögelchen. Sagt ›Käsekuchen‹!«