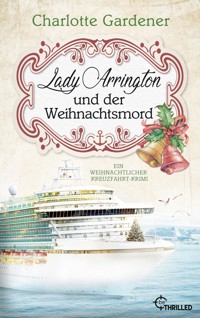
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Mary Arrington
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Lady Mary Arrington ist zurück auf der Queen Anne. Diesmal führt die Route über das Polarmeer - und weil Weihnachten vor der Tür steht, ist das ganze Schiff festlich geschmückt, überall duftet es nach Pfefferkuchen, und künstlicher Schnee lässt die Augen der Passagiere funkeln.
Doch mit der besinnlichen Weihnachtsstimmung ist es schnell vorbei, als vor dem prächtigen Christbaum in der Grand Lobby der Weihnachtsmann tot in seinem Sessel sitzt.
Für den Schiffarzt ist der Fall schnell klar: Schließlich war der Mann nicht nur Diabetiker, sondern auch ein ausgemachtes Schleckermaul. Lady Arringtons Scharfsinn aber entgeht nicht, dass es sich hier um einen Mord handeln muss! Wird sie den Täter überführen können, bevor er womöglich erneut zuschlägt?
Der sechste Fall für unsere ermittelnde Krimi-Autorin Lady Arrington und ihre tatkräftigen Helfer! Ein charmanter Weihnachtskrimi auf einem der luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe der Welt.
Die weiteren Bände der Reihe:
Lady Arrington und der tote Kavalier
Lady Arrington und die tödliche Melodie
Lady Arrington und die rätselhafte Statue
Lady Arrington und ein Mord auf dem Laufsteg
Lady Arrington und der dunkle Schatten des Mondes
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Lady Mary Arrington ist zurück auf der Queen Anne. Diesmal führt die Route über das Polarmeer – und weil Weihnachten vor der Tür steht, ist das ganze Schiff festlich geschmückt, überall duftet es nach Pfefferkuchen und künstlicher Schnee lässt die Augen der Passagiere funkeln. Doch mit der besinnlichen Weihnachtsstimmung ist es schnell vorbei, als vor dem prächtigen Christbaum in der Grand Lobby der Weihnachtsmann tot in seinem Sessel sitzt. Für den Schiffarzt ist der Fall schnell klar: Schließlich war der Mann nicht nur Diabetiker, sondern auch ein ausgemachtes Schleckermaul. Lady Arringtons Scharfsinn aber entgeht nicht, dass es sich hier um einen Mord handeln muss! Wird sie den Täter überführen können, bevor er womöglich erneut zuschlägt?
Der sechste Fall für unsere ermittelnde Krimi-Autorin Lady Arrington und ihre tatkräftigen Helfer! Ein charmanter Weihnachtskrimi auf einem der luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe der Welt.
Charlotte Gardener
Lady Arrington und der Weihnachtsmord
Ein weihnachtlicher Kreuzfahrt-Krimi
1
Er rannte in Panik über die Korridore. Das Poltern seiner Stiefel auf den stilvoll gemusterten Teppichen erschütterte die Stille, die zu dieser späten Stunde auf dem Schiff herrschte. Unter dem roten Mantel wölbte sich sein Bauch. Er drängte gegen den schwarzen Gürtel und wackelte bei den hastigen Schritten hin und her. In den Manteltaschen klirrte es, wie Glas, das gegen Glas stieß. Der weiße Fellaufsatz an Ärmeln und Hosenbeinen schimmerte im trüben Licht des Flurs. Der braune Sack aus grobem Leinen, dessen verschnürte Öffnung er mit beiden Händen umklammert hielt, hüpfte ihm auf dem Rücken. Es klapperte jedes Mal, wenn er ihm ins Kreuz prallte, als wollte er ihn zusätzlich zur Eile antreiben. Weicher, dabei nicht weniger drängend, peitschte der Bommel am Zipfel seiner Mütze auf ihn ein, unter der schneeweißes Haar hervorwallte. Aber schneller konnte er nicht. Mit prustenden Atemstößen schnaufte er in seinen weißen Bart. Dieser reichte ihm bis auf die Brust und ließ nur wenig von seinem Gesicht frei, seine knollige Nase, einen Teil der Wangen und die Stirn. All dies glänzte fast so rot wie sein Mantel. Seine Haut war feucht vom Schweiß, den die Anstrengung ihm aus den Poren trieb — und die Angst, die in seinen blauen, von dichten Brauen überzogenen Augen stand.
Er achtete weder auf die Bilder und Reliefs von Meeres- und Tierdarstellungen, an denen er vorbeihastete, noch auf den künstlichen Schnee, die Tannenzweige, rotweißen Girlanden und die sonstige Weihnachtsdekoration, mit der die holzgetäfelten Gänge geschmückt waren. Die stimmungsvolle Atmosphäre, die sie verbreitete, passte ganz und gar nicht zu seiner Aufregung. Beinahe wirkte es unverschämt, dass er sie durch solche Unruhe störte. Aber auch das scherte ihn in seiner Hetze nicht. Sein ganzer Wille war darauf ausgerichtet, voranzukommen. Auch wenn er mehrmals stolperte und beinahe gefallen wäre, verlangsamte er sein Tempo nicht. Immer wieder warf er hektische Blicke über die Schulter. Wobei es nicht schien, als würde ihn jemand verfolgen. Nur einige Nachtschwärmer, die sich in den Bars und dem Nachtclub der Queen Anne vergnügt hatten und auf dem Weg in ihre Kabinen waren, wunderten sich über ihn und fragten sich, ob diese sonderbare Erscheinung auf den übermäßigen Genuss von Champagner und Cocktails zurückzuführen war. Einige lachten oder riefen ihm nach, ob er hinter dem Christkind her oder von seinem Schlitten gefallen sei.
Doch seine Eile wirkte nicht, als fürchte er, zu spät zum Fest zu kommen und Weihnachten zu verpassen. Auch nicht, als seien ihm seine Rentiere durchgegangen. Vielmehr hätte man glauben können, ihm sei der Grinch auf den Fersen. Das Ende des Korridors, durch den er stürmte, war nicht weit entfernt. Von dort aus strahlte ihm die Grand Lobby mit bunten Lichtern entgegen.
Er stürzte auf sie zu, als hoffte er, dort Rettung und Sicherheit zu finden.
2
»Mami, was hat denn der Weihnachtsmann?«
Die Grand Lobby, immer eindrucksvoll mit ihren Säulen, ihren geschwungenen Treppen und Emporen, war niemals so prachtvoll gewesen wie jetzt. Ihre Mitte nahm ein riesiger Weihnachtsbaum ein. Seine ausladenden, dicht begrünten Äste waren über und über mit glänzenden Kugeln behangen, mit kleinen Engeln und Glöckchen, mit Lametta in Gold und Silber. Eine Lichterkette mit weißen und roten Kerzen umwand ihn von seinem Fuß bis hinauf zu seiner Spitze. Sie war mit einem Stern gekrönt und reckte sich fast bis an das Bronzerelief, das hoch über der Lobby prangte und die Queen Anne umgeben von Wellen und einem Strahlenkranz zeigte. Vor dem Baum lag eine Vielzahl von Päckchen und Paketen in Geschenkpapier aufgetürmt. Neben ihnen war eine hölzerne Krippe aufgebaut. Als lebensgroße Figuren umstanden Maria und Josef gerührt das auf Stroh gebettete Jesuskind. Hirten, von einem Engel zum Stall von Bethlehem geführt, hielten sich ehrfürchtig bei Ochse und Esel im Hintergrund, während sich die drei Weisen aus dem Morgenland anschickten, dem Heiland ihre Geschenke darzubringen. Zwischen dem Baum und der Krippe stand ein breiter roter Sessel, der eigentlich ebenfalls zu der festlichen Atmosphäre beitragen sollte.
Stattdessen aber verpasste er ihr einen herben Dämpfer.
In diesem Sessel saß der Weihnachtsmann. Soweit hatte alles seine Ordnung. Schließlich war dieser Platz dafür gedacht, dass er hier Kinder empfing, um sich zu erkundigen, ob sie brav gewesen waren und was sie sich zu Weihnachten wünschten. Allerdings befand Santa sich ganz und gar nicht in einer Verfassung, in der es ihm möglich gewesen wäre, die Herzen von kleinen Jungen und Mädchen zu rühren und ihnen ein Lächeln auf die Gesichter zu zaubern. Schlaff zusammengesunken hing er schräg zwischen den Armlehnen, kurz davor, schien es, vom Gewicht seines eigenen prallen Bauches auf den Boden gezogen zu werden. Das Kinn war ihm auf die Brust geklappt, als wollte er seine Nase tief in den weißen Wogen seines Bartes vergraben. Seine Mütze saß schief. Ihr Bommel, der bei seinem Lauf auf ihm getanzt hatte, hielt nun still vor seinen geschlossenen Augen. Sein Sack, den er vielleicht an den Sessel gelehnt hatte, war umgekippt. Einige mit Schleifen zugebundene Päckchen waren herausgerutscht, außerdem eine Handvoll rot-weißer Zuckerstangen, oben rund gebogen in der Form von Bischofsstäben. Trotz Geschenken, rot-weißem Mantel und Rauschebart — es war schwer vorstellbar, dass der Weihnachtsmann jemals einen weniger weihnachtlichen Anblick geboten hatte.
Das eine Kind jedenfalls, das gerade vor ihm stand, ein Mädchen an der Hand seiner Mutter, scheute sichtlich davor zurück, sich auf seinen Schoß zu setzen. Falls es den Versuch unternommen hätte, wäre ein Crew-Mitglied eingeschritten, das sich neben dem Sessel aufgestellt hatte und dafür Sorge trug, dass niemand dem reglosen Weihnachtsmann zu nahe kam.
»Der schläft, Ellie«, sagte die Mutter. »Er hat ja vor Weihnachten so viel zu tun, weißt du? Da muss er sich zwischendurch mal ausruhen.«
Ihre Erklärung klang freundlich und geduldig. Anders verhielt es sich mit den Blicken, die sie dem Kapitän zuwarf, der zusammen mit einer älteren Dame auf der anderen Seite neben dem Weihnachtsbaum stand. Aus ihnen sprach deutliche Missbilligung.
»Können wir ihn aufwecken?«, fragte Ellie, deren braune Haare zu zwei Zöpfen zusammengebunden waren.
»Was?«, rief ihre Mutter beinahe erschrocken, bevor sie sich mit Mühe wieder fasste. »Nein, also ... Das geht nicht.«
»Warum nicht?«
»Na ja«, stammelte sie, eine leicht füllige Frau mit blonder Dauerwelle. »Weil er ...«
Sie drohte, sich vollkommen zu verhaspeln. Da kam ihr die Dame zu Hilfe, die beim Kapitän gestanden hatte und nun zu ihr und ihrer Tochter eilte. Mary Elizabeth Arrington, die als Schriftstellerin zahlreiche Kriminalfälle erfunden und als Ermittlerin viele echte Verbrechen an Bord der Queen Anne aufgeklärt hatte, war eine hochgewachsene, schlanke Frau. In ihrem dunklen Kleid strahlte sie eine natürliche Eleganz aus. Obwohl graue Striemen ihr langes schwarzes Haar durchzogen, hätte niemand vermutet, dass sie Mitte sechzig war. Das lag nicht nur an ihrer aufrechten Körperhaltung und ihren dynamischen Bewegungen. Vor allem waren es ihre smaragdgrünen Augen mit dem wachen klaren Blick, die sie deutlich jünger wirken ließen.
Sie beugte sich zu dem Mädchen hinab.
»Hallo, Ellie. Ich bin Mary.«
»Hallo.«
»Ich verstehe, dass du mit dem Weihnachtsmann sprechen willst. Das ist ja auch etwas ganz Besonderes, ihn zu treffen.«
Das Mädchen nickte.
»Aber er ist wirklich sehr erschöpft, weißt du? Er hat die ganze Nacht gearbeitet.«
Es wäre ihr nie eingefallen, dem Mädchen seinen Glauben an den Weihnachtsmann zu nehmen, indem sie darauf hinwies, dass dies lediglich ein normaler Mann in einem Kostüm war. Und schon gar nicht würde sie ihr verraten, dass er möglicherweise nicht bloß schlief, sondern, wie sie fürchtete, niemals wieder aufwachen würde. Bei dieser Verkündung wäre das Kind garantiert in eine solche Verzweiflung gestürzt, dass sich Weihnachten bei ihm zu Hause für alle Zeiten erledigt hatte.
»Aber sobald er wach ist, sagen wir dir sofort Bescheid, okay, Ellie?«
Das Mädchen wirkte enttäuscht, erwiderte jedoch Marys Lächeln.
»Okay!«
Sie winkte dem Mann im Sessel.
»Schlaf gut, Weihnachtsmann!«
Die Mutter nickte Mary zu, dankbar für die Unterstützung. Der Kapitän hingegen erfuhr eine weniger freundliche Behandlung, als sie ihre Tochter aus der Lobby führte.
»Das kann ja wohl nicht sein«, raunte sie ihm zu, »dass dieser Kerl hier seinen Rausch ausschläft. Ich hoffe, Sie regeln das auf der Stelle.«
»Selbstverständlich«, sagte George MacNeill. »Wir werden uns sofort darum kümmern. Bitte entschuldigen Sie vielmals!«
Er rieb sich die Stirn. Wie sein ganzes Gesicht war sie wettergegerbt von langen Jahren auf See. Gerade warf sie zusätzlich noch tiefe Sorgenfalten.
»Das hat mir gerade noch gefehlt«, seufzte er, als Mutter und Tochter außer Hörweite waren. »Reicht es nicht, dass sie mein ganzes Schiff in ein schwimmendes Weihnachtsdorf verwandeln mussten?«
»Nun ja, George«, merkte Mary an. »Wir sind nun einmal auf einer Weihnachtskreuzfahrt.«
Bis an den Nordpol und damit die angebliche Heimat des Weihnachtsmannes konnte ein Schiff wie die Queen Anne nicht gelangen. Dafür wäre, statt eines Luxuskreuzers, ein Eisbrecher nötig gewesen, um die Massen an Packeis zu durchstoßen. Doch gab es schließlich zahllose, wenn auch nicht bewiesene Gerüchte, er habe seinen Wohnsitz ein kleines Stück nach Süden verlegt — und zwar nach Grönland. Genau dorthin würde die Reise also führen. Von Hamburg aus, wo das Schiff dieses Mal abgelegt hatte, hatte es in den letzten Tagen ein gutes Stück des europäischen Nordmeers durchquert und Island bereits hinter sich gelassen. Im weiteren Verlauf würde es entlang der grönländischen Küste durch die Labradorsee und die Baffin Bay bis nach Kanada fahren. Vorbei an Eisbergen in herrlichen Fjorden würde es für Landgänge der über 3.000 Passagiere verschiedene Häfen anlaufen. Dabei würden diese Ausflüge auf die schneebedeckte Insel, wie alles an Bord, vollends unter dem Motto Weiße Weihnachten stehen. Dies sollte die Gäste — und die Besatzung — in die richtige Stimmung für das große Fest versetzen, mit dem der Weihnachtstag begangen werden sollte.
Ohne einen Weihnachtsmann, dachte Mary, würde diese Stimmung allerdings weit schwerer aufkommen. Jener im Sessel wirkte jedenfalls nicht, als würde er in nächster Zeit freudig durch irgendwelche Kamine rutschen, selbst wenn die Schornsteine der Queen Anne ihm trotz seines Bauchumfangs genügend Platz dafür geboten hätten.
»Das ist mir schon klar«, sagte George. »Aber dieser ganze Kram, der überall rumsteht und rumhängt — das ist mir einfach zu kitschig und viel zu viel. Von dem Geflimmer da«, er wies auf eine Reihe bunter Lichter, die an der Brüstung der Galerie über der Lobby blinkten, »kriege ich Kopfschmerzen. Und jetzt«, er schwenkte von den Lichtern zu dem Weihnachtsmann, »auch noch das!«
Es wunderte Mary nicht, dass George, mit dem sie seit einer ihrer früheren Kreuzfahrten liiert war, kein Weihnachtsfan war. Feierlichkeiten jeder Art, viele Leute, laute Musik und Aufruhr waren nicht unbedingt seine Sache. Es war ihm schon unangenehm, wenn seine Besatzung ihm zu seinem Geburtstag ein Ständchen brachte. Noch unbehaglicher war es ihm, wenn er sich in seiner Gala-Uniform bei Empfängen oder Bällen an Bord unter die Passagiere mischen oder gar eine Rede halten musste. Dabei war es nicht so, dass er die Passagiere nicht leiden konnte. Er war schlichtweg ein ruhiger, nicht gerade geselliger Typ. Am wohlsten fühlte er sich — abgesehen von der Zeit, die sie beide in seiner oder ihrer Kabine verbrachten — auf seiner Brücke, wo er zusammen mit seinen Offizieren sein geliebtes Schiff über den Ozean lenkte. Er war nicht begeistert, wenn etwas die Routine, den reibungslosen Ablauf einer Kreuzfahrt störte. Schon gar nicht, wenn es sich um Zwischenfälle dieser Art handelte.
Mary trat an den Weihnachtsmann heran. Es waren keinerlei Verletzungen an ihm erkennbar, wobei Blut auf seinem Mantel aufgrund der Farbe ohnehin nicht sofort aufgefallen wäre. Sein Gesicht war leicht gerötet, nicht leichenblass. Auf den ersten Blick hätte man wirklich meinen können, er schliefe. Zu diesem Eindruck passte allerdings nicht, dass er bei den Unterhaltungen um ihn herum nicht aufgewacht, sich kein bisschen geregt und keinerlei Geräusch wie etwa ein Schnarchen von sich gegeben hatte. Auch ließ sich keine Bewegung seines Bauches feststellen, der sich bei jedem Atemzug hätte heben und senken müssen. Bei seinem gewaltigen Wanst wäre das leicht erkennbar gewesen. Aber er hielt vollkommen still und nährte Marys dunkle Ahnungen. Sie schob ihre Hand in seinen Bart. Berührungsängste hatte sie nicht. Sie hatte schon öfter mit Toten zu tun gehabt, wenn auch noch nie mit einem, der als Weihnachtsmann verkleidet war. Dass er tot war, daran hegte sie nur noch einen geringen Zweifel. Dieser schwand vollends, als sie sich durch das dichte Geflecht wühlte und den Hals ertastete, um seinen Puls zu fühlen. Wie erwartet fand sie keinen.
»Er ist tot«, sagte sie zu George.
Der Kapitän holte tief Luft und stieß sie in einem Schnaufen durch seinen grauen Vollbart wieder aus. Wenn dieser auch dicht gewachsen war — an Länge und Fülle konnte George dem Weihnachtsmann in Sachen Gesichtsbehaarung keine Konkurrenz machen.
»Gottverdammt. Das hatte ich befürchtet.«
Er gab dem Stewart, der auf der anderen Seite der Lobby hinter einem Tresen stand, ein Zeichen. Der Stewart nickte und griff zu seinem Telefon, das er neben sich hatte.
»Ich habe ihn vorhin schon gebeten, sich bereitzuhalten und eine Trage zu organisieren, falls der schlimmste Fall tatsächlich eingetreten sein sollte.«
»Gut vorausgedacht.«
Zum Glück war jetzt, am Morgen, in der Lobby noch nicht viel los. Einige wenige Frühaufsteher durchquerten sie auf dem Weg zum Frühstück in einem der Restaurants. Mary, George und das Besatzungsmitglied neben dem Sessel bemühten sich, den Weihnachtsmann vor ihren neugierigen Blicken abzuschirmen. Noch funktionierte das einigermaßen. Sie durften hoffen, dass die meisten ebenfalls glaubten, die Müdigkeit habe ihn nach einer durchzechten Nacht niedergestreckt und der Kapitän und seine Begleiter versuchten lediglich, ihn wieder zu sich zu bringen. Lang aber würde sich diese Strategie nicht aufrechterhalten lassen. Im Laufe des Tages, und zwar schon bald, würde sich die Lobby mit Menschen füllen, die den Baum und die Krippe bestaunen, sich am Tresen nach Bordaktivitäten oder den anstehenden Landgängen erkundigen oder einfach in einer der Sitzgruppen bei den Säulen dem Pianisten lauschen wollten, der Weihnachtslieder spielen würde. Und natürlich würden viele ihre Kinder herbringen, damit sie den Weihnachtsmann treffen konnten. Mary und George durften ihn nicht einfach hier sitzenlassen, bis die Kleinen anfingen, auf ihm herumzuklettern oder ihm am Bart zu ziehen, um ihn aufzuwecken, was ein aussichtsloses Unterfangen gewesen wäre. Sie mussten den Toten so schnell wie möglich fortbringen.
»Mein Gott, der arme Kerl«, sagte George, während sie warteten. »Er wollte nur ein wenig Freude verbreiten.«
Die Verantwortung für ein gigantisches Kreuzfahrtschiff mit Tausenden von Leuten an Bord zu tragen, war immer eine Herausforderung. Da war es verständlich, dass George sich nach unvorhergesehenen Komplikationen wie dieser nicht gerade sehnte. Das hieß jedoch nicht, dass der Tod dieses Mannes ihn nicht berührt hätte — auch wenn er es sicher vorgezogen hätte, er hätte sich ohne Aufsehen in dessen Kabine ereignet.
»Ja«, sagte Mary. »Als er sich dieses Kostüm angezogen hat, hat er bestimmt nicht damit gerechnet, dass er darin sterben würde. Hast du eine Ahnung, wie lang er schon hier sitzt?«
George schüttelte den Kopf.
»Er muss irgendwann im Laufe der Nacht hergelangt sein. Aber wann, kann ich dir nicht sagen.«
Sie schaute zum Stewart hinter dem Tresen, der gerade einigen Passagieren etwas erklärte. Etwas, hoffte sie, das nichts mit dem Weihnachtsmann zu tun hatte.
»War die Lobby denn nicht besetzt? Es hätte doch die ganze Zeit über jemand hier sein müssen.«
»Es gab einen Zwischenfall«, antwortete George. »Ein paar Passagiere haben sich einige Weihnachtsfiguren aus einem der Gänge geschnappt, einen Schneemann und ein Rentier aus Plastik und sie in den Außenpool geworfen. Sie fanden das wohl lustig. Jemand hat dem Stewart Bescheid gesagt und er musste hoch auf Deck 8, um sie herauszufischen und zurück an ihre Plätze zu bringen. Das hat eine Weile gedauert. Als er zurückkam, hat er die Lobby durch den hinteren Eingang betreten, sodass er nicht an dem Sessel vorbeigekommen ist. Von seinem Tresen aus konnte er ihn nicht sehen, weil der Baum ihm die Sicht darauf versperrte. Er hat deshalb gar nicht mitgekriegt, dass der Weihnachtsmann darin saß. Erst ein paar Passagiere, die früh in die Lobby kamen, haben ihn darauf aufmerksam gemacht. Er hat den Weihnachtsmann angesprochen und an der Schulter gefasst und gerüttelt. Aber er hat nicht reagiert. Da hat er mich verständigt, und ich habe sofort dir Bescheid gegeben. Ich hatte schon das Schlimmste geahnt.«
Das Schlimmste war tatsächlich eingetroffen. Dabei leuchtete Mary ein, dass George die Lobby nicht sofort hatte absperren lassen. Es wäre eine Großaktion gewesen, die mit viel Aufwand und enormen Schwierigkeiten einhergegangen wäre. Schließlich war sie der wichtigste Durchgangspunkt auf dem Schiff. Die unteren Eingänge in den Lobbybereich ließen sich gut kontrollieren. Aber die Lobby zog sich über drei Decks. Das machte es schwierig, auch die oberen von sämtlichen Passagieren freizuhalten und zu verhindern, dass Schaulustige über die Brüstung spähten. Ganz davon abgesehen hätte es für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt und im Zuge dessen für Gerüchte, die der weihnachtlichen Atmosphäre nicht gerade förderlich gewesen wären. Es war besser, die Angelegenheit so diskret wie möglich zu regeln — und so schnell wie möglich.
»Glaubst du, er hatte einen Herzinfarkt oder einen Schwächeanfall?«, fragte George.
In seinen Worten schwang die Befürchtung mit, dass es eine andere, möglicherweise gewaltsame Ursache geben, jemand anders seine Finger im Spiel gehabt haben könnte. Ein toter Weihnachtsmann war schrecklich genug. Ein Mörder an Bord hätte die Katastrophe komplett gemacht. Leider hatte George schon des Öfteren die Erfahrung machen müssen, dass ein solcher sich auf der Queen Anne herumtrieb. Auch Mary konnte die Möglichkeit nicht ausschließen, so gern sie es auch getan hätte. Es gab einfach zu viele offene Fragen. Neben der, woran der Weihnachtsmann gestorben war, vor allem die, was er mitten in der Nacht in der Grand Lobby getrieben hatte.
»Das werden wir herausfinden«, sagte sie, als gerade zwei weitere Besatzungsmitglieder mit der Trage eintrafen.
»Aber eins nach dem anderen. Erst einmal konzentrieren wir uns darauf, ihn wegzubringen, bevor dieser Vorfall die Runde macht. Ein toter Weihnachtsmann ist schließlich das Letzte, was irgendjemand unter einem Christbaum sehen will.«
3
Wie sich zeigte, gestaltete es sich alles andere als einfach, einen leblosen Weihnachtsmann diskret aus der Lobby zu bringen. Allein schon, ihn aus dem Sessel und auf die Trage zu hieven, war ein enormer Kraftakt gewesen, für den sechs Seeleute nötig waren. Sie war ein wenig zu schmal für ihn, sodass nicht nur seine Arme, sondern auch ein Teil seines Rumpfes an den Seiten herunterhing und sich immer zwei neben ihm halten mussten, damit er nicht herunterrutschte. Zum Glück verfügte die Trage über Rollen, sodass sie ihn nicht schleppen mussten. Sie hatten darauf verzichtet, ihn mit einem Laken zuzudecken, weil dadurch sofort für jeden ersichtlich gewesen wäre, dass jemand gestorben war — und wenn jemand einen Blick auf sein Kostüm erhascht hätte, wäre auch klar gewesen, wer. So konnten sie den erstaunten Passagieren, an denen sie ihn vorüberschoben, zumindest einigermaßen glaubhaft versichern, er habe lediglich einen Schwächeanfall erlitten und sei bald wieder auf den Beinen. Normalerweise hielt Mary nichts von Verstellung und Verschleierung. Aber da sie den Passagieren ansonsten das Weihnachtsfest verdorben hätten, waren sie und George der Meinung, dass eine Notlüge ausnahmsweise in Ordnung ging — obgleich der Mann auf der Trage sie sicher dafür gerügt hätte. Auch mit den sonstigen Bemerkungen, die nun über ihn geäußert wurden, wäre er garantiert nicht einverstanden gewesen.
»Meine Güte, ist der fett.«
Germer betrachtete ihn mit unverhohlenem Ekel.
»Der wiegt bestimmt drei Zentner.«
»Mein lieber Dr. Germer«, sagte Mary. »Ich weiß, dass Sie Ihre medizinische Expertise vorzugsweise dafür einsetzen, die wohlhabenden Passagiere der oberen Klassen von harmlosen Wehwehchen zu kurieren und Ihnen nichts so sehr zuwider ist wie die Beschäftigung mit Leichen. Dummerweise gehört sie zu Ihrem Job als Schiffsarzt. Ich wäre Ihnen daher sehr verbunden, wenn Sie aufhören könnten, den Toten zu beleidigen, und stattdessen die Güte hätten, endlich an Ihre Arbeit zu gehen.«
Nachdem sie die Krankenstation erreicht hatten, hatten sie die Trage direkt in die Leichenkammer gerollt. Jedes größere Kreuzfahrtschiff war mit einer solchen ausgestattet, einem kühlen gekachelten Raum mit einer stetig surrenden Lüftungsanlage und metallenen Schubfächern, allein dazu gedacht, menschliche Körper darin aufzubewahren. Schließlich konnte es im Laufe jeder Reise geschehen, dass jemand einen tödlichen Unfall hatte oder einer Erkrankung erlag. Abgesehen davon hatte Mary bereits mehrfach erfahren, dass Kriminelle gern die scheinbar günstige Gelegenheit auf hoher See nutzten, um unliebsame Zeitgenossen gewaltsam aus dem Weg zu räumen.
George hatte seine Leute zurück auf ihre Posten geschickt. Bei dem, was nun anstand, brauchten sie nicht unbedingt Publikum. Zumal sich auch unter dem Personal unvermeidlich das eine oder Tratschmaul fand, das sich nicht darum scherte, wenn der Kapitän seine Besatzung auf Verschwiegenheit einschwor. Nachdem sie gegangen waren, hatten Mary und er sich darangemacht, dem Toten seinen Mantel auszuziehen. Zum einen wollten sie ihn nach Verletzungen absuchen. Zum anderen war es einfach zu verstörend, die ganze Zeit einen toten Weihnachtsmann vor Augen zu haben. Germer hatte Abstand gehalten und es Molly Prendergast überlassen, ihnen dabei zur Hand zu gehen. Sie war nicht nur Germers Sprechstundenhilfe und Arzthelferin, sondern, wie Mary wusste, auch seine Bettgefährtin. Sie verkniff sich die Bemerkung, dass sie als solche ja einige Erfahrung darin besaß, dicke Männer auszuziehen. Dennoch ging auch die Entkleidung nicht ohne Mühe vonstatten. Sie mussten ihn auf der Trage anheben und auf die Seite wuchten, um ihm die Ärmel herunterzukrempeln und den Mantel unter ihm hervorzuzerren. Darunter trug er ein weißes Unterhemd und eine rote Unterhose, als habe er auch bei der Farbgestaltung seiner Unterwäsche einen weihnachtlichen Dresscode einhalten wollen.
Wenn ein angezogener Toter schon Germers Abscheu erregte, tat dies ein halb nackter umso mehr.
»Ich meine ja nur«, sagte der Schiffsarzt. »Wie manche sich gehen lassen.«
Zugegebenermaßen hatte der Mann auf der Trage kein Kissen oder sonstiges Polster gebraucht, um seinen Bauch weihnachtsmanngerecht auszustopfen. Weich wölbte er sich unter seiner schwabbeligen Brust. Wie seine Arme und Beine war sie mit weißen Haaren bewachsen, die oben aus dem Ausschnitt des Unterhemdes quollen und ein wenig aussahen, als sei frischer Schnee auf ihn gefallen.
»Man könnte behaupten«, merkte Mary mit einem Blick auf Germers eigene Bauchregion an, »dass Sie, mein lieber Dr. Germer, ihm in Sachen Körperfülle in nichts nachstehen. Da stellt sich die Frage, ob sie der richtige sind, seine Lebensführung und Ernährung zu kritisieren.«
»Wie bitte?«, begehrte Germer auf. »Wie kommen Sie dazu ... Auf keinen Fall bin ich so ein Trumm wie der!«
Mary ersparte sich die Widerrede. Die Antwort lag ihrer Meinung nach auf der Hand. Auch sah sie davon ab, zu erwähnen, dass neben dieser ersichtlichen Übereinstimmung auch ein weihnachtlicher Vollbart Germer gut gestanden hätte. Dieser hätte zumindest den unteren Teil seines speckig glänzenden Gesichts verborgen. Je weniger man davon sah, dachte Mary, desto besser. Natürlich hätte Germer ihn orange färben müssen, damit er zu der Haartolle passte, die er sich sorgfältig über den Schädel kämmte, auf dem ansonsten nicht mehr viel wuchs. Sämtliche körperlichen Makel machte er durch ein aufgeplustertes Ego wett. Dadurch hinderten ihn weder Übergewicht noch kahle Stellen daran, sich für einen jungen Gott zu halten. Die ihm eigene Eitelkeit sorgte dafür, dass er auf jede Form von Kritik überaus empfindlich reagierte.
»Ich habe vielleicht ein oder zwei Pfund zu viel«, sagte er. »Das passiert halt um die Weihnachtszeit. Aber das macht mich ja eher stattlich.«
Er versuchte, den Bauch einzuziehen, ohne nennenswerten Erfolg. Er hatte einfach zu viel Masse. Mit beinahe flehendem Blick wandte er sich an seine Sprechstundenhilfe.
»Das sagst du doch immer, Molly. Oder? Ich bin doch kein Fettwanst wie der da!«
Molly Prendergast zog sich diplomatisch aus der Affäre.
»Komm schon, Germerchen.«
Sie klopfte ihm zärtlich auf seinen Bauch.
»Du weißt, ich mag dich, so wie du bist. Und jetzt hör auf, so gemein zu sein. Das ist immerhin der Weihnachtsmann.«
Wieder einmal kam Mary nicht umhin, sich zu fragen, warum sich diese so sympathische, intelligente und noch dazu hübsche junge Frau mit einem aufgeblasenen Grobian wie Germer abgab. Aber sie wusste: Bei allen Rätseln, die sie auf dem Schiff gelöst hatte, würde sie auf dieses wohl nie eine Antwort erhalten.
»Okay, okay«, maulte Germer. »Ich mach ja schon.«
»Du bist ein Schatz, Germerchen.«
Dieser Meinung schloss Mary sich zwar nicht an. Aber sie war erleichtert, dass Molly mehr Erfolg hatte als sie. Germer hörte aus Prinzip nicht einmal auf den Kapitän, geschweige denn auf dessen Lebensgefährtin.
Aus einer Schachtel, die auf einem Metalltisch stand, zog Germer ein Paar Gummihandschuhe und streifte sie über seine wurstigen Finger. Dann näherte er sich dem Toten, was ihn unübersehbar Überwindung kostete, und fing an, ihn abzutasten. Mary hielt sich dicht bei ihm. So früh am Morgen verströmte Germer noch nicht seinen üblichen Geruch von Enzianschnaps (den er sich, vermutete Mary, gönnen würde, sobald sie und George die Krankenstation verlassen hatten). Der strenge Moschusduft seines Deos war jedoch nicht weniger aufdringlich. Immerhin war er so streng, dass es sogar jeglichen Leichengeruch überdeckte. Mary blieb sowieso nichts übrig, als das herbe Aroma in Kauf zu nehmen, wenn sie Germers Untersuchung verfolgen wollte. Als sie den Mantel des Weihnachtsmannes entfernt hatten, war ihr nichts aufgefallen, keine Stichwunden, keine Würgemale oder Ähnliches, das auf äußere Einwirkung hinwies. Sie wollte sicherstellen, dass Germer bei seiner genaueren Betrachtung nichts übersah — oder stillschweigend darüber hinwegging. Als Chief Medical Officer der Queen Anne oblag es ihm allein, die Todesursache offiziell festzustellen, ein Vorrecht, das er skrupellos missbrauchte. Wenn es eines gab, dass er mehr hasste als Tote, waren es ermordete Tote, die ihm und dem Schiffseigner, dem Germer loyal ergeben war, Scherereien verursachten. So wenig Einsatz er auch im Allgemeinen in seinem Beruf zeigte, so erpicht war er stets darauf, Verbrechen an Bord zu vertuschen, damit der Ruf des Unternehmens bloß nicht durch einen Skandal in Mitleidenschaft gezogen wurde.
»Seine Name war Bjarne Holm«, sagte George, der mit Molly hinter Germer und Mary stehen geblieben war. Mary warf ihm einen fragenden Blick über die Schulter zu.
»Ich habe mich über ihn informieren lassen«, erklärte er, »während ich in der Lobby auf dich gewartet habe. Ich wusste, dass, sollte er tatsächlich tot sein, wir so viel wie möglich über ihn erfahren müssen.«
»Sehr vorausschauend«, lobte Mary. »Alle Achtung, Herr Kapitän.«
»Danke. Ich habe von der Besten gelernt. Holm stammte aus Norwegen.«
»Passend für einen Weihnachtsmann.« Mary wandte sich wieder dem Toten zu, während sie ihr Gespräch fortsetzten.
»Ja«, antwortete George. »Angestellt war er allerdings bei einer britischen Firma, die Weihnachtsmänner an unterschiedliche Auftraggeber vermittelt, an Kaufhäuser, an Unternehmen für Firmenfeiern. Daher war er kein offizielles Crewmitglied und hatte seine Kabine auch nicht im Besatzungsbereich, sondern auf Deck 5. Offenbar kam er letzte Nacht von dort oder zumindest aus dieser Richtung. Einige Passagiere haben ihn über die Gänge rennen sehen und sich heute früh bei meinen Leuten erkundigt, was es damit auf sich hatte.«
»Da stellen sich die Fragen«, sagte Mary, »warum er es so eilig hatte und ob er in die Lobby wollte oder es einfach nicht weiter geschafft hat. Und falls dem so war, wohin er tatsächlich wollte und warum.«
Germer hatte derweil das Gesicht und den Hals des Toten betrachtet, anschließend seine Arme und Beine. Dadurch hatte er es so lang wie möglich aufgeschoben, sich mit seinem Bauch zu befassen, den er immer noch sichtlich unappetitlich fand (oder der ihn, wie Mary vermutete, an sein eigenes Übergewicht erinnerte, das sich nicht bestreiten ließ, egal, wie vehement Germer das versuchte). Nun blieb ihm nur noch dieser Teil der Leiche — oder der Lendenbereich. Die rote Unterhose hätte Germer aber vermutlich nur mit der Kneifzange angefasst. Trotz der Handschuhe griff er das Unterhemd mit den Fingerspitzen und entblößte den Bauch, der wie ein Hefeteig zu allen Seiten quoll. Germer nahm ihn in Augenschein und piekte ein wenig daran herum.
»Nichts«, sagte er. »Keine Wunden, kein Blut, keinerlei Anzeichen dafür, dass Gewalt im Spiel war.«
Er wirkte hochzufrieden, dass der Tote ihm entgegen seiner Befürchtung keine weiteren Komplikationen einbrocken würde. Es schien ihn mit Holm zu versöhnen. Er tätschelte ihm sogar freundschaftlich den Bauch, der dadurch leicht in Wallung geriet.
»Wie es aussieht, haben wir es mit einem natürlichen Tod zu tun. Ein Herzinfarkt wäre bei dem Fettwanst ja auch wirklich kein Wunder.«
Ein Schicksal, dachte Mary, das Germer möglicherweise auch drohte, vor allem bei seinem übermäßigen Schnapskonsum.
»Na, dann.«
Germer fasste das Unterhemd, um es wieder über den Bauch zu ziehen.
»Schön, dass wir das erledigt haben. Dann können wir ...«
»Warten Sie!«, rief Mary. »Da. Sehen Sie das?«
»Was denn?«, fragte Germer, dessen kurzzeitig gestiegene Stimmung direkt wieder in den Keller stürzte. Mary deutete auf eine Stelle in dem wabbeligen Fleisch, knapp über der Hüfte, wo der Bauch einen Fettwulst warf. Dort waren in der bleichen Haut mehrere kleine rote Punkte zu erkennen, relativ dicht beieinander.
»Das sind eindeutig Einstiche.«
George trat näher.
»Ja, und sie sehen frisch aus.«
»Blödsinn«, sagte Germer, den diese Verkündung in Hektik versetzte. »Das können auch ... Bestimmt ist es ein Ausschlag oder so etwas. Das muss gar nichts bedeuten.«
»Vielleicht hat ihm jemand Gift gespritzt«, sagte George.
»Lassen Sie uns mal keine voreiligen Schlüsse ziehen.«
Germer schien einer Panik nahe. Er hatte sich sicher auf ein geruhsames Weihnachtsfest gefreut, bei dem er sich neben Enzianschnaps das eine oder andere Gläschen Eierlikör genehmigen und sich mit Keksen vollstopfen würde. Im Fall eines Mordes würde er diese schönen Pläne aufgeben müssen, um seine üblichen Vertuschungs- und Sabotageakte zu begehen, damit nichts darüber an die Öffentlichkeit gelangte. Eine Weihnachtskreuzfahrt mit ermordetem Weihnachtsmann war schließlich nichts, was das Schifffahrtsunternehmen in seine Werbebroschüre aufnehmen würde.
»Ich meine, vielleicht hat ihn irgendein Insekt gestochen oder ...«
Aber seine Einwände schienen ihn selbst nicht zu überzeugen.
»Schauen Sie mal hier!«
Mary, George und Germer wandten sich um. Während sie sich mit dem Toten befasst hatten, hatte Molly Prendergast den rotweißen Mantel und die Mütze genommen und sie an einen Haken an der Wand gehängt, der sonst für Kittel gedacht war. Nun hielt sie ihnen etwas hin, das auf den ersten Blick wie ein Filzstift oder ein breiter Kugelschreiber aussah.
»Das war in seiner Tasche.«
Germer nahm den Gegenstand, drehte ihn in der Hand — und lächelte.
»Ich weiß, was das ist.«
»Dann erleuchten Sie uns bitte«, sagte Mary.
»Aber gern. Es ist ein Insulin-Pen.«
Er schaute Mary und George triumphierend an, als hätte er persönlich diese bahnbrechende Entdeckung gemacht, die alle Fragen auf einen Schlag beantwortete und jeden Zweifel an seiner medizinischen Einschätzung zunichtemachte.
»Der Specksack war Diabetiker.«
»Das heißt«, sagte George, »dass die Einstiche von diesem Ding herrühren?«
»Ganz genau. Damit hat er sich sein Insulin verabreicht, um seinen Zuckerspiegel zu regulieren.«
Germer zog die Kappe des Pens ab, unter der eine kurze Nadel zum Vorschein kam. Den Daumen setzte er hinten auf den Druckknopf, mit dem die Injektion ausgelöst wurde. Dabei hielt er ihn eher wie einen Dolch statt eines medizinischen Geräts.
»Er hat es sich in die Bauchfalte gespritzt. Dadurch, dass er den Pen in seinem Mantel hatte, liefert er uns netterweise nicht nur Aufschluss über seinen gesundheitlichen Zustand, sondern auch über sein spontanes Ableben. Er muss einen Zuckerschock erlitten haben. Da wir keine anderen Anzeichen an ihm gefunden haben, ist das die einzige Erklärung. Es passt perfekt zusammen. Das Rätsel ist gelöst und wir brauchen uns nicht länger mit ihm zu befassen!«
Vor Aufregung glänzte sein Gesicht noch stärker als sonst. Mary war es schleierhaft, wie es ihm selbst in diesem stark gekühlten Raum gelang, dermaßen zu schwitzen. Seinen Enthusiasmus teilte sie nicht.
»Es ist absolut nichts gelöst«, sagte sie. »Er hat ja ...«
»Papperlapapp«, fiel ihr Germer ins Wort. »Kommen Sie mir bloß nicht wieder mit Ihren bescheuerten Theorien. Offensichtlicher geht es doch nun wirklich nicht. Aber warten Sie, ich liefere Ihnen den endgültigen Beweise. Dann werden selbst Sie nichts mehr einwenden können.«
Er legte den Pen auf den Metalltisch.
»Molly, sei ein Schatz und hol mir das Testkit aus dem Untersuchungszimmer.«
»Natürlich, Germerchen.«
Sie eilte aus der Leichenkammer und kehrte kurz darauf mit einem kleinen Etui zurück, das sie Germer reichte. Der Arzt öffnete es, entnahm ihm ein schmales Gerät mit einem Display, eine kleine Dose und einige schmale blaue Plastikstücke. Er legte alles auf dem Tisch zurecht. Dann schaltete er das Gerät ein, das prompt einen Piepton von sich gab. An einem der Plastikstücke drehte er den oberen Teil ab. Darunter befand sich, wie bei dem Pen, eine dünne Nadel. Mit dieser trat Germer nun an den Toten und zapfte ein paar Tropfen Blut aus dessen Fingerspitze. In der Regel weigerte er sich, irgendeine Form von Untersuchung an jenen durchzuführen, die unter ungeklärten Umständen an Bord ums Leben gekommen waren. Schließlich konnte dabei etwas zutage treten, das ihm gar nicht gefiel. Jetzt aber, wo er hoffte, seine Theorie zu bestätigen, legte er einen Eifer an den Tag, den Mary sonst nicht an ihm kannte.
Molly stand mit einem länglichen, mit Markierungen versehenen Papierstreifen bereit, den sie dem Döschen entnommen hatte. Auf diesen träufelte Germer das Blut. Anschließend führte er den Streifen in eine Öffnung des Messgeräts ein. Nach wenigen Sekunden schon verkündete es durch ein weiteres Piepen, das die Analyse abgeschlossen war. Germer prüfte das Display, bevor er Mary und George das Gerät entgegenstreckte.
»Da! Habe ich es doch gewusst. Extrem erhöhte Blutzuckerwerte. Tödlich erhöht. Wir haben es also mit einem Diabetiker zu tun, der an einem Zuckerschock gestorben ist. Keinerlei Mysterium. Wie gesagt: Fall gelöst!«
Molly Prendergast sah ihn an, als wollte sie in Beifall über seine bahnbrechende Leistung verfallen, und unterließ es nur, weil es angesichts des Toten nicht angemessen gewesen wäre.
Mary runzelte die Stirn.
»Ihre Hingabe in allen Ehren, mein lieber Herr Doktor. Ich wünschte, Sie wären immer mit so viel Einsatzfreude bei der Sache. Leider ergibt Ihre Theorie überhaupt keinen Sinn.«
Germer sah sie genervt an. Für ihn, wusste sie, war sie eine ewige Querulantin, die auf nichts anderes aus war, als ihm das Leben schwer zu machen — was sie aus seiner Sicht nun wieder einmal unter Beweis stellte.
»Warum macht das bitte keinen Sinn?«
Er fuchtelte mit dem Gerät vor ihr herum.
»Das Ding lügt nicht. Sein Blutzucker ist durch die Decke gegangen. Das konnte er nicht überleben.«
»Aber er hätte es überleben müssen«, erwiderte Mary. »Durch das Insulin.«
»Genau«, sagte George. »Ich verstehe, was du meinst, Mary. Die Einstiche zeigen ja, dass er sich das Insulin injiziert hat, und zwar offenbar vor Kurzem. Ich bin kein Fachmann, aber die wirken auf mich, als wären sie nur einige Stunden alt. Darum müssen wir uns fragen: Warum hat das Hormon seinen Blutzuckerspiegel nicht gesenkt und ihn gerettet?«
Germer zuckte beleidigt die Schultern.
»Was weiß ich? Vielleicht hat er es sich zu spät verabreicht oder sein Pen hat nicht ordentlich funktioniert.«
Er deutete auf die dicht gesetzten Punkte.
»Das würde auch erklären, warum er sich so oft damit gestochen hat.«
»Mein lieber Herr Doktor, ich bitte Sie. Es liegt doch wohl auf der Hand, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.«
»Bah!«
Germer vollführte eine wegwerfende Handbewegung.
»Sie wollen nur wieder Stunk machen. Sie werden uns noch allen das Weihnachtsfest verderben mit ihren Wahnvorstellungen und ihren paranoiden Anfällen.«
»Und Sie wollen nur wieder ein Verbrechen unter den Teppich kehren. Aber das habe ich in der Vergangenheit nicht zugelassen und das werde ich auch dieses Mal nicht tun. Ich werde alles unternehmen, was in meiner Macht steht, um herauszufinden, was es mit dem Tod dieses Mannes auf sich hat.«
»Ach ja?«
Germer reckte ihr seinen drallen Bauch entgegen.
»Na, versuchen Sie es doch. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass ich ...«
Molly Prendergast schob sich zwischen sie.
»Vertragen Sie sich doch, Sie beide. Es ist schließlich Weihnachtszeit.«
»Apropos«, mischte sich nun auch George ein. »Ich gebe dir recht, Mary. Die Aufklärung dieses Todesfalls hat oberste Priorität und ich werde dich wie immer nach besten Kräften dabei unterstützen. Allerdings haben wir noch ein weiteres Problem. Im Vergleich zu einem möglichen Mord mag es nebensächlich erscheinen. Trotzdem müssen wir uns darum kümmern.«
»Welches Problem meinst du, George?«
»Nun ja.«
Der Kapitän wies auf den Toten auf der Trage.
»Wir befinden uns auf einer Weihnachtskreuzfahrt, bei der uns der Weihnachtsmann abhandengekommen ist. Der einzige, den wir hatten.«
»Es gab nur ihn?«
»Leider ja. Jemand muss einspringen.«
»Mal sehen«, überlegte Mary.
Es stimmte, was George gesagt hatte: Gegen ein Verbrechen war dies eine geringe Schwierigkeit. Nichtsdestotrotz war es eine, die sie beheben mussten.
»Vielleicht findet sich unter den Passagieren jemand.«
George schüttelte den Kopf.
»Ich glaube nicht, dass die Leute, die alle schon für ihre Kreuzfahrt bezahlt haben und ihren Urlaub genießen wollen, die Reise mit Arbeit verbringen möchten. Sie wollen schließlich selbst Weihnachten feiern. Abgesehen davon gäbe das Komplikationen mit unserer Personalabteilung und der Versicherung.«
Er schaute nachdenklich von Germer zu dem rot-weißen Mantel an der Wand. Mary schwante, was in ihm vorging.
»Ist das dein Ernst?«, fragte sie.





























