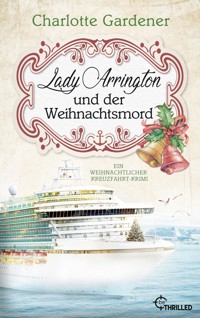5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Mary Arrington
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mary Elizabeth Arrington ist 63 Jahre alt und verzweifelt: Der erfolgsverwöhnten Krimi-Autorin will einfach keine neue Idee einfallen. Also bucht sie auf der luxuriösen Queen Anne eine Kreuzfahrt durch die Karibik. Die Schiffsreise soll sie auf andere Gedanken bringen - und hoffentlich die eine oder andere Inspiration für ihren nächsten Roman liefern. Doch schon der Eröffnungsball verläuft dramatisch: Der adrette Franzose, der Mary gerade noch zum Tanz aufgefordert hat, windet sich im Todeskampf am Boden und stirbt. Ein Mord!
Marys Neugierde und ihr Spürsinn sind geweckt. Auf keinen Fall glaubt sie an einen Herzinfarkt, wie Kapitän MacNeill ihr und den übrigen Passagieren weißmachen will. Mit englischer Höflichkeit, schriftstellerischer Raffinesse und trockenem Humor begibt Mary sich auf die Suche nach dem Mörder - tatkräftig unterstützt vom forschen Zimmermädchen Sandra und Marys langjährigem Londoner Lektor. Als ein weiterer Mord geschieht, weiß Mary, dass sie dem Täter gefährlich nah ist ...
Ein klassischer Whodunit-Krimi auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff vor herrlich maritimer Kulisse! Hier trifft "Mord ist ihr Hobby" auf "Traumschiff". Für Krimi-Fans und Leser von Feel-Good-Romanen. Die perfekte Lektüre für den Urlaub - oder um sich an grauen Regentagen in Urlaubsstimmung zu bringen.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Über dieses Buch
Mary Elizabeth Arrington ist 63 Jahre alt und verzweifelt: Der erfolgsverwöhnten Krimi-Autorin will einfach keine neue Idee einfallen. Also bucht sie auf der luxuriösen Queen Anne eine Kreuzfahrt durch die Karibik. Die Schiffsreise soll sie auf andere Gedanken bringen – und hoffentlich die eine oder andere Inspiration für ihren nächsten Roman liefern. Doch schon der Eröffnungsball verläuft dramatisch: Der adrette Franzose, der Mary gerade noch zum Tanz aufgefordert hat, windet sich im Todeskampf am Boden und stirbt. Ein Mord!
Marys Neugierde und ihr Spürsinn sind geweckt. Auf keinen Fall glaubt sie an einen Herzinfarkt, wie Kapitän MacNeill ihr und den übrigen Passagieren weißmachen will. Mit englischer Höflichkeit, schriftstellerischer Raffinesse und trockenem Humor begibt Mary sich auf die Suche nach dem Mörder – tatkräftig unterstützt vom forschen Zimmermädchen Sandra und Marys langjährigem Londoner Lektor. Als ein weiterer Mord geschieht, weiß Mary, dass sie dem Täter gefährlich nah ist …
Über die Autorin
Charlotte Gardener ist eine englische Autorin. Nachdem sie mehr als dreißig Jahre in London am Theater gearbeitet hat, ist sie nun ins wunderschöne Brighton zurückgekehrt, den Ort ihrer Kindheit. Hier hat sie auch endlich die Ruhe gefunden, um ihr Hobby zum Beruf zu machen: das Schreiben von Kriminalromanen. Und wenn sie nicht gerade in einem kleinen Café an einem ihrer Romane tüftelt, liebt sie es, mit ihrem Hund Scofield lange Spaziergänge am Strand zu unternehmen.
Charlotte Gardener
Lady Arringtonund der toteKavalier
EINKREUZFAHRT-KRIMI
beTHRILLED
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Stephan Trinius
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven von Shutterstock: © PhuuchaayHYBRID | © AKaiser | © VladisChern | © mariakraynova | © Jullius
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5176-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1.
»Habe ich Ihre Nachricht korrekt interpretiert, Mrs. Arrington?«
»Das hängt davon ab, wie Sie meine Nachricht interpretiert haben, Mr. Bayle.«
Mrs. Arrington und Mr. Bayle: So nannten sie einander auch nach Jahrzehnten. Aus ihrer engen Zusammenarbeit war etwas entstanden, das man durchaus als Freundschaft bezeichnen konnte. Aber trotz der langen Zeit und aller Verbundenheit waren sie nie zum ›Du‹ übergegangen. Mary schob es vor allem auf Mr. Bayles britische Steifheit.
»Sie planen«, drang es ungläubig aus dem Smartphone, »sich auf die Bahamas zu begeben?«
»Nein«, antwortete Mary.
»Dann sehen, beziehungsweise hören Sie mich beruhigt.«
»Ich befinde mich bereits auf den Bahamas.«
»Dann sehen, beziehungsweise hören Sie mich beunruhigt.«
»In Nassau, um genau zu sein.«
»Diese Detailinformation trägt nicht dazu bei, meine Unruhe zu mildern.«
»Auf dem Prince-George-Kai.«
»Und diese noch weniger.«
Mary musste lächeln und blieb stehen, um das Panorama zu bewundern: In der Ferne spannten sich zwei schlanke Brücken von Nassau hinüber nach Paradise Island. Auf der kleinen Insel erhoben sich protzig die sandfarbenen Hochhäuser des Atlantis-Freizeitparks zwischen sattgrünen Palmen und türkisblauen Lagunen und Buchten. Alles schillerte und funkelte unter einem makellos blauen Himmel.
»Demnach spielen Sie wirklich mit dem Gedanken«, Mr. Bayle klang jetzt noch ungläubiger, »eine … Kreuzfahrt anzutreten?« Er sprach das Wort aus wie die Bezeichnung einer ekelerregenden Krankheit.
»Nein«, antwortete Mary.
»Irgendeine Nuance in der Modulation Ihrer Stimme hält mich davon ab, erleichtert aufzuatmen.«
Mary schmunzelte und spazierte weiter den Kai entlang, vorbei an einer Reihe riesenhafter Kreuzfahrtschiffe der verschiedensten Herkunftsländer.
»Ich bin bereits dabei, eine Kreuzfahrt anzutreten. Mein Gepäck wurde schon an Bord gebracht und erwartet mich in meiner Suite.«
»Das kann doch unmöglich Ihr Ernst sein«, knurrte Mr. Bayle. »Ich war der Ansicht, es hätte sich herumgesprochen, dass zwischen unserer lieben Mutter Erde und den entlegensten Peripherien unserer Milchstraße nichts Langweiligeres existiert als eine Kreuzfahrt.«
»Ja, das dachte ich auch. Aber Greta hat mich eines Besseren belehrt.«
Zur Antwort erhielt sie zunächst nichts als ein frustriertes Grollen.
»Ich hätte es ahnen müssen«, sagte Mr. Bayle dann, »dass hinter diesem hanebüchenen Unterfangen niemand anders als diese impertinente Person steckt, deren liebster Zeitvertreib darin besteht, sich in das Leben anderer Leute einzumischen. Bei aller Hochachtung, die ich Ihnen entgegenbringe, verehrte Mrs. Arrington: Ich muss Sie dafür tadeln, einmal mehr den Einflüsterungen dieses aufdringlichen Weibsstücks zu erliegen.«
Beinahe hätte Mary laut aufgelacht über Mr. Bayles Empörung. Ebenso, wie er mit Mary seit langer Zeit eine innige Vertrautheit pflegte, unterhielt er zu Greta, ihrer altgedienten Haushaltshilfe, eine nicht weniger lange und nicht weniger innige Abneigung. Sie beruhte auf Gegenseitigkeit. Seit ihrer ersten Begegnung ließen die beiden keine Gelegenheit aus, sich einen leidenschaftlichen Schlagabtausch zu liefern, der sich meistens um Marys Wohlergehen drehte. Beide glaubten zu wissen, was für sie am besten war. Mary selbst genoss diese unterhaltsamen Streitigkeiten. Am Ende machte sie ohnehin immer das, was sie selbst für richtig hielt.
»Von Einflüsterungen, werter Mr. Bayle, kann gar nicht die Rede sein. Aber wie Sie vielleicht wissen, verbringt Greta seit Jahren ihre Urlaube auf einem Kreuzfahrtschiff und hat mich nun darüber in Kenntnis gesetzt …«
»Ungefragt in Kenntnis gesetzt, möchte ich wetten«, unterbrach sie Mr. Bayle. »Diese Frau bringt es ja nicht fertig, auch nur einen einzigen ihrer ausnahmslos trivialen Gedanken für sich zu behalten.«
»… mich darüber in Kenntnis gesetzt«, fuhr Mary fort, »dass sich dort die originellsten Charaktere zusammenfinden und sich die erschütterndsten Dramen und skurrilsten Komödien ereignen, die man sich nur denken kann.«
Das Smartphone schwieg einen Moment, bevor Mr. Bayle grummelte: »Allmählich begreife ich. Sie klammern sich an die verzweifelte Hoffnung, jene zündende Idee, die Sie weder hier in London noch bei Ihnen in Sussex aufzutreiben vermochten, auf einem dieser schwimmenden Spiel-, Spaß-, Sport- und Geschmacklosigkeits-Paläste zu entdecken.«
»Sie haben mich, wie üblich, durchschaut, Mr. Bayle.«
Das war auch kein Wunder. Schließlich waren bereits gut vierzig Jahre vergangen, seit der junge Mr. Bayle in seiner Funktion als Lektor des Verlags Fitch & Finnegan der jungen Mary zur Veröffentlichung ihres ersten Kriminalromans verholfen hatte. Danach war aus ihrer Zusammenarbeit durchschnittlich jedes zweite Jahr ein Buch hervorgegangen, das es zumindest unter die ersten Zehn der Bestsellerlisten geschafft hatte. Bis auf die letzten drei Bücher. Irgendetwas war mit denen schiefgelaufen. Die Kritiker hatten sich ratlos, die Fans enttäuscht, die Verkaufszahlen ernüchternd gezeigt.
Möglicherweise hatten diese Rückschläge sogar den so unerschütterlich scheinenden Mr. Bayle verunsichert. Jedenfalls hatte er in letzter Zeit geradezu reflexartig sämtliche Romanentwürfe abgelehnt, die Mary ihm vorgelegt hatte: Zu altmodisch, zu klischeehaft, zu unglaubwürdig. Sie benötigte einfach dringend eine Idee, die zunächst Mr. Bayle und in der Folge ihre verbliebene Leserschaft zu glühender Begeisterung hinreißen würde. Und wie Mr. Bayle messerscharf erkannt hatte, war sie entschlossen, diese Idee aus ihren Beobachtungen und Erfahrungen während der bevorstehenden Kreuzfahrt zu gewinnen.
»Und nun erlauben Sie mir, Ihnen eine Gute Nacht zu wünschen«, sagte Mary, denn in London war es gerade acht Uhr abends. »Ich muss mich jetzt einschiffen.«
»Sie müssen was?«, schallte es noch aus dem Smartphone, ehe Mary es in ihre Umhängetasche steckte.
Hätte sie dabei jemand von Ferne beobachtet, wäre er kaum auf den Gedanken gekommen, sie sei 63. Das mochte an ihrer aufrechten Haltung liegen, an ihren energischen und dabei graziösen Bewegungen oder ihrer hochgewachsenen, schlanken Figur, die sie mit Fitnessübungen in Form hielt. Aus der Nähe war freilich nicht zu übersehen, dass ihre smaragdgrünen Augen nicht mehr ganz so strahlten wie die einer Dreißigjährigen, dass ihr langes schwarzes Haar, das im Nacken gewöhnlich von einem einfachen Band zusammengehalten wurde, von grauen Strähnen durchzogen war. Diese etwa zu färben, wäre ihr allerdings geschmacklos erschienen. Der Stil der Mary Elizabeth Arrington, auch was Kleidung, Schuhe, Schmuck betraf, war geprägt von einer natürlichen und schlichten Eleganz.
Mit diesem Anspruch hatte sie auch ihr Schiff ausgewählt. Nachdem sie es bisher nur auf Bildern gesehen hatte, stand sie nun endlich davor. Es lag ein wenig abgesondert am äußersten Ende des Kais statt in der Reihe der anderen Schiffe, als wäre es dafür zu stolz. Im Gegensatz zu ihnen entsprach es nämlich keineswegs Mr. Bayles Vorstellung von einem schwimmenden Spiel-, Spaß-, Sport- und Geschmacklosigkeits-Palast.
Zwar war es der luxuriöseste und prachtvollste unter den Ozeankreuzern der renommierten Reederei Kenneth aus Southampton: 345 Meter lang, 41 Meter breit und 72 Meter hoch. Seine 16 Decks boten durchaus Platz für rund 1.200 Crew-Mitglieder und bis zu 3.000 Passagiere. Jedoch weder für eine Kamikaze-Wasserrutsche noch für eine Roller-Skating-Bahn oder einen Fallschirmsprung-Simulator. Selbstbewusst verweigerte dieses Schiff sich dem Bombast moderner Kreuzfahrtkolosse, stilbewusst besann es sich auf die Tradition und das Flair klassischer britischer Lebensart.
Als Mary an seinem mächtigen Rumpf hochblickte, leuchteten seine weißen Aufbauten mit dem knallroten Schornstein verheißungsvoll in der Sonne. In wenigen Stunden würde es auslaufen zu ihrer Reise durch die Karibik: Von Nassau nach Miami und um Kuba herum nach Jamaika. Von Jamaika über Grand Cayman zur mexikanischen Insel Cozumel und von dort wieder nach Nassau. An seinem Heck und seinem Bug prangte ein Name, der bewies, dass dieser Gigant nicht nur eine Sie, sondern sogar eine Königin war: Queen Anne.
2.
Es war erhebend, sich an Bord dieses majestätischen Schiffes zu befinden. Nachdem sie die Sicherheitskontrolle und die übrigen Formalitäten der Einschiffung hinter sich gebracht hatte, stieg Mary eine der geschwungenen Treppen der Grand Lobby hinauf.Das Innere der Queen Anne stand ihrem Äußeren an Erhabenheit in nichts nach, und die Lobby war das geschäftige Herzstück all dieser schwimmenden Pracht. Über drei Decks erstreckte sie sich in die Höhe und vermittelte mit ihren bordeauxroten Teppichen, ihren marmorierten Säulen und der warmen, indirekten Beleuchtung eine ebenso gediegene wie lebendige Atmosphäre. Schicke, einladend wirkende Sessel und ein edler schwarzer Konzertflügel verhießen angenehme Abende bei gehobener musikalischer Unterhaltung, und Filialen exklusiver Firmen wie Hermès oder Harrods gewährleisteten, dass die vornehmen Ladys und Gentlemen, die sich hier die Ehre gaben, auch auf den Weiten des Meeres nicht auf stilsicheres Shopping, eine gepflegte Erscheinung und den Wohlgeruch feiner Parfüms zu verzichten brauchten.
Einige von Marys Mitreisenden hatten sich hier eingefunden, um ehrfürchtig all diese Herrlichkeit zu bestaunen oder sich in freudiger Erwartung darüber auszutauschen. Bell Boys in roter Livree schritten zügig, aber niemals hektisch zwischen ihnen umher, erteilten bereitwillig Auskünfte, trugen Koffer oder geleiteten Gäste zu ihren Unterkünften. Vorbei an Geschäften, Passagieren und Personal erreichte Mary einen gläsernen Lift, der sie beinahe lautlos über dieses quirlige Treiben erhob und sie hinauf zum Deck 10 beförderte.
Dort folgte sie einem breiten Korridor, in welchem sich die Türen der Premium-Class-Kabinen mit Balkon aneinanderreihten. Er mündete in eine Art Foyer, verziert mit Farnen und Palmen in Messingbehältern und ausgelegt mit weichen Läufern, die das Geräusch von Marys Schritten gänzlich verschluckten. Auch sonst war hier oben nichts zu hören, sodass man das Gefühl haben konnte, von allem übrigen Geschehen an Bord abgeschottet zu sein, unerreichbar für allen Lärm und andere Störungen. Das Einzige, was sich nicht in diesen Eindruck harmonischer Abgeschiedenheit fügen wollte, war der Handwagen einer Reinigungskraft mit seinen Schrubbern und Schwämmen und Eimern, den hier jemand achtlos hatte stehen lassen.
Es gab in diesem Foyer nur zwei Türen, beide aus poliertem Walnussholz, die in weitem Abstand nebeneinander lagen. In goldenen Buchstaben war die linke mit Trafalgar Suite, die rechte mit Piccadilly Suite beschriftet.
Mary zückte ihre Bordkarte. Sie war mit ihrem Namen und ihrem Bild versehen und würde ihr auf der Queen Anne als Ausweis, Kreditkarte und vor allem als Schlüssel dienen. Mary schob sie in das Schloss der linken Tür und betrat zum ersten Mal die Trafalgar Suite, die für die kommenden Tage ihr Heim sein würde.
Sie war ein wenig skeptisch gewesen, ob sie sich in einem schwimmenden Hotelzimmer wohlfühlen würde. Jetzt aber zerstreuten sich ihre Bedenken. Die Suite erfüllte sämtliche Erwartungen, die die Prospekte des Reiseanbieters in ihr geweckt hatten.
Auf knapp 100 Quadratmetern bot sie, mit Ausnahme einer Küche, alle Möglichkeiten und Annehmlichkeiten einer vollständigen Wohnung. Das gesamte Interieur war in unaufdringlichen Creme-, Beige- und Brauntönen gehalten. Zusätzlich zu all diesem sorgsam gestalteten Komfort wartete sie mit einer grandiosen Aussicht auf. Man hatte die Wahl, sie entweder durch ein riesiges Fenster zu genießen, das auf das Vorderdeck hinausging, oder vom Balkon aus, der auf der Backbordseite lag.
Natürlich hatte all das seinen Preis. Aber auch wenn die Verkäufe ihrer letzten Bücher nicht gerade überwältigend gewesen waren, war Mary dank ihrer vorherigen Erfolge immer noch wohlhabend genug, um sich einen solch extravaganten Luxus gelegentlich leisten zu können.
Sie war sicher, dass es ihr hier an nichts fehlen würde. Nur im Schlafzimmer, beim Anblick des King-Size-Bettes, wurde sie kurz von Wehmut ergriffen. Sie musste an Maxwell denken, an all die Reisen, die sie gemeinsam unternommen hatten, und daran, dass sie diese Reise – ihre erste seit seinem Tod vor sechs Monaten – nun allein, ohne ihn machen würde. Aber sie verbot sich, darüber in Kummer zu verfallen. Maxwell hätte nicht gewollt, dass sie sich als gramvolle Witwe zu Hause einigelte. Außerdem wäre eine Kreuzfahrt sowieso nichts für ihn gewesen. Obwohl er als Diplomat in aller Welt unterwegs gewesen war und etliche Stunden in Flugzeugen, Zügen und Bussen verbracht hatte, war er doch selbst auf kurzen Überfahrten mit einer Fähre unvermeidbar seekrank geworden. Seinen Aufenthalt auf einem Kreuzfahrtschiff hätte er vermutlich zum überwiegenden Teil an der Reling verbracht – allerdings nicht, um versonnen auf die Wellen und den Horizont zu starren.
Mary riss sich aus ihrer Versunkenheit. Neben dem Kleiderschrank standen ordentlich aufgereiht ihre Koffer. Als spezieller Service für Passagiere ihrer Preiskategorie waren sie vom Personal der Queen Anne vom Hotel abgeholt, durch die Sicherheitskontrollen geschleust und hierher gebracht worden.
Mary ließ sie erst einmal, wo sie waren. Auspacken konnte sie auch später noch. Was sie in diesem Moment wirklich wollte, war eine kühle, belebende Dusche. Außerdem hatte sie das Badezimmer noch gar nicht besichtigt.
Sie öffnete die Tür – und erschrak. Nicht über das Badezimmer. Das entsprach vollends ihren Erwartungen. Was jedoch absolut nicht ihren Erwartungen entsprach, war die Tatsache, dass sich in diesem Badezimmer eine Frau befand. Mary war fest davon ausgegangen, in ihrer Suite allein zu sein. Jetzt musste sie erkennen, dass sie die ganze Zeit über ungeahnte Gesellschaft gehabt hatte.
Die fremde Frau hingegen erschrak überhaupt nicht. Auch sonst zeigte sie auf Marys Erscheinen hin keine nennenswerte Reaktion, wenn man von dem genervten Blick absah, den sie ihr zuwarf. Sie hatte Mary wohl längst gehört, es allerdings nicht für nötig erachtet, sich bemerkbar zu machen.
»Was machen Sie hier?«, stieß Mary in ihrer Verwunderung aus. Sie erkannte jedoch gleich, wie überflüssig diese Frage war. Schließlich war es ziemlich ersichtlich, was diese Frau hier machte: Allein ihr himmelblauer, tailliert geschnittener Arbeitsmantel wies sie als Reinigungskraft aus. Zudem hielt sie in den Händen, die in knallgelben Gummihandschuhen steckten, eine Flasche Scheuermilch und einen Schwamm, die an ihrer Tätigkeit keinen Zweifel ließen.
»Regen Sie sich bloß nicht auf«, sagte sie mit einem Akzent, den Mary nicht recht einzuordnen wusste. Sie wandte sich von Mary ab, sprühte etwas Scheuermilch ins Waschbecken und schrubbte mit dem Schwamm lustlos darin herum. »Nicht, dass Sie ’nen Herzinfarkt kriegen. Ich hab schon genug Stress heute.«
Mary brauchte einen Augenblick, um sich zu fassen. Nicht wegen des Schrecks. Vielmehr wegen des Tonfalls, in dem diese Putzfrau sie ansprach. Mit einer solchen Begrüßung durch das Schiffspersonal hatte sie nicht gerechnet.
»Sehe ich aus wie jemand, der sich aufregt?«, fragte sie schließlich betont gelassen.
»Sie sehen aus wie jemand, der sich gleich aufregen wird«, sagte die Putzfrau, über das Becken gebeugt. »Ihr regt euch doch immer auf.«
»Ihr? Wer ist ihr?«
Die Putzfrau verkniff sich eine Antwort. Stattdessen murmelte sie, mehr für sich selbst: »Ich hab schließlich noch was anderes zu tun, als euren Dreck wegzumachen. Da bin ich halt nicht immer pünktlich auf die Sekunde fertig.« Sie warf Mary einen weiteren ihrer mürrischen Blicke zu. Beinahe schien sie es ihr zu verübeln, dass sie noch immer hinter ihr stand und sie durch ihre Gegenwart belästigte. »Wollten Sie was Bestimmtes?«
Dieses Mal war Mary nicht um eine Antwort verlegen. Jetzt, wo sie ihre Verblüffung überwunden hatte, fand sie zu der Schlagfertigkeit zurück, für die sie bei Lektoren, Reportern und Literaturkritikern bekannt und von nicht wenigen gefürchtet war. Auf keinen Fall, beschloss sie, würde sie sich von dieser frechen Person auf der Nase herumtanzen lassen.
»Was Bestimmtes?«, fragte sie. »Im Badezimmer? Ich bin, offen gesagt, noch unschlüssig. Ich schwanke zwischen einer Partie Golf, einer Fuchsjagd, einer Runde Tontaubenschießen und einem Autorennen, zu dem nur Modelle mit einem Baujahr vor 1970 zugelassen sind. Was würden Sie mir empfehlen?«
Daraufhin drehte die Frau sich um und blickte sie zum ersten Mal richtig an. Wahrscheinlich nahmen die meisten Leute ihre Unverschämtheiten entweder einfach hin, weil sie von ihnen überrumpelt waren. Oder sie regten sich tatsächlich auf, keiften oder drohten ihr mit Beschwerden. Dass ihr jemand so souverän Paroli bot, war sie offenbar nicht gewöhnt. Was nicht hieß, dass es sie verunsichert hätte. Ihre wachen, bernsteinfarbenen Augen funkelten Mary streitlustig an. Sie hob sogar den Schwamm, als scheute sie selbst vor einer körperlichen Auseinandersetzung nicht zurück, obwohl sie gut einen Kopf kleiner war als Mary und sich unter ihrem Kittel, so weit erkennbar war, ein schmaler und zierlicher Körper verbarg. Um ihre Frisur bräuchte sie sich bei Handgreiflichkeiten jedenfalls keine Sorgen zu machen. Selbst wenn jemand an ihrem brünetten Haar gezerrt hätte, wäre nichts Schlimmeres dabei herausgekommen als der schlampige, zerzauste Knoten, zu dem sie es zusammengebunden hatte. Sie mochte ungefähr Mitte zwanzig sein. Das goldene Namensschild über ihrer linken Brust wies sie als Aleksandra Kaczmarek aus.
»Polnisch«, sagte sie, nachdem sie Mary einige Sekunden angestarrt hatte.
»Bitte?«, fragte Mary.
»Mein Name ist polnisch. Drum red ich so komisch. Oder so entzückend. Und ich bin voll dankbar«, leierte sie herunter, »dass ich auf so einem schnieken englischen Kutter arbeiten darf, und Sie brauchen mir nicht mehr Trinkgeld geben, nur weil ich Migrantin aus dem armen Ostblock bin, wo wir keinen Strom und kein fließend Wasser haben und es außer trocken Brot nix zu essen gibt.«
Beinahe musste Mary schmunzeln. Sie fragte sich, woher der Groll stammen mochte, den diese junge Frau in sich trug und so leidenschaftlich zum Ausdruck brachte.
Aber so unterhaltsam ihr kleines verbales Duell auch sein mochte: Sie hatte ihre Kreuzfahrt nicht gebucht, um sich mit den Angestellten herumzustreiten.
»Das trifft sich gut«, sagte sie. »Ich habe ohnehin nicht die Angewohnheit, mir von Fremden gegen Bezahlung Flegeleien an den Kopf werfen zu lassen.« Sie wies auf die offene Tür. »Wenn ich Sie dann bitten dürfte …«
»Soll ich gar nicht fertig machen?« Die Putzfrau deutete mit dem Schwamm auf das Waschbecken und versuchte nicht einmal, ihre Erleichterung zu verbergen.
»Ich will Sie keinesfalls länger belästigen«, sagte Mary. »Sie haben zweifellos Wichtigeres zu tun. Es gibt sicher noch zahlreiche andere Passagiere, denen Sie auf charmant-patzige Weise Ihre Aufwartung machen können.«
»Komm eh wieder morgen«, murmelte die Putzfrau und klaubte ihre Sachen zusammen. »Ist ja jeden Tag der gleiche Mist hier.«
»Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie wieder begrüßen zu dürfen«, beteuerte Mary.
Aleksandra Kaczmarek bedachte sie im Vorübergehen mit einem gehässigen Blick. Doch meinte Mary, darin eine gewisse Anerkennung zu erkennen, wie man sie einem ebenbürtigen Gegner gönnt.
Aber Aleksandra ließ ihr keine Zeit, sich näher damit zu befassen. Mit kurzen, energischen Schritten steuerte die kleine, zerzauste Reinigungskraft auf den Ausgang der Suite zu. Unterwegs drehte sie sich noch einmal um.
»Tät mir alles keinen Spaß machen«, sagte sie.
»Bitte?«, fragte Mary.
»Golf und Tontauben und das ganze Zeug, womit ihr vornehmen Schnösel euch die Zeit vertreibt. Ich steh auf Achterbahn.« Damit verschwand sie und knallte die Tür hinter sich zu.
Mary schüttelte lächelnd den Kopf. Von dieser Begegnung musste sie unbedingt Greta erzählen. Offensichtlich hatte ihre treue Haushaltshilfe nicht übertrieben, als sie ihr interessante Zusammentreffen mit originellen Charakteren in Aussicht gestellt hatte.
Ihr Aufenthalt an Bord ließ sich jedenfalls vielversprechend an.
3.
Am frühen Abend lichtete die Queen Anne ihre Anker. Erhaben glitt sie an Paradise Island vorbei und hinaus auf die offene See. Dort drehte sie ihren Bug nach Nordwesten, der sinkenden Sonne entgegen, in Richtung Miami.
Frisch geduscht hatte Mary nach dem Ertönen des entsprechenden Signals ihre Rettungsweste unter den Arm geklemmt und sich zur verpflichtenden Sicherheitsübung eingefunden. Mit ungleich größerem Vergnügen fand sie sich wenig später im Royal Grill Restaurant zum Dinner ein. Dessen Räume, mit goldenen Deckenleuchtern und Glasvitrinen voll edler Weine, standen ausschließlich Passagieren der Luxusklasse zur Verfügung. Trotz der frühen Stunde hatten sich bereits einige von ihnen hier eingefunden. An weiß gedeckten Tischen saßen fein gekleidete Damen und Herren auf weinrot gepolsterten Stühlen, führten gedämpfte Unterhaltungen, stießen mit Champagner auf den Antritt ihrer Reise an oder vergewisserten sich mit raffinierten Gerichten, dass in den kommenden Tagen auch ihren kulinarischen Ansprüchen Genüge getan würde. Dezente Musik untermalte die mondäne Atmosphäre. Nach Vorweisen ihrer Bordkarte wurde Mary von einem Kellner in schwarzem Smoking zu ihrem Platz geleitet.
Die Speisekarte hielt, was das Ambiente versprach. Mary wählte gebackenen Camembert mit Thymian als Vorspeise und Hühnerbrust in Himbeersenfkruste mit Gemüse-Julienne und Butterspinat als Hauptgericht. Während sie bei einem Glas trockenen Weißburgunders auf das Essen wartete, vertrieb sie sich die Zeit damit, ihre Umgebung zu sondieren. Schließlich war sie gewissermaßen dienstlich hier. Ein auffälliger Gast, ein geflüsterter Streit, ein begehrlicher Blick zwischen einem Herrn und einer Dame an getrennten Tischen konnten ausreichen, um ihre geübte Fantasie in Gang zu setzen.
Allerdings war jener Gast, der zunächst ihr Interesse weckte, überhaupt nicht auffällig. Aber eben weil er so unauffällig war, fiel er ihr auf. Er saß allein in einer Ecke, hatte sein Dinner bereits beendet und blickte durch eine klobige Hornbrille scheu um sich, als wäre er eigentlich lieber woanders. Gemeinsam mit dieser Brille verbargen schulterlanges dunkles Haar und ein dichter Vollbart beinahe sein ganzes Gesicht. Mary hörte, wie er von einem Kellner, der ihm eine Tasse Tee servierte, mit Mr. Miller angesprochen wurde.
»Das ist ja der Hammer!«, dröhnte es plötzlich vom Eingang her. »Nicht übel, der Schuppen. Na, für die Kohle, die man dafür hinblättert …«
Sämtliche Anwesende wandten sich nach der donnernden Stimme um. Die zu ihrem Besitzer mit seinem hünenhaften Körper und seinem kantigen, glatt rasierten Schädel perfekt passte. Wie ein Ochse, dem man sich besser nicht in den Weg stellt, trampelte er, geführt von einem professionell gleichmütigen Kellner, auf einen Doppeltisch zu.
An seinem Arm flatterte eine Frau hinter ihm her, die ihm höchstens bis an die Brust reichte. Im Verhältnis zu ihrer geringen Körpergröße wirkte alles andere an ihr übertrieben: Sie hatte eine zu blonde, zu üppig wuchernde Mähne. Zu große Augen unter zu langen Wimpern. Zu wulstige Lippen und vor allem eine zu ballonartig aufgepumpte Oberweite, die aus ihrem bauchfreien Top fast herausplatzte. Man musste kein Schönheitschirurg sein, um zu erkennen, dass ein erheblicher Teil davon aus Silikon bestand.
Mary schämte sich beinah dafür, zu wissen, wer die beiden waren. Die Welt jener Prominenten der Kategorien B, C oder noch tiefer zählte eigentlich nicht zu ihren Interessengebieten. Doch mit einer Haushälterin wie Greta war es schlechthin unmöglich, sich dem jeweils aktuellen Society-Klatsch zu entziehen. Sie versorgte sich damit aus den einschlägigen Illustrierten, von denen sie mehrere abonniert hatte, und konnte es sich einfach nicht abgewöhnen, auch ihre duldsame Arbeitgeberin über sämtliche Einzelheiten im Leben der ›Reichen und Schönen‹ ungebeten auf dem Laufenden zu halten.
Diesem Mitteilungsdrang verdankte Mary das Wissen, dass es sich bei diesem Rüpel um Uwe Ponger handelte. Er war ein ehemaliger deutscher Schwergewichtsboxer, der sich im Laufe seiner Karriere weniger durch Erfolge im Ring als durch Nachtklub-Schlägereien, alkoholisierte Spritztouren in seinem Ferrari und ähnliche Exzesse zweifelhaften Ruhm erworben hatte. Jetzt, mit Mitte 40, hatte er die Zeit seiner sportlichen Leistungen hinter sich gelassen. Die Arme, die aus seinem roten Muscleshirt ragten, waren zwar immer noch massiv. Über dem Bund seiner blauen Trainingshose jedoch, die zusammen mit einem Paar schwarzer Adiletten seine Abendgarderobe vervollständigte, wölbte sich der Ansatz eines Bierbauchs und zeigte, dass er nicht mehr viel Zeit damit verbrachte, sich fitzuhalten. Was sein flegelhaftes Verhalten anging, war er allerdings nach wie vor in Höchstform, wie er soeben eindrucksvoll demonstriert hatte. Diesem Verhalten sowie seiner Rolle als neuer Werbeträger des Energy-Drinks Scarlet Buffalo verdankte er es, dass er nicht wie andere abgehalfterte Ex-Stars still und leise in der Versenkung verschwunden war, sondern nach wie vor einen Dauerplatz in den Schlagzeilen der Boulevardblätter belegte.
Ächzend ließ er sich in einen der Stühle fallen und zog sich seine zurechtoperierte Gefährtin auf den Schoss.
»Was meinste, Baby?«, fragte Ponger. »Kann man’s hier aushalten, oder was?«
»Mit dir halt ich es überall aus, Uwe-Schnucki«, quietschte sie, legte einen Arm um ihn und spielte mit der Goldkette, die um seinen Hals hing und an der, als sei sie nicht schon protzig genug, ein Dollarzeichen mit glitzernden roten Steinen baumelte.
Zu Marys Bedauern war ihr dank Greta auch dieses Geschöpf bekannt, das geldgierige Chirurgen gestaltet oder besser verunstaltet und das Modedesigner gekleidet hatten, denen für ihre Kreationen offenbar der Stoff ausgegangen war. Sie war in ihren frühen Zwanzigern, stammte angeblich aus Slowenien und hieß höchstwahrscheinlich nicht Honey Hot, nannte sich aber so. Sie gehörte zu dieser neuen Generation von Prominenten, die man als It-Girl bezeichnet. Ihre Bekanntheit erwarb und pflegte sie dadurch, dass sie jede noch so belanglose Begebenheit ihres Lebens in dilettantischen Fotos oder verwackelten Videos über Social-Media-Plattformen einer breiten Weltöffentlichkeit zugänglich machte. Zu Marys Bedauern – und vollkommenem Unverständnis – gab es allem Anschein nach genügend Leute, die sich an diesen Banalitäten ergötzten – oder zumindest an Honey Hots aufgeblasenen und spärlich verhüllten Brüsten. Auch jetzt fischte sie aus ihrem paillettenbesetzten Täschchen ein mit Herzchen beklebtes Smartphone und filmte Ponger, wie er nach der Speisekarte grapschte.
»Mal schauen«, grunzte er mit seinem plumpen Akzent, »was die Küchensklaven so zusammenpanschen. Mir hängt der Magen schon bis zu den Fersen! Jetzt aber happa-happa!«
Auch diese beiden gehörten eindeutig in die Kategorie ›originelle Charaktere‹. In diesem Fall jedoch hätte Mary auf ihre Gesellschaft gerne verzichtet.
Offenbar war sie mit dieser Meinung nicht allein. Eine andere Dame, die wenige Tische entfernt und somit in direkter Sicht- und Hörweite des nervtötenden Gespanns saß, wirkte ebenfalls peinlich berührt. Trotz der dunklen Sonnenbrille, hinter der sie ihre Augen verbarg, erkannte Mary – Greta sei Dank – in ihr die amerikanische Schauspielerin Jill Benny. Mit ihrer fuchsroten Kurzhaarfrisur, dem blassen Teint und den feingliedrigen Händen, die an zerbrechliches Porzellan erinnerten, war sie eine zu einprägsame Schönheit, um einer aufmerksamen Beobachterin wie Mary zu entgehen. Sie hatte eine beeindruckende Hollywoodkarriere durchlaufen, die in den letzten Jahren jedoch ins Stocken geraten war. Kein Wunder, sie ging auf die 50 zu, womit sie nach den Maßstäben der Traumfabrik zum alten Eisen gehörte.
Vor Kurzem hatte sie den Boulevard in Entzücken versetzt, indem sie sich nach nur einjähriger Ehe vom Hollywoodstar Johnny Carr hatte scheiden lassen. Carr war als Gewalttäter verschrien, der sich mehrmals an Paparazzi, Autogrammjägern und auch Freundinnen und Ehefrauen vergriffen hatte. Laut Greta hatte Jill Benny sich genau aus diesem Grund von ihm getrennt. War sie deshalb auch auf diesem Schiff? Unternahm sie, und wie es aussah allein, eine Kreuzfahrt, um sich von den Turbulenzen ihrer Scheidung zu erholen?
Marys Essen kam und schmeckte so vorzüglich, dass nicht einmal Pongers Gepolter und Honey Hots Gekicher ihr diesen Genuss verderben konnten. Nach dem Abservieren bestellte sie einen Espresso und kramte aus ihrer Umhängetasche ein schlichtes schwarzes Moleskine-Notizbuch und einen edlen Montblanc-Federhalter. Es waren die Arbeitsgeräte, mit denen sie stets die ersten Entwürfe ihrer Romane erstellte. Die Bilanz der Beobachtungen, die sich als Ausgangspunkt einer Krimihandlung eignen könnten, war für den Anfang gar nicht schlecht. Die PUTZFRAU, schrieb Mary auf eine neue Seite. Polin. Sehr umgangssprachliches, aber fließendes Englisch. Streitlustig, dabei patent.
Sie hatte erst wenige weitere Zeilen geschrieben, als eine angenehme Männerstimme sie aus ihrer Konzentration riss: »Verzeihen Sie die Unterbrechung, Gnädigste«, sagte die Stimme. »Aber gehe ich recht in der Annahme, dass Sie sich Notizen über die hier versammelte Gesellschaft machen? Und sollte ich mit dieser Vermutung richtigliegen: Habe auch ich unter Umständen die Ehre, in diesen Notizen aufzutauchen?«
Mary blickte auf – und zwar geradewegs in ein Paar ozeanblauer Augen, die ihr mit einnehmender Heiterkeit entgegenblitzten. Das dazugehörige verschmitzte Lächeln fand sich unter einem weißen Oberlippenbart. Dieser wiederum passte perfekt zu dem weißen Haar, dessen liebenswerte Wirbel jeder Bändigung durch einen Kamm zu trotzen schienen.
»Wie kommen Sie darauf«, fragte sie und legte, aus unbewusster Gewohnheit, eine Hand über die Seite des Buches, »es sei eine Ehre, darin aufzutauchen?«
Einem anderen gegenüber hätte sich Mary diese Störung verbeten. Bei diesem entwaffnenden Charme aber konnte sie ihm die Unterbrechung nicht übel nehmen. Zumal es sich auch bei ihm um eine bekannte Persönlichkeit handelte – und im Gegensatz zu Ponger einer der angenehmen Sorte. Die Art, in der er wie aus dem Nichts vor ihrem Tisch aufgetaucht war, wäre eines Zauberkünstlers würdig gewesen – und Sir Cedric Hawthorne war nicht nur ein Zauberkünstler: Er war für seine legendären magischen Kräfte sogar von der Queen geadelt worden. Er war so etwas wie ein britisches Nationalheiligtum. Und zwar, wie Mary nun aus unmittelbarer Nähe feststellen durfte, ein überaus stattliches Nationalheiligtum, groß, breitschultrig und für seine Mitte 60 in bewundernswert sportlicher Verfassung.
Auch an Humor schien es ihm nicht zu fehlen. Auf Marys Frage hin wurde sein Lächeln jedenfalls noch ein wenig verschmitzter.
»Aber ich bitte Sie, Madam«, sagte er. »Im Entwurf eines neuen Romans von Mary Elizabeth Arrington vorzukommen – das wäre sogar eine Ehre, wenn ich in der Geschichte als der Bösewicht herhalten müsste. Wenn Sie mir freilich die Wahl ließen, Teuerste, würde ich die Rolle des Detektivs bevorzugen. Mord entspricht schlichtweg nicht meinem Naturell, wissen Sie? Außerdem hätte sich der gute Stuart Smith nach den Strapazen in Tod in Taormina doch eine Auszeit verdient. Finden Sie nicht?«
»Wollen Sie damit andeuten, er habe in meinem letzten Buch müde gewirkt?« Mary erwiderte sein Lächeln. Obwohl ihr bei diesem Gedanken gar nicht nach Lächeln zumute war.
»Keineswegs«, beschwichtigte Sir Cedric. »Stuart Smith war amüsant wie eh und je. Wobei ich gestehen muss, dass ich ihn lieber mochte, als er noch nicht mit der Polizei zusammenarbeitete. Als er selbst noch ein echter Gauner war. Das war irgendwie romantischer.«
Darüber würde Mary nachdenken müssen. »Jedenfalls fürchte ich«, sagte sie, »dass Sie sich zum Detektiv nicht recht eignen. Sie wären Ihren Gegenspielern einfach zu überlegen. Ein Detektiv, der jederzeit eine Waffe herbeizaubern kann … Der sich in brenzligen Situationen kurzerhand in Luft auflöst und durch Wände geht … Der wäre für den Leser nicht sehr spannend.«
»Ach, das sind doch nur einfache Bühnentricks. Die auch nur auf einer Bühne funktionieren.«
»Ich sah Ihre letzte Show, in der Royal Albert Hall. Zwei Stunden lang hatte ich den Eindruck, die Naturgesetze wären schlichtweg aufgehoben. Von wegen einfach …«
»Letztendlich ist es einfach«, beteuerte er. »Selbst der verblüffendste Trick funktioniert nach einem simplen Prinzip: Lenke die Aufmerksamkeit des Publikums aufs Unwesentliche, damit es das Wesentliche nicht bemerkt.«
Interessant, dachte Mary und lachte. Nach demselben Prinzip funktionieren Detektivgeschichten. »Wenn es denn so einfach ist, werde ich demnächst auch mit einer Zaubershow auftreten. Und wenn Sie sich Magic Cedricnennen, könnte ich mich …«
»… Magic Marynennen«, ergänzte er und lachte mit. Dabei entstand auf seinem gebräunten Gesicht eine Anordnung aus sympathischen Falten und Grübchen. »Reservieren Sie mir gleich ein Ticket?«
4.
Mary fuhr aus unruhigem Schlaf auf. Wie immer, wenn sie nicht in ihrem Westflügel in Sussex übernachtete, wusste sie zunächst nicht, wo sie war. Dann fiel ihr alles wieder ein: Die Queen Anne, die Trafalgar Suite,das Bett, das groß genug war für zwei – und in dem sie dennoch allein lag, ohne Maxwell. Sie schaute nicht neben sich und lauschte nicht nach seinem Atem, wie sie es nach seinem Tod noch monatelang getan hatte. Sie waren 33 Jahre verheiratet gewesen. Es fiel ihr schwer, sich daran zu gewöhnen, dass er nicht mehr neben ihr schlief.
Die Uhr auf dem Smartphone zeigte eine halbe Stunde nach Mitternacht. Ortszeit, irgendwo auf dem Meer, zwischen den Bahamas und Florida. Warum war sie aufgewacht? Es war nicht dieses normale Aufwachen gewesen, wie es ihr manchmal passierte. Es hatte irgendeinen Grund gegeben. Aber gerade konnte sie ihn nicht bestimmen. Es war nichts zu hören außer dem leisen, kaum wahrnehmbaren Brummen der Maschinen und dem leisen Schlag der Wellen gegen den Schiffsrumpf.
Mary blickte zur Decke und spürte die sachten Bewegungen der Queen Anne, die sie kraftvoll, dabei sanft über die gewaltigen Wassermassen trug. Sie fragte sich, wo sie wohl waren, wie viele Kilometer sie schon zurückgelegt hatten. Aber bald, ohne dass sie es hindern konnte, wanderten ihre Gedanken zurück zu dem köstlichen Dinner und zur Unterhaltung mit Sir Cedric. Er hatte ihr erzählt, dass auch für ihn diese Kreuzfahrt eine Premiere sei. Letztes Jahr sei er nicht nur Dutzende Male über die Bühne der Royal Albert Hall stolziert, gewirbelt und nicht zuletzt geschwebt, auch bei zahlreichen Auftritten auf dem europäischen Festland, den USA und sogar Japan habe er seine magischen Künste zur Aufführung gebracht.
Da es auf Dauer ziemlich anstrengend sei, sich zu zersägen und wieder zusammenzusetzen, durch Mauern zu gehen, sich in Wassertanks aus Zwangsjacken zu befreien und Lokomotiven in Luft aufzulösen, war es nach einer solchen Tournee seine Gewohnheit, sich einen ausgiebigen Urlaub zu gönnen. Er wählte dazu stets einen Ort, an dem ihm weder sein Manager noch Journalisten oder eifrige Zauberlehrlinge auflauern konnten, die ihm seine Geheimnisse entlocken wollten. Auf einem Schiff mitten auf dem Ozean fühlte er sich vor ihren Nachstellungen einigermaßen sicher. Zudem sei das eine tolle Gelegenheit für eine neue Erfahrung. Er reise für gewöhnlich allein. Für eine solche Fahrt hätte er allerdings ohnehin nicht die passende Begleitung gehabt, da er Junggeselle sei. Das ›Jung‹ in diesem Ausdruck sei allerdings ziemlich irreführend, hatte er mit seinem schalkhaften Lächeln zugefügt, diesem Lächeln, das Mary so gefallen hatte und das …
Aber weiter kam sie nicht. Ein Geräusch störte sie aus ihren Gedanken auf. Mary richtete sich auf und lauschte. Das musste es sein, was sie aufgeweckt hatte … Ein Weinen, das die nächtliche Ruhe unterbrach. Es musste einen Moment ausgesetzt haben. Jetzt aber war es wieder da. Zunächst war es nur als Wimmern zu vernehmen. Dann aber steigerte es sich in ein heftiges Schluchzen, laut genug, die Kabinenwände zu durchdringen. Es war das verzweifelte, qualvolle Schluchzen einer Frau, und es gab nur einen Ort, von dem es kommen konnte: die Piccadilly Suite.
Mary überlegte, was sie tun sollte. Ob sie überhaupt etwas tun sollte. Hinübergehen, an die Tür klopfen und Hilfe anbieten? Oder würde sie damit eine ohnehin schon bedauernswerte Frau zusätzlich in Verlegenheit bringen? Das Weinen hörte sich nicht an, als befände die Frau sich in physischer Not. Es klang eindeutig nach seelischer Not. Vielleicht hatte sie einen erschütternden Anruf, eine niederschmetternde Nachricht erhalten: ihre Krankheit war unheilbar, ihre Mutter war gestorben, ihr Geliebter hatte sie betrogen …
Mary schlug die Bettdecke zurück. Sie wollte der Frau ihre Hilfe anbieten, wer immer sie sein mochte und was auch immer sie so erschüttert hatte. In dem Moment aber erstarb das Schluchzen. Mary lauschte noch eine Weile, doch es erklang nicht von Neuem. Vielleicht ist es auch besser so, dachte Mary. Sich in fremde Angelegenheiten einzumischen, hatte sie schon mehr als einmal in Schwierigkeiten gebracht, und Mary war nicht an Bord gekommen, um in Schwierigkeiten zu geraten. Sie versuchte, wieder einzuschlafen. Doch in seinem Dämmerzustand konnte ihr Gehirn, das Gehirn einer Schriftstellerin, gar nicht anders, als sich weitere Ursachen für das Leid jener Frau auszumalen.
5.
Am nächsten Morgen lag die Queen Anne vor Miami. Bescheiden hatte sie sich diesmal den anderen Schiffen angeschlossen, die am kilometerlangen Kai von Dodge Island hintereinander aufgereiht standen. Dodge Island war eine der Stadt vorgelagerte, hässlich zweckmäßige Betoninsel. Wer auf der Steuerbordseite der Queen Anne stand,blickte in der Ferne auf Kräne zwischen blauen und roten Containern und in der Nähe auf klotzige Verwaltungsgebäude zwischen Parkplätzen und Lagerhallen.
Doch als Mary im Morgenmantel auf ihren Balkon an der Backbordseite trat, bot sich ihr ein ungleich erfreulicherer Anblick. Durch die schillernde Wasserfläche der Biscayne Bay erstreckte sich eine von Palmen gesäumte Straße vom Festland hinüber nach South Beach. Das von roten Hausdächern durchbrochene Grün von Palm Island schimmerte unter der Morgensonne. Der beinah wolkenlose Himmel verhieß einen herrlichen Tag.
Trotzdem hatte Mary nicht vor, an Land zu gehen. Schließlich unternahm sie diese Reise nicht, um Orte zu besichtigen. Sie war auf der Queen Anne, um die Gepflogenheiten auf einem solchen Schiff kennenzulernen, und die verborgenen Dramen, die sich darauf unzweifelhaft ereigneten.
Nur für Jamaika würde sie eine Ausnahme machen. Dort hatte sie zu Beginn ihrer Ehe einige ihrer glücklichsten Jahre verbracht. In Kingston hatte Maxwell als Diplomat im Dienst des britischen Generalgouverneurs gestanden. Und Mary hatte, mit brieflicher und telefonischer Unterstützung von Mr. Bayle, Killer in Kingston geschrieben, ihren zweiten Roman um Stuart Smith. Seit damals war sie nicht mehr auf Jamaika gewesen. Die Möglichkeit, es nach so langer Zeit wiederzusehen, war einer der Gründe, warum sie sich unter all den angebotenen Kreuzfahrtrouten für die Karibik entschieden hatte.
Unter der Dusche dachte sie an das nächtliche Schluchzen, das sie wohl nicht so bald aus ihrem Kopf bekommen würde. Sie nahm sich vor, zumindest in Erfahrung zu bringen, wer die Piccadilly Suitebewohnte.
Und sie fand es heraus, auf die unverhofft einfachste Weise.
Als sie ihre Suite verließ, um im Royal Grill Restaurant zu frühstücken, zog auch ihre Nachbarin gerade die Tür hinter sich zu. Es war Jill Benny, in einem schlabbrigen grauen Jogginganzug, der weder zur ihrer teuren Designertasche noch überhaupt zu einem Hollywoodstar passte, der schließlich immer damit rechnen musste, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Jill Benny aber schien in einem Zustand zu sein, in dem es sie nicht kümmerte, wie sie aussah und was andere darüber dachten. Sie war blass und ungeschminkt und hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, sich die Haare zu kämmen. Sie wirkte noch zerbrechlicher als gestern, während sie fahrig in ihrer Handtasche wühlte. Als sie Mary bemerkte, zuckte sie regelrecht zusammen.
»Guten Morgen«, sagte Mary lächelnd.
Jill murmelte etwas, versteckte ihre geröteten Augen hastig hinter der Sonnenbrille, die sie aus der Tasche gekramt hatte, und eilte durch Foyer und Korridor davon. Vor dem Lift wartete sie nicht auf Mary, wie es die Höflichkeit geboten hätte, sondern verschwand fluchtartig damit in die Tiefe.
Beim Betreten des Restaurants stellte Mary erleichtert fest, dass von dem unsäglichen Ex-Boxer und seiner Begleiterin, die am Abend grobschlächtig für missbilligende Blicke und gerunzelte Stirnen gesorgt hatten, weit und breit nichts zu sehen war. Und vor allem nichts zu hören. Einem geruhsamen Frühstück stand also nichts im Wege. Auch Sir Cedrics Tisch war leer. Mr. Miller hingegen beugte sich in seiner Ecke tief über seine Teller und senkte jedes Mal den Blick, wenn Mary zu ihm hinüberschaute.
Ähnlich verhielt sich Jill, die ganze Zeit, während sie frühstückte. Sofern man das als Frühstücken bezeichnen konnte. Nach wie vor mit Sonnenbrille im Gesicht, stocherte sie nur nervös in ihrem Omelette herum, anstatt etwas davon zu sich zu nehmen. Ihre Lippen zuckten, und ihre Hand umklammerte die Gabel so fest, dass die Knöchel hervortraten. Als der Kellner ihr von der Seite her Kaffee servierte, kippte sie vor Schreck den Orangensaft um.
Keine Frage, dachte Mary. Das ist die Frau, die letzte Nacht so verzweifelt geweint hat. Die Schauspielerin Jill Benny hat ein ernstes Problem. Aber welches? Hatte es mit ihrer Trennung zu tun? Solche Angelegenheiten nahmen schließlich jeden mit. Mary brach ihre Überlegungen ab, um sich ganz ihrem Frühstück zu widmen. Die Spiegeleier waren auf den Punkt gebraten, der Speck knusprig, der Kaffee und die Brötchen heiß, der Ananassaft frisch gepresst und kühl. Es wäre schade gewesen, all das nicht zu genießen, weil man sich in Grübeleien verstrickte, die ohnehin zu nichts führten. Sie würde sich auch später noch mit ihrer unglücklichen Kabinennachbarin befassen können.
Doch kaum dass Mary ihr Frühstück beendet hatte, trat Jill, mit sichtlicher Überwindung, an ihren Tisch. Ihre Finger zitterten, als sie die Sonnenbrille hinauf in ihr struppiges Haar schob. Nun sah Mary deutlich die roten Äderchen in ihren verheulten Augen und die tiefen Furchen darunter.
»Verzeihen Sie«, begann Jill mit dünner Stimme, »aber sind Sie nicht diese Krimischreiberin?«
Mary musste sich zusammenreißen, um nicht zu entgegnen: Nein! Ich bin weder diese noch sonst eine Krimischreiberin! Ich bin eine Schriftstellerin, die Kriminalliteratur schreibt! Stattdessen antwortete sie freundlich: »Das hängt davon ab, welche Sie meinen.«
»Oh, Verzeihung …«, stammelte Jill. »Ich wollte nicht … Und ich will Sie auch nicht belästigen, aber … Sie schreiben doch diese … Stuart-Smith-Bücher, nicht wahr?«
»Ja. Diese Krimischreiberin bin ich. Und Sie«, Mary bemühte sich, unmissverständlich scherzhaft zu klingen, »sind diese Schauspielerin, nicht?«
»Wow.« Jill lächelte zum ersten Mal, wenn auch ein wenig bitter. »Man erkennt mich also doch noch. Wobei … Nach all dem, was passiert ist, erkennen mich wahrscheinlich viel mehr Leute als früher. Nur dass die nicht unbedingt ein Autogramm von mir wollen. Ich meine, nichts ist packender als hässliche Trennungsgeschichten, über die man …« Sie unterbrach sich, beinahe gewaltsam, schien es. »Jill Benny.«
Mary drückte ihre Hand, die kalt und winzig war, und bot ihr einen Stuhl an. Jill betrachtete sie, als sei sie unschlüssig, ob sie sich wirklich auf eine Unterhaltung mit Mary einlassen sollte oder es nicht ein Fehler gewesen war, sie anzusprechen. Sie blickte zur Tür und schien mit dem Gedanken zu spielen, ein weiteres Mal ohne ein Wort die Flucht zu ergreifen. Dann aber fasste sie sich ein Herz.
»Ich wollte … mich entschuldigen«, sagte sie, während sie sich setzte. »Wegen vorhin. Ich hab nicht gewusst, dass … neben mir jemand wohnt und …«
»Es besteht keinerlei Anlass für eine Entschuldigung.«
Die Gedanken hinter dem Blick, den Jill ihr nun zuwarf, las Mary, als stünden sie ihr auf der Stirn geschrieben: Hat sie mich heute Nacht gehört? Hat sie meine Verzweiflung und meinen Schmerz mitbekommen?
»Und dann wollte ich noch …«, fuhr Jill fort, »Ich möchte natürlich nicht … Aber waren Sie schon mal in Miami?«
»Ja. Vor langer Zeit.«
Wiederum las Jill forschend in ihrem Gesicht, wiederum schien sie in einem inneren Zwiespalt mit sich zu ringen – und wiederum entschied sie letzten Endes, dass sie es wagen durfte, ihr zu vertrauen.
»Würden Sie … Ich war noch nie dort. Dürfte ich … mich Ihnen anschließen, heute?«
Mary war verwundert über diese Bitte, aber nicht nur über die Bitte selbst. Der Blick, mit dem Jill sie vortrug, war nicht der Blick einer Frau, die um eine Stadtführung bittet oder sich für einen Ausflug lediglich ein wenig Gesellschaft zur Unterhaltung wünscht. Diese großen flackernden Augen baten unmissverständlich um Hilfe. Vielleicht sogar um Schutz. Oder eigentlich baten sie nicht. Sie flehten, voller Kummer und ja, dachte Mary, auch voller Angst. Innerhalb einer Sekunde verwarf Mary sämtliche Pläne für den heutigen Tag. Nicht nur, dass sie nach wie vor neugierig war, zu erfahren, was Jill Benny nachts umtrieb. Wenn sie sich in ihrer Verzweiflung sogar an eine Wildfremde wandte, musste es wirklich schlimm um sie stehen, und Mary hätte es nicht über sich gebracht, sie abzuweisen.
»Aber selbstverständlich«, sagte sie. »Es wäre mir ein Vergnügen.«