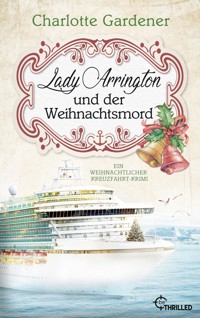5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Mary Arrington
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Mary Elizabeth Arrington freut sich, auf die Queen Anne zurückzukehren! Doch schon beim Eröffnungskonzert wird ihre Freude getrübt. Der Pianist ruiniert den Abend, indem er den Auftritt der Operndiva Anastasia Botticelli mit einem vollkommen falschen Lied übertönt. Noch in derselben Nacht wird der Musiker tot aufgefunden - erdolcht an seinem Klavier! Erneut steckt Krimi-Autorin Mary mitten in einem echten Mordfall - und gerät diesmal selbst ins Visier des Mörders. Zum Glück kann sie sich diesmal nicht nur auf die tatkräftige Hilfe ihres Zimmermädchens Sandra und ihres Lektors Mr. Bayle verlassen - sondern auch auf die des attraktiven Kapitäns.
Nach "Lady Arrington und der tote Kavalier" der zweite Krimi mit Mary Elizabeth Arrington! Ein klassischer Whodunit-Krimi auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff vor herrlich maritimer Kulisse! Hier trifft "Mord ist ihr Hobby" auf "Traumschiff". Für Krimi-Fans und Leser von Feel-Good-Romanen. Die perfekte Lektüre für den Urlaub - oder um sich an grauen Regentagen in Urlaubsstimmung zu bringen.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Weitere Titel der Autorin
Lady Arrington und der tote Kavalier
Über dieses Buch
Mary Elizabeth Arrington freut sich, auf die Queen Anne zurückzukehren! Doch schon beim Eröffnungskonzert wird ihre Freude getrübt. Der Pianist ruiniert den Abend, indem er den Auftritt der Operndiva Anastasia Botticelli mit einem vollkommen falschen Lied übertönt. Noch in derselben Nacht wird der Musiker tot aufgefunden – erdolcht an seinem Klavier! Erneut steckt Krimi-Autorin Mary mitten in einem echten Mordfall – und gerät diesmal selbst ins Visier des Mörders. Zum Glück kann sie sich diesmal nicht nur auf die tatkräftige Hilfe ihres Zimmermädchens Sandra und ihres Lektors Mr. Bayle verlassen – sondern auch auf die des attraktiven Kapitäns.
Über die Autorin
Charlotte Gardener ist eine englische Autorin. Nachdem sie mehr als dreißig Jahre in London am Theater gearbeitet hat, ist sie nun ins wunderschöne Brighton zurückgekehrt, den Ort ihrer Kindheit. Hier hat sie auch endlich die Ruhe gefunden, um ihr Hobby zum Beruf zu machen: das Schreiben von Kriminalromanen. Und wenn sie nicht gerade in einem kleinen Café an einem ihrer Romane tüftelt, liebt sie es, mit ihrem Hund Scofield lange Spaziergänge am Strand zu unternehmen.
Charlotte Gardener
Lady Arringtonund die tödliche Melodie
EINKREUZFAHRT-KRIMI
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Stephan Trinius
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: AKaiser | VladisChern | Aleksandra Vologzhina und © iStockphoto
E-Book-Produktion: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7325-7732-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1
»Die Lösung ist ganz einfach: Sie müssen wieder reisen, Mary!«
»Was für ein hanebüchener Unsinn!«, schimpfte Mr. Bayle. »Eine Reise ist nun wirklich das Letzte, was Mrs. Arrington in einer solchen Krisensituation unternehmen sollte.«
»Nichts Unsinn. Mary geht uns ja noch ein, wenn sie immer nur in diesem zugigen alten Gemäuer hockt. Daher kommt doch das ganze Elend überhaupt nur. Sie muss mal wieder an die Luft, unter Menschen, was erleben.«
Greta unterstrich ihre Worte mit einem resoluten Schwung ihres Staubwedels, obwohl weder Flusen noch Spinnweben oder sonstiger Schmutz zu beseitigen war. Marys Studier- und Schreibzimmer war wie üblich tadellos sauber, schließlich war es der erste aller Räume, den sich Greta bei ihren täglichen Reinigungsgängen durch das Anwesen vornahm. Aber wenn Greta mitbekam, dass sich Mary mit ihrem Lektor Mr. Bayle eben dorthin für ein Gespräch zurückzog, fiel ihr unvermeidlich ein, wie dringend die zahllosen ledergebundenen Bücher in den Regalen abgestaubt und der antike Globus poliert werden musste. Gretas Blick fiel auf den alten Perserteppich am Boden. Sollte diese Unterhaltung nicht endlich die von ihr gewünschte Wendung nehmen, würde sie zum Staubsauger greifen, um mit dessen zuverlässiger Lautstärke besagter Unterhaltung ein Ende zu setzen.
»Ganz im Gegenteil«, erwiderte Mr. Bayle indes. »Die einzig annehmbare Herangehensweise besteht darin, sich nicht von der Stelle zu rühren und, anstatt kindischen Fluchtimpulsen nachzugeben, die Hindernisse mit Mut, Tatkraft und Durchhaltevermögen zu überwinden.«
Marys langjähriger Ansprechpartner und Förderer beim Verlag Fitch & Finnegan saß vollkommen ruhig in einem der Ledersessel, die vor den mit Büchern vollgestopften Regalen eine Sitzgruppe um den Beistelltisch bildeten. Seine Sitzhaltung war ebenso tadellos wie sein Tweed-Anzug mit dem Karo-Muster und sein schwarzgrauer Scheitel über den silberglänzenden Schläfen. Jede andere Person nötigten die Sessel geradezu zur Bequemlichkeit. Nicht aber Mr. Bayle. Auf seine unnachahmliche Weise gelang es ihm, darin jene aufrechte, etwas steife Positur zu bewahren, die ihm die britische Etikette gebot – vor allem, wenn er sich in Gesellschaft zweier Damen befand. In diesem Fall hätte Mr. Bayle selbst den Begriff Dame wohlweislich in der Einzahl verwendet und ihn ausschließlich auf seine Gastgeberin bezogen. Für Greta hielt er andere, weniger schmeichelhafte Bezeichnungen parat.
Mary räusperte sich und zog damit die Blicke der beiden Streithähne auf sich, deren Schlagabtausch sie hinter der schützenden Barriere ihres Schreibtisches beigewohnt hatte. Bis zu diesem Moment hatte Mary es tunlichst vermieden, sich in die Auseinandersetzung einzumischen. Wenn Mr. Bayle und Greta erst mal aneinandergerieten, war es nicht besonders ratsam, sich in die Schusslinie zu begeben. Vor allem nicht, wenn man selbst Gegenstand ihrer verbalen Scharmützel war. Die beiden miteinander zu versöhnen, war wie immer so gut wie aussichtslos. Doch nun musste Mary einschreiten. Schließlich ging es hier um Belange von höchster Wichtigkeit. Da konnte sie nicht einfach zusehen, wie Mr. Bayle und Greta sich in ihr übliches Patt hineindiskutierten. Mary seufzte innerlich. Sie fand es wenig reizvoll, es sich wahlweise mit ihrem Lektor oder ihrer altgedienten Haushaltshilfe zu verderben. Sowohl das eine wie auch das andere könnte mit mehr als unangenehmen Konsequenzen einhergehen. Sie musste also sehr behutsam vorgehen.
»Mein lieber Mr. Bayle«, begann sie. »So sehr ich für gewöhnlich auch bereit bin, Ihrem von Sach- und Menschenverstand geprägten Urteil zuzustimmen, plagen mich doch unter den gegebenen Umständen arge Zweifel, was die Durchführbarkeit Ihres Vorschlages anbelangt.«
Mr. Bayle wollte schon zu einem Gegenargument ansetzen, doch Mary war schneller. »Vielmehr muss ich gestehen, dass meine Tatkraft und mein Durchhaltevermögen sich ihrem Ende nähern, und auch mein Mut, fürchte ich, im Schwinden begriffen ist. Um es auf den Punkt zu bringen: Ich komme einfach nicht voran.«
Mit einer resignierten Geste wies sie auf das Manuskript, das vor ihr auf dem glänzend gewienerten und edel gemaserten Eichentisch lag, an dem sie ihrer schriftstellerischen Tätigkeit nachzugehen pflegte. In den letzten Wochen nun war diese Arbeit mehr und mehr ins Stocken geraten. Und schließlich gänzlich zum Stillstand gekommen. Stundenlang hatte sie in den vergangenen Tagen vor ihrem Laptop gesessen und auf den Bildschirm gestarrt, von wo aus der Cursor sie hämisch anblinkte. Schließlich hatte sie den bisher entstandenen Text ausgedruckt in der Hoffnung, das Blättern in den Seiten, Korrekturen, Unterstreichungen, Ergänzungen, die schiere Bewegung des Stiftes auf dem Papier würden ihr einen neuen Zugang zu ihrer Geschichte eröffnen. Die Hoffnung hatte sich nicht erfüllt. Es war ihr einfach nicht gelungen, den Schreibprozess wieder in Gang zu bringen.
»Es muss also etwas passieren. Und eine Reise könnte mir tatsächlich aus dieser Misere heraushelfen.«
Greta reckte ihren Kopf mit dem blonden Dutt, vor dem eine weiße Haube saß, und warf Mr. Bayle einen siegessicheren Blick zu. Gleichzeitig drohte sie ihm mit dem Staubwedel, als wollte sie ihm für jeden weiteren Einwand jene rigorose Behandlung mit ihrem Reinigungsinstrument angedeihen lassen, die sie sonst den Bücherrücken zukommen ließ. Greta war eine große Frau, deren üppige Formen ihre blaue Uniform mit der weißen Schürze selbstbewusst ausfüllten. Ihre Erscheinung war von Natur aus eindrucksvoll, und wenn sie es darauf anlegte, gar einschüchternd. In dieser Pose vollkommener Überlegenheit, in der sie nun auf ihren Rivalen herabsah, wirkte Greta besonders stattlich — und wie jemand, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte.
Für einen kurzen Moment sah es tatsächlich so aus, als würde Mr. Bayle unter ihrem strengen Blick seine stramme Haltung aufgeben und nun doch so tief wie möglich in seinen Sessel sinken. Doch er weigerte sich, vor ihr einzuknicken. Stattdessen ließ er einen Laut vernehmen, der irgendwo zwischen einem tiefen Seufzen und einem dunklen Grummeln angesiedelt war. Ein Laut, zu dem ihn niemand so verlässlich verleitete wie Greta. Mehr als einmal hatte Mr. Bayle Mary nahegelegt, diese impertinente Person doch um Gottes willen endlich aus dem Herrenhaus zu entfernen und sie durch einen traditionellen Butler zu ersetzen, der nur in Erscheinung trat, wenn man ihn auch wirklich brauchte, und der sich den Gästen gegenüber mit Respekt betrug und seine Äußerungen auf ein diskretes »Yes, Madame« und »Certainly, Sir« beschränkte, anstatt zu allem ungebeten seinen Senf dazuzugeben. All sein Frust darüber, dass sein Bemühen bis heute ohne Erfolg geblieben war, kam in jenem brummigen Seufzen zum Ausdruck.
»Es muss also eine Reise sein, ja?«, sagte er und trank einen Schluck Tee aus der Porzellantasse mit dem dezenten Blumenmuster. »Gut, dann eben eine Reise.«
Ein Geistesblitz hellte sein Gesicht auf.
»Wie Sie wissen, besitze ich ein kleines Cottage in Wales. Eine herrliche Landschaft, frische Luft, Ruhe. Und aufgrund der übersichtlichen Räumlichkeit lässt sich die Haushaltsführung ganz ohne fremde Hilfe bewerkstelligen. Sie könnten sich, werte Mrs. Arrington, daher ohne jedwede Störung«, er warf Greta einen vielsagenden Seitenblick zu, »oder Belästigung durch penetrante Gesellschaft auf die Fertigstellung Ihres Manuskriptes konzentrieren, dessen Abgabetermin, wenn ich das bemerken darf, in nicht allzu weiter Ferne liegt. Schön. Wie mir scheint, haben wir die perfekte Lösung für all Ihre Schwierigkeiten gefunden.«
Er stellte seine Tasse zurück auf den niedrigen orientalischen Tisch neben seinem Sessel, griff nach einem der Gurkensandwiches, die auf einer Etagere angerichtet waren, biss hinein und kaute zufrieden, als sei das letzte Worte damit gesprochen. Auch wenn er eine innige Feindschaft mit Greta pflegte, hinderte ihn diese nicht daran, sich an den köstlichen Häppchen gütlich zu tun, für deren Zubereitung sie berühmt war. Seine Miene verleugnete keineswegs den Genuss, den er beim Verzehr verspürte. Zugleich tat sie jedoch kund, wie viel besser es ihm in Gretas Abwesenheit gemundet hätte. Das Liebste wäre ihm gewesen, Greta hätte sich, nachdem sie die Leckereien und den Earl Grey in der silbernen Kanne serviert hatte, schnurstracks ans andere Ende des geräumigen Herrenhauses begeben. Oder wenigstens außer Hörweite.
»Nun ja«, ergriff Mary das Wort und tippte mit einem Federhalter auf ihrem bekritzelten, widerspenstigen Manuskript herum. »Das wäre eine Möglichkeit, um mal wieder rauszukommen, ohne gleich eine lange Zugfahrt oder einen Flug auf mich nehmen zu müssen. Und eine gewisse Abgeschiedenheit ohne jegliche Ablenkung könnte meiner Arbeit tatsächlich guttun.«
Mr. Bayle gelang es, mit vollem Mund ein triumphales Lächeln aufzusetzen. Er hatte seine staubwedelnde Widersacherin in ihre Schranken gewiesen.
Doch im selben Moment belehrte sie ihn eines Besseren.
»Nichts da, Cottage«, brauste Greta auf. Als langjährige Angestellte des Hauses Arrington hatte sie ja wohl ein Stimmrecht! Und das würde sie sich weder von Mr. Bayle noch sonst jemandem absprechen lassen. Schließlich war sie ein fester Bestandteil des Anwesens, eine Institution sozusagen. Mr. Bayle hingegen war in ihren Augen bloß ein Besucher.
»Soll Mary etwa wie eine Kuhmagd in irgendeinem abgelegenen Schuppen in der Pampa versauern, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen? Da kriegt sie ja die Schwermut und tut sich was an. Nein, es gibt nur eins: Mary muss zurück aufs Schiff. Und zwar auf die Queen Anne.«
Die bloße Erwähnung dieses Namens fegte Mr. Bayle das Lächeln aus dem Gesicht. Fast hätte er sich an seinem Gurkensandwich verschluckt. Seine Manieren verboten ihm, mit vollem Mund zu sprechen. Doch auch die Hast, mit der er den halb zerkauten Bissen herunterwürgte, zeugte nicht unbedingt von feiner englischer Art.
»Um Gottes Willen«, stieß er hervor. Für einen Mann, der für gewöhnlich als Inbegriff von Gemütsruhe und Selbstbeherrschung galt, kam dies geradezu einem Wutausbruch gleich. Greta, die Frau, die ihn immer wieder aus der Fassung brachte, hatte genau jenes Stichwort gewählt, das ihn am empfindlichsten traf. »Ich beschwöre Sie, verehrte Mrs. Arrington, eine Rückkehr auf diesen rostigen Kutter dürfen Sie nicht einmal in Erwägung ziehen. Denken Sie nur einmal an die Strapazen, denen Sie sich auf diesem Seelenverkäufer ausliefern: lärmende Menschenmassen. Niveauloses Unterhaltungsprogramm. Seegangsbedingte Übelkeit.«
Durch ihre jahrelange Freundschaft war Mary mit den Marotten ihres Lektors wohlvertraut. Nicht nur, dass er dem Meer gegenüber eine Abneigung hegte, die für einen geborenen Inselbewohner verwunderlich war. Geradezu allergisch reagierte er, leidenschaftlicher Liebhaber gehobener Literatur und klassischer Musik, auf alles, was er mit Massentourismus, All-inclusive-Urlaub und, wie er es nannte, geistfreier Vergnügungssucht in Verbindung brachte. Sein Ausbruch kam für die Schriftstellerin daher nicht überraschend. Aber deshalb war sie noch lange nicht bereit, ihn ohne Weiteres hinzunehmen.
»Ich darf Sie darauf hinweisen, mein lieber Mr. Bayle«, sagte Mary, »dass die Queen Anne ihren Passagieren höchsten Komfort bietet und die oft verwendete Bezeichnung Schwimmendes Luxushotel weitaus zutreffender ist als Ihr rostiger Kutter. Trotz aller Widrigkeiten, die mit meinem ersten Aufenthalt an Bord einhergingen, habe ich dort eine durchaus bereichernde Zeit verbracht und einige Freundschaften mit liebenswerten Menschen geschlossen.«
So viel Wert Mr. Bayle normalerweise auf Beherrschtheit und vornehme Zurückhaltung legte – hier und jetzt war es aussichtslos, ihn in seiner Erregung zu bremsen. Das Sandwich in seiner Hand schien er vollkommen vergessen zu haben. Es fehlte nicht viel, und er hätte es fallen lassen und sich den von seinem Londoner Schneider maßgefertigten Anzug bekleckert.
»Ich darf Sie meinerseits darauf hinweisen, verehrte Mrs. Arrington, wie wenig zutreffend mir die von Ihnen gewählte Bezeichnung Widrigkeiten scheint, wenn man bedenkt, dass eine dieser sogenannten Widrigkeiten darin bestand, dass sie beinahe umgebracht wurden – und zwar infolge eines anderen, grausamen Mordes. Es ist mir schleierhaft, was einen intelligenten Menschen dazu bewegen könnte, sich freiwillig nicht nur einmal, sondern gleich zweimal auf diesen schwimmenden Sarg zu begeben.«
Er legte das angebissene Sandwich beiseite und trank einen Schluck Tee, um seine Nerven zu beruhigen.
»Ich appelliere an Ihre Vernunft«, fuhr er sodann gefasster fort. »Fahren Sie in mein Cottage. Es ist noch niemand landkrank geworden. Zudem denke ich, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich Ihnen verspreche, dass während Ihres Aufenthaltes dort mit höchster Wahrscheinlichkeit niemand das Zeitliche segnen wird.«
»Höchstens Mary selbst«, warf Greta ein, die seinen Ausführungen mit verächtlicher Miene zugehört hatte. »Vor lauter Langeweile.«
Bevor Mr. Bayle zu einer weiteren Parade ausholen konnte, hatte Mary sich erhoben und war an den antiken Globus getreten.
»Vergessen Sie nicht, Mr. Bayle«, sagte sie und fuhr mit den Fingerspitzen über die blauen Flächen, die darauf eingezeichnet waren. »Es war just diese Reise, die mir den Stoff zu meinem aktuellen Roman lieferte und mich damit, wie Sie sich gewiss erinnern, schon einmal aus einer künstlerischen Schaffenskrise rettete. Was läge also näher, als frische Inspiration für diese Geschichte dort zu suchen, wo sie sich abgespielt hat?«
»Was näher läge?«, grollte Mr. Bayle. »Ich sage Ihnen, was näher läge: Mein Cottage läge näher.«
Aber der Trotz in seiner Stimme verriet bereits das notgedrungene Eingeständnis seiner Niederlage, einer schmählichen Niederlage, die seinem Stolz einen tiefen Stich versetzte: Ausgebootet von einer Haushaltshilfe. Wobei der Begriff ausgebootet in Bezug auf das Thema Schiff und Kreuzfahrt einen besonders schmählichen Beigeschmack erhielt.
»Außerdem«, sagte Greta, »hat Mary ja noch die Gratis-Reise, die sie beim letzten Mal geschenkt bekommen hat, weil sie den Kriminalfall so bravourös gelöst hat. Die kann sie ja unmöglich verfallen lassen.«
»Sie müsste sie ja nicht verfallen lassen«, bemerkte Mr. Bayle. »Die Reise ist sicherlich übertragbar. Wenn Sie mich fragen, Mrs. Arrington, hat Greta für all ihre Anstrengungen einen Urlaub verdient. Es gibt bestimmt Kreuzfahrten an den Nordpol, auf denen sie …«
»Wohin möchten Sie reisen, Mary?«, unterbrach Greta ihn grob und stellte sich neben Mary. »Wieder in die Karibik?«
Mary schüttelte den Kopf, und Mr. Bayle erkannte, dass er endgültig verloren hatte. Beleidigt griff er sein Sandwich, biss hinein und verfolgte mit Schmollmiene, wie die gegen seinen Willen und fachmännischen Rat beschlossenen Pläne ins Werk gesetzt wurden.
»Neue Reise, neues Ziel«, sagte Mary und versetzte den Globus mit einem ordentlichen Schubs in Drehung.
2
Die Queen Anne herrschte über den Hafen von Southampton, wie es sich für eine Königin gehörte. Der dreimastige Segelschoner, der in ihrem Schatten vor Anker lag, die Jachten, die an ihr vorüberkreuzten, als wollten sie der Monarchin ihre Aufwartung machen, und die Motorboote, die sich ehrerbietig, wie es schien, in ihre Nähe wagten, wirkten neben ihr wie Miniaturmodelle. Selbst ein weiteres Kreuzfahrtschiff, das für sich allein mächtig und eindrucksvoll gewesen wäre, nahm sich im Vergleich mit der Majestät der Weltmeere wie ein Spielzeug aus. Mit ruhiger Erhabenheit thronte die Queen Anne mit ihrem knallroten Schornstein längs des Ocean Terminals, einer lang gezogenen, mattsilbernen Halle mit abgerundetem Dach, die von der Seite gesehen einem U-Boot ähnelte. Die letzten Vorbereitungen zum Aufbruch liefen auf Hochtouren. Eine Armee von Arbeitern mit gelben Warnwesten war damit beschäftigt, die Autos der eintreffenden Passagiere auf den Parkplatz zu leiten und Gepäckstücke auf Sackkarren an Bord zu transportieren. Unter den Männern, Frauen und Kindern, die in den kommenden Tagen auf dem Luxusschiff zu Gast sein würden, gab es niemanden, der beim Anblick des Schiffes nicht vor Erstaunen innegehalten hätte. Die meisten der Passagiere verewigten den Moment auf einem Foto oder hielten ihn in einem Video fest, bevor sie sich in der aufgeregt schwatzenden Menge ihrer Mitreisenden in das Terminal zum Check-in begaben. Vollkommen ungerührt stand die Queen Anne über all dem Gewimmel. Alles drehte sich einzig und allein um sie. Aber um so weltliche Belange brauchte sich eine Hoheit natürlich nicht zu kümmern.
Mary hatte ihre Koffer bereits aufgegeben und auch alle übrigen Formalitäten hinter sich gebracht. Zusammen mit einigen ihrer unbekannten Reisegenossen überquerte sie die Gangway, die das Schiff mit dem britischen Festland verband. Durch die gläsernen Wände, die sie umschlossen, blickte sie auf das Wasser, das zwischen dem Kai und dem schwarzen Rumpf der Queen Anne spielerische Wellen schlug. Mary hatte das Gefühl, über eine Brücke zu schreiten, und zwar in mehrfachem Sinne. Dieser Übergang bedeutete nicht nur, festen Grund zu verlassen und sich dem Ozean, seiner Weite und seinen Gefahren – wie harschem Wellengang und Stürmen – zu übereignen, wenngleich in höchstem Komfort. Er hieß auch, in jene ganz eigene Welt zurückzukehren, die Mary während ihres ersten Aufenthalts an Bord kennengelernt hatte. Eine Welt, in der die Menschen, die sie für eine Weile bevölkerten, in einer Art Schicksalsgemeinschaft zusammengeschlossen waren – und niemand konnte auch nur erahnen, welche Dramen sich zwischen ihnen entspinnen würden.
Am Eingang zum Schiff stand ein Stewart, gekleidet in einen schwarzen Anzug, an einem Pult, um die Passagiere in Empfang zu nehmen und ihre Bordkarten zu prüfen. Dahinter hatten sich in zwei Reihen, eine links, eine rechts, weitere schwarz gekleidete Stewarts aufgestellt, von denen jeder im Knopfloch eine Rose und auf dem Gesicht ein Lächeln trug. Hinter diesem Spalier wiederum, das Mary ihrerseits mit einem Lächeln durchschritt, hielten sich Bell Boys in roten Livreen, mit roten Mützen und weißen Handschuhen bereit, den Gästen ihr Handgepäck abzunehmen und sie zu ihren Unterkünften zu geleiten. Mary freilich kannte sich gut genug aus, um sich allein zurechtzufinden. Bevor sie jedoch den Weg zu den Aufzügen einschlagen konnte, stellte sich ihr ein Mann in den Weg.
3
»Entschuldigen Sie, Madam«, sagte der Fremde. Seine Uniform mit den goldenen Schulterstreifen wies ihn als Offizier aus. Er sprach Englisch mit einem breiten Akzent, den Mary nicht direkt zuordnen konnte. »Aber wenn mich nicht alles täuscht, müssen Sie Lady Arrington sein, nicht wahr?«
»Ganz recht«, sagte Mary mit einer gewissen Neugier in der Stimme.
Der Offizier nickte zu dieser Bestätigung dessen, was er bereits gewusst hatte.
»Hendrik de Jong«, sagte er und gab ihr dadurch nicht nur seinen Namen, sondern auch seine Nationalität preis. Sowohl Name als auch Akzent waren niederländisch.
»Sehr erfreut«, sagte Mary.
Sie erwartete, er werde ihr die Hand reichen, und hob bereits ihre, um sie ihm entgegenzustrecken. Stattdessen aber nahm er Haltung an, schlug die Hacken zusammen und salutierte. Mary war sich zwar sicher, dass die Gepflogenheiten der Seefahrt von ihr keinesfalls verlangten, diese Begrüßung in gleicher Form zu erwidern. Sie wusste indes nicht, wie eine angemessene Erwiderung auszusehen hatte. Ohnehin brachte es sie hinreichend in Verlegenheit, vor aller Augen mit militärischen Ehren an Bord empfangen zu werden.
Sie beschränkte sich daher auf ein höfliches, wenn auch leicht irritiertes Lächeln.
»Gestatten Sie mir«, sagte de Jong und zog zackig die Hand von seiner schwarz-weißen Offiziersmütze mit dem goldenen Wappen, »Sie im Namen der gesamten Besatzung der Queen Anne an Bord willkommen zu heißen. Zudem möchte ich Ihnen stellvertretend für den Schiffseigner noch einmal ganz herzlich unseren Dank für den Dienst ausdrücken, den Sie uns während Ihrer ersten Reise erwiesen haben.«
Mary kam nicht umhin, zu bemerken, dass er darauf verzichtete, hinzuzufügen, dass es sich bei besagtem Dienst um die Aufklärung eines Verbrechens gehandelt hatte. Vermutlich, weil sie sich in Hörweite anderer Passagiere befanden, und die Erwähnung eines brutalen Mordes nicht unbedingt dazu beigetragen hätte, die Vorfreude der Reisegäste auf Cocktails im Liegestuhl auf dem Sonnendeck zu erhöhen.
»Gern geschehen«, sagte Mary und verkniff sich ihrerseits eine Bemerkung darüber, wie viel lieber es dem Schiffseigner damals gewesen wäre, der Fall wäre still und heimlich vertuscht worden, anstatt durch ihre Ermittlungen ans Licht der Öffentlichkeit zu gelangen. Aber schließlich war de Jong nur der Überbringer dieser heuchlerischen Grußbotschaft. Zudem war er, wenn Mary sich nicht irrte, damals gar nicht an Bord gewesen und hatte mit all dem folglich nichts zu tun. Sein Name jedenfalls rief in Mary keine Erinnerung wach. Natürlich hatte sie nicht mit jedem Einzelnen der über tausend Crew-Mitglieder persönlichen Kontakt gehabt. Aber selbst wenn sie einander auch nur auf einem der Gänge über den Weg gelaufen wären – Mary war ziemlich sicher, dass er ihr im Gedächtnis geblieben wäre.
Mit über 60 Jahren war sie lange aus dem Alter heraus, in dem sie über die Attraktivität eines Mannes in mädchenhafte Schwärmerei verfallen wäre. Aber sie musste zugeben, dass dieser Hendrik de Jong außergewöhnlich gut aussah. Als Schriftstellerin hütete sie sich eigentlich davor, auf Klischees zuzugreifen. Aber hier blieb ihr keine Wahl: Stahlblaue Augen. Sinnlicher Mund. Markantes Kinn. Dazu breite Schultern und schmale Hüften. Wäre sie nicht Kriminalroman-Autorin, sondern Verfasserin kitschiger Liebesromane, sie hätte ihn ohne Weiteres als Vorbild für den leidenschaftlichen Helden genommen, der mit schmelzenden Blicken und heißen Küssen die Herzen sämtlicher Damen im Sturm erobert. Den nötigen Charme dafür schien er dem ersten Eindruck nach jedenfalls zu haben. Und seine Uniform, die ihm selbstverständlich wie angegossen passte, war wie gemacht dafür, seinen imposanten Körperbau zu unterstreichen.
»Wir freuen uns sehr«, riss er Mary aus ihren Gedanken, »Sie ein weiteres Mal als Gast bei uns zu empfangen, und hoffen, dass Sie auf der Queen Anne eine angenehme Zeit verbringen werden. Ich wurde persönlich vom Kapitän damit beauftragt, für Ihr Wohlbefinden Sorge zu tragen. Falls Sie also irgendetwas benötigen, wenden Sie sich einfach an mich.«
»Vielen Dank, Mr. de Jong«, erwiderte Mary. »Es ist beruhigend, mich in so fähigen Händen zu wissen.«
De Jong lächelte, und für einen Moment fürchtete Mary, der letzte Satz könnte falsch herausgekommen sein. Schließlich hatte sie, bei all seiner Attraktivität, keinesfalls vor, sich buchstäblich in seine Hände zu begeben. Sie war zwar auf Abenteuer aus. Aber nicht auf Liebesabenteuer, und schon gar nicht mit einem Mann, der um so vieles jünger war als sie selbst.
Zu ihrer Beruhigung hatte de Jongs Lächeln – perlweiße Zähne, wie könnte es anders sein – nichts Anzügliches. Seine Freundlichkeit wirkte aufrichtig. Trotzdem fragte Mary sich, ob seine Sorge um ihr Wohlergehen möglicherweise mit dem Auftrag einherging, sie im Auge zu behalten, damit sie nicht ein weiteres Mal geschäftsschädigende Unannehmlichkeiten verursachte. Sie schob diesen Gedanken beiseite. Schließlich hatte sie ohnehin nicht vor, auf dieser Reise ein weiteres Mal in einen Mordfall verwickelt zu werden.
Hendrik de Jong hob seine Mütze und fuhr sich mit seiner gepflegten Hand durch das nicht weniger gepflegte goldblonde Haar, das nun zum Vorschein kam. Mit seinem Glanz und seiner Spannkraft sah es aus, als käme es in den täglichen Genuss einer Wellness-Behandlung mit Shampoo, Conditioner und jeglichem anderen auf der Welt erhältlichen Pflegeprodukt. Im Gegensatz zu seinem sonstigen Verhalten wirkte diese Geste etwas gekünstelt und zeugte von einer gewissen Eitelkeit, fand Mary. Wenn de Jong auch bemüht war, es sich nicht anmerken zu lassen: Er war sich der Anziehungskraft durchaus bewusst, die von ihm ausging – und die selbst auf ihn ihre Wirkung offensichtlich nicht verfehlte.
Der Offizier setzte seine Mütze so behutsam auf, als fürchte er, seiner Frisur dadurch bleibenden Schaden zuzufügen.
»Wenn Sie nun so freundlich wären, mich zu begleiten«, sagte er und wies in Richtung des Schiffsinneren. »Der Kapitän würde gern mit Ihnen sprechen.«
4
Dezente Klaviermusik empfing Mary, als sie die Grand Lobby betraten. Sie hatte die Lobby während ihrer letzten Reise durch die Karibik zahllose Male durchschritten. Aber auch jetzt empfand sie eine gewisse Ehrfurcht vor diesem beeindruckenden Herzstück des Schiffes. Die stuckverzierte Galerie, auf der Edelboutiquen erlesene Waren für den nicht ganz so alltäglichen Bedarf anboten. Die runden Emporen, von denen aus man hinab in die aufwendig gestaltete Halle blicken konnte. Die sacht geschwungenen, mit rotem Teppich ausgelegten Treppen, die hinunter in den weitläufigen, von marmorierten Säulen umstellten Sitzbereich mit seinen komfortablen Sesseln führten. Das gewaltige bronzene Relief, das hoch über all dem prangte, und aus dem das Schiff, von stürmischen Wellen getragen, triumphal aus einem Strahlenkranz hervorzubrechen schien. Die Grand Lobby versetzte ihren Betrachter zurück in die 1920er-Jahre, das goldene Zeitalter der Kreuzfahrten, und Mary war sicher, dass die Ladys und Gentlemen von damals sich nicht erhabener gefühlt hatten als sie selbst und ihre Mitreisenden, die hier gerade versammelt waren und sich dieser Pracht voller Bewunderung hingaben.
An einem schwarzen Konzertflügel, der am Fuße einer der Treppen aufgestellt war, saß der Bordpianist in schwarzem Anzug und füllte die gediegene Atmosphäre mit weichen Klängen, die leicht und spielerisch durch die Halle schwebten – gläsern, schien es, wie die glitzernden Kristalle an den üppigen Blumensträußen, mit denen die Lobby geschmückt war. Bei der Musik, die er zur Unterhaltung der Bordgäste zum Besten gab, handelte es sich um die Instrumentalversion eines bekannten Songs der Beatles. Auch wenn dieses Stück das Können des Pianisten sicher nicht übermäßig forderte, hörte Mary, dass er nicht einfach zum tausendsten Mal lustlos sein Repertoire herunterspulte. Und sie sah es auch. Die Musik schien durch ihn hindurch und aus ihm hinaus in den Flügel zu fließen. Sein schmaler Oberkörper, der auf dem Hocker hoch über das Instrument hinausragte, wiegte sich im Rhythmus vor und zurück, während seine langgliedrigen schlanken Finger über die Tasten eilten. Sein Kopf, bedeckt mit wirr gelocktem dunklem Haar, pendelte an seinem leicht geknickten Hals mal abwärts, wie von den Tönen herabgezogen, mal aufwärts, wie von ihnen emporgehoben. Mary empfand eine gewisse Traurigkeit, als sie sah, dass die übrigen Passagiere die Musik kaum wahrzunehmen schienen. Ihnen galten die innig vorgetragenen Klänge lediglich als Hintergrundgeplänkel. Den Pianisten schien es nicht zu kümmern. Seine dunklen, weichen Augen, deren Blick er gelegentlich durch die Grand Lobby schweifen ließ, verrieten: Es wäre ihm unmöglich gewesen, auch nur eine einzige Note zu spielen, ohne seine gesamte Leidenschaft in ihr erklingen zu lassen. Und wann immer ihn eine Passage seines Liedes besonders berührte, lief ein Lächeln über sein Gesicht, in dem die tiefe Liebe zu seiner Kunst leuchtete.
Der Pianist war das erste bekannte Gesicht, das Mary auf der Queen Anne erblickte. Schon während ihrer ersten Fahrt hatte er für die musikalische Unterhaltung der Gäste gesorgt. Zwar hatte sich kein Gespräch zwischen ihm und Mary ergeben, aber sein Können und seine Hingabe hatten sie schon damals tief beeindruckt. Sie freute sich, erneut in den Genuss seiner Musik zu kommen. Vielleicht, dachte sie, ergibt sich ja dieses Mal die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen und ihm ihre Bewunderung auszudrücken. Schließlich gehörte er ganz eindeutig zu jenen faszinierenden Charakteren, die einen Aufenthalt an Bord so abwechslungsreich gestalteten.
De Jong hatte Mary zu einem Sessel nahe des Säulengangs geleitet.
»Wenn Sie Platz nehmen und sich ein wenig gedulden möchten«, sagte er und rückte ihr den Sessel zurecht. »Ich lasse Ihnen einen Tee bringen und teile Kapitän MacNeill mit, dass Sie eingetroffen sind. Er wird sofort bei Ihnen sein.«
»In Ordnung, ich warte dann so lange hier«, sagte Mary. »Und vielen Dank für Ihren freundlichen Empfang, Mr. de Jong.«
»Es ist mir eine Ehre, Mrs. Arrington.«
Er wandte sich um und durchquerte die Halle mit den ausgreifenden Schritten, die seiner stattlichen Erscheinung angemessen waren. Etwa in der Mitte der Lobby hielt er einen gerade vorüberkommenden Stewart an. Während er ihm mit einem diskreten Zeichen in Marys Richtung den Auftrag erteilte, ihr Tee zu servieren, lüftete de Jong ein weiteres Mal seine Mütze, um sich das Haar zurechtzustreichen. Mary, die ihn beobachtete, schmunzelte über diese eitle kleine Eigenheit – und über die begehrlichen Blicke einiger Damen, denen der fesche Offizier nicht entgangen war und die wohl hofften, er werde ihnen – sozusagen als Teil des bordeigenen Unterhaltungsprogramms – die Reise noch ein wenig aufregender gestalten.
Mary indes lehnte sich in ihrem Sessel zurück, um die Herrlichkeit der Grand Lobby, das geruhsame Treiben, das hier herrschte, und die anmutige Musik, die all dies untermalte, ganz in Ruhe in sich aufzunehmen.
Plötzlich aber brach das Lied ab.
5
Wie abgehackt endete die Musik mitten in ihrem eben noch so flüssigen Lauf. Der letzte, abgerissene Ton verstummte, harsch zum Schweigen gebracht. Und in der jähen Stille, die folgte, schien die gesamte Grand Lobby mit ihrer entspannten Geschäftigkeit für einen Moment in Starre zu verfallen. Wenn die anwesenden Passagiere dem Klavierspiel auch keine allzu große Beachtung geschenkt hatten – sein unerwarteter Abbruch verwirrte sie. Mit der Musik schien auch die magische Atmosphäre dieses Ortes zu verstummen. Es war keiner unter den Anwesenden, der nicht beim Schlendern zwischen den Säulen verdutzt stehen geblieben, in seinem Gespräch innegehalten oder den Blick von seiner Lektüre genommen hätte. Alle schauten sie hinüber zu dem Flügel unter der Treppe, um herauszufinden, was es mit dieser Störung ihrer schwelgerischen Bewunderung der Halle, ihres Müßiggangs oder ihrer feierlichen Ankunftsstimmung auf sich hatte.
Auch Mary blickte zu dem Pianisten und versuchte eine Erklärung zu finden, warum dieser sein Spiel so unschön beendet hatte. Einen kurzen Moment lang saß er steif auf seinem Hocker. Seine Finger schwebten wie von unsichtbaren Fäden gehalten über den Tasten. In seinem Gesicht unter dem Lockenschopf meinte Mary einen Ausdruck von Fassungslosigkeit, ja Entsetzen zu erkennen. Aber die Lähmung, die ihn ergriffen zu haben schien, hielt nicht lange. Kaum hatten sich alle Blicke auf ihn gerichtet, senkte er die Finger auch schon wieder auf die Tasten und brachte den Flügel erneut zum Klingen. So beklemmend die plötzliche Stille auch gewesen sein mochte, sie war Mary doch tausendmal lieber gewesen als das, was ihr nun folgte.
Mit aller Kraft, ja Gewalt, hämmerte er – Mary fand keine anderen Worte dafür – eine heiter überdrehte Melodie aus seinem Instrument, die nicht nur keineswegs zur Atmosphäre der Grand Lobby passte, sondern zudem so ohrenbetäubend durch die Halle schallte, dass die Kristalle an den Blumensträußen zu erzittern schienen. Es gelang nun niemandem mehr, die Darbietung des Pianisten unbeachtet an sich vorüberziehen zu lassen.
Mary sah, wie der Stewart, mit dem de Jong eben noch gesprochen hatte, herumwirbelte und mit einem Bell Boy zusammenstieß, der mit einem Koffer auf dem Weg zu den Aufzügen war. De Jong selbst, der die Halle noch nicht verlassen hatte, fasste seine Mütze und hielt sie fest, als fürchte er, der Höllenlärm könnte sie ihm vom Kopf wehen und seine Haare durcheinanderbringen. Eine füllige Dame in einem teuer wirkenden, quietschbunten Kleid, die über und über mit kostbarem Schmuck behängt war, ließ vor Schreck ihre Teetasse fallen, presste sich die Hände auf die Ohren und stieß einen gequälten Schrei aus, der nicht weniger spitz und durchdringend war als die kreischenden Töne, die der Pianist noch immer aus dem Flügel hämmerte. Ein im Gegensatz zu ihr beinahe asketisch dürrer älterer Herr mit Glatze und randloser Brille, der Mary in seinem schwarzen Anzug an einen Bestattungsunternehmer erinnerte, sprang aus seinem Sessel auf und warf dem Pianisten vernichtende Blicke zu.
»Verdammt, nun hören Sie doch auf mit diesem furchtbaren Geklimper!«, rief eine laute Männerstimme. Mary versuchte auszumachen, von wo aus der Ruf gekommen war. Doch ihr Blick blieb an einer kräftigen Frau hängen – robust war der Ausdruck, der Mary einfiel – mit streng geknotetem braunem Dutt und schlichter, farbloser Kleidung. Sie drängte ein junges, blasses Mädchen, das sich offenbar in ihrer Begleitung befand, von der Empore fort, von der aus sie offenbar die Lobby betrachtet hatten. Während sie das Mädchen, vielleicht sechzehn oder siebzehn Jahre alt, zum Ausgang drängte, vollführte sie mit ihren Händen immer wieder Gesten, die Mary als Gebärdensprache erkannte, wenn sie auch nicht verstand, was sie zu bedeuten hatten. Dann waren die beiden aus Marys Sichtfeld verschwunden. Sie waren nicht die Einzigen, die vor dieser akustischen Folter Reißaus nahmen. Ein Feueralarm hätte die Leute nicht zuverlässiger in die Flucht schlagen können.
Mary hingegen blieb an ihrem Platz. Sie war nicht so schreckhaft, dass ein Lied, ganz gleich wie unpassend und laut, sie aus der Ruhe gebracht hätte. Ganz abgesehen davon hätte ihre Neugier ihr niemals gestattet, aufzuspringen und die Lobby zu verlassen. Mit der Faszination der Schriftstellerin, die immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Ereignissen und auffälligen Verhaltensweisen ist, hatte sie die merkwürdige Szenerie beobachtet und wandte ihre Aufmerksamkeit nun wieder dem Pianisten zu. Von seinem vorherigen Fingerspitzengefühl und seiner Einfühlsamkeit gegenüber seinem Instrument war nichts mehr übrig. Die Vehemenz, ja Gewalt, mit der er spielte, hätte Mary in einem ihrer Romane wohl als panische Besessenheit bezeichnet. Sein Gesicht war leichenblass und verkrampft, die Augen weit aufgerissen, die Zähne aufeinandergepresst. Er sah aus, als wollte er den Flügel mit bloßen Händen in Stücke schlagen.
Und dann war es vorbei.
Als sei nichts gewesen, wechselte der Pianist übergangslos zu einem seiner vorherigen ohrenfreundlichen Evergreens – und zu erträglicher Lautstärke. Die Anspannung wich aus seinem Gesicht, die Besessenheit aus seinem Blick. Die weichen Klänge, die nun von Neuem unter seinen Händen aus dem Flügel strömten, schienen ihn zu beruhigen, wie sie alle und alles um ihn herum zu besänftigen schienen.
Der Aufruhr legte sich allmählich. Die Passagiere und Schiffsangestellten, die in der Lobby geblieben waren, schüttelten die Verwunderung von sich und kehrten zu ihren vorherigen Beschäftigungen zurück. Der Stewart machte sich auf, den Tee zu besorgen. De Jong schritt aus der Lobby. Die füllige Dame sank in einen Sessel, der ihren Umfang kaum zu fassen vermochte, und winkte einem der Bell Boys, ihr ein Glas Wasser zu bringen. Der dürre Herr warf dem Pianisten einen letzten anklagenden Blick zu, setzte sich dann jedoch ebenfalls wieder und widmete sich der Lektüre eines schmalen, schwarz gebundenen Buches. Gespräche wurden fortgesetzt, Erkundungsrundgänge zwischen den Säulen wieder aufgenommen. Neuankömmlinge, die von der Störung nichts mitbekommen hatten, bevölkerten die kurzzeitig fast leere Halle und füllten sie von Neuem mit Äußerungen von Staunen und Bewunderung.
Die erhabene Stimmung der Grand Lobby war wiederhergestellt.
Mary aber konnte und wollte den Vorfall nicht einfach vergessen. Allzu sonderbar kam ihr das Betragen des Pianisten vor, der jetzt zurück in jene wiegenden Bewegungen verfiel, mit denen er voll und ganz in seiner Musik aufzugehen schien. Der Mann faszinierte Mary, so wie sie alle Menschen faszinierten, die etwas taten, das von gewöhnlichem Verhalten abwich, vor allem, wenn es auf so drastische Weise geschah wie bei seinem Ausbruch. Mary fragte sich, was ihn dazu getrieben haben konnte.
Und sie wusste, dass diese Frage nicht von ihr ablassen würde, wenn sie ihr nicht nachging.
6
»Ihre Musik entfaltet eine eindrucksvolle Wirkung«, sagte Mary, als sie an den Flügel herantrat. Sie war sich durchaus bewusst, dass man diese Bemerkung sowohl auf das Können des Pianisten als auch auf seine verstörende Einlage beziehen konnte.
Er selbst schien sich für die schmeichelhaftere Auslegung zu entscheiden.
»Vielen Dank für das Kompliment, Madam«, sagte er und blickte auf, ohne sein Spiel zu unterbrechen. Mary kam es vor, als spielten seine Hände ganz von allein weiter und er vertraute ihnen, die richtigen Töne zu treffen, ohne sie dabei ununterbrochen beaufsichtigen zu müssen. Seine gepflegten Finger waren imstande, sich über eine beeindruckende Anzahl von Tasten zu spreizen und somit auch jene, die vom Daumen weit entfernt lagen, mit dem kleinen Finger mühelos zu erreichen. Mary selbst spielte kein Instrument. Aber sie wusste, dass eine solche Fertigkeit und Sicherheit nur durch jahrelange, vielleicht jahrzehntelange Übung erworben werden konnte.
»Ich weiß es sehr zu schätzen.« Er lächelte, ein ehrliches Lächeln, das echte Freude ausdrückte. Sein Gesicht wirkte aus der Nähe betrachtet jungenhaft und offenherzig. Von seiner vorherigen Anspannung war nichts mehr zu spüren. Doch konnte Mary nicht bestimmen, ob sie tatsächlich vergangen war oder er sich nicht lediglich verstellte. Immerhin war er als Künstler daran gewöhnt, vor Publikum den Schein zu wahren. Bei genauerer Betrachtung entdeckte Mary Schatten um seine Augen, die zudem leicht gerötet waren. Es sah aus, als hätte er zu wenig Schlaf bekommen. Auch meinte sie, in seinem Blick, hinter der Offenheit und Freude eine Bedrückung zu erkennen, eine tiefe Sorge, die seinen lächelnden Mund Lügen strafte.
»Sie wissen ja«, fuhr er fort. »Applaus und Lob sind das Brot des Künstlers.«
Wie um zu zeigen, dass er sich nicht auf Marys Lob ausruhen wollte, sondern bereit war, sich sogleich ein weiteres zu verdienen, flocht er einen Lauf ein, bei dem seine Finger einander spielerisch zu jagen schienen, bis die linke Hand die rechte überholte, über sie hinwegsetzte und die beiden kurzzeitig ihre Plätze auf der Tastatur tauschten. Nach diesem kleinen Wettstreit fanden sie sofort zurück zu ihrer vorherigen harmonischen Zusammenarbeit, ohne dass Mary in dem Stück auch nur den geringsten Bruch vernommen hätte.
»Kann ich etwas tun, um mich für Ihre Freundlichkeit zu revanchieren?«, fragte er. »Ich nehme immer gerne Wünsche entgegen. Gibt es vielleicht ein bestimmtes Lied, das ich für Sie spielen darf?«
Mary war dankbar für dieses Angebot, denn es schien ihr sinnvoll, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und ihn auf seinen Aussetzer anzusprechen. Sie wollte ihm keinesfalls das Gefühl geben, von ihr verhört zu werden.
»Wie wäre es mit Autumn Leaves?«, fragte sie. »Das Lied hat eine besondere Bedeutung für mich.«
»Sehr gerne, Madam«, sagte der Pianist und wechselte ohne hörbaren Bruch von einem fröhlichen Popsong zu den weichen und dabei so ausdrucksstarken Tönen von Autumn Leaves. Schon bei den ersten Tönen war Mary tief berührt. Nicht nur, weil der Pianist das Stück mit so viel Hingabe spielte, sondern auch, weil es in Mary die schönsten Erinnerungen ihres Lebens hervorrief.
Es war Maxwells und Marys Song. Zu diesem Lied hatte Maxwell ihr einen Heiratsantrag gemacht. Es war so viele Jahre her, und doch erinnerte Mary sich an jedes Detail dieses Abends auf Jamaika, wo sie zu dieser Zeit gemeinsam gelebt hatten. Maxwell hatte sie zu einem romantischen Dinner am Strand eingeladen und einen Gitarristen engagiert, der auf sein Zeichen hin bei ihnen erschienen war und jenes Lied gespielt hatte. Maxwell war vor ihr auf ein Knie gesunken, hatte einen Ring zu ihr hochgereicht und ihr die Frage aller Fragen gestellt. Natürlich hatte sie Ja gesagt.
Das war vor fünfunddreißig Jahren gewesen. Zwei Jahre lang waren sie verlobt gewesen und hatten dieser Verlobungszeit dreiunddreißig glückliche Ehejahre folgen lassen, bis Maxwell eines Tages vor nicht ganz eineinhalb Jahren friedlich in seinem Sessel eingeschlafen war. Die ersten Monate war es Mary vorgekommen, als werde sie vor Trauer verrückt. Maxwell nicht mehr um sich zu haben, nicht mehr mit ihm sprechen zu können, nicht mehr mit ihm im Herrenhaus am Kamin zu sitzen oder mit ihm durch den Park zu spazieren, der zu dem Anwesen gehörte – das alles war Mary vollkommen unwirklich vorgekommen. Nach und nach aber hatte sie gelernt, ihrer gemeinsamen Zeit mit Maxwell nicht in Kummer zu gedenken, sondern sich voller Dankbarkeit daran zu erinnern. Sie vermisste Maxwell noch immer, und in Gedanken weilte er stets bei ihr. Aber der Schmerz lähmte sie nicht mehr. Dieses Lied war ihre Art, Maxwell an einem Ort zu gedenken, an dem er – hätte das Schicksal es anders gewollt – an ihrer Seite gestanden hätte.
Während die letzten Töne dieser lieb gewonnenen Melodie erklangen, meinte Mary, den Sonnenuntergang über den Wellen zu sehen, das Rauschen des Meeres zu hören, noch einmal die Freude zu spüren, als sie eingewilligt und er ihr den Ring an den Finger gesteckt hatte. Trotz dieser Erinnerungen und all der Gefühle, die sie in ihr weckten, verlor sie aber nicht aus den Augen, worüber sie nun, da das Lied vorüber war, mit dem Pianisten sprechen wollte.
»Das war wunderschön, Mr. …«
»Winkler«, sagte er und hatte bereits zu einem entspannten Evergreen mit eingängiger Melodie übergeleitet. »Christoph Winkler.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Winkler. Mein Name ist Mary Elizabeth Arrington.«
Er konnte sein Spiel nicht unterbrechen, um ihr die Hand zu geben. Ein Lächeln und ein Kopfnicken mussten also genügen, und selbst dieses Nicken erfolgte im Takt seiner Musik.
»Ich freue mich ebenfalls sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mrs. Arrington«, sagte er. »Ebenso freue ich mich, dass Ihnen meine Version von Autumn Leaves gefallen hat.«
»Es war wirklich hervorragend. Und ich hoffe sehr, Sie finden mich nicht aufdringlich, wenn ich es wage, einen weiteren Wunsch zu äußern.«
»Aber nicht doch, nur zu. Ich bin Ihnen gerne zu Diensten. Was haben Sie im Sinn? Etwas aus dem Bereich Klassik, Jazz, Softrock? Es darf auch gerne etwas Ausgefallenes sein. Stellen Sie mich ruhig auf die Probe.«
»Wenn Sie derart offen und entgegenkommend sind, Mr. Winkler«, sagte Mary, »würde ich gern etwas über das Lied erfahren, das Sie gerade spielten. Jenes, das, wie mir scheint, recht auffällig aus Ihrem übrigen Programm hervorstach.«
Mary konnte an Mr. Winklers Gesicht keinerlei Veränderung erkennen, keine Verstörung, keine Überraschung, keinen Schock. Aber sie wusste, dass nicht nur die Miene Aufschluss über die inneren Regungen gab. Auch der Körper teilte mit, was in jemandem vor sich ging. Ihr entging daher nicht, wie seine Hände für den Bruchteil einer Sekunde in ihrem flüssigen Lauf stockten und einer seiner Finger die Taste, auf die er abzielte, nicht mit der gleichen Präzision traf wie zuvor. Stattdessen rutschte er auf die Taste daneben, und wenn er sie auch nur leicht berührte, so sorgte er doch dafür, dass eine Note sich in das Lied stahl, die nicht in dessen Tonart gehörte. Der Fehler war zu klein, zu unbedeutend, als dass er irgendjemandem in der Grand Lobby aufgefallen wäre. Vor allem, da Winkler sich sofort wieder gefasst und ihn gekonnt überspielt hatte. Mary aber hatte ihn bemerkt. Und Winkler wusste es. Aber nur weil sie ihn dabei ertappt hatte, war er noch lange nicht bereit, ihr offenherzig Rede und Antwort über ein Thema zu stehen, das offenbar einen wunden Punkt in ihm berührte.
»Ach, das …« Er lächelte von Neuem. Sein Lächeln war so sympathisch wie zuvor. Und gleichzeitig vollkommen undurchschaubar. »Das war nichts weiter. Eine kleine Improvisation. Manchmal neigt man als Musiker vielleicht ein wenig zu sehr dazu, seinen künstlerischen Impulsen zu folgen. Es kam einfach über mich. Ich entschuldige mich dafür. Es tut mir leid, wenn ich Sie damit gestört haben sollte.«
»Das macht gar nichts, Mr. Winkler. Im Gegenteil fand ich es sehr … einnehmend.«
Es schien Mary aussichtslos, weiter auf ihn einzudringen. Sie wusste, er verschwieg ihr etwas, und es gab nichts, was ihre Neugier so sehr reizte wie ein Geheimnis. Hier und jetzt aber würde er ihr nichts verraten. Er würde einfach weiter freundlich lächeln und ihren Fragen ausweichen. Allerdings hätte sie ohnehin keine weiteren stellen können, da ihr in diesem Moment eine Hand auf die Schulter tippte und ihrem Gespräch mit dem mysteriösen Pianisten ein Ende setzte.
7
»Mrs. Arrington!«
Überrascht wandte Mary sich um. Aufgrund des musikalischen Zwischenfalles und ihres Gesprächs mit Winkler hatte sie ganz vergessen, warum sie sich eigentlich immer noch in der Grand Lobby aufhielt, statt endlich ihre Suite zu beziehen. Und so war sie im ersten Moment ehrlich überrascht, plötzlich Kapitän George MacNeill gegenüberzustehen. In seiner strahlend weißen Uniform gab er eine eindrucksvolle Erscheinung ab. Auch wenn Mary schien, dass er sich darin nicht so recht wohlfühlte. So wie sie ihn kannte, hätte er das Kommando über sein Schiff wahrscheinlich am liebsten in Öljacke, Wollmütze und groben Stiefeln geführt. Im Outfit des Dockarbeiters, der er früher einmal gewesen war, bevor er sich bis auf die Brücke des luxuriösesten Kreuzfahrtschiffes der Welt emporgearbeitet hatte.
»Wie schön, Sie wiederzusehen.« Ein Lächeln breitete sich über sein vom Wetter gezeichnetes Gesicht mit dem grauen Vollbart und den buschigen Brauen.
»Das finde ich auch«, sagte Mary, der sein Lächeln ein wenig gequält vorkam.
Sie reichte ihm die Hand. MacNeill schüttelte sie kräftig. Für Handküsse war er nicht der Typ.
»Ich fühle mich geehrt, von Ihnen persönlich an Bord begrüßt zu werden.«
»Ja, also das …«, sagte MacNeill. »Sehen Sie, worüber ich mit Ihnen reden wollte … Wenn Sie so freundlich wären.«
Er fasste ihren Arm und zog sie vom Flügel und Winkler fort, der wieder gänzlich in seinem Spiel aufzugehen schien. Das Betragen des Kapitäns kam Mary ein wenig sonderbar vor. Dennoch ließ sie sich von ihm an den Rand der Lobby führen, wo die Säulen sie ein wenig vom Treiben in der Halle abschirmten. Trotzdem blickte MacNeill um sich, als fürchte er, belauscht zu werden. Und selbst als er sicher war, außer Hörweite der übrigen Passagiere, Stewarts und Offiziere zu sein, rückte er nicht gleich mit der Sprache heraus. Stattdessen räusperte er sich umständlich. Mary musste schmunzeln. Auf der Brücke war der Kapitän um kein Wort verlegen, zögerte nicht, seine Kommandos zu geben, und tat das in einer Weise, die an seinen Entscheidungen und seiner Autorität nicht den geringsten Zweifel ließ. Das hatte Mary selbst erleben dürfen. Sie erinnerte sich aber auch gut daran, wie schwer es diesem von Natur aus eher wortkargen Schotten fiel, Unterhaltungen mit den Passagieren zu führen oder gar vor ihnen eine Rede zu halten. Er war durchaus imstande, sich der gewählten Ausdrucksweise zu bedienen, welche die Gäste seines Schiffes von ihm erwarteten. Aber er tat das nicht natürlich und ungezwungen. Er hatte sich die Sprechweise der höheren Klassen mühsam antrainiert, weshalb seine Sätze oft wie einstudiert klangen und er bei seinen Ansprachen vor den Passagieren dieselbe Anspannung zeigte, die ihn auch jetzt dazu brachte, vor Mary herumzudrucksen.
»Wir hatten beim letzten Mal unsere Schwierigkeiten miteinander«, rang er sich endlich durch.
Das kann man wohl laut sagen, dachte Mary. Diese Schwierigkeiten hatten unter anderem darin bestanden, dass sie ihn auf einen Mord hingewiesen hatte, der auf seinem Schiff begangen worden war – und er all ihre Warnungen und Hinweise in den Wind geschlagen hatte. Aber sie verzichtete darauf, ihm seine damalige Sturheit vorzuwerfen. Schließlich war es ihr trotz allem gelungen, das Verbrechen aufzuklären, und MacNeill hatte sich doch noch einsichtig gezeigt. Außerdem gehörte Mary keineswegs zu den Leuten, die anderen ihre Fehler ewig nachtrugen.