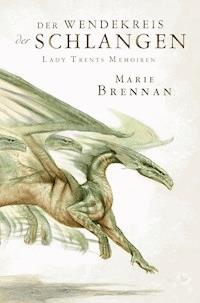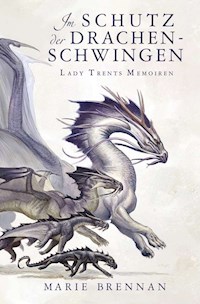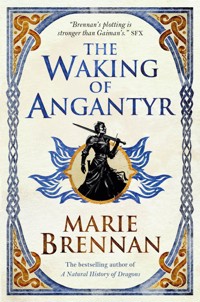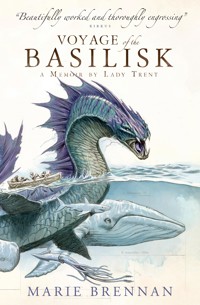Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Lady Trents Memoiren
- Sprache: Deutsch
Lady Trent ist die herausragendste und erfolgreichste Drachenforscherin der Welt. Einst war sie ein junges Mädchen, vernarrt in Bücher und lernbegierig, das den erstickenden Konventionen ihrer Zeit trotzte und ihren guten Ruf, ihre Zukunft und ihre zarte Haut aufs Spiel setzte, um ihre wissenschaftliche Neugier zu befriedigen. Nun endlich liegt die wahre Geschichte dieser beispiellosen Pionierin vor. In ihren eigenen Worten berichtet Lady Trent über ihre aufregende Expedition in die Berge von Vystrana, wo sie die erste von vielen historischen Entdeckungen machte, die sie und die Welt für immer verändern sollten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Ins Deutsche übersetzt vonAndrea Blendl
Die deutsche Ausgabe von LADY TRENTS MEMOIREN 1:DIE NATURGESCHICHTE DER DRACHENwird herausgegeben von Amigo Grafik, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg.Herausgeber: Andreas Mergenthaler und Hardy Hellstern,Übersetzung: Andrea Blendl; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde;Lektorat: Kerstin Feuersänger; Korrektorat: André Piotrowski; Satz: Rowan Rüster/Amigo Grafik;Illustrationen Innenteil: Todd Lockwood, Karte: Rhys Davies,Printausgabe gedruckt von CPI Moravia Books s.r.o., CZ-69123 Pohořelice.Printed in the Czech Republic.
Titel der Originalausgabe: THE MEMOIRS OF LADY TRENT 1:A NATURAL HISTORY OF DRAGONS
Copyright © 2013 by Bryn NeuenschwanderGerman translation copyright © 2017, by Amigo Grafik GbR.
Print ISBN 978-3-95981-503-1 (November 2017)E-Book ISBN 978-3-95981-504-8 (November 2017)
WWW.CROSS-CULT.DE
Inhalt
VORWORT
TEIL EINS
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
TEIL ZWEI
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
TEIL DREI
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
TEIL VIER
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
VORWORT
Es vergeht kein Tag, an dem mir die Post nicht mindestens einen Brief von einem jungen Menschen (oder manchmal von einem nicht ganz so jungen Menschen) bringt, der sich wünscht, in meine Fußstapfen zu treten und Drachenforscher zu werden. Heutzutage ist das natürlich ein respektables Forschungsgebiet, in dem es Studiengänge gibt und für das Forschungsgesellschaften dicke Wälzer herausbringen mit Titeln wie Tagungsberichte von der einen oder anderen Tagung. Diejenigen, die sich für respektable Dinge interessieren, besuchen allerdings meine öffentlichen Vorlesungen. Diejenigen, die mir schreiben, wollen ausnahmslos von meinen Abenteuern hören: meinem Entkommen aus der Gefangenschaft in den Sümpfen von Mouleen oder meiner Rolle in der großen Schlacht von Keonga oder (am häufigsten) meiner Flucht in die unwirtlichen Höhen der Mrtyahaimagipfel, dem einzigen Ort auf der Erde, wo die Geheimnisse der Drachen zu entschlüsseln waren.
Selbst die eifrigsten Briefeschreiber könnten nicht darauf hoffen, dass ich persönlich auf all diese Anfragen antworte. Ich habe deshalb das Angebot der Herren Carrigdon und Rudge angenommen, eine Reihe an Memoiren zu veröffentlichen, die meine interessanteren Lebensabschnitte nachzeichnen. Generell werden sich diese auf jene Expeditionen konzentrieren, die zu der Entdeckung führten, für die ich so berühmt wurde, doch gelegentlich wird es auch Exkurse zu persönlichen und unterhaltsameren oder sogar (jawohl!) schlüpfrigen Angelegenheiten geben. Ein Vorteil daran, jetzt eine alte Dame zu sein, und noch dazu eine, die ein »nationales Kulturgut« genannt wurde, besteht darin, dass es sehr wenige Personen gibt, die mir sagen können, was ich schreiben darf und was nicht.
Seien Sie also gewarnt: Die gesammelten Werke dieser Reihe werden eisige Berge, feuchte Sümpfe, feindliche Ausländer, feindliche Inländer, gelegentlich ein feindliches Familienmitglied, falsche Entscheidungen, Orientierungsmissgeschicke, Erkrankungen der unromantischen Art und eine Menge Schlamm enthalten. Sie lesen auf eigene Gefahr weiter. Meine Memoiren sind ungeeignet für zaghafte Gemüter – genau wie die Drachenforschung selbst. Aber diese Forschung bietet unvergleichliche Belohnungen: In der Präsenz eines Drachen zu stehen, und sei es auch nur für den kürzesten Moment – selbst unter Lebensgefahr –, ist eine Freude, die man, hat man sie einmal erlebt, niemals vergessen kann. Wenn meine bescheidenen Worte nur einen Bruchteil dieses Wunders beschreiben, kann ich zufrieden sein.
Wir müssen natürlich am Anfang anfangen, vor der Reihe an Entdeckungen und Innovationen, die die Welt in diejenige, die Sie, geschätzter Leser, so gut kennen, verwandelten. In dieser uralten und beinahe vergessenen Zeit liegen die bescheidenen Ursprünge meiner wenig bescheidenen Karriere: meine Kindheit und meine erste Expedition ins Ausland, in die Berge von Vystrana. Die grundlegenden Fakten aus dieser Expedition sind seit Langem Allgemeinwissen, aber es steckt viel mehr in dieser Geschichte, als Sie gehört haben.
Isabella, Lady Trent
Casselthwaite, Linshire
11 Floris, 5658
TEIL EINS
In welchem die Schreiberin dieser Memoireneine jugendliche Obsession mit Drachen entwickeltund eine Gelegenheit einfädelt,dieser Obsession zu frönen
EINS
Grünie – Ein unglückseliger Vorfall mit einer Taube –Meine Obsession mit Flügeln – Meine Familie –Der Einfluss von Sir Richard Edgeworth
Als ich sieben Jahre alt war, fand ich auf einer Bank am Rand des Waldes, der die hintere Grenze unseres Gartens bildete, einen toten Funkling, den der Hausmeister noch nicht weggebracht hatte. Voller Aufregung nahm ich ihn mit, um ihn meiner Mutter zu zeigen, doch bis ich sie erreichte, war er in meinen Händen fast völlig zu Asche zerfallen. Mama schrie angeekelt auf und schickte mich zum Händewaschen.
Unsere Köchin, eine große und schlaksige Frau, die dennoch die wundervollsten Suppen und Soufflés herstellte (und so das Gerücht, dass man einem schlanken Koch nicht vertrauen dürfe, Lügen strafte), war diejenige, die mir das Geheimnis verriet, wie man Funklinge nach ihrem Tod konservierte. Sie bewahrte in ihrem Schrank einen auf, den sie für mich herausholte, als ich in der Küche ankam und wegen des Verlusts des Funklings und des Tadels meiner Mutter sehr niedergeschlagen war. »Wie hast du ihn aufbewahren können?«, fragte ich und wischte meine Tränen weg. »Meiner ist in lauter Stücke zerfallen.«
»Essig«, sagte sie, und dieses eine Wort leitete mich auf den Pfad, der mich bis dahin führte, wo ich heute stehe.
Wenn man ihn nach seinem Tod schnell genug findet, kann man einen Funkling (wie viele Leser dieses Bandes zweifellos wissen) konservieren, indem man ihn in Essig einbalsamiert. Ich sprang fest entschlossen zum Suchen in den Garten hinaus und stopfte ein Glas Essig in eine Tasche an meinem Kleid, sodass der Rock ganz schief hing. Der erste, den ich fand, verlor im Konservierungsprozess seinen rechten Flügel, aber ehe eine Woche um war, hatte ich ein intaktes Exemplar: einen Funkling, der anderthalb Zoll lang war und dessen Schuppen in tiefem Smaragdgrün schimmerten. Mit der grenzenlosen Genialität eines Kindes nannte ich ihn Grünie, und er steht bis zum heutigen Tag auf einem Regal in meinem Arbeitszimmer, wo er seine winzigen Flügel ausbreitet.
Funklinge waren nicht die einzigen Dinge, die ich in jenen Tagen sammelte. Ich brachte andauernd andere Insekten und Käfer (denn damals klassifizierten wir Funklinge als Insektenspezies, die einfach Drachen ähnelten, was, wie wir heute wissen, nicht stimmt) und viele weitere Dinge nach Hause: interessante Steine, verlorene Vogelfedern, Bruchstücke von Eierschalen, Knochen jeglicher Art. Mama hatte Wutanfälle, bis ich mit meinem Hausmädchen einen Pakt schloss, dass sie kein Wort über meine Schätze verlieren und ich ihr dafür jede Woche eine zusätzliche Arbeitsstunde geben würde, in der sie sich hinsetzen und die Füße hochlegen konnte. Danach versteckte sich meine Sammlung in Zigarrenschachteln und Ähnlichem, sicher in meinen Schränken verstaut, wo meine Mutter nicht hinschaute.
Ohne Zweifel kam ein Teil meiner Begeisterung davon, dass ich die einzige Tochter unter sechs Kindern war. Weil ich so sehr von Jungen umgeben war und unser Haus recht isoliert im ländlichen Tamshire lag, glaubte ich sicher, dass Kinder einfach immer seltsame Dinge sammelten, unabhängig von ihrem Geschlecht. Die Versuche meiner Mutter, mich zu erziehen, hinterließen ansonsten wenig Eindruck, befürchte ich. Etwas von meinem Interesse kam auch von meinem Vater, der sich wie jeder Gentleman zu jener Zeit moderat über Entwicklungen auf allen Gebieten informiert hielt: Recht, Theologie, Wirtschaft, Naturkunde und mehr.
Der Rest davon war, wie ich mir einbilde, angeborene Neugier. Ich saß oft in der Küche (wo ich sein durfte, ja, sogar dazu ermutigt wurde, nur weil das bedeutete, dass ich mich nicht draußen schmutzig machte und meine Kleider ruinierte) und stellte der Köchin Fragen, wenn sie ein totes Huhn für eine Suppe häutete. »Warum haben Hühner Wunschknochen?«, fragte ich sie eines Tages.
Eines der Küchenmädchen antwortete mir im albernen Tonfall einer Erwachsenen, die mit einem Kind spricht. »Damit man sich etwas wünschen kann!«, und sie gab mir fröhlich einen, der bereits getrocknet war. »Du nimmst eine Seite davon …«
»Ich weiß, was wir damit tun«, schnitt ich ihr ungeduldig und recht taktlos das Wort ab. »Aber deshalb haben Hühner so etwas nicht, oder dieses Huhn hätte sich bestimmt gewünscht, nicht als unser Abendessen im Topf zu landen.«
»Himmel, Kind, ich weiß nicht, warum sie ihnen wachsen«, sagte die Köchin. »Aber man findet sie in allen Arten von Vögeln – Hühnern, Truthähnen, Gänsen, Enten und so weiter.«
Die Erkenntnis, dass alle Vögel diese Eigenschaft teilten, war faszinierend, etwas, das ich nie zuvor bedacht hatte. Meine Neugier trieb mich bald zu einer Tat, bei deren Andenken ich heute noch erröte, nicht wegen der Tat selbst (weil ich seither viele Male ähnliche Dinge getan habe, wenn auch auf eine sorgfältigere und wissenschaftlichere Art), sondern wegen der heimlichen und naiven Weise, wie ich sie ausführte.
Auf meinen Wanderungen fand ich eines Tages eine Taube, die tot unter eine Hecke gestürzt war. Sofort erinnerte ich mich daran, was die Köchin gesagt hatte, dass alle Vögel Wunschknochen hatten. Sie hatte auf ihrer Liste keine Tauben aufgezählt, aber Tauben waren Vögel, oder nicht? Vielleicht würde ich herausfinden, wozu sie dienten, weil ich es noch nicht herausgefunden hatte, indem ich am Esstisch beobachtet hatte, wie ein Bediensteter eine Gans zerlegte.
Ich nahm die Leiche der Taube und versteckte sie hinter dem Heuschober neben der Scheune, dann stahl ich mich hinein und klaute ein Taschenmesser von Andrew, meinem nächstälteren Bruder, ohne dass er es bemerkte. Als ich wieder draußen war, machte ich mich an meine Erforschung der Taube.
In meiner Herangehensweise an diese Arbeit war ich organisiert, wenn auch nicht ganz vernünftig. Ich hatte die Dienstmädchen Vögel für die Köchin rupfen gesehen, deshalb verstand ich, dass der erste Schritt war, die Federn zu entfernen – eine Aufgabe, die sich als schwieriger erwies, als ich erwartet hatte, und als fürchterlich schmutzig. Sie erlaubte mir allerdings zu sehen, wie der Federschaft in seinen Follikel (ein Wort, das ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte) passte, und die unterschiedlichen Arten an Federn zu betrachten.
Als der Vogel mehr oder weniger nackt war, verbrachte ich einige Zeit damit, seine Flügel und Füße zu bewegen, um zu sehen, wie sie funktionierten – und in Wahrheit, um mich für das zu wappnen, was ich als Nächstes zu tun beschlossen hatte. Schließlich besiegte die Neugier meinen Ekel und ich nahm das Taschenmesser meines Bruders, setzte es auf der Haut des Vogelbauchs an und schnitt.
Der Gestank war entsetzlich – im Nachhinein bin ich mir sicher, dass ich die Eingeweide perforiert hatte –, aber meine Faszination war ungebrochen. Ich untersuchte die Fleischklumpen, die herauskamen, und wusste bei den meisten nicht, was sie waren, denn für mich waren Leber und Nieren Dinge, die ich bisher nur auf einer Servierplatte gesehen hatte. Ich erkannte allerdings den Darm und vermutete, was die Lungen und das Herz waren. Nachdem mein Ekel besiegt war, setzte ich mein Werk fort, zog die Haut ab, zupfte an Muskeln und sah, wie alles zusammenhing. Ich deckte die Knochen einen nach dem anderen ab und bewunderte, wie fein die Flügel gebaut waren und wie breit das Sternum wirkte.
Ich hatte gerade den Wunschknochen entdeckt, als ich hinter mir einen Schrei hörte, mich umwandte und sah, wie mich ein Stalljunge entsetzt anstarrte.
Während er wegrannte, versuchte ich hektisch, mein Chaos zu beseitigen, und zerrte Heu über die zerstückelte Leiche der Taube, war aber so verstört, dass dies hauptsächlich darin resultierte, dass ich noch schlimmer aussah als zuvor. Zu dem Zeitpunkt, als Mama den Ort des Geschehens erreichte, war ich von Blut und Taubenfleischbrocken, Federn und Heu und mehr als nur einigen Tränen bedeckt.
Ich möchte meine Leser nicht mit einer detaillierten Beschreibung der Behandlung, die ich in diesem Moment erhielt, belasten. Die Abenteuerlustigeren unter Ihnen haben nach ihren eigenen Eskapaden zweifellos ähnliche Züchtigungen erlebt. Am Ende fand ich mich im Arbeitszimmer meines Vaters wieder, wo ich sauber und mit verschämter Miene auf seinem Akhiateppich stand.
»Isabella«, sagte er mit tadelnder Stimme, »was ist nur in dich gefahren, dass du so etwas tust?«
Es strömte alles in einem Redeschwall heraus, dass ich die Taube gefunden hatte (ich versicherte ihm immer wieder, dass sie tot gewesen war, als ich sie entdeckt hatte, und dass ich sie ganz sicher nicht getötet hatte) und meine Neugier, was den Wunschknochen betraf – ich redete und redete, bis Papa näher kam, sich vor mich hinkniete, mir eine Hand auf die Schulter legte und mich schließlich zum Schweigen brachte.
»Du wolltest wissen, wie es funktioniert?«, fragte er.
Ich nickte, weil ich mich nicht zu sprechen traute, damit der Wortschwall nicht dort weitermachte, wo er aufgehört hatte.
Er seufzte. »Dein Benehmen war für eine junge Lady nicht angemessen. Verstehst du das?« Ich nickte. »Dann lass uns sicherstellen, dass du dich daran erinnerst.« Mit einer Hand drehte er mich um und mit der anderen verabreichte er meinem Hintern drei kurze Schläge, die die Tränen wieder laufen ließen. Als ich mich wieder unter Kontrolle hatte, stellte ich fest, dass er mich alleine gelassen hatte, um mich zu sammeln, und zur Wand seines Arbeitszimmers gegangen war. Die Regale dort waren voller Bücher, von denen einige, wie ich vermutete, so viel wogen wie ich selbst. (Das war natürlich bloße Einbildung. Das schwerste Buch in meiner derzeitigen Bibliothek, mein eigenes De draconum varietatibus, wiegt bloße zehn Pfund.)
Der Band, den er herunterholte, war viel leichter, wenn auch dicker als alles, was man einem siebenjährigen Kind für gewöhnlich geben würde. Er drückte ihn mir in die Hand und sagte: »Deine Mutter wäre nicht glücklich, dich damit zu sehen, nehme ich an, aber mir ist lieber, du lernst aus Büchern als aus Experimenten. Jetzt hinaus mit dir und zeige das nicht deiner Mutter.«
Ich machte einen Knicks und floh.
Wie Grünie steht dieses Buch immer noch auf meinem Regal. Mein Vater hatte mir Gotherhams Anatomie der Vögel gegeben, und obwohl unser Verständnis für dieses Thema sich seit Gotherhams Tagen wesentlich verbessert hat, war es zu dieser Zeit eine gute Einführung für mich. Der Text war mir nur halb verständlich, aber ich verschlang die Hälfte, die ich verstehen konnte, und dachte fasziniert und verwirrt über den Rest nach. Das Beste waren die Diagramme, dünne, sorgfältige Zeichnungen von Vogelskeletten und Muskulatur. Aus diesem Buch lernte ich, dass die Funktion des Wunschknochens (oder, genauer gesagt, der Furcula) ist, das Thoraxskelett von Vögeln zu stärken und Haltepunkte für die Flügelmuskeln zu bieten.
Es schien so einfach, so offensichtlich: Alle Vögel hatten Wunschknochen, weil alle Vögel fliegen konnten. (Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nichts von Straußen, genau wie Gotherham.) Kaum eine geniale Folgerung auf dem Feld der Naturkunde, aber für mich war sie wirklich genial und eröffnete mir eine Welt, die ich nie zuvor betrachtet hatte: eine Welt, in der man Muster und ihre Umstände beobachten und daraus Schlüsse ziehen konnte, die mit bloßem Auge nicht sichtbar waren.
Flügel waren wahrlich meine erste Obsession. In jenen Tagen machte es für mich keinen großen Unterschied, ob die entsprechenden Flügel einer Taube oder einem Funkling oder einem Schmetterling gehörten. Der springenden Punkt war, dass diese Wesen fliegen konnten, und dafür verehrte ich sie. Ich sollte hier wohl erwähnen, dass Mr. Gotherham, obwohl sich sein Text mit Vögeln befasst, gelegentlich faszinierende Verweise auf analoge Strukturen oder Verhaltensweisen bei den Drachen macht. Weil man (wie ich schon erwähnt habe) damals Funklinge als eine Insektenart klassifizierte, könnte man dies als meine erste Einführung in die wundersame Welt der Drachen zählen.
Ich sollte zumindest kurz von meiner Familie erzählen, denn ohne sie wäre ich nicht zu der Frau geworden, die ich heute bin.
Ich vermute, dass Sie bereits einen gewissen Eindruck von meiner Mutter haben. Sie war eine aufrechte und ordentliche Frau ihrer Klasse und versuchte ihr Bestes, um mir das Benehmen einer Lady beizubringen, doch niemand kann das Unmögliche erreichen. Jegliche Schwächen in meinem Charakter dürfen nicht ihr zur Last gelegt werden. Was meinen Vater betrifft, so hielten ihn seine Geschäfte oft fern von daheim, und so war er für mich eine distanziertere Gestalt und vielleicht gerade deshalb auch toleranter. Er hatte den Luxus, mein Fehlverhalten als liebenswerte Schrullen in der Persönlichkeit seiner Tochter betrachten zu können, während meine Mutter die Unordnung und die ruinierten Kleider beseitigen musste, die diese Schrullen verursachten. Ich blickte zu ihm auf, wie man zu einem kleineren heidnischen Gott aufblicken würde, sehnte mich ernsthaft nach seinem Wohlwollen, war mir aber nie ganz sicher, wie ich ihn gewogen stimmen konnte.
Was Geschwister betrifft, war ich, wie gesagt, das vierte in einer Familie mit sechs Kindern und die einzige Tochter. Die meisten meiner Brüder werden, auch wenn sie für mich persönlich wichtig sind, in dieser Geschichte nicht oft vorkommen. Ihre Leben sind mit meiner Karriere nicht besonders verflochten.
Die Ausnahme ist Andrew, den ich bereits erwähnte. Er ist derjenige, dem ich das Taschenmesser geklaut hatte. Er war mehr als alle anderen mein ernsthafter Partner in all den Dingen, an denen meine Mutter verzweifelte. Als Andrew von meinem blutigen Experiment hinter dem Heuschober hörte, war er so beeindruckt, wie es nur ein achtjähriger Junge sein kann, und bestand darauf, dass ich das Messer als Trophäe für meine Taten behielt. Ich habe es nicht mehr. Es hätte einen Ehrenplatz neben Grünie und Gotherham verdient, aber ich verlor es in den Sümpfen von Mouleen. Allerdings nicht, ehe es mir das Leben rettete, als es mich aus den Ranken freischnitt, mit denen mich meine Labane-Häscher gefesselt hatten, und so bin ich Andrew für dieses Geschenk auf ewig dankbar.
Ich bin ihm außerdem für seine Hilfe während unserer Kindertage dankbar, wo er für mich die Privilegien der Jungen ausübte. Wenn unser Vater nicht in der Stadt war, lieh sich Andrew Bücher aus seinem Arbeitszimmer, damit ich sie benutzen konnte. Texte, für die ich selbst nie die Erlaubnis bekommen hätte, fanden so ihren Weg in mein Zimmer, wo ich sie zwischen den Matratzen oder hinter meinem Kleiderschrank versteckte. Mein neues Hausmädchen hatte zu viel Angst, mit hochgelegten Beinen erwischt zu werden, um auf die alte Vereinbarung einzugehen, aber sie war Süßigkeiten zugetan, und so einigten wir uns auf einen neuen Handel, und ich las zu mehr als einer Gelegenheit bis tief in die Nacht.
Die Bücher, die er für mich auslieh, betrafen natürlich beinahe alle Naturkunde. Mein Horizont erweiterte sich von seinem geflügelten Anfang auf alle Arten: Säugetiere und Fische, Insekten und Reptilien, Pflanzen jeglicher Art, denn in jenen Tagen war unser Wissen noch allgemein genug, dass man von einem Mann (oder in meinem Fall einer Frau) erwarten konnte, sich mit dem gesamten Gebiet vertraut zu machen.
Einige Bücher erwähnten Drachen. Sie taten das nie ausführlicher als in kurzen Exkursen, knappen Absätzen, die wenig mehr taten, als meinen Appetit auf mehr Informationen anzustacheln. An mehreren Stellen allerdings fand ich Bezüge auf ein bestimmtes Werk: Sir Richard Edgeworths Eine Allgemeine Drachenkunde. Carrigdon & Rudge sollten es angeblich bald neu auflegen, wie ich aus ihrem Herbstkatalog erfuhr. Ich riskierte sehr viel, indem ich mich in das Arbeitszimmer meines Vaters schlich, um dieses Heft offen hinzulegen, sodass die Seite, die die Neuauflage bewarb, aufgeschlagen war. Sie beschrieb Eine Allgemeine Drachenkunde als »das unverzichtbarste Grundlagenwerk über Drachen, das in unserer Sprache verfügbar ist«. Sicher würde das reichen, um meinem Vater ins Auge zu fallen.
Mein Risiko zahlte sich aus, denn es war bei der nächsten Lieferung an Büchern, die wir erhielten, dabei. Ich konnte es nicht sofort haben – Andrew wollte nichts ausleihen, was unser Vater noch nicht gelesen hatte –, und das Warten machte mich beinahe wahnsinnig. Im frühen Winter aber übergab mir Andrew das Buch in einem Korridor und sagte: »Er hat es gestern fertig gelesen. Lass dich nicht damit erwischen.«
Ich war auf meinem Weg in den Salon für meinen wöchentlichen Unterricht am Pianoforte, und wenn ich wieder in mein Zimmer hinaufgegangen wäre, wäre ich zu spät gekommen. Stattdessen huschte ich weiter und versteckte das Buch, nur Sekunden ehe mein Lehrer eintrat, unter einem Kissen. Ich zeigte ihm meinen schönsten Knicks und mühte mich danach redlich, nicht zum Diwan zu sehen, von wo aus ich spüren konnte, wie mich das ungelesene Buch neckte. (Ich würde sagen, mein Spiel litt unter der Ablenkung, aber für etwas so Schreckliches ist es schwierig, noch schlechter zu werden. Obwohl ich Musik schätze, könnte ich bis zum heutigen Tag keinen Ton halten, wenn man ihn zur Aufbewahrung an mein Handgelenk binden würde.)
Sobald ich aus meinem Unterricht entkommen war, begann ich sofort mit dem Buch und machte kaum Pausen, außer um es zu verstecken, wenn nötig. Ich kann mir vorstellen, dass es heutzutage nicht mehr so bekannt ist wie damals, weil es von anderen, vollständigeren Werken verdrängt wurde, also könnte es für meine Leser schwierig sein, sich vorzustellen, wie faszinierend es mir damals vorkam. Edgeworths Identifikationsmerkmale für »Echte Drachen« waren ein nützlicher Ausgangspunkt für viele von uns, und seine Auflistung an qualifizierten Spezies ist umso beeindruckender, weil sie durch Korrespondenz mit Missionaren und Händlern zusammengestellt wurde anstatt durch eigene Beobachtungen. Er befasste sich außerdem mit der Frage der »Unechten Drachen«, nämlich jener Kreaturen, wie zum Beispiel Wyvernen, die das eine oder andere Kriterium nicht erfüllten und doch (nach den Theorien jener Zeit) Äste am gleichen Stammbaum zu sein schienen.
Der Einfluss, den dieses Buch auf mich hatte, kann abgeschätzt werden, wenn ich sage, dass ich es viermal vom Anfang bis zum Ende las, weil einmal sicher nicht reichte. Gerade so, wie manche Mädchen in diesem Alter nach Pferden und reiterlichen Abenteuern verrückt sind, so wurde ich drachenverrückt. Dieser Ausdruck beschrieb mich gut, weil er nicht nur zum Hauptaugenmerk meines Erwachsenenlebens führte (was wahrlich mehr als nur ein paar Aktionen hier und da einschloss, die man für wahnsinnig halten könnte), sondern auch direkt zu der Handlung, die ich kurz nach meinem vierzehnten Geburtstag beging.
ZWEI
Erpressung – Waghalsige Dummheit –Ein noch unglückseligerer Vorfall mit einem Wolfsdraken –Der Beinaheverlust des schulterfreien Kleides
In jenen Tagen wussten wir schrecklich wenig über Drachen, weil es in Scirland keine Echten Drachen gab und das Feld der Naturkunde erst langsam seine Aufmerksamkeit auf das Ausland richtete. Ich war allerdings sehr wohl mit den verfügbaren Informationen über jene unbedeutenderen Vettern der Drachen, die in unserem eigenen Land immer noch zu finden sind, vertraut, und kein Befehl oder irgendeine Geldsumme hätte mich davon überzeugen können, eine Gelegenheit verstreichen zu lassen, mehr aus erster Hand zu erfahren.
Als mich also die Neuigkeit erreichte, dass ein Wolfsdrake auf unserem Besitz gesichtet worden war, und zwar nicht einmal, sondern mehrfach und von verschiedenen Augenzeugen, und dass er Schafe gerissen hatte, kann man sich wohl vorstellen, wie mein Interesse stieg. Der Name ist natürlich recht fantasievoll. Sie haben keine Ähnlichkeit mit Wölfen, abgesehen von ihrer Tendenz, Nutztiere als ihre rechtmäßigen Mahlzeiten zu betrachten. Heutzutage sind sie in Scirland selten, und damals waren sie schon nicht häufig. In unserer Gegend hatte man seit Generationen keinen mehr gesichtet.
Wie konnte ich diese Chance verstreichen lassen?
Zuerst aber musste ich einen Weg finden, um die Bestie zu sehen. Papa machte sich sofort daran, eine Jagd zu organisieren, genau wie er es bei einem Wolf getan hätte, der für Ärger sorgte. Hätte ich allerdings um Erlaubnis ersucht mitzureiten – wie es Andrew ohne Erfolg tat –, hätte man sie mir absolut verweigert. Ich war vernünftig genug, um einzusehen, dass es fruchtlos gewesen wäre, alleine hinauszureiten und zu hoffen, den Wolfsdraken zu sichten – und höchst gefährlich, falls nicht. Meine Sehnsucht zu erfüllen, würde daher ernsthafterer Mühen bedürfen.
Ein Teil der Ehre – oder vielleicht der Schuld – für das, was folgte, gebührt zumindest Amanda Lewis, deren Familie in meiner Jugend unser nächster Nachbar war. Mein Vater und Mr. Lewis waren gute Freunde, aber man konnte nicht dasselbe über meine Mutter und Mrs. Lewis behaupten, und dies schuf einen gewissen Grad an Spannungen, wann immer uns gesellschaftliche Anlässe zusammenbrachten – besonders in Anbetracht von Mamas Missbilligung ihrer Tochter.
Amanda war ein Jahr älter als ich und das einzige Mädchen im Tal von Tam River in ungefähr meinem Alter und von ähnlichem Status. Zum unendlichen Ärger meiner Mutter war sie auch das, was die jungen Leute heutzutage cool nennen – sehr unanständig auf eine Weise, die Amanda für modern hielt. (Ich war nie cool. Meine Unanständigkeit war immer völlig unmodern.) Aber weil ich sonst niemanden hatte, mit dem ich mich unterhalten konnte, konnte Mama es mir kaum verbieten, die Familie Lewis zu besuchen, und so wurde Amanda meine engste Freundin, bis die Heirat uns beide fortbrachte.
Am Tag, als wir von dem Wolfsdraken erfuhren, marschierte ich die zwei Meilen zu ihrem Haus hinunter, um ihr die Neuigkeiten mitzuteilen, und meine Situation befeuerte sofort ihre lebhafte Fantasie. Amanda presste ein Buch an ihre Brust, holte erfreut Luft und sagte, während ihre Augen voller Übermut funkelten: »Oh, aber es ist einfach! Du musst dich als Junge verkleiden und mitreiten!«
Damit niemand denkt, ich würde den Namen meiner Kindheitsfreundin beschmutzen, indem ich ihr diesen Vorfall in die Schuhe schiebe, muss ich allen versichern, dass ich, nicht sie, diejenige war, die eine Möglichkeit fand, ihre Idee praktisch umzusetzen. So ist es bei mir oft gelaufen: Ideen, die zu verrückt sind, als dass jemand anders sie ernst genommen hätte, sind genau die Ideen, auf die ich mich stürze und nach denen ich handle, oft auf die organisierteste und vernünftigste Weise. (Ich sage dies nicht aus Stolz, denn es ist eine sehr dumme Angewohnheit, die mich mehr als einmal beinahe umgebracht hätte, sondern aus Ehrlichkeit. Wenn man das, was mein Gatte meine derangierte Zweckmäßigkeit nannte, nicht versteht, wird sehr wenig von meiner Lebensgeschichte auch nur den geringsten Sinn ergeben.)
Also war Mandas Ausruf der Funke. Der Zunder und Span, die ihn zu einer Feuersbrunst machten, waren alleine mein Tun. So lief es also.
Es gab eine Anzahl junger Männer, die auf unserem Gut anfallende Arbeiten übernahmen, hauptsächlich draußen. Ich stand ihnen generell nicht nahe, aber da war einer, Jim, den ich in der Hand hatte. Genauer gesagt hatte ich ihn einmal in höchst kompromittierenden Umständen mit einem unserer Küchenmädchen ertappt. Ich selbst war dazu unterwegs gewesen, einen kleinen und faszinierenden Schädel, den ich nicht identifizieren konnte, zu verstecken, aber weil ich ihn unter meinem Rock verborgen hatte, konnte Jim meine eigenen kompromittierenden Umstände nicht erkennen. Daher schuldete er mir einen Gefallen, und ich beschloss, dass nun der Zeitpunkt gekommen war, diesen einzufordern.
Mich auf die Jagd mitzunehmen, war natürlich ein Vergehen, für das er ohne Referenzen hinausgeworfen werden konnte. Ich hätte allerdings dasselbe erreichen können, indem ich von seinem Techtelmechtel mit der Magd erzählt hätte, und obwohl ich das nie getan hätte, ließ ich ihn glauben, dass ich es tun würde. Man mag das schrecklich von mir finden, und ich erröte jetzt noch, wenn ich mich an meine Erpressung erinnere, aber ich werde nicht vorgeben, dass ich damals solche Skrupel hatte. Ich bestand darauf, dass Jim mich auf die Jagd mitnehmen musste.
Hier diente die kühle Distanz zwischen meiner Mutter und Mrs. Lewis meinem Zweck hervorragend. Amanda erzählte Mama, dass sie mich für einen Nachmittag und Abend zu sich nach Hause eingeladen hätte und ich am Morgen zurückkehren würde, und Mama, die wenig Lust verspürte, mit ihrer Nachbarin zu korrespondieren, gab die Erlaubnis, ohne Fragen zu stellen. Deshalb kam Amanda an dem Morgen, als die Jagd beginnen sollte, mit einem Bediensteten zu unserem Anwesen und gab vor, dass ich einige Zeit mit ihrer Familie verbringen würde.
Eine kurze Strecke die Straße hinunter zügelten wir unsere Pferde und ich nickte ihr von meinem Sattel aus zu, während ihr Bediensteter verwirrt zusah. »Danke, Manda.«
Ihre Blicke tanzten beinahe. »Du musst mir alles darüber erzählen, wenn es vorbei ist!«
»Sicher«, antwortete ich, obwohl ich wusste, dass die Geschichte sie wahrscheinlich nach kurzer Zeit langweilen würde, wenn ich nicht eine aufregende Romanze während der Jagd hinzudichtete. Amandas Geschmack an Lesestoff erstreckte sich auf Groschenromane, nicht Naturkunde.
Ich ließ sie zurück, um sich mit den Mitteln, die sie für angemessen hielt, mit dem Bediensteten auseinanderzusetzen, und ritt über Feldwege zu dem Feld, wo sich die Jagdgesellschaft versammelte. Jim wartete bei einer tiefer gelegenen Quelle auf mich, wie wir es verabredet hatten.
»Ich habe ihnen erklärt, dass Sie mein Cousin und zu Besuch hier sind«, sagte er und übergab mir einen Stapel Kleider. »Es ist da drüben wie im Irrenhaus – Leute von überall. Niemand wird es seltsam finden, wenn Sie sich uns anschließen.«
»Ich brauche nur einen Moment«, sagte ich zu ihm und schlich zu einer Stelle, wo er mich nicht sehen konnte. Während ich ständig über meine Schultern sah, für den Fall, dass er mir gefolgt wäre, wechselte ich aus meiner eigenen Reitkleidung in die viel rauere Jungenkleidung, die er mir mitgebracht hatte. (Worte können, wie ich hinzufügen sollte, nicht ausdrücken, wie seltsam es war, zum ersten Mal eine Hose zu tragen. Ich fühlte mich halb nackt. Seither trug ich sie zu vielen Gelegenheiten – weil Hosen viel praktischer zum Drachenjagen sind als Röcke –, aber ich brauchte viele Jahre, um mich daran zu gewöhnen.)
Man muss ihm zugutehalten, dass Jim errötete, als er mich so skandalös gekleidet sah. Er war ein guter Kerl. Aber er half mir, mein Haar unter eine Kappe zu stecken, und als es verborgen war, gab ich, glaube ich, einen passablen Jungen ab. Ich war damals noch im Wachstum und bestand ganz aus schlaksigen Armen und Beinen und noch nicht der Rede werten Hüften und Brüsten.
(Und warum, das frage ich alle, sollte sich mein Herausgeber bei mir über solche Worte beschweren, wo ich doch mehrere Bücher geschrieben habe, in denen ich die Anatomie und Fortpflanzung der Drachen in weitaus drastischeren Ausdrücken beschreibe? Er wird diese Bemerkung nicht beibehalten wollen, wie ich voraussehe, aber ich werde ihn dazu bringen. Mein Alter und mein Status bringen Vorteile.)
Der verblüffendste Teil des Morgens kam allerdings, als Jim mir ein Gewehr übergab. Er sah meinen Gesichtsausdruck und sagte: »Sie wissen nicht, wie man so eines benutzt, oder?«
»Warum sollte ich?«, war meine Antwort, und ich sprach sie in einem etwas schärferen Tonfall aus, als er verdiente. Immerhin war ich diejenige, die darauf bestanden hatte, Jungenkleidung anzuziehen. Es war wohl kaum gerecht, dass ich jetzt die beleidigte Dame spielen sollte.
Er ging darüber hinweg. »Na ja, es ist ziemlich einfach – man legt das hier an seine Schulter, zielt in die Richtung …« Er verstummte. Ich vermute, dass er, wie ich, sich die potenziellen Konsequenzen vorstellte, wenn ich mitten in einer chaotischen Jagd tatsächlich eine Waffe abgefeuert hätte.
»Lassen wir das einfach ungeladen, einverstanden?«, fragte ich, und er sagte: »Ja, das machen wir.«
Und so kam es, dass ich auf der Jagd nach einem Wolfsdraken mitritt, als Junge verkleidet, mein Haar unter einer Kappe und ein ungeladenes Gewehr in meiner Hand, auf meiner Stute Bossy, die überall mit Schmutz eingerieben war, um ihr glänzendes Fell zu tarnen. Jim hatte es mit Recht ein Irrenhaus genannt: Trotz Papas aufrichtiger Mühen war es eine unorganisierte Angelegenheit mit viel zu vielen Leuten dabei. Wenige Männer wollten ihre Gelegenheit verpassen, einen Wolfsdraken zu jagen.
Der Tag war recht schön, und ich konnte meine Aufregung kaum verbergen, als wir losritten. Die Gebiete, in denen man den Wolfsdraken gesichtet hatte, waren nicht schrecklich weit von unserem Gutshaus entfernt, weshalb sich Papa so schnell darum gekümmert hatte, die Jagd zu organisieren, aber wir hatten trotzdem einige Entfernung zurückzulegen.
Unser Besitz bestand hauptsächlich aus felsigem, hügeligem Boden, der für Schafe besser als für alles andere geeignet war, doch wir hatten einige Bauern als Pächter im Tal des Tam River. Das Anwesen stand genau am nördlichen Rand dieses Tals. Wäre man nach Osten oder Westen geritten, wäre das Gelände sanfter geworden, aber unser Pfad führte uns nach Norden, wo das Land schnell zu einem Gebiet anstieg, das zu steil war, um es urbar zu machen. Dort dominierten immer noch Kiefern, und in deren Schatten versteckte sich angeblich der Wolfsdrake.
Ich hielt mich wie angeklebt an Jims Seite und gab vor, schüchtern zu sein, sodass ich nicht mehr Fragen als nötig beantworten musste. Ich vertraute nicht darauf, dass meine Stimme als männlich durchgehen würde, obwohl ich eindeutig ein bartloser Junge sein sollte. Jim kümmerte sich in dieser Hinsicht gut um mich und sprach genug, dass niemand sonst zu Worte kam – obwohl das Geplauder vielleicht an seinen Nerven lag. Er hatte Grund genug, besorgt zu sein.
Wir erreichten den Wald im Norden kurz nach Mittag, woraufhin die Anführer begannen, die Jagd einzuteilen. »Schnell, reite zu Simpkin«, sagte ich und drängte Jim von meinem Vater und anderen Männern fort, die mich vielleicht erkannt hätten.
Ich schloss aus den Bruchstücken von Gesprächen, die ich mithörte, dass die Vorbereitungen für diese Jagd schon lange vor diesem Tag begonnen hatten. Wir sammelten uns in einiger Entfernung auf der windabgewandten Seite eines Dickichts, das einen unbestreitbaren Gestank von Aas verströmte. Anscheinend hatten Papas Jäger für mehrere Tage dort Kadaver platziert, um den Wolfsdraken zu einem festgelegten Platz zu locken. Einige mutige Kerle waren an jenem Morgen dorthin geschlichen, um das Dickicht zu untersuchen, und hatten Anzeichen gefunden, dass die Kreatur darin lag.
Was folgte, war für mich ein recht verwirrendes Durcheinander, weil ich ja nichts über die Jagd wusste. Männer hielten Wolfshunde und Mastiffs an Leinen, und jeder Hund trug einen Maulkorb, damit er nicht bellen und unsere Anwesenheit verraten würde. Sie wirkten sehr angespannt auf mich. Hunde, die ohne Furcht Wölfe jagen würden, zucken immer noch davor zurück, sich jeglicher Art von Drachen zu nähern. Dennoch hetzten und zerrten ihre Führer sie an vorher festgelegte Positionen, an denen, wie ich verstand, der Wolfsdrake vorbeigetrieben werden sollte. Eine Reihe einheimischer Männer wurde mit nicht entzündeten Fackeln vorgeschickt, in großer Entfernung zum Wald. Wenn die Zeit kam, sollten sie ihre Fackeln anzünden und sich dem Unterschlupf der Kreatur nähern, sodass sie ihre Flucht provozieren würden.
Dies war zumindest der Plan. Wolfsdraken sind verschlagene Bestien. Niemand konnte sicher sein, dass er uns entgegenkommen würde, indem er in unsere Falle floh. Daher wurden die Reiter, einschließlich Jim und mir, an anderen Punkten auf dem Gebiet postiert: Sollte die Kreatur entkommen, würden wir sie jagen müssen.
Erfahrene Leser werden korrekt annehmen, dass ich mir nicht die Mühe gemacht hätte, diesen letzten Punkt zu erwähnen, wenn die Jagd nach Plan gelaufen wäre.
Mein erster Blick auf den Wolfsdraken kam als hektische Bewegung, die aus dem Wald schoss. Ich weiß nicht, was genau die Hunde in diesem Moment hätten tun sollen, aber sie hatten nie eine Chance, es zu tun. Der Drake war zu schnell über ihnen.
Da die Spezies so selten war, hatten die Jäger die Berichte über ihre Schnelligkeit unterschätzt. Die Kreatur stürzte sich auf einen der Mastiffs, und es gab eine abrupte, schockierende Fontäne aus Blut. Die anderen Hunde zögerten, ehe sie sich in den Kampf stürzten, und diese Verzögerung ließ all unsere sorgfältige Planung scheitern. Die Reihe der Jäger wurde durchbrochen, und nun machten wir uns an die Verfolgung.
Ich war immer eine gute Reiterin, denn in jenen Tagen war es nicht ungewöhnlich für die Töchter des Landadels, das Reiten sowohl im Damensattel als auch im Herrensattel zu lernen. Doch nie hatte ich auf meinen gemütlichen Ritten auf Bossy über die Güter meiner Familie etwas Derartiges erlebt.
Jim trieb sein Pferd vorwärts, und meines folgte instinktiv, weil es (wie für Pferde üblich) nicht alleine gelassen werden wollte. Schon bald galoppierten wir über den felsigen Hang, in einem schnelleren Tempo, als meine Mama für sicher gehalten hätte. Der Wolfsdrake war eine Gestalt in großer Entfernung und schon weit vor uns, und nur die schnelle Reaktion einiger einheimischer Männer verhinderte, dass er uns gänzlich entkam. Sie versperrten ihm mit Feuer den Weg und ließen ihn wieder nach Süden drehen, worauf wir eine Kurve ritten, um ihn abzufangen.
Die Hunde rannten, als würden sie den Tod ihres Bruders rächen wollen, und die Wolfshunde führten sie an. Sie trieben den Wolfsdraken immer weiter, während Jagdhörner ertönten und die Reiter dirigierten. Allzu früh aber erreichten wir ein weiteres Wäldchen, und ich verstand, warum man ursprünglich dieses isolierte Dickicht gewählt hatte, um die Köder zu legen: Wären wir erst einmal im richtigen Wald, würde es viel schwieriger, den Draken zu finden und in die Falle zu jagen.
Trotz der Anstrengungen von Jägern und Hunden erreichte die Kreatur den Schutz des Waldes. Einer von Papas Jägern, ein Kerl mit einem so steinernen Gesicht wie die Hügel um uns, spuckte auf den Boden, und ich erinnerte mich daran, dass er nicht wusste, dass eine Dame anwesend war. »Wird jetzt nicht mehr so schnell fliehen«, sagte er und betrachtete die Schatten, in die der Drake verschwunden war. »Aber wir werden es verdammt schwer haben, ihn auszugraben.«
Dies gestattete uns die erste Verschnaufpause, seit die Jagd begonnen hatte. Einige der Männer führten kurze, unverständliche Gespräche, aus denen ich als einzige Information ziehen konnte, dass wir jetzt gewisse Techniken nutzen würden, die man aus der Wildschweinjagd kannte. Weil ich darüber nicht mehr wusste als über die Wolfsjagd, bedeutete diese Änderung nicht viel für mich, aber die Mastiffs wurden vorgeschickt und die Wolfshunde zurückgepfiffen. Die Lage verlangte nun eher Stärke als Schnelligkeit.
Die Kiefern in diesem Gebiet waren alt und hoch genug, dass wir oft unter ihren Ästen reiten konnten, ohne uns zu ducken, und das Dach aus ihren Nadeln bedeutete, dass der Boden verblüffend nackt war, außer wo ein Baum gefallen war und eine Lichtung geschaffen hatte, auf der andere Pflanzen wachsen konnten. Ich verlor schnell einen Großteil der Jagdgesellschaft aus den Augen, aber Jim blieb bei mir, und der Rest unserer Gruppe ritt auf unserer Seite. Zwischen den Bäumen hörten wir gelegentliche Rufe und Hornsignale, die uns sagten, dass noch nichts gesichtet worden war.
Dann ein hektisches Gebell … dann nichts.
Wir hielten inne, wo wir waren, und betrachteten unseren Pfad, weil vor uns dichtes Unterholz über den Boden wucherte. Ich sah Jim an und er mich. »Ich sollte Sie jetzt nach Hause bringen, Miss«, sagte er so leise, dass es niemand anders hören konnte, obwohl auch niemand in der Nähe war. »Das ist wirklich nicht mehr sicher.«
Zum ersten Mal war mir danach, ihm zuzustimmen. Mein einziges Ansinnen auf diesem Ausflug war es, den Draken lebend und mit eigenen Augen zu sehen statt als tote Trophäe, aber nun verstand ich, wie unwahrscheinlich das war. Der rasende Nebel, der einen der Hunde zerfleischt hatte, mochte wohl der beste Blick gewesen sein, den ich im Laufe des Tages bekommen würde.
Während ich darüber nachdachte, schrie Jim plötzlich und trieb sein Pferd direkt auf mich zu.
Bossy stieg und kreischte – ein schreckliches Geräusch – und stürzte dann auf die Seite, sodass sie mich aus dem Sattel schleuderte. Sie fiel um Haaresbreite neben mein Bein. Ich zerrte mich auf den trockenen Nadeln in eine sitzende Stellung, weil mir die Puste wegblieb, und Jim wimmerte und stöhnte auf eine Weise, die ich niemals zuvor gehört hatte.
Was aber meine Aufmerksamkeit erregte, war ein langes, dröhnendes Knurren.
In Ländern, wo Wolfsdraken immer noch häufig sind, gehört es zum Allgemeinwissen, dass sie weibliche Beute bevorzugen. Leider war dies ein Detail, das wir vergessen hatten und welches Sir Richard Egdeworth in seinem ansonsten hervorragenden Buch nicht eingeschlossen hatte.
Ich blickte auf den Wolfsdraken hinüber, der auf einem großen hervorstehenden Felsen hockte. Seine schuppige Haut zeigte ein dunkles Braun, das sich gut in unsere Umgebung einfügte, und seine Augen waren verstörend blutrot. Sein niedriger, gedrungener Körper besaß kräftige Beine, die in sichelartigen Klauen endeten, und einen langen, biegsamen Schwanz, der hypnotisch vor und zurück peitschte, wie bei einer Katze. Direkt hinter seinen Schultern bewegte und faltete sich ein Paar verkümmerter Schwingen.
Ich konnte meinen Blick nicht von ihm abwenden. Meine rechte Hand tastete blind in den Nadeln nach dem Gewehr, das ich hatte fallen lassen, aber ich fand es nicht. Panik stieg meine Kehle hoch. Die Klauen des Wolfsdraken spannten sich auf dem Stein. Ich fummelte mit meiner linken Hand herum, streckte sie immer weiter aus, und da! Meine Finger schlossen sich um den Griff eines Gewehrs. Ich zerrte es zu mir und hob es an, wie ich es bei den Männern gesehen hatte. Der Wolfsdrake spannte sich an, und als ich das Gewehr hochriss, sprang er auf mich zu, doch erst als sich meine Finger um den Abzug krümmten, erinnerte ich mich, wir hatten das Gewehr nicht geladen.
Ein ohrenbetäubender Knall dröhnte in meinen Ohren, und der Wolfsdrake landete direkt an meiner Seite, wobei seine Klauen durch mein Hemd und meine Schulter rissen wie ein Messer durch Butter.
Ich schrie und rollte mich weg und ließ das Gewehr wieder fallen, das Gewehr, das Jims gewesen sein musste, weil es ganz sicher geladen gewesen war. Was war mit Jim passiert? Der Wolfsdrake drehte sich und stellte sich mir wieder entgegen. Seine Fülle war agiler, als sie wirkte, und obwohl auf seiner Haut nun Blut war – ich hatte ihn mit einem Streifschuss getroffen –, war er bei Weitem nicht besiegt.
Hier sollte ich etwas Heroisches schreiben, doch in Wahrheit schoss mir nur dieser Gedanke durch den Kopf: Genau dafür bist du gekommen, und es ist das Letzte, was du je sehen wirst.
Weitere Schüsse knallten, diesmal nicht direkt in meinen Ohren, aber immer noch laut genug, dass ich wieder schrie und mich zusammenkrümmte, voller Panik, dass die Schüsse mich treffen würden, dass der Wolfsdrake wieder springen würde, dass ich auf diese oder jene Weise sterben würde.
Stattdessen hörte ich ein wildes Knurren, den gequälten Schrei eines Pferdes, brüllende Männer und schallende Jagdhörner und dann, nach ein oder zwei Augenblicken, einen gelobten Ton, den ich erkannte, denn es war dieselbe Hornmelodie, die man benutzte, wenn man von einer erfolgreichen Jagd zurückkehrte: Beute erlegt.
Dann standen Männer um mich und ich richtete mich auf, nur um festzustellen, dass irgendwann im Kampf meine Kappe heruntergefallen war und sich mein Haar aus der Schleife, mit der ich es an meinen Kopf gebunden hatte, gelöst hatte. Überall schienen braune Strähnen zu hängen und wie Banner zu wehen, die sagten: Hier! Seht! Ein Mädchen!
Was auch mehr oder weniger das war, was ich die Männer sagen hörte. (Aber mit etwas mehr Kraftausdrücken.)
Weitere Schreie, und dann war mein Vater da und starrte entsetzt auf mich herunter: der niedere heidnische Gott, entsetzt darüber, was sein Verehrer getan hatte. Ich starrte zu ihm zurück, glaube ich. Das ist die Stelle, wo die Dinge etwas vernebelt sind, weil ich weiß, dass ich in einen Schock fiel. Papa hob mich hoch und ich fragte nach Jim, aber niemand antwortete mir. Bald war ich auf Papas Pferd, immer noch in seinen Armen, und wir ritten aus dem Wald über den felsigen Hang zur Hütte eines Schäfers.
Ein Arzt hatte die Jagd begleitet, um sowohl Hunde als auch Männer zu versorgen. Er kam kurz nach uns an. Ich war aber nicht seine erste Patientin. Ich hörte Jims Stimme von der anderen Seite des kleinen Raums stöhnen, aber ich konnte ihn durch das Gedränge an anderen Leuten nicht sehen.
»Tut ihm nicht weh«, sagte ich zu niemand Bestimmtem, obwohl ich rein rational wusste, dass der Arzt versuchen musste, ihm zu helfen. »Gebt ihm keine Schuld. Ich brachte ihn dazu, es zu tun. Und er hat mich beschützt. Er ging dazwischen, als der Wolfsdrake mich angriff.« Das hatte ich mir nach den Ereignissen zusammengereimt.
Die Verletzungen, die Jim durch seine Heldentat erlitt, waren eines der zwei Dinge, die ihn davor bewahrten, schimpflich entlassen zu werden. Das andere war – auch wenn ich darauf wenig stolz bin – meine unermüdliche Verteidigung, weil ich darauf bestand, dass er nicht dafür beschuldigt werden durfte, dass er mich auf die Jagd mitgenommen hatte. Nun brodelten viel zu spät meine Schuldgefühle hoch, und ich fürchte, ich hackte noch darauf herum, lange nachdem mein Vater zugestimmt hatte, ihn zu behalten.
Alles das kam aber später. Sobald der Arzt mit Jim fertig war, kam er zu mir und vertrieb alle außer meinem Vater und dem nun schlafenden Jim aus der Hütte, weil die Wunde an meiner Schulter war und es nicht schicklich gewesen wäre, dass andere anwesend waren, während sie nackt war. (Dies hielt ich sogar damals schon für närrisch, weil junge Damen sehr wohl schulterfreie Kleider tragen können, die genauso viel Fleisch zeigen, wie es seine Untersuchung tat.)
Ich bekam Brandy zu trinken, was ich nie zuvor getan hatte, und sein Feuer ließ mir beinahe die Augen aus dem Kopf fallen. Sie brachten mich aber dazu, noch mehr zu trinken, und als ich genug in mir hatte, gossen sie etwas davon über die Wunden an meiner Schulter, um sie zu reinigen. Das brachte mich zum Weinen, aber dank des Brandys kümmerte es mich nicht länger besonders, dass ich weinte. Zu dem Zeitpunkt, als der Arzt anfing, mich zu nähen, bekam ich überhaupt nicht mehr viel mit, außer dass er Papa mit leiser Stimme erklärte: »Die Klauen waren scharf, deshalb ist das Fleisch nicht zu zerfetzt. Und sie ist jung und kräftig. Wenn keine Infektion droht, wird es gut heilen.«
Durch Lippen, die sehr dick und unkooperativ geworden waren, versuchte ich etwas darüber zu murmeln, dass ich schulterfreie Kleider tragen wollte, aber ich glaube nicht, dass es sehr deutlich herauskam, und dann schlief ich ein.
Mama plusterte sich bei meiner Rückkehr natürlich auf, aber niemand befragte mich sofort, weil sie vermuteten, dass ich Ruhe brauchte, um mich von meiner Tortur zu erholen. Das war nicht gänzlich eine Gnade. Es bedeutete, dass ich viele Stunden hatte, in denen ich mir vorstellen konnte, was sie zu mir sagen würden, wenn die Zeit kam. Und auch wenn ich wohl nicht Amandas lebhafte Fantasie habe, so ist meine doch, wenn man ihr genug Zeit gibt, adäquat.
Als man mir schließlich erlaubte, aus dem Bett zu kommen, einen Bademantel anzuziehen und ins Wohnzimmer hinauszugehen (zwei Tage nachdem ich mich für bereit dazu hielt), stellte ich fest, dass Papa mich erwartete.
Ich hatte mich darauf vorbereitet. Diese zwei Tage hatten neben den Nachteilen auch ihre Vorteile gehabt. »Erholt sich Jim gut?«, fragte ich, ehe Papa irgendetwas sagen konnte, weil mir niemand irgendetwas von ihm erzählt hatte.
Papas Gesicht zog hinter seinem Bart noch tiefere Furchen. »Das wird er. Er bekam aber eine ordentliche Wunde ab.«
»Das tut mir leid«, sagte ich aufrichtig. »Wäre er nicht gewesen, wäre ich jetzt vielleicht tot. Es ist nicht seine Schuld, dass ich dort war, weißt du.«
Seufzend bedeutete mir Papa, mich hinzusetzen. Ich setzte mich auf einen Stuhl statt auf das Sofa, auf das er zeigte, weil ich nicht so wirken wollte, als würde ich mich vielleicht hinlegen müssen. »Ich weiß«, sagte er mit einer ganzen Welt an Erschöpfung in seinem Tonfall. »Wahnsinn wie dieser hätte von Anfang an nicht seine Idee sein können. Er hätte es natürlich verweigern und mir berichten sollen …«
»Ich hätte ihn nicht gelassen«, unterbrach ich ihn, begierig darauf, mich zur Märtyrerin zu machen. »Du darfst ihm …«
»Nicht die Schuld geben, ich weiß. Das hast du schon viele Male gesagt.«
Ich hatte genug Verstand, um meinen Mund zu halten, anstatt weiter zu protestieren.
Papa seufzte wieder, als er zu mir herüberblickte. Das Licht des Vormittags kam durchs Fenster und erleuchtete all die Rosen, die in meine Kissen gestickt waren. In seinem nüchternen grauen Anzug wirkte mein Vater schrecklich fehl am Platze. Ich konnte mich nicht an das letzte Mal erinnern, als er in mein Wohnzimmer gekommen war, falls er das überhaupt je getan hatte.
»Was soll ich nur mit dir tun, Isabella?«, fragte er.
Ich senkte meinen Kopf und versuchte, kleinlaut zu wirken.
»Ich kann mir die Geschichte vorstellen, die du mir erzählen wirst, wenn ich dir den Hauch einer Chance gebe. Du wolltest den Wolfsdraken sehen, ja? Vorzugsweise lebendig anstatt tot und ungefährlich. Ich vermute, ich muss Sir Richard Edgeworth dafür die Schuld geben.«
Daraufhin schoss mein Kopf hoch, und zweifellos war mir mein schlechtes Gewissen ins Gesicht geschrieben.
Er nickte. »Oh, ich achte genauer auf meine Bücherei, als du zu denken scheinst. Der Katalog, so sorgfältig aufgeschlagen, und dann ein Buch, das von weitaus weniger Staub bedeckt ist, als es sein sollte. Was deine Mutter als Hinweis aufnehmen würde, dass wir das Hausmädchen entlassen sollten – aber mir macht ein wenig Staub nichts aus. Besonders, wenn er mich über die heimlichen Aktivitäten meiner Tochter unterrichtet.«
Auf unerklärliche Weise sorgte dies dafür, dass sich meine Augen mit Tränen füllten, als sei das Herumschleichen in seiner Bücherei ein größerer Anlass für Buße als meine Eskapade mit dem Wolfsdraken. Mamas Enttäuschung war mir wohlvertraut, aber dies konnte ich, wie ich feststellte, nicht ertragen. »Es tut mir leid, Papa.«
Das Schweigen zog sich hin. Von Scham überwältigt fragte ich mich, wie viele von den Hausmädchen an den Schlüssellöchern lauschten.
Schließlich richtete Papa sich auf und sah mir in die Augen. »Ich muss an deine Zukunft denken, Isabella«, sagte er. »Genau wie du. Du wirst nicht ewig ein junges Mädchen sein. In wenigen Jahren müssen wir einen Ehemann für dich finden, und das wird nicht einfach, wenn du weiter darauf bestehst, dich in Schwierigkeiten zu bringen. Verstehst du das?«
Kein Gentleman würde eine Ehefrau wollen, die wegen Abenteuern mit gefährlichen Bestien von Narben übersät war. Kein Gentleman würde sich eine Frau nehmen, die ihm Schande machen würde. Kein Gentleman würde mich heiraten, wenn ich so weitermachte.
Für wenige, zitternde, trotzige Augenblicke wollte ich meinem Vater erklären, dass ich dann eben als alte Jungfer leben würde und alles andere doch verdammt sein sollte. (Ja, ich dachte es wirklich mit diesen Ausdrücken; glauben Sie, dass vierzehnjährige Mädchen nie Männer fluchen gehört haben?) Das waren die Dinge, die ich liebte. Warum sollte ich sie aufgeben – für die Gesellschaft eines Mannes, der mich alleine den Haushalt führen und mich ansonsten zu Tode langweilen lassen würde?
Aber ich hatte nicht so wenig gesunden Menschenverstand, dass ich geglaubt hätte, Trotz würde zu Glück führen, für mich oder sonst irgendwen. Die Welt funktionierte einfach nicht so.
Oder so kam es mir vor, im weisen Alter von vierzehn.
Deshalb presste ich meine Lippen zusammen und sammelte meine Kraft. Unter den Verbänden, die sie bedeckten, schmerzte meine Schulter.
»Ja, Papa«, sagte ich. »Ich verstehe.«
DREI
Die grauen Jahre – Pferde und Zeichnen –Sechs Namen für meine Saison – Die Menagerie des Königs –Ein peinliches Gespräch dort – Die Aussicht auf einen Freund –Meine Saison setzt sich fort – Ein weiteres peinliches Gespräch,mit guten Ergebnissen
Ich werde Ihnen jeglichen längeren Bericht über die folgenden beiden Jahre ersparen. Es reicht, wenn ich sage, dass ich sie auf immer »die grauen Jahre« nannte, weil der Versuch, mich dem Schema für eine angemessene junge Dame anzupassen, gegen meine wahren Vorlieben, beinahe jegliche Farbe aus meinem Leben tilgte.
Meine Kuriositätensammlung aus der Welt der Natur verschwand, auf den Boden im Wäldchen hinter unserem Haus gekippt. Die Karten, die ich geschrieben hatte, um verschiedene Exponate zu beschriften, wurden mit großem (um nicht zu sagen melodramatischem) Zeremoniell verbrannt. Ich brachte nichts Schmutzigeres mehr als gelegentlich eine im Garten gepflückte Blume nach Hause.
Nur Grünie blieb da, in einem Versteck, wo ihn Mama nicht finden würde. Ich brachte es nicht übers Herz, diesen einen Schatz zu entsorgen.
Ich wäre aber eine Lügnerin, wenn ich behaupten würde, dass ich meine Passion gänzlich aufgab. Pferde waren ein akzeptabler Zeitvertreib, wo es Drachen nicht waren, und so wandte ich ihnen gemeinsam mit Amanda Lewis meine Aufmerksamkeit zu. Sie hatten keine Flügel – ein Fehler, den ich ihnen nie ganz verzieh –, aber ich lernte in diesen zwei Jahren eine Menge über sie: die unterschiedlichen Zuchtlinien und ihre Eigenschaften, Farbschläge, die verschiedenen Gänge, sowohl die, die natürlich vorkamen, als auch die, die erlernt werden konnten. Ich führte in einem Code, den Mama nicht lesen konnte, ausführliche Tagebücher und notierte darin Tausende Details der Pferdenatur, vom Erscheinungsbild über Bewegungsmuster, Verhalten und noch mehr.
Pferde führten zufällig und indirekt zu einer neuen und unerwarteten Quelle des Vergnügens. Während meine Schulter heilte – und sogar noch eine lange Zeit danach –, betrachtete man mich als zu zerbrechlich zum Reiten, aber ich hielt es nicht aus, die ganze Zeit im Haus zu sein. Deshalb ließ ich die Bediensteten bei schönem Wetter einen Stuhl an die Koppel stellen und setzte mich dort zum Zeichnen hin.
Die Leute sagen oft höfliche und absolut fehlgeleitete Dinge über mein »Talent« für Kunst. In Wahrheit habe ich kein Talent, und ich hatte es auch nie. Wenn irgendeine meiner jugendlichen Skizzen überlebt hätte, würde ich sie als Beweis zeigen, denn diese waren so ungelenk wie die eines jeden Anfängers. Aber Zeichnen war eine angemessene Beschäftigung für eine junge Dame – eine der wenigen, die mir Spaß machten –, und ich bin sehr stur. Also lernte ich durch entschlossenes Üben die Regeln von Perspektive und Schatten und wie ich das, was ich sah, mit Zeichenkohle oder Bleistift wiedergeben konnte. Andrew, den diese Wendung des Geschehens langweilte, verließ mich für eine Weile, aber ich konnte ihn davon überzeugen, mir Bescheid zu sagen, wenn der Pferdedoktor kam, um Verletzungen zu behandeln oder Fohlen zur Welt zu bringen, und so lernte ich etwas über Anatomie. Mama war erleichtert, als sie sah, dass ich mir einen damenhaften Zeitvertreib zugelegt hatte, und stellte sich bei diesen Exkursionen blind.
In dieser Zeit schien es mir ein armseliger Ersatz für meine großartigen Abenteuer, die (wie ich dachte) endgültig Geschichte waren. Mit der Weisheit des Alters aber wurde ich dankbarer für die Früchte dieser grauen Jahre. Sie schulten meinen Blick und lehrten mich, Notizen über das zu machen, was ich sah: zwei Fertigkeiten, die die Grundlage aller meiner Leistungen seither bildeten.
Trotz alledem aber waren es zwei sehr langweilige, sehr zähe Jahre.
Ihr Ende kam mit meinem sechzehnten Geburtstag und meinem offiziellen Übergang vom »Mädchen« zur »jungen Frau«. Mama kümmerte sich deshalb um meine Zukunft – oder ich sollte eher sagen, sie setzte die Pläne in die Tat um, die sie gemacht hatte, seit ich zur Welt gekommen war. Sie hatte große Ambitionen für meine Heirat: Sir Daniel Hendemores einzige Tochter sollte keinen Gentleman aus dem Tal von Tam River heiraten, sondern nach Falchester reisen und als Debütantin in die Gesellschaft eingeführt werden, wo sie wohl wirklich einem sehr vornehmen Mann ins Auge fallen konnte.
Meine Geduld für mein Märtyrertum hätte sich wohl nicht ganz so weit erstreckt, als dass ich auch dies friedlich ertragen hätte, wäre da nicht ein verblüffendes Gespräch gewesen, das ich mit meinem Vater führte, kurz bevor ich nach Falchester gezerrt werden sollte.
Wir hatten diese Begegnung in seinem Studierzimmer, wo ich meine Augen von den Regalen mit meinen alten, verbotenen Freunden abwandte. Mein Vater lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und verschränkte seine Hände vor sich.
»Es ist nicht meine Intention«, sagte er, »dich ins Unglück zu zwingen, Isabella.«
»Das weiß ich, Papa«, antwortete ich, ein Bild von töchterlicher Bescheidenheit.
Vielleicht ließ ein Lächeln seinen Mund unter seinem Bart zucken, vielleicht bildete ich es mir auch einfach ein. »Du machst das sehr gut«, sagte er, während seine Zeigefinger aneinandertippten. »In der Tat bist du eine wahre Zierde für uns geworden, Isabella. Ich weiß aber, dass diese Jahre nicht leicht für dich waren.«
Darauf antwortete ich nicht, weil ich nichts Damenhaftes zu sagen hatte. Seine Wertschätzung war mir zu wichtig, um sie zu riskieren.
Nach einer Pause sagte er: »Ehestifter sind heutzutage aus der Mode gekommen. Wir scheinen zu glauben, dass wir es ohne professionelle Hilfe besser können. Aber ich habe mir erlaubt, einen zu bezahlen, damit er eine kleine Liste erstellt, die du auf dem Tisch an deiner Seite finden wirst.«
Verwirrt fand ich das Papier und entfaltete es, sodass sechs Namen zu lesen waren.
»Ein Gatte, der willens ist, eine Bücherei für seine bücherliebende Frau zu unterhalten, ist nicht leicht zu finden. Die meisten würden es als Geldverschwendung betrachten. Du könntest allerdings jemanden finden, der willens ist, seine Bücherei mit dir zu teilen. Die Gentlemen auf dieser Liste sind allesamt Amateurgelehrte mit gut ausgestatteten Studierzimmern.« Papas Augen funkelten mich unter seinen Brauen an und die Falten um sie zuckten verschmitzt. »Ich habe es aus sicherer Quelle, dass diejenigen, die ich unterstrichen habe, Ausgaben von Eine Allgemeine Drachenkunde besitzen.«
Weil ich mir seit zwei Jahren nicht gestattet hatte, an diesen Namen zu denken, traf er mich mit etwa derselben Wucht, die, wie ich mir vorstellen kann, den Namen einer Jugendliebe begleitet, die man seit Jahren nicht gesehen hat. Für einen Augenblick verstand ich Manda und ihre Groschenromane.
Ehe ich erfolgreich meine Sprache wiederfand, fuhr Papa fort. »Ich habe keinen von ihnen für dich gesichert. Diese Aufgabe bleibt für dich und deine Mutter, die mir für meine Einmischung nicht dankbar wäre. Sie sind aber alle geeignete Kandidaten, und solltest du dir einen schnappen, verspreche ich dir meine Zustimmung.«
Er stand rechtzeitig aus seinem Stuhl auf, um mich aufzufangen, als ich um seinen Schreibtisch gerannt kam, um ihn zu umarmen. Ein Lachen voll verblüffter Freude brach aus mir hervor. Nach unserem Gespräch in meinem Wohnzimmer hatte ich meinen Vater vom kleineren heidnischen Gott zum wohlmeinenden Ungeheuer demontiert – aber es schien, dass sich meine pflichtbewussten Anstrengungen dieser zwei vergangenen Jahre auszahlten.
Sechs Namen. Sicher würde einer von ihnen mich glücklich machen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: