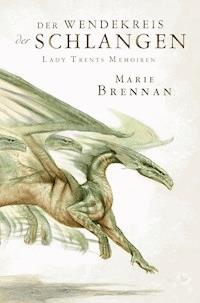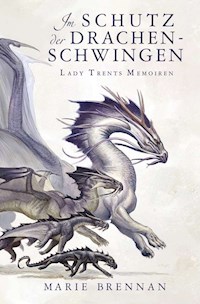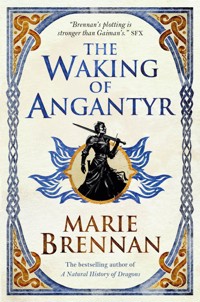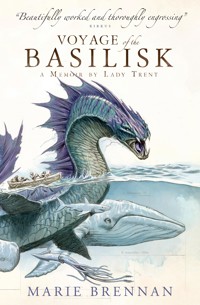Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Lady Trents Memoiren
- Sprache: Deutsch
Lady Trents Entdeckungen in Akhien sind der Stoff romantischer Legenden und haben sie von akademischer Bedeutungslosigkeit zu weltweitem Ruhm katapultiert. Die Details ihres Privatlebens während jener Zeit sind ebenso bekannt und haben bis über die Landesgrenzen hinaus für Aufregung gesorgt. Doch, wie es in der Karriere dieser schillernden Frau so oft der Fall ist, ist die Geschichte, welche die Öffentlichkeit kennt, bei Weitem nicht vollständig. Im vierten Band ihrer Memoiren erzählt Lady Trent, wie sie zu ihrer Anstellung bei der Scirländischen Königlichen Armee kam, wie ausländische Saboteure ihr Leben in Gefahr brachten, und wie die entschlossene Suche nach Wissen sie in die tiefsten Schluchten des Labyrinths der Draken führte, wo das Verhalten eines Drachens durch Zufall die Voraussetzungen für ihre bisher größte Errungenschaft schuf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
ImLABYRINTHder DRAKEN
LADY TRENTS MEMOIREN
MARIEBRENNAN
Ins Deutsche übersetzt vonAndrea Blendl
Die deutsche Ausgabe von LADY TRENTS MEMOIREN 4: IM LABYRINTH DER DRAKEN wird herausgegeben von Amigo Grafik, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg.Herausgeber: Andreas Mergenthaler und Hardy Hellstern,Übersetzung: Andrea Blendl; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde;Lektorat: Kerstin Feuersänger; Korrektorat: André Piotrowski; Satz: Rowan Rüster/Amigo Grafik;Illustrationen Innenteil: Todd Lockwood, Karte: Rhys Davies,Printausgabe gedruckt von CPI Moravia Books s.r.o., CZ-69123 Pohořelice.Printed in the Czech Republic.
Titel der Originalausgabe: THE MEMOIRS OF LADY TRENT 4: IN THE LABYRINTH OF DRAKES
Copyright © 2015 by Bryn NeuenschwanderGerman translation copyright © 2018, by Amigo Grafik GbR.
Print ISBN 978-3-95981-806-3 (November 2018)E-Book ISBN 978-3-95981-807-0 (November 2018)
WWW.CROSS-CULT.DE
Inhalt
VORWORT
TEIL EINS
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
TEIL ZWEI
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
TEIL DREI
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
TEIL VIER
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
VORWORT
Ich vermute, ein gewisser Anteil meiner Leserschaft wird den Titel dieses Bandes sehen und erwarten, dass sich alles, was er enthält, einer bestimmten Entdeckung widmet, die im Labyrinth der Draken gemacht wurde. Ich werde sie tatsächlich an der entsprechenden Stelle erläutern – da haben Sie nichts zu befürchten –, aber wenn diese Entdeckung das Einzige ist, wofür Sie sich interessieren, dann sollten Sie dieses Buch sofort zuklappen und sich eine Ausgabe von Naomi Songfields ausgezeichneter Studie Unter den Augen der Wächter besorgen. Jenes Buch wird Ihnen das geben, was Sie wollen – mit all den sorgfältig recherchierten Details, die Sie sich erhoffen können (und noch eine Menge darüber hinaus).
Die Übrigen von Ihnen sind, wie ich annehme, für den Rest hier, die Vorfälle und Probleme, die sich mir während der Vorlaufzeit und nach jener Entdeckung stellten. Das war ein außerordentlich komplexer Abschnitt in meinem Leben, und es ist nicht einfach, die Geschichte zu erzählen. Binnen eines einzigen Jahres kämpfte ich mit moralischen, intellektuellen und politischen Dilemmas, riskierte mein Leben sowohl freiwillig als auch unfreiwillig, ertrug einige der schlimmsten Schmähungen meiner Karriere, erzielte einige meiner größten Erfolge und traf eine Entscheidung, die den Lauf meines Lebens völlig veränderte.
Es ist letztlich eine überaus persönliche Geschichte. (Eine seltsame Aussage über einen Lebensabschnitt, der am Ende so gewaltige öffentliche Aufmerksamkeit erregte, ich weiß.) Selbst ich, die ich normal so schamlos bin, habe bei zahlreichen Gelegenheiten gezögert, während ich sie aufschrieb, denn ich kann viele dieser Ereignisse nicht erklären, ohne Details aus dem tiefsten Inneren meines Herzens und Verstandes zu teilen. Das ist natürlich der Sinn von Memoiren, und ich wusste das, als ich mich an meine Aufgabe machte, aber jetzt, wo die Zeit gekommen ist, um von solchen Angelegenheiten zu sprechen, muss ich gestehen, dass ich Zweifel habe. Was auch immer meine professionellen Leistungen mir an Ruhm eingebracht haben, ich mache mir keine Illusionen, dass meine persönlichen Gedanken und Handlungen dasselbe tun werden.
Sei es, wie es sei: Dies ist meine Geschichte, und ich werde sie so erzählen, wie ich es für angemessen halte. Ich werde mich deshalb dem verschlungenen Pfad widmen, der mich zum Labyrinth der Draken führte – einem Pfad, der voll von allen Arten an Hindernissen war, von wissenschaftlichen Rätseln bis zu Mordversuchen –, und lade Sie ein, verehrte Leser, ihm mit mir zu folgen.
Isabella, Lady TrentFalchester26 Ventis, 5661
TEIL EINS
In welchem die Schreiberin dieser Memoirentrotz des Widerstands mehrerer Beteiligtereine Arbeitsstelle erhält
EINS
Ein Stellenangebot – Drachenzucht – Lord RossmeresBedingung – Suche nach einem alten Freund –Meine Studie – Vorbereitungen für den Aufbruch –Gedanken über die Vergangenheit
Es ist sehr wenig vergnüglich, wenn man bei einer Aufgabe, für die man gut qualifiziert ist, übergangen wird. Es ist allerdings ziemlich vergnüglich, wenn man später beobachten kann, wie diejenigen, die einen übergangen haben, zu Kreuze kriechen müssen.
Mein Dank für dieses Vergnügen gilt Thomas Wilker, der seit vielen Jahren mein Kollege in wissenschaftlichen Angelegenheiten war. Er war Mitglied im Philosophenkolloquium und ich nicht – weil sich diese ehrwürdige Gesellschaft dazu herabgelassen hatte, gelegentlich einen Mann von weniger als nobler Geburt in ihre Reihen aufzunehmen, aber keine Damen, unabhängig deren Abstammung. Präzise ausgedrückt war es Tom und nicht ich, der übergangen wurde.
Der Posten, den man ihm verweigerte, war Gegenstand eines ernsthaften Wettstreits. Die Naturkunde war als Forschungsgebiet noch nicht schrecklich alt. Das spezialisiertere Feld der Drachenkunde hatte sich erst kürzlich zu einem eigenständigen Studiengebiet entwickelt. Toms und meine eigenen Veröffentlichungen spielten für diese Entwicklung eine Rolle, aber wir waren nicht die Einzigen. Es gab in Anthiopien locker ein halbes Dutzend Leute mit ähnlichen Interessen, nicht zuletzt den geschätzten Herrn Doktor Stanislau von Lösberg.
Dieses halbe Dutzend lebte aber im Ausland, an Orten wie Eiverheim und Thiessin. In Scirland gab es niemanden, dessen Qualifikationen denen von Tom wirklich ebenbürtig waren, jetzt, wo er ein Kolloquiumsmitglied war. Wenn eine Stelle frei wurde, für die man im Speziellen einen Drachenkundler brauchte, hätte er die erste Wahl sein müssen – wie er es tatsächlich war.
Jedes Gerücht, das behauptet, dass er die Stelle nicht annahm, ist falsch. Tom hat sich nicht geweigert. Im Gegenteil, er erklärte seinen potenziellen Arbeitgebern, dass er und ich sie mit Freuden annehmen würden. Als diese sagten, dass das Angebot ihm allein gelte, versicherte er ihnen, dass ich kein Gehalt benötigen würde, weil meine letzten Vortragsreisen und Veröffentlichungen mir ein recht angenehmes Einkommen beschert hatten. (Was das betrifft, hätte ich das Gehalt schon brauchen können, denn mein Einkommen reichte nicht so weit, wie ich es gerne gehabt hätte – aber ich hätte das für eine solche Chance ignoriert.) Sie stellten klar, dass ich, ungeachtet meiner Finanzen, bei dieser Unternehmung nicht willkommen sei. Tom bestand darauf, dass sie uns nur im Doppelpack bekommen konnten. Statt uns stellten sie Arthur Halstaff an, den Baron von Tavenor, und das war es dann.
Vorerst.
Anderthalb Jahre später kamen die fraglichen Arbeitgeber zu Kreuze gekrochen. Lord Tavenor hatte seine Stellung gekündigt. Er hatte bisher keinen Erfolg gehabt und außerdem Schwierigkeiten mit den Einheimischen. Das Angebot an Tom wurde erneuert. Ebenso erneuert wurde seine Bedingung – nur dass er diesmal sagte, dass nach reiflicher Überlegung ein Gehalt für mich doch genau richtig sei. Er machte recht deutlich, dass sie sich ihr Angebot an den Hut stecken konnten, wenn sie es nicht für nötig hielten, diese Bedingung zu erfüllen.
Kurzum, auf diese Weise kam es dazu, dass ich von der Königlichen Scirländischen Armee in den Wüsten von Akhien dafür angestellt wurde, deren ganz eigene Herde Drachen aufzuziehen.
Das Problem der Drachenzucht war nicht neu. Schon zu Urzeiten träumte die Menschheit davon, Drachen für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Das nahm jede vorstellbare Form an, davon, auf den Rücken eines ausgewachsenen Drachen zu springen und zu hoffen, ihn einreiten zu können – ein Versuch, der stattdessen fast unweigerlich mit einem kaputten Reiter endet –, über das Stehlen von frisch geschlüpften Exemplaren oder Eiern wegen der Theorie, dass eine junge Kreatur leichter zu zähmen sei, bis dahin, Drachen in Käfige zu sperren und sie optimistisch zur Paarung zu ermutigen.
Letzteres ist selbst mit weniger gefährlichen wilden Tieren schwierig. Geparden zum Beispiel sind dafür bekannt, in ihrem Paarungsverhalten sehr wählerisch zu sein, und gehen sehr schnell von Desinteresse zu Zorn und dann dazu über, ihre ehemaligen Liebhaber zu zerfleischen. Andere verweigern die Aufgabe gänzlich: Egal ob es an ihrem Schamgefühl oder irgendeinem anderen Grund liegt, die Riesenpandas aus Yelang haben sich unseres Wissens noch nie innerhalb der Zäune einer kaiserlichen Menagerie fortgepflanzt.
(Ich nehme an, ich sollte eine Vorwarnung aussprechen. Weil sich dieser Band meiner Memoiren mit meiner Forschung in Akhien beschäftigt, wird er notwendigerweise recht viel über das Paarungsverhalten von Drachen und anderen Kreaturen enthalten. Diejenigen, deren Gemüt zu sensibel sind, um solche Offenheit zu ertragen, wären wohl besser beraten, wenn sie sich von einem hartgesotteneren Freund eine sorgfältig bereinigte Version vorlesen lassen. Allerdings fürchte ich, dass diese Ausgabe ziemlich kurz sein könnte.)
Drachen sind in dieser Hinsicht sogar noch weniger lenkbar. Die Yelangesen insbesondere haben eine lange Geschichte von Zuchtversuchen mit ihren Drachen hinter sich, aber trotz einiger recht grandioser historischer Behauptungen gibt es keine verlässlichen Beweise, dass ihre Erfolge irgendetwas anderes als von der winzigsten Sorte waren. Große Drachen, die Art, die einem in den Sinn kommt, wenn man das Wort hört, wollen einfach nicht kooperieren.
Und doch war es die Kooperation großer Drachen, die wir im dritten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts am meisten brauchten.
Der Grund waren natürlich ihre Knochen. Erstaunlich leicht und phänomenal stark, ist Drachenbein eine wundersame Substanz … wenn man sie bekommen kann. Die Knochen zerfallen nach dem Tod schnell, sobald ihre besondere chemische Zusammensetzung nicht mehr von Fleisch und Blut geschützt wird. Ein Chiavorer namens Gaetano Rossi hatte eine Methode entwickelt, um sie zu konservieren. Tom Wilker und ich hatten diese Methode gestohlen. Sie wurde uns ebenfalls gestohlen und an eine Gesellschaft in Va Hing verkauft. Drei Jahre bevor ich nach Akhien reiste, wurde öffentlich bekannt, dass die Yelangesen Drachenknochen benutzten, um funktionierende Caeliger zu bauen: Luftschiffe, die man zu mehr als reine Kuriositäten verwenden konnte.
»Wenn Sie der Krone mitgeteilt hätten, was Sie wussten, als Sie es erfuhren«, sagte Lord Rossmere bei unserem ersten Treffen zu Tom und mir, »wären wir jetzt nicht in dieser Lage.«
Ich erklärte daraufhin nicht, dass ich die Information gerade, um unsere derzeitige Lage zu verhindern, geheim gehalten hatte. Erstens, weil es nur teilweise zutraf, und zweitens, weil mir Tom fest auf den Fuß trat. Er hatte ziemlich hart gearbeitet, um uns diese Chance zu ermöglichen, und wollte nicht, dass ich sie verschwendete, indem ich einen Brigadegeneral der Königlichen Armee unverfroren ansprach. Stattdessen gab ich meine Gedanken etwas gemäßigter wieder. »Ich weiß, dass es vielleicht nicht so wirkt, aber wir haben einen Vorteil gegenüber den Yelangesen. Ich glaube, dass unsere Forschung zur Drachenknochensynthese dank der großen Mühen von Frederick Kemble ein gutes Stück weiter fortgeschritten ist als ihre. Er hatte mehrere Jahre, um an dem Problem zu arbeiten, während der Rest der Welt nichts davon wusste.«
Lord Rossmere ignorierte meinen Kommentar und richtete seine nächsten Worte an Tom. »Ich vergieße über den Tod von Drachen keine Träne, wenn sie uns nützlich sein können. Ich bin aber auch Pragmatiker. Scirland hat bereits einen Großteil seiner abbaufähigen Eisenerzminen ausgebeutet, und dank Ihrer Kameradin haben wir auch unseren Brückenkopf in Bayembe verloren. Wenn wir jetzt die Hälfte der Drachen als Rohstoff töten, dann werden wir in einer Generation um die wenigen verbleibenden kämpfen. Wir brauchen einen nachwachsenden Vorrat, und das bedeutet, dass wir sie züchten müssen.«
Nichts davon war Tom oder mir neu. Lord Rossmere sprach allerdings nicht, um uns zu informieren. All dies war Vorgeplänkel für seine nächste Aussage. Er fuhr fort: »Ihre Arbeit muss unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ausgeführt werden. Die Formel für die Knochenkonservierung mag zwar weltweit bekannt sein, aber niemand hatte bisher viel Glück mit der Zucht. Die Nation, die Drachen erfolgreich zu diesem Zweck einsetzt, wird einen anhaltenden Vorteil gegenüber ihren Rivalen genießen, und wir haben nicht vor, diese Gelegenheit zu verschwenden.«
Es gab mindestens zwei Nationen mit diesem speziellen Geheimnis. Scirland hatte keine echten Drachen mehr übrig, nur drakonische Vettern, wie zum Beispiel die Funklinge, mit denen ich so viele Jahre zuvor meine Forschung angefangen hatte. Die Politik ergibt oft seltsame Bettgenossen. In diesem Fall steckten wir mit Akhien unter einer Decke, dessen Wüstendraken für diesen Zweck perfekt geeignet wären – falls wir die Tiere zum Kooperieren bewegen konnten.
Tom sagte: »Wir werden natürlich tun, was wir können. Man wird aber weitaus mehr als zwei Leute brauchen, um die notwendigen Arbeiten auszuführen … Ich glaube, Lord Tavenor hatte einen Stab, der ihn unterstützte?«
»Ja, natürlich. Einige akhische Arbeiter, und das Anwesen ist gleichzeitig die Kaserne für unsere Streitkräfte in Qurrat. Es gibt dort einen Gentleman, mit dem Sie zu tun haben werden …« Lord Rossmere schob einige Papiere zur Seite und suchte. »Husam ibn Ramiz ibn Khalis al-Aritati. Ein Scheich von einem ihrer Stämme. Man hat uns versichert, dass er vertrauenswürdig ist.«
»Ich nehme an, dass wir auch Zugang zu Lord Tavenors Aufzeichnungen bekommen?«, fragte ich. »Er hat nichts von seiner Arbeit veröffentlicht. Offensichtlich hatte er keinen Erfolg, sonst würden Sie nicht nach einem Ersatz für ihn suchen, aber wir müssen wissen, was er getan hat, damit wir keine Zeit damit verschwenden, seine Fehler zu wiederholen.« Abhängig davon, was wir in seinen Aufzeichnungen finden konnten, sah ich voraus, dass wir ziemlich viel Zeit damit verbringen würden, seine Fehler zu wiederholen, um zu sehen, ob es seine Theorien oder seine Methoden waren, die gescheitert waren. Doch Tom und ich hatten das schon zuvor diskutiert, und meine pflichtbewusste Frage diente nur dazu, den Boden für Toms eigene Antwort zu bereiten.
Mein Kamerad runzelte kunstvoll die Stirn und sagte: »Ja, das Fehlen von Veröffentlichungen ist recht besorgniserregend für eine wissenschaftliche Unternehmung dieser Art. Es kommt mir wie eine ziemliche Verschwendung vor. Mir ist bewusst, dass alles, was die Drachenzucht betrifft, unter Verschluss gehalten werden muss – aber wir hätten gerne eine Übereinkunft, dass Dame Isabella und ich unsere anderen Entdeckungen veröffentlichen dürfen, wie es uns angemessen scheint.«
Es war seltsam zu hören, wie Tom sich auf mich als »Dame Isabella« bezog. Wir waren seit Mouleen nicht mehr so förmlich miteinander umgegangen. Tatsächlich hatten wir eine unausgesprochene Übereinkunft, dass wir unseren Standesunterschied nie wieder zwischen uns stehen lassen würden. Förmlichkeit war aber notwendig, wenn man mit Männern wie Lord Rossmere umging. Der Brigadegeneral plusterte sich verärgert auf. »Andere Entdeckungen? Wir schicken Sie dorthin, um Drachen zu züchten, nicht, um herumzulaufen und zu erforschen, was auch immer Sie wollen.«
»Wir werden dieser Aufgabe natürlich unsere volle Aufmerksamkeit widmen«, versicherte ich und machte meinen Tonfall so versöhnlich, wie ich konnte. »Aber während wir genau das tun, werden wir zweifellos Tausende anatomische Details und Verhaltensmuster beobachten, die keine Staatsgeheimnisse bleiben müssen. Mathieu Sémery hat in Thiessin mit seiner Studie über Wyverne in Bulskevo ziemlich viel Bewunderung eingeheimst. Ich würde nicht gerne sehen, wie Scirland in den Augen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zurückfällt, nur weil wir über alles Schweigen bewahren, was wir vielleicht entdecken.«
Dies war keine Situation, in der ich mir heimlich schwören, dass ich tun würde, was ich wollte, und auf die Konsequenzen pfeifen konnte. Das mochte ausreichen, wenn ich bei der Feldforschung Hosen trug oder für meine Freundschaft mit verschiedenen Männern, egal welche Gerüchte daraus resultierten … aber wenn wir gegen unsere Vereinbarung mit der Königlichen Armee verstießen, konnten Tom und ich im Gefängnis landen. Ich war fest entschlossen, mir diese Chance nicht entgehen zu lassen, doch zuerst brauchten wir Lord Rossmeres Zustimmung.
Er machte sich keine Mühe, sein Misstrauen zu verbergen, und sagte: »Welche Art von Dingen würden Sie Ihrer Vorstellung nach veröffentlichen?«
Ich zermarterte mir das Hirn nach dem langweiligsten vorstellbaren wissenschaftlichen Thema. »Oh, vielleicht … das Putzverhalten des Wüstendraken nach dem Fressen. Lecken sie sich sauber, wie Katzen es tun? Oder rollen sie sich vielleicht im Sand – und falls ja, welche Auswirkung hat diese Reibung auf ihre Schuppen …«
»Danke, Dame Isabella, das reicht.« Ich hatte Lord Rossmere mit Erfolg ausreichend gelangweilt. »Sie werden alles, was Sie schreiben, in Qurrat bei Oberst Pensyth einreichen, zusammen mit einer Liste der Veröffentlichungen und Individuen, denen Sie es schicken möchten. Er wird sich, wenn nötig, mit General Lord Ferdigan absprechen – und wenn sie zustimmen, dann, ja, dann dürfen Sie veröffentlichen. Aber diese Männer haben die endgültige Entscheidungsbefugnis in der Angelegenheit.«
Mir gefiel der Gedanke an eine militärische Überprüfung nicht sehr, aber das war wahrscheinlich das Beste, worauf Tom und ich hoffen konnten. »Danke.« Ich versuchte, aufrichtig zu klingen.
»Wie bald sollen wir anfangen?«, fragte Tom.
Lord Rossmere schnaubte. »Wenn ich Sie morgen auf ein Boot setzen könnte, würde ich das tun. Falls Sie nicht einen Weg finden, dass Drachen schneller ausgewachsen werden, wird es Jahre dauern, bis wir einen angemessenen Vorrat haben – und das nur, wenn Sie sofort Erfolg haben. Die Yelangesen verfolgen zweifellos dasselbe Ziel. Wir haben keine Zeit zu verschwenden.«
»Weil Sie uns nicht morgen auf ein Boot setzen können …«, soufflierte ich.
»Wie schnell können Sie aufbrechen?«
Seine Fragestellung machte deutlich, dass »Übermorgen« die ideale Antwort wäre und dass sich seine Laune mit jedem weiteren Tag, den er warten musste, verschlechtern würde. Tom und ich tauschten Seitenblicke. »Diese Selemer-Woche?«, schlug Tom vor.
Ich war in meinem Leben oft genug gereist, sodass ich es effizient vorbereiten konnte. »Das sollte machbar sein«, stimmte ich zu.
»Wunderbar.« Lord Rossmere notierte es sich. »Ich werde sofort schreiben, wenn wir Ihre Überfahrt gebucht haben. Mr. Wilker, Sie werden im Männerhaus im Segulistenviertel von Qurrat logieren. Dame Isabella, Sie werden bei einer einheimischen Familie wohnen, einem gewissen Shimon ben Nadav. Auch Segulist natürlich, aber, wie Sie sich wohl denken können, ein Tempelverehrer. Es gibt wenige Magisteriale in Akhien, fürchte ich. Möbel und Ähnliches werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Es ist nicht nötig, dass Sie Ihren gesamten Haushalt einpacken.«
Es gab Gerüchte, dass Lord Tavenor genau das getan hatte und dann gezwungen gewesen war, seine Besitztümer auf eigene Kosten nach Hause zu verschiffen, nachdem er seine Stelle gekündigt hatte. Zum Glück für Lord Rossmere war ich daran gewöhnt, mit sehr wenigen Dingen zurechtzukommen. Im Vergleich mit meiner Kabine an Bord der Basilisk würde mir selbst die armseligste Unterkunft wie ein regelrechter Palast vorkommen – und sei es nur, weil ich mich außerhalb davon freier bewegen konnte.
Es gab natürlich Hunderte anderer Kleinigkeiten zu organisieren, aber solch triviale Dinge waren nichts für einen Mann wie Lord Rossmere. Er rief seinen Adjutanten herein und übernahm die notwendige Vorstellung. Dieser Offizier würde sich in seinem Auftrag um den Rest kümmern. Dann wurden wir weggeschickt, um unseren eigenen Geschäften nachzugehen.
Tom und ich stiegen die Treppe hinunter und traten auf die belebten Straßen von Drawbury hinaus, wo in jenen Tagen noch das Hauptquartier der Königlichen Armee in Falchester lag. Wir standen für einen Augenblick schweigend da und beobachteten, wie die Leute an uns vorbeiliefen. Dann drehten wir uns, wie mit einer schweigenden Übereinkunft, um und sahen einander an.
»Akhien«, sagte Tom mit dem Hauch eines Grinsens im Gesicht.
»In der Tat.« Ich wusste, warum sein Grinsen noch nicht ganz ausgeprägt war. Meine eigene Aufregung wurde von Besorgnis gebremst. Unsere Forschung an Bord der Basilisk war teilweise unter der Aufsicht anderer Gruppen – der Scirländischen Geografischen Vereinigung, der Ornithologischen Gesellschaft – durchgeführt worden, aber das war ganz anders gewesen als die Art von Beaufsichtigung, die uns jetzt bevorstand.
Ich hätte es nie zu Tom gesagt, der so hart für meine Aufnahme in dieses Projekt gekämpft hatte, doch mir war bei der Aussicht, für die Königliche Armee zu arbeiten, nicht ganz wohl. Meine Abenteuer im Ausland hatten mich zu mehreren Gelegenheiten in solche Affären verwickelt, ich hatte sie mir jedoch nie zuvor absichtlich ausgesucht. Und ich wusste sehr gut, dass wir, wenn wir erfolgreich Drachen züchteten, wie es die Krone wünschte, sie im Endeffekt auf den Status von Vieh reduzieren würden. Kreaturen, die in Gefangenschaft gefüttert und bis ins Erwachsenenalter aufgezogen wurden, nur damit man sie für den Profit von Menschen schlachten konnte.
Die Alternative aber war schlimmer. Wenn man Drachen nicht züchten konnte, dann würden sie nur gejagt. Die wilden Populationen würden nach kurzer Zeit ausgerottet. Ich war auf dem Land aufgewachsen, wo das Schlachten von Schafen und Geflügel völlig alltäglich gewesen war. Ich musste mich dazu durchringen, Drachen auf diese Weise zu betrachten – egal wie schwierig diese Denkweise auch sein mochte.
Tom und ich spazierten zur Ecke der Rafter Street, wo wir vielleicht eine Droschke heranwinken konnten. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben hatte ich genug Geld, dass ich mir eine eigene Kutsche hätte leisten können, wenn ich es gewollt hätte, aber ich war das nicht mehr gewohnt. (Meine Freunde mussten mich später überzeugen, dass es, auch wenn Mrs. Camherst oder Dame Isabella tun konnte, was sie wollte, nicht angemessen war, dass Lady Trent in einer gemieteten Kutsche herumfuhr.) Sobald wir uns hineingesetzt hatten und auf dem Weg waren, sah mir Tom in die Augen und fragte: »Wirst du nach ihm suchen?«
Es war sinnlos vorzugeben, dass ich nicht wusste, von wem Tom gerade sprach. Es war wenig sinnvoller vorzugeben, dass es mich nicht kümmerte, doch ich versuchte mein Bestes – eher um meiner eigenen Würde willen als aus irgendeiner Hoffnung, dass ich Tom etwas vormachen konnte. »Ich bezweifle, dass ich ihn finden könnte, wenn ich es versuchen würde.« Ich starrte aus dem Fenster auf die Stadt, die vorbeirauschte. »Es muss in Akhien sehr viele Männer namens Suhail geben.«
Unser ehemaliger Kamerad von der Basilisk, der Mann, der mit mir auf die verfluchte Insel Rahuahane gekommen war, der einen yelangesischen Caeliger gestohlen und versucht hatte, eine Prinzessin zu retten. Ich hatte ihm meine Adresse in Falchester gegeben, ehe wir uns in Phetayong getrennt hatten, aber ich hatte in den beinahe drei Jahren seither keinen einzigen Brief erhalten. Möglicherweise hatte er die Notizbuchseite verloren, auf welche ich die Information gekritzelt hatte. Aber es war nicht zu schwierig, mich zu finden. Es gab auf der Welt wenige Drachenforscherinnen, und nur eine davon hieß Isabella Camherst.
Meine Worte waren eine Maske für diesen Kummer, enthielten jedoch auch einen Hauch Wahrheit. So gut ich Suhail zu kennen glaubte, ich wusste sehr wenig über ihn: nicht den Namen seines Vaters, nicht seinen Familiennamen, nicht einmal die Stadt, in der er lebte.
Als könne er diese Gedanken hören, sagte Tom: »Ich könnte mir vorstellen, dass der Prozentsatz an Archäologen namens Suhail wesentlich geringer ist.«
»Vorausgesetzt, er beschäftigt sich immer noch mit solcher Arbeit.« Ich seufzte. »Ich hatte den entschiedenen Eindruck, dass der Tod seines Vaters bedeutete, dass er zu seinen Pflichten nach Hause gerufen wurde. Er kann wohl gezwungen worden sein, seine eigenen Interessen beiseitezuschieben.«
Obwohl ich meinen Kommentar gemäßigt klingen lassen wollte, verriet das Wort »gezwungen« meine eigenen Gefühle. Ich hatte einst zum Wohl meiner Familie all meinen gewöhnlichen Interessen abgeschworen. Die »Grauen Jahre«, wie ich sie nannte, waren eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens gewesen – nur von der Zeit übertroffen, die ich in Trauer um meinen Ehemann Jacob verbracht hatte. Ich kannte Suhails Leidenschaft für seine Arbeit. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er sie ohne Reue aufgegeben hätte.
»Du könntest herumfragen«, sagte Tom freundlich. »Was könnte es schon schaden?«
Suhails Familie blamieren vielleicht – aber weil ich sie nie getroffen hatte und nichts über sie wusste, fand ich es schwierig, viel Rücksicht auf ihre Gefühle zu nehmen. Und doch wollte ich mir keine Hoffnungen machen, nur um enttäuscht zu werden. »Vielleicht«, sagte ich. Tom war nett genug, es dabei zu belassen.
Ich hatte nicht viel Zeit, um melancholisch zu sein, nachdem ich in mein Stadthaus am Hart Square zurückgekehrt war. Wenn wir in anderthalb Wochen aufbrechen sollten, hatte ich keine Zeit zu verlieren. Ich schickte das Hausmädchen los, um ein Inventar meiner Reisegarderobe anzufertigen, und ging in mein Studierzimmer, um zu überlegen, welche Bücher ich mitnehmen würde.
Mein Studierzimmer war über die Jahre eine Quelle von tiefem und ruhigem Vergnügen für mich geworden. Es war nicht elegant, wie es die Studierzimmer von einigen Gentlemen sind. Man konnte es eher »vollgestopft« nennen. Abgesehen von den Büchern hatte ich Notizen, Landkarten, Skizzen und vollendete Zeichnungen, Präparate und ähnlichen Tand, den ich auf meinen Reisen gesammelt hatte. Muscheln, die mein Sohn Jake gefunden hatte, beschwerten Papierstapel. Die Replik des Eis, das ich von Rahuahane mitgenommen hatte, lehnte an einem Bücherregal. (Der Feuerstein, den ich aus dem Eigelb des echten Eis gehackt hatte, war immer noch zum Großteil auf meinem Kleiderschrank versteckt, obwohl ich einige Stücke geschliffen und mit der Zeit verkauft hatte, um mich zu finanzieren.) Hoch an der Wand über den Regalen marschierte eine Reihe an in Gips gegossenen Fußabdrücken in einer schiefen Linie: die versteinerten Spuren eines prähistorischen Drachen, im Vorjahr von Konrad Vigfusson im südlichen Otholé entdeckt.
Eine große Klaue lag auf meinem Schreibtisch, wo ich sie an jenem Morgen gelassen hatte. Die Klaue war ein völliges Mysterium und mir von einem Fossiliensucher aus Isnats geschickt worden. Er vermutete, dass sie Zehntausende Jahre alt war, wenn nicht mehr. Sie bot einen faszinierenden Einblick in die graue Vorzeit der Drachen … natürlich vorausgesetzt, dass die Klaue wirklich von einem Drachen stammte. Der Fossiliensucher hatte keine Knochen in der Nähe gefunden, die gewöhnlich dabei helfen würden, eine Spezies zu klassifizieren. In diesem Fall mochte das Fehlen von Knochen das Identifikationsmerkmal sein: Wenn der Besitzer der Klaue ein »echter« Drache gewesen war, dann waren seine Knochen natürlich zu schnell für eine Versteinerung zerfallen. (Während Konservierung in der Natur zwar vorkommen kann, sind die chemischen Bedingungen dafür so selten, dass versteinerte Knochen beinahe unbekannt sind – obwohl ein großer Haufen Gauner und Trickbetrüger gerne hätte, dass Sie das Gegenteil glauben.)
Also: Angenommen, es konnte ein Drache gewesen sein. Falls ja, dann war es einer von gewaltiger Größe gewesen, der selbst die größten heute bekannten Arten in den Schatten stellte, weil die Klaue entlang ihrer Rundung vom Ansatz bis zur Spitze beinahe dreißig Zentimeter maß. Tom hatte die Theorie, dass die Klaue im Vergleich zum Rest des Drachen unverhältnismäßig groß gewesen war, was biologisch gesehen sicherlich einen Sinn ergab. Was allerdings der Zweck einer solch übergroßen Klaue gewesen sein mochte, ist heute immer noch ein Rätsel. Jagd, Verteidigung, das Anziehen eines Partners … Wir haben viele Ideen, aber keine Fakten.
Mein Studierzimmer enthielt außerdem eine Kiste, hoch oben auf einem Regal, deren mitgenommenes Äußeres nahelegte, dass darin nichts Besonderes enthalten war. Ohne dass es irgendjemand außer Tom und mir wusste, enthielt sie meinen größten Schatz.
Diese holte ich herunter, nachdem ich mich erst versichert hatte, dass meine Tür geschlossen war. Als der Deckel heruntergenommen war, enthüllte sie verschiedene Gipsklumpen, die von Drahtstücken zusammengehalten wurden. Dies war, wie sich Leser des vorherigen Bandes vielleicht erinnern, der Abdruck, den ich von den Hohlräumen im Inneren des Eis aus Rahuahane gemacht hatte – die Leere, wo einst ein Embryo gewesen war.
Der Abdruck war leider viel zu zerbrechlich, um eine Seereise nach Akhien zu riskieren, und außerdem so gut wie unersetzlich. Ich hatte ihn Hunderte Male betrachtet und sein Erscheinungsbild aus jedem Winkel gezeichnet. Die Skizzen konnte ich mitnehmen. Nichts ersetzte aber die Erfahrung, ihn direkt anzusehen, und so untersuchte ich ihn ein letztes Mal und brannte seine Umrisse in mein Gedächtnis.
Ich glaubte – konnte jedoch noch nicht bestätigen –, dass es einen Beweis für eine ausgestorbene Drachenart darstellte, eine, die die antiken Drakoneer tatsächlich gezähmt hatten, wie es die Legenden besagten. Diese Legenden waren wegen der Unzähmbarkeit der meisten Drachenarten immer bezweifelt worden, aber eine jetzt ausgestorbene Art mochte vielleicht kooperativer gewesen sein. Tatsächlich fragte ich mich, ob diese Kooperationsbereitschaft genau der Grund war, warum die Art ausgestorben war: Wir haben gewisse Hunderassen so gründlich domestiziert, dass sie in freier Wildbahn nicht länger überleben können. Wenn die Drakoneer eine solche Kreatur entwickelt hatten, mochte sie sehr wohl nach dem Zusammenbruch ihrer Zivilisation ausgestorben sein.
Solche Gedanken waren allerdings reine Spekulation. Selbst die Form des Embryos war wegen der Versteinerung des Eigelbs und der Ungenauigkeiten im Abdruck ungewiss. Wer konnte vermuten, wie die ausgewachsene Form ausgesehen haben mochte? Wir wussten zu wenig über Drachenembryologie, um das zu sagen.
Aber mit genug Zeit in Akhien – und genug fehlgeschlagenem Ausbrüten, was unvermeidlich wäre – würde ich vielleicht eine bessere Antwort finden.
Es klopfte an der Tür meines Studierzimmers. »Einen Moment!«, rief ich, legte den Abdruck in seine Kiste zurück und stellte mich auf einen Stuhl, um ihn wieder auf sein unauffälliges Regal zu schieben. Schuldgefühle durchströmten mich, als ich das tat: Wie konnte ich darüber jammern, dass die Königliche Armee ihre Naturforscher zum Schweigen verdammte, wenn ich selbst auf einem derartigen wissenschaftlichen Geheimnis saß? Es war nicht einmal das einzige: Ich hatte zwei wertvolle Informationen, die ich noch nicht mit der Welt geteilt hatte, und die andere war in eine Schublade am Schreibtisch einen Meter hinter mir gestopft.
Das Problem mit dem Abdruck war, dass ich nicht sagen wollte, wo ich ihn herhatte. Mein eigener Landgang auf Rahuahane war unabsichtlich gewesen. Andere würden absichtlich hinreisen, wenn sie von den Ruinen dort erführen. Und jene anderen würden zu einer Flut, wenn sie wüssten, dass der Vorrat an Eiern dort auch einen gewaltigen Vorrat an ungeschliffenen Feuersteinen darstellte. Ich hatte mich seit dem Tag, als ich den Abdruck hergestellt hatte, darum bemüht, eine plausible Geschichte über seinen Ursprung zu konstruieren, die weder wahre Informationen mit falschen verzerren noch zu viel verraten würde. Ich hatte noch keinen Erfolg gehabt.
Was das Papier in meiner Schreibtischschublade betraf … da war meine Motivation nicht ein Zehntel so nobel.
»Komm herein!«, rief ich, sobald ich von meinem Stuhl herunter und ein Stück vom entsprechenden Regal weg war.
Die Tür ging auf und ließ Natalie Oscott ein. Sie war einst meine Gesellschafterin und Mitbewohnerin gewesen, aber in eine eigene Wohnung gezogen, nachdem Jake aufs Internat gegangen war. »Er braucht keine Tutorin mehr«, sagte sie damals, »und du brauchst mehr Platz für Bücher.« Letzteres war eine Art höfliche Ausrede. Ich hatte einst versprochen, sie für ein unabhängiges und exzentrisches Leben als alte Jungfer zu qualifizieren. Das hatte sie seither erreicht, obwohl ich dafür kaum die Lorbeeren einheimsen konnte. Natalie hatte ihre Berufung im Ingenieurwesen gefunden und dazu einen Kreis an gleichgesinnten Freunden, die sie annehmbar beschäftigt hielten. Ihre Finanzen waren etwas angespannt – sicher hatte sie weitaus weniger, als sie vom Leben hätte erwarten können, wenn sie ein ehrbares Mitglied der feinen Gesellschaft geblieben wäre –, aber sie konnte ihre Rechnungen jetzt selbst bezahlen und hatte beschlossen, das zu tun. Ich konnte mich ihr kaum in den Weg stellen, obwohl ich es, nachdem Jake fort war, manchmal vermisste, Gesellschaft im Haus zu haben.
Sie warf mir einen neugierigen Blick zu, als sie hereinkam. »Das Alleinleben hat dich seltsam werden lassen. Was hast du getrieben, dass ich im Gang warten musste?«
»Ach, du kennst mich«, sagte ich mit einem vagen Lächeln. »Ich habe mit meiner Unterhose auf dem Kopf getanzt. Das konnte ich dich nicht sehen lassen. Bitte, setz dich – hat Tom dir die Neuigkeiten erzählt?«
»Dass ihr nächste Woche aufbrecht? Ja, das hat er.« Sie wohnten nicht in derselben Nachbarschaft, aber es wäre für Tom auf dem Heimweg kein großer Umweg gewesen, bei der Werkstatt vorbeizuschauen, wo Natalie und ihre Freunde an ihren Geräten schraubten. »Was wirst du mit dem Haus machen?«
Ich setzte mich hinter meinen Schreibtisch und schob ein frisches Blatt Papier auf die Schreibunterlage. »Es absperren, denke ich. Ich kann es mir jetzt leisten, das zu tun, und es ist schrecklich kurzfristig, um einen Untermieter zu finden. Obwohl du hier willkommen bist, wenn du willst. Du hast immerhin noch einen Schlüssel.«
»Nein, es abzuschließen, ist sinnvoll. Ich werde aber Bücher holen kommen, wenn es dich nicht stört, dass ich an deiner Stelle die Bibliothekarin spiele.«
Das war eine ausgezeichnete Idee, und ich dankte ihr dafür. Die sogenannte »Fliegende Universität«, die in meinem Wohnzimmer angefangen hatte, war jetzt eine ganze Reihe an Versammlungen, die in vielen Häusern um Falchester stattfanden, meine Bibliothek nahm in diesem Netzwerk allerdings immer noch eine wichtige Position ein. Obwohl meine Regale natürlich nicht jedes Thema abdeckten – was mir eine weitere Idee gab. »Ich habe auch noch ein paar Bücher, die ihren Besitzern zurückgegeben werden sollten. Eines von Peter Landenbury, glaube ich, und zwei oder drei von Georgine Hunt.«
»Ich werde sie mitnehmen«, sagte Natalie. »Du hast genug, um das du dich kümmern musst. Schreibst du da einen Brief an Jake?«
Das tat ich, obwohl ich noch nicht weiter als Datum und Grußformel gekommen war. Wie erklärt man seinem dreizehnjährigen Sohn, dass man in einer Woche in ein fremdes Land aufbricht – um für wer weiß wie lange nicht zurückzukehren –, und dass er nicht mitkommen darf?
Natalie kannte Jake so gut wie ich. Sie lachte. »Stelle sicher, dass du den Inhalt deiner Reisetruhen untersuchst, bevor das Schiff ablegt. Ansonsten kommst du vielleicht in Akhien an und findest deinen Sohn unter deinen Hüten versteckt.«
»Akhien ist eine Wüste und deshalb viel weniger interessant für ihn.« Aber Jake würde trotzdem mitkommen wollen. Als er sehr jung gewesen war, hatte ich ihn zurückgelassen, damit ich nach Eriga reisen konnte. Als er älter gewesen war, hatte ich diese Vernachlässigung gesühnt, indem ich ihn auf meine Weltreise mitgenommen hatte. Diese Tatsache hatte ihn auf Ideen kommen lassen. Es stimmte, dass Jakes größte Liebe der See galt, aber allgemeiner hatte er sich in den Kopf gesetzt, dass jeder Junge in regelmäßigen Abständen in fremde Länder reisen sollte. Ich hatte ihn an der besten Schule eingeschrieben, für die mein Rang und meine Finanzen reichten – Suntley College, das in jenen Tagen nicht ganz zur obersten Klasse gehörte –, doch für einen Jungen, der mit Drachenschildkröten geschwommen war, war sie unvermeidbar langweilig.
Gedanken an meinen Sohn hätten mich nicht zu Tieren führen sollen, aber das taten sie. Immerhin war Jake für seine Versorgung und Ernährung nicht länger von mir abhängig, andere Kreaturen hingegen waren es. »Willst du die Honigsucher? Oder soll ich Miriam fragen?«
Natalie verzog das Gesicht. »Ich sollte eine gute Freundin sein und dir sagen, dass ich sie nehme, aber die Wahrheit ist, dass ich zu oft in der Werkstatt einschlafe, um für irgendetwas Lebendiges verantwortlich zu sein. Ich würde es hassen, wenn du heimkommst und feststellst, dass deine Haustiere tot sind.«
»Dann also Miriam.« Sie waren keine Vögel, die Miriam Farnswoods Spezialität waren, sie mochte sie trotzdem gern genug. Ich legte meine Feder beiseite, weil ich wusste, dass ich für den Brief an Jake meine volle Aufmerksamkeit brauchen würde, und knackste mit meinen Fingern. »Was fehlt mir noch?«
»Respektable Kleidung dafür, wenn du in der Stadt bist. Hosen, wenn du es nicht bist. Hüte. Nein, du wirst ein Kopftuch brauchen, um dein Haar zu bedecken, oder nicht? Dein anatomisches Kompendium. Sie werden dort Skalpelle und Vergrößerungsgläser und so weiter haben, die auf euch warten, nehme ich an, und Mr. Wilker hat das Set, das du ihm geschenkt hast – aber geh lieber auf Nummer sicher. Man sagt mir, dass Akhier eine Art Ölpaste haben, die sie nutzen, um ihre Haut vor der Sonne zu schützen. Du solltest vielleicht so etwas kaufen.« Natalie rollte mit den Augen nach oben und betrachtete meine Decke, als könne sie dort eine Liste finden. »Gibt es in Akhien Malaria?«
»Ich glaube schon. Ich werde mich allerdings auf mein Glück verlassen müssen: Amaneener billigen das Trinken nicht.« Einige waren natürlich strenger als andere, aber ich wollte nicht von Anfang an den falschen Eindruck erwecken, indem ich mit einer Kiste Gin im Gepäck auftauchte.
Sie fragte nach meiner Wohnsituation, die ich beschrieb, dann sagte sie: »Zelte? Andere Ausrüstung zum Kampieren?«
»Lord Rossmere hat es ziemlich deutlich gemacht, dass man von mir erwartet, in Qurrat zu bleiben und an meiner Aufgabe für die Armee zu arbeiten.«
Natalie warf mir einen ironischen Blick zu, und ich lachte. »Ja, ja. Ich weiß. Aber wenn ich zufällig in die Wüste hinauswandern und nach Dingen zum Erforschen suchen sollte, bin ich sicher, dass ich von einem einheimischen Kaufmann passende Zelte erwerben kann. Außerdem das Kamel, das sie für mich trägt.«
»Dann bist du vorbereitet«, sagte Natalie. »So gut du es je sein kannst.«
Womit sie meinte, nicht einmal halbwegs ausreichend vorbereitet. Aber ich hatte mich schon lange mit dieser Tatsache abgefunden.
Ich musste an die Vergangenheit denken, als Tom und ich uns in Sennsmouth trafen und auf das Schiff hinausblickten, das uns nach Akhien bringen würde.
Vierzehn Jahre zuvor hatten wir an beinahe genau derselben Stelle gestanden und uns auf unsere Abreise nach Vystrana vorbereitet. Aber damals waren wir zu viert gewesen: ich selbst und Jacob, Tom und sein Gönner Lord Hilford. Jacob war nicht lebend nach Hause zurückgekehrt, und Lord Hilford war im vorherigen Frühling nach vielen Jahren, in denen sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte, verstorben. Ich war froh, dass er zumindest noch erlebt hatte, wie sein Schützling zum Kolloquiumsmitglied geworden war, obwohl ich es nicht geschafft hatte, ihm das sofort nachzutun.
Toms Gedanken mussten einem ähnlichen Pfad gefolgt sein, denn er sagte: »Das ist unserer ersten Abreise nicht sehr ähnlich.«
»Ja«, stimmte ich zu. »Doch ich glaube, sie hätten sich beide gefreut, wenn sie gesehen hätten, wo wir jetzt sind.«
Der Wind war steif und beißend und ließ mich sehnsüchtig an die Wüstenhitze denken, die vor uns lag. (Damit lag ich etwas falsch: Selbst im südlichen Anthiopien ist der Acinis nicht der wärmste Monat. Es war dort aber wärmer als in Scirland.) Wenn mir jedoch kalt war, musste ich nur meine Gedanken auf das richten, was in meiner Zukunft lag: die Wüstendraken von Akhien.
Sie sind in vielerlei Hinsicht die perfekten Drachen, die Art, die einem in dem Augenblick in den Sinn kommt, wenn man das Wort hört. Schuppen, so golden wie die Sonne, die der Ursprung von Legenden sind, dass Drachen Gold horten und auf riesigen Bergen davon schlafen, bis ihre Haut von dem Edelmetall überzogen ist. Feuriger Hauch, sengend wie die Wüstensonne selbst. Ich hatte im Lauf meiner Karriere viele Drachenarten gesehen, einschließlich einiger, deren Anspruch auf den Namen überaus zweifelhaft war … aber ich war nie einem Wüstendraken näher gekommen als damals, als ich so viele Jahre zuvor in der Menagerie des Königs auf einen Kümmerling geblickt hatte. Jetzt würde ich sie endlich in ihrer ganzen Pracht sehen.
Ich sagte: »Danke, Tom. Ich weiß, dass ich das schon zuvor gesagt habe, und ich werde es wahrscheinlich immer wieder sagen: Ich verdanke diese Chance alleine dir.«
»Und deinem eigenen Werk«, wehrte er ab. Doch dann lächelte er reumütig und fügte hinzu: »Gern geschehen. Und danke dir. Wir sind gemeinsam hierhergekommen.«
Sein Ton war beschämt genug, dass ich nichts mehr sagte. Ich streckte nur mein Gesicht in die Meeresbrise und wartete auf das Schiff, das mich nach Akhien bringen würde.
ZWEI
Ankunft in Rumaish – Unsere Willkommensfeier –Vom Rauchzimmer ausgeschlossen – Flussaufwärtsnach Qurrat – Shimon und Aviva
Die Natur selbst hat dem Hafen von Rumaish ein beeindruckendes Tor beschert. Zwei felsige Landzungen erheben sich wie Säulen über eine Meerenge dazwischen. In Kriegszeiten ist es einfach, zwischen ihnen Ketten zu spannen, um feindliche Schiffe an der Durchfahrt zu hindern. Die Kalifen aus der Sarqaniden-Dynastie allerdings fanden, dass das nicht reichte, und schmückten diese beiden Landzungen mit einem Paar monumentaler drakoneischer Statuen, die sie aus dem sogenannten Tempel der Stille im Labyrinth der Draken holen ließen. Die Winde vom Meer haben ihre Spuren an den drachenköpfigen Skulpturen hinterlassen, und ihre Gesichtszüge sind jetzt beinahe nicht mehr erkennbar, doch die Wirkung ihrer beständigen Präsenz ist deshalb nicht weniger beeindruckend.
Ich stand an der Reling des Schiffs und skizzierte, als wir uns diesen beiden Wächtern näherten, und blickte oft auf ihre gewaltigen Umrisse hoch. Sentimentalität nach dieser antiken Zivilisation war nie eine meiner Schwächen gewesen, aber mein Interesse an ihr war sprunghaft gestiegen, seit wir den Tempel auf Rahuahane entdeckt hatten. Welche Drachenart hatten sie auf jener Insel ausgebrütet? Zu welchem Zweck? War dieser Drache unter den Arten, die heute noch lebten, oder war er in den Jahrtausenden seither ausgestorben? Als wir an jenem Tag in den Hafen einfuhren, erlaubte ich mir einen Moment von Sentimentalität und stellte mir vor, dass diese verwitterten Steinaugen die Antworten gesehen hatten.
Dann fuhren wir durch das Tor in den Hafen selbst. Dieser ist kein so geschäftiger Ort wie Saydir, das an der Mündung von Akhiens mittlerem Fluss liegt. Eine großzügigere Einfahrt macht jenen Hafen geeigneter für kommerziellen Verkehr in einem größeren Ausmaß. Rumaish hat allerdings mit Schiffen aus ganz Anthiopien sein eigenes Maß an Geschäftigkeit. Selbst in jenen Tagen war es notwendig, die Durchfahrt durch das Tor mit einem einheimischen Beamten zu koordinieren, damit dieser Kanal nicht durch zu viele Schiffe gleichzeitig gefährlich verstopft würde.
Zwei Männer in scirländischer Militäruniform warteten am Kai auf uns, als wir von Bord gingen. Einer von ihnen trug die Kappe und Schulterklappen eines Obersts. Der andere brauchte keine Insignien, um ihn zu identifizieren, denn ich erkannte ihn sofort.
»Andrew!« Mein erfreuter Schrei verlor sich im Lärm der Docks beinahe. Ich ließ die Tasche fallen, die ich gerade trug, hastete vorwärts und warf die Arme um meinen Bruder – den einzigen Bruder, von dem ich sagen konnte, dass ich ein gutes Verhältnis zu ihm hatte, statt nur toleriert zu werden. »Ich dachte, du seist immer noch in Coyahuac!«
»Das war ich bis vor Kurzem.« Er schwang mich lachend herum. »Aber es ging das Gerücht um, dass du vielleicht hierherkommen würdest, und so habe ich um meine Versetzung gebeten. Wollte aber nichts sagen, falls es nicht geklappt hätte.«
»Du meinst, du konntest dir die Chance nicht entgehen lassen, mir aufzulauern«, tadelte ich ihn.
Andrews reuloses Grinsen sagte mir, dass ich nicht falschlag. Dann unterbrach uns eine Stimme: »Hauptmann Hendemore.«
Der Klang seines Namens ließ meinen Bruder sich kerzengerade hinstellen und seine Uniform zurechtzupfen, während er eine Entschuldigung an Oberst Pensyth murmelte. Mein eigener tadelnder Blick wurde von dem des Obersts in den Schatten gestellt, weil der ihn wesentlich mehr so meinte. Ich konnte mir das Gespräch denken, das dieser Begegnung am Kai vorausgegangen sein musste: Andrew, der darum bettelte (mit seinem besten Versuch angemessener militärischer Würde), dass er dort sein durfte, wenn ich ankam, Pensyth, der es unter der Bedingung erlaubte, dass Andrew sich benehmen würde. Mein Bruder hatte einige Zeit an der Universität vertrödelt, ehe er beschlossen hatte, dass ihm das Leben in der Armee besser passen würde, aber es passte trotzdem nicht perfekt. Ich hatte ihm das Geld geliehen, um ein Leutnantspatent zu erwerben – das höchste, das ich kaufen konnte, ohne zu viel Feuerstein auf einmal abzustoßen –, und er hatte sich die Beförderung zum Hauptmann verdient, nachdem sein befehlshabender Offizier getötet worden war. Ich bezweifelte, dass er je höher aufsteigen würde, weil er das Leben beim Militär nicht mit dem Ernst behandelte, den sich seine Vorgesetzten wünschten.
Tom lenkte Pensyth mit einer ausgestreckten Hand und einem Gruß ab. »Ich nehme an, Sie sind hier, um uns nach Qurrat weiter zu begleiten?«, fragte Tom.
»Ja, wir haben eine Flussbarke organisiert«, sagte Pensyth. »Es wird aber den ganzen Tag dauern, Ihre Ausrüstung vom Schiff auf die Barke umzuladen, deshalb haben Hauptmann Hendemore und ich Zimmer in einem Hotel genommen. Nachdem Sie die Gelegenheit hatten, sich frisch zu machen, wollen Sie sich mir vielleicht im Rauchzimmer anschließen.«
Das Letzte war ganz klar an Tom gerichtet, nicht an mich. Man erwartete, dass Damen nicht rauchten (obwohl es damals natürlich einige von ihnen taten und es jetzt noch mehr tun). Das Rauchzimmer war deshalb eine reine Männerdomäne. Ich konnte nicht anders, als mich zu wundern, ob Pensyth mich absichtlich ausgeschlossen hatte oder ob es bloß ein gedankenloser Reflex gewesen war.
So oder so, ich würde streitlustig wirken, wenn ich das ansprach – besonders weil mir Andrew grinsend in die Rippen stieß. »Du und ich bekommen eine Gelegenheit zu plaudern, hm?«
»In der Tat«, sagte ich. Sosehr mich Pensyth auch vor den Kopf gestoßen hatte, ich konnte nicht leugnen, dass ich mich auf Zeit mit meinem Bruder freute. Meine Beziehung mit dem Rest meiner engen Verwandten war nicht so schlecht, wie sie es einmal gewesen war. Die Ehre meines Ritterschlags hatte die Brücke zu meiner Mutter zumindest teilweise repariert, obwohl es aus meiner Perspektive mehr zum Wohl der Harmonie in der Familie als aus irgendeinem Sinneswandel war. Und so gut ich auch mit meinem Vater auskam, ich hatte das Bild aus meiner Kindheit von ihm als einem kleineren heidnischen Gott, den man günstig stimmte, sich aber nie ganz zu eigen machte, nicht völlig verworfen. Andrew war immer noch der einzige Verwandte, mit dem ich wirklich warm wurde – abgesehen von meinem Sohn natürlich.
Andrew trat zur Seite, um eine Traube einheimischer Männer auf die Füße zu scheuchen: Dockarbeiter, die die körperliche Arbeit übernehmen würden, unsere Besitztümer vom Schiff zur Barke zu tragen. Dann gingen wir zum Hotel weiter, das auf einem sehr steilen Hügel lag, wo uns dessen Anhöhe erlaubte, die wenigen kühlenden Brisen zu erhaschen, die es gab.
Das Hotel hatte, wie viele im Süden von Anthiopien, abgetrennte Frauenwohnbereiche, um die Privatsphäre seiner weiblichen Gäste zu schützen. Ich ließ Andrew deshalb im Innenhof zurück, während ich mir mein Zimmer ansah. Als ich wiederkam, hatte er Tee von einer Sorte bestellt, die ich nie zuvor geschmeckt hatte. Der war an einem Tag, der trotz der Sonne etwas kühler war, als ich erwartet hatte, herrlich wärmend.
»Weißt du«, begann Andrew in dem Tonfall, der nur bedeuten konnte, dass er gleich irgendetwas erschreckend Ungehobeltes sagen würde, »ich verstehe nicht, warum irgendjemand denkt, dass du und dieser Wilker-Kerl eine Affäre habt. Man braucht nur einen Blick, um zu wissen, dass das völliger Blödsinn ist.«
Ich stellte meine Tasse ab und sagte ironisch: »Danke … glaube ich.«
»Oh, du weißt, was ich meine. Er könnte ebenso gut ein Eunuch sein, was dich betrifft. Es gibt hier Eunuchen, wusstest du das? Hauptsächlich in der Regierung. Ich schwöre, dass die Hälfte der Minister, die ich getroffen habe, keine Eier hat.«
Die Armee hatte ganz eindeutig einen wundervollen Einfluss auf die Manieren meines Bruders. »Hast du mit vielen Leuten in der Regierung zu tun?«
»Habe ich mit ihnen zu tun? Nein, wohl kaum. Das machen hauptsächlich General Lord Ferdigan und sein Stab in Sarmizi oder manchmal Pensyth. Leute, die höherrangig sind als ich. Ich trabe ihnen nur mit Akten und so hinterher.«
Andrews Tonfall verriet, dass er froh war, sich im Hintergrund zu halten – ein Eindruck, den ich ihm nachfühlen konnte. Ich würde hier wahrscheinlich nicht zu Treffen mit Ministern eingeladen, weil weder die Akhier noch meine eigenen Landsleute begierig darauf sein würden, mich in diplomatische Angelegenheiten einzubeziehen, und insgesamt gesehen war ich erleichtert … aber ich gebe zu, dass es einen Teil von mir gab, der sich über den Ausschluss, oder eher über dessen Grund, ärgerte.
Mir fiel auf, dass mein Bruder bei einer Vielzahl von Besprechungen dabei gewesen sein musste, die mich vielleicht betreffen würden. Ob er dabei aufmerksam gewesen war, war natürlich eine andere Sache. »Gibt es irgendetwas, das ich wissen sollte, bevor ich anfange?«
Andrew legte seinen Kopf auf eine Seite und dachte nach. Er hatte seine Kappe abgenommen und fächelte sich damit Luft zu, was wahrscheinlich gegen militärisches Protokoll verstieß. Obwohl ich den Tag recht kühl fand, hatte er auf dem Marsch zum Hotel herauf seine Uniform durchgeschwitzt. »Alle sind verärgert. Sie hatten nicht erwartet, dass es so lange dauern würde – dachten, dass unsere überlegenen wissenschaftlichen Kenntnisse das Problem einfach machen sollten, ganz egal, dass Leute seit Urzeiten ohne Erfolg versuchen, Wüstendraken zu züchten.« Er hörte mit dem Fächeln auf und beugte sich vor, wobei er sich mit einem Ellbogen auf einem Knie abstützte. »Um ehrlich zu sein – und ich will dich nicht unter Druck setzen oder irgendetwas, aber –, ich weiß nicht, wie lange dieses Bündnis halten wird. Es ist nur diese Angelegenheit mit Yelang und ihren Caeligern, die uns und die Akhier zusammenarbeiten lässt. Wenn es nicht bald irgendwelche Fortschritte gibt, könnte das auseinanderfallen.«
Nichts an dem, was er sagte, überraschte mich, trotzdem war es nervenaufreibend. Man würde bei einem Scheitern ohne Zweifel Tom und mir die Schuld geben, falls wir noch am Ruder wären, wenn das Ende kam. Tatsächlich ging mir der schreckliche Gedanke durch den Kopf, dass man uns vielleicht genau aus diesem Grund ausgewählt hatte. Wir waren viel bessere Sündenböcke, als es Lord Tavenor gewesen wäre.
Nun, wenn das der Plan war, dann war ich entschlossen, ihn zu durchkreuzen. Und um das zu tun, brauchte ich Informationen. Die Papiere unseres Vorgängers würden uns in Qurrat erwarten, aber mir gefiel der Gedanke, gut bewaffnet zu sein, bevor wir ankamen. »Kannst du mir irgendetwas über das erzählen, was Lord Tavenor getan hat?« Andrew schüttelte den Kopf, und ich erinnerte mich daran, dass er erst kürzlich in das Land gekommen war. »Hast du diesen Scheich schon getroffen? Den, der uns mit Drachen versorgen soll?«
Mein Bruder wurde fröhlicher. »Ja! Nur einmal, wohlgemerkt, aber Pensyth hat mich davor eingewiesen. Ziemlich wichtiger Kerl, wie ich es verstanden habe. Die Aritat haben vor einigen Generationen geholfen, das derzeitige Kalifat an die Macht zu bringen, und er ist ihr neuester Anführer.«
»Warum ist er in das Programm involviert? Liegt es an seinem politischen Einfluss?«
»Nein – oder zumindest nicht ausschließlich. Sein Stammesgebiet liegt im Jefi, und offenbar findet man dort die meisten Drachen.« Andrew grinste. »Er schickt seine Nomadenvettern los, um einige zu fangen, und dann zerren sie diese für dich zurück nach Qurrat.«
Bei seinen Worten spitzte ich unwillkürlich die Ohren. Sie mögen mich für verrückt halten, weil ich das tat: Das Jefi ist der südlichste Teil von Akhien, das unwirtliche Wüstental zwischen den Gebirgszügen von Qedem und Farayme. Es bekommt vernichtend wenig Regen ab. Die Nomaden dort überleben, indem sie ihre Kamele an verstreuten Oasen grasen lassen und tränken. Selbst für eine hitzeliebende Kreatur wie mich kann es nicht annähernd als attraktives Reiseziel betrachtet werden.
Es wird meine Leser jedoch nicht überraschen, dass das häufige Vorkommen von Draken dort mein Interesse weckte. Das Jefi war nicht so weit von Qurrat entfernt – was Sinn ergab, weil niemand gerne gefangene Draken weiter transportieren würde, als er muss. Ich war fest entschlossen, die Kreaturen in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, ehe ich dieses Land verließ. Jetzt wusste ich, wo ich hingehen und mit wem ich sprechen musste.
Andrew konnte sich meine Ideen eindeutig denken, denn er grinste breit. Das dauerte aber nur einen Moment, ehe er ernst wurde. »Ich würde nicht versuchen, ohne Erlaubnis des Scheichs dorthin zu gehen, Isabella. Um nur eine Sache zu nennen, wirst du dort sterben. Und falls du nicht stirbst, werden die Aritat dich töten. Sie mögen keine Eindringlinge.«
Ganz zu schweigen davon, wie mein Handeln auf Scirland zurückfallen würde. Ein unbefugtes Eindringen würde mich bei niemandem beliebt machen. »Ich verstehe«, sagte ich und betete um ein gutes Verhältnis zum Scheich.
Die Barke, die uns den Fluss hinauf nach Qurrat brachte, war kein schnelles Schiff, aber das störte mich nicht, weil mir das die Gelegenheit gab, die Landschaft um mich herum zu betrachten.
Der Zathrit, der die südlichste von Akhiens drei großen Wasserstraßen ist, entspringt im Qedemgebirge, das jenes Land von Seghayen und Haggad trennt. Ein riesiges Netzwerk aus Bewässerungskanälen verzweigt sich aus ihm wie die Äste eines Baums. Zu jener Jahreszeit waren sie trocken, aber im Frühling würden die Bauern die Lehmwände an ihren Mündungen einreißen und das lebensspendende Wasser auf ihre Felder voll Gerste, Hirse und Weizen sprudeln lassen.
Entlang der Flussufer selbst war die Wüste viel grüner, als ich sie mir vorgestellt hatte. Dort wuchsen hohes Gras und Schilf, Palmen und andere Spezies, die ich nicht identifizieren konnte. Es gab auch wilde Tiere in Hülle und Fülle, von Fischen über Füchse zu Vögeln am Himmel. Aber von Zeit zu Zeit konnte ich das Terrain sehen, das sich hinter dem Schwemmland erhob, und dann konnte ich erkennen, wie es in der Entfernung trockener wurde, ein Beigeton, der sich nicht sehr von dem der Uniform meines Bruders unterschied.
Es war, auf ihre eigene Art, eine Landschaft, die so tödlich wie die Grüne Hölle war. Während der Dschungel von Mouleen jedoch recht lebhaft und mit jedem verfügbaren Werkzeug, das von Raubtieren bis zu Parasiten reicht, versucht, eine Person umzubringen, töten die Wüsten Akhiens am häufigsten durch Gleichgültigkeit. Schakale mögen das Ende von jemandem beschleunigen und sich dann am Kadaver gütlich tun, aber sie machen sich selten große Mühe, jemanden zu jagen. Hitze und Durst übernehmen diese Arbeit für sie: Man stirbt, weil jegliche Lebensgrundlage lange verbraucht und verschwunden ist.
Das Jefi allerdings war nicht mein Reiseziel – noch nicht, und (aus der Perspektive meiner militärischen Arbeitgeber) auch in Zukunft nicht. Natürlich ging ich mehr als einmal in die Wüste hinaus, aber vorerst wandte ich meine Aufmerksamkeit dem besiedelten Land im Flusstal zu und der Stadt, die es beherrschte.
Qurrat ist eine komplexe Stadt, wie es viele alte Siedlungen sind. Anders als die akhische Hauptstadt Sarmizi zeigt es wenig planvolle Organisation. Es gab dort niemanden, der ähnlich wie der Kalif Ulsutir die halbe Stadt abgerissen und in einem prächtigen Stil neu erbaut hätte. Es gibt keine Runde Stadt in ihrem Herzen, kein vernünftiges Gitter aus Prachtstraßen, um eine Klasse von der anderen zu trennen. Wie die Stadtmitte von Falchester ist sie einfach zufällig entstanden, und die Menschen leben in ihr, wie es Schicksal und Umstände vorgeben.
Das hindert sie nicht daran, einen gewissen Prunk zu erlangen, der umso beeindruckender ist, weil er so zufällig verteilt ist. Die Stadt wird von einem Emir oder Befehlshaber geführt, einem von den dreien, die dem Kalifen dienen, und sein Palast überblickt den Fluss von seinem Aussichtspunkt auf einem niedrigen Hügel, während sich Gärten wie ein grüner Rock bis zum Rand des Wassers hinunter ausbreiten. Verschiedene Plazas sind mit Stelen und Statuen geschmückt, die man aus drakoneischen Ruinen geholt hat, und diese Relikte aus der Vergangenheit wechseln sich mit amaneenischen Gebetshöfen ab, die man an ihren hohen Spitztürmen und kunstvollen Mosaikfliesen erkennt.
Die Gegend, in der Tom und ich wohnen sollten, ist nicht annähernd so prächtig. Das Viertel, das als Segulistenviertel bekannt ist, ist einer der ältesten Stadtteile, und wie viele alte Nachbarschaften ist es seit Langem von der Elite verlassen und anderen Gesellschaftsschichten übergeben worden. In diesem speziellen Fall sind die Bewohner des Viertels, wie der Name nahelegt, fast alle Segulisten (obwohl sie nicht die gesamte segulistische Bevölkerung der Stadt darstellen). Es ist eine höfliche Vereinfachung, wenn man sagt, dass die meisten von ihnen Bayitisten mit einer Minderheit an Magisterialen sind. Man könnte akkurater sagen, dass das Viertel aus einer Ansammlung von hundert segulistischen Splittergruppen besteht, von denen einige beinahe oder direkt häretisch sind. Bis zu diesem Tag zum Beispiel gibt es dort eine kleine Enklave an Eschiten, die nach der Zerstörung des Tempels trachten, damit er in einer ihrer Ansicht nach reineren Form wieder aufgebaut werden kann. Ich brauche nicht zu betonen, dass dieses Ziel sie in Haggad nicht beliebt macht, aber man lässt sie in Qurrat leben, solange sie den Gesetzen des Kalifen gehorchen (und die Steuern des Kalifen zahlen).
Wie Lord Rossmere gesagt hatte, sollte Tom im Männerhaus wohnen, das einige von den Bewohnern des Viertels zum Wohl von Reisenden und neuen Einwanderern unterhalten. Es bedeutete, dass er ein Zimmer mit drei anderen Männern teilen musste, dennoch hatte er nicht vor, viele von seinen wachen Stunden dort zu verbringen. Wenn er nicht schliefe, würde er sich wahrscheinlich in dem Komplex aufhalten, der als unsere Operationsbasis dienen würde.
Weil weibliche Reisende und Einwanderinnen weniger gewöhnlich waren, gab es kein vergleichbares Frauenhaus, in dem ich wohnen konnte. Ich sollte stattdessen mit einer einheimischen Bayitistenfamilie leben: Shimon ben Nadav und seiner Frau Aviva.
Shimon war ein Kaufmann, der mit feinem Leinen aus Haggad handelte (weil die sporadische Feindschaft zwischen diesen beiden Nationen nicht eine gewisse Menge an Handel ausschließt). Sie waren ein älteres Paar, Shimons erste Frau war tot, und ihre Kinder waren schon lange erwachsen und ausgezogen. Die meisten waren verheiratet, aber zwei unverheiratete Söhne halfen ihrem Vater bei seinen Geschäften und begleiteten Karawanen über das Qedemgebirge. Sie hießen mich im Innenhof ihres Hauses mit einer Wasserschüssel willkommen, damit ich mir Gesicht und Hände waschen konnte, dann gab es Datteln und Kaffee, um meinen Hunger zu stillen.
»Ich danke Ihnen sehr für Ihre Gastfreundschaft«, sagte ich und meinte es ganz aufrichtig. Meine vorherigen Expeditionen hatten mich in eine Vielzahl von Wohnbedingungen geführt, die von einem chiavorischen Hotel über eine Schiffskabine zu einer Laubhütte mitten in einem Sumpf reichten. Nur das chiavorische Hotel war dieser Unterkunft an Annehmlichkeit ebenbürtig gewesen, und ich war nicht lange dort geblieben.
»Wir freuen uns sehr, Sie hierzuhaben«, sagte Aviva auf Akhisch. Es war eine ihrer beiden Sprachen. Ihr Mann und sie sprachen kein Scirländisch, und weil ich magisterial war, sprach ich beinahe kein Lashon, da unsere Literatur in der Landessprache ist.