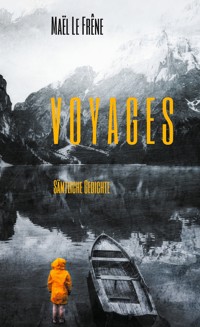Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
LAUT UND LEISE erzählt uns die Geschichte von der Erfindung des Klaviers, des Fortepiano, und seinem vermeintlichen Schöpfer, Bartolomeo Cristofori, seinem ungemein talentierten Gesellen, Giovanni Ferrini, Instrumentenbauer aus Parma, sowie von dessen Chronist, Scipione di Maffei, seines Berufes nach stadtschreibender Journalist. Es ist die Tragikomödie eines verkannten Genies im barocken Florenz des aufblühenden achtzehnten Jahrhunderts, in welchem schöne Künste, pralle Lebenslüste, aber auch Intrigen und gesellschaftlich bedingte Zwänge vorherrschten. Fürwahr eine italienische Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dedicato alla delusione, il più fedele di tutti i compagni
„Alles, was man tun muß, ist, die richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt zu treffen.“
Johann Sebastian Bach
Inhaltsverzeichnis
Preambolo
Der Orchideengarten
Der Fluß
Die Stadt
La Mattina
Andere Menschen, andere Welten
Der Käfig
Luisa Lapiccola
Mezzanotte
Das Bein des Pantalone
Die Zärtlichkeit des Hammers
Mezzogiorno
La Sera
Fine Del Viaggio
Un Altro Giorno
Epilogo
Preambolo
Wenn ich heute auf das zurückblicke, was sich damals ereignet hat, erscheint mir manches als unwirklich, als unwahr, als nur erträumt.
Und doch hat sich alles so zugetragen, wie ich es erzählen und aufschreiben will, denn ich bin stets peinlichst bemüht, das Geschehene in all seinen Einzelheiten wahrheitsgetreu festzuhalten, selbst wenn mein Gedächtnis mittlerweile leicht gewisse Lücken aufweisen sollte, welche ich einige Mühe hätte, im Nachhinein wieder zu füllen.
Nun, wie dem auch sei, eines ist sicher und gänzlich unbestreitbar: Was geschah, wird so nicht wieder geschehen, denn alles ist wandelbar, und nichts bleibt ewig.
Darum ist diese meine Geschichte wohl wert, festgehalten zu werden, damit auch künftige Generationen daraus lernen und ihr eigenes Wissen schöpfen können: das Wissen um die geheimen Irrwege menschlichen Schaffens.
Der Orchideengarten
Ich stamme aus recht einfachen, aber nicht unbescheidenen Verhältnissen: mein Vater Francesco und mein Großvater Flavio, wie auch dessen Vater Pietro, waren hart arbeitende Olivenbauern und Schweinezüchter aus der Provinz Parma. Obwohl der kleinste unter meinen Brüdern und Schwestern, so gewiß der fleißigste von ihnen und wegen meines blonden Haarschopfes von unseren Eltern Il Biondo genannt, mußte ich schon seit frühester Kindheit weidlich mit anpacken, besonders dann, wenn es um das Einholen der Olivenernte und die Versorgung der Tiere ging.
Auch spielte der jährliche Anbau sowie die sorgfältige Lese von Wein eine nicht unwesentliche Rolle im häuslichen Tagesgeschehen.
Ich war ein etwas schmächtiger Junge, doch wurde ich schon bald ein schwer ersetzbarer und wichtiger Teil der Familie mit eigenen Aufgaben, die ich redlichst versuchte, meinen jugendlichen Möglichkeiten gemäß, zu bewältigen.
Meine eigentliche Pflicht aber war es, die Orchideen im elterlichen Garten zu pflegen, derer es eine unglaubliche Vielfalt von unterschiedlichsten Exemplaren gab.
Insgesamt sind derer fünfundzwanzigtausend verschiedene Sorten aller Prägungen und Größen bekannt und verzeichnet. Man findet sie in sämtlichen Regenbogenfarben, und die in der Natur vorkommenden Orchideen weisen deren gesamtes Spektrum auf. Ich führe an dieser Stelle nur ein paar von denen an, welche unseren Garten schmückten.
Wie auch manch andere Blume steht die rote Orchidee für Begehren und Sehnsucht, aber ebenso für Blut und Wut. Die orangene Orchidee gilt als Symbol für Begeisterung und Unerschrockenheit, sie verkörpert die Energie der Sonne und das Wachstum. Freundschaft und Freude werden zumeist durch gelbe Orchideen zum Ausdruck gebracht, doch kann man sie auch einsetzen, um ein neues Leben zu feiern – sowohl physisch als auch metaphorisch. Grüne Orchideen heben sich dank ihrer fast fluoreszierenden Farbe von allen anderen Sorten ab, denn sie bedeuten Gesundheit und Glück. Blaue Orchideen werden gern und häufig verschenkt, um eine Seltenheit, eine Besonderheit zu vermitteln, da sie so in der Natur kaum vorkommen. Die violette Orchidee trägt die Farbe der Könige und Fürsten, wodurch sie eine besonders noble, ja extravagante Note bekommt. Eine wunderschöne rosa Orchidee kann Stolz, Mutterschaft und Weiblichkeit zum Ausdruck bringen. Die weißen Orchideen aber stehen für einen reinen Geist und für die höchste Form der Liebe, die Vereinigung zweier Menschen. Bei richtiger Pflege und einiger Sorgfalt können sie noch lange nach solch einem großen Tag für Freude sorgen.
Fürwahr ein kleines Paradies, das mir da anvertraut war. Nur konnte ich mich weder an den mannigfachen Farben der Orchideen in unserem Garten erfreuen, noch war ich in der Lage, ihren Charakter zu bestimmen. Eine angeborene Farbenblindheit ließ mich die Dinge nicht so sehen, wie andere Menschen sie wahrnehmen.
Es kam vor, daß ich immer wieder Dinge, Pflanzen oder Tiere, mitunter auch meine Angehörigen ganz einfach übersah, wenn sie rot, blau oder gelb an sich hatten oder bunt gekleidet waren, was allerdings eher zu größeren Festlichkeiten im Jahr der Fall war. Sogar der Olivenhain und die Weinhänge existierten für mich nicht im wirklichen Sinne; sie waren schlichte, aschfarbene Flächen und die Orchideen, wie auch der Himmel über mir, ganz einfach grau. Das hatte zur Folge, daß ein anderer Sinn sich auf ganz bemerkenswerte Weise in mir ausprägte: das Gehör. Jedoch nicht im herkömmlichen Sinne über das Wahrnehmen von Tönen und Geräuschen oder Sprache. Auch besaß ich nicht das absolute Gehör, wie es einigen Wenigen geschenkt ist, die sich gern aus der Masse gewöhnlicher Sterblicher hervorheben. Vielmehr verbanden sich meine übrigen Sinne miteinander zu einem besonderen Gespür für Klänge, ganz so, als wollten sie ein fehlendes Glied in einer Kette von Besonderheiten ersetzen und zwar derart, daß ich begann, derlei Klänge zu schmecken, zu riechen und zu erfühlen. Und da ich, noch im Wachstum begriffen, auch beständig hungrig war – die täglichen Essensportionen fielen in einer neunköpfigen Familie mit Großeltern, Eltern und fünf Geschwistern nicht gerade üppig aus – entwickelte ich einen ebensolchen Appetit auf Töne und schließlich einen wahren Heißhunger auf Klänge in jeglicher Art und Weise. Zudem mußte ich immer alles zweimal tun, ganz so, wie man atmet: ein und aus, oder wie man geht: auf und ab, hin und her und alles andere: zwei Verbeugungen, zwei Handbewegungen, zweimal anklopfen, zweimal Kopfnicken oder -schütteln, zweimal niesen oder husten. Schaute ich nach links, mußte ich mich auch nach rechts drehen. Weinte ich, mußte ich zugleich lachen und umgekehrt. Sagte ich „Nein“, schickte ich ein „Ja“ voran und so weiter und so fort.
Es heißt, die äußere Widersprüchlichkeit des Seins bestimme unsere innere Zwanghaftigkeit. Selbiges trifft wohl auch auf mich zu. Im Laufe der Jahre hatten sich meine Angehörigen an diesen „difetto“, wie sie es nannten, gewöhnt, und irgendwann sprach man nicht mehr weiter darüber. Man trug größere Sorgen des Lebens mit sich herum.
Trotz jenes kleinen „Defekts“, der mir also mitgegeben ward, bedeutete mir, wie wohl für die meisten meiner Altersgenossen, die arglos unschuldige Grausamkeit und Sorglosigkeit der Jugend mein ganzes Kapital. Ich war durchaus gewissenhaft, arbeitsam, aber auch unbekümmert und, meinem Alter entsprechend, gefühlsfrei. Oft leistete ich des Abends meiner Mutter Maria in der Küche noch Gesellschaft und schnitzte für meine Geschwister kleine Käfer aus Zypressenholz, deren echte Vorlagen ich vorher auf Strohalme aufgespießt hatte, oder ich reparierte geringe Schäden am Haus. Schnell entwickelte ich mich zu einem vortrefflichen Handwerker, dessen Fertigkeiten auch die übrigen Familien der umliegenden Höfe bald zu schätzen wußten, und da meine Eltern einiges Geld angespart hatten, ermöglichte man mir, dem Erstgeborenen, schließlich und endlich eine Instrumentenbaulehre im nahen Padua und ein Gesellenjahr bei Maestro Giusti im ferner gelegenen Lucca. Eines Tages war es soweit. Meine Lehre war abgeschlossen, und ich zog aus dem elterlichen Hofe aus. Die Geschwister winkten, meine Mutter schnäuzte in ihre Schürze, und Vater Francesco packte mich bei den Schultern und sah mir dabei ganz fest in die Augen.
„Vergiß nicht, mein Sohn: Das Glück klopft nur einmal kurz an. Den Rest mußt Du selbst bewerkstelligen.“
Damit ging ich fort. Ich brauchte drei volle Tagesmärsche, um nach Lucca zu gelangen, und hatte nur gerastet, um etwas zu schlafen und mich mit dem Nötigsten zu versorgen. Giusti war ein durchaus geduldiger Lehrer, der mich gar vieles ausprobieren ließ und erlaubte, daß ich, sooft es mir passierte, handwerkliche Fehler machte, welche er jedesmal mit einem gnädigen Lächeln zu quittieren wußte und dazu in altersmilder Weisheit sagte: „Mio caro ragazzo, mein Junge, das war artig – aber nicht großartig.“
Irgendwann konnte er mir nichts mehr beibringen und verwies mich an Bartolomeo Cristofori, einen ehemaligen Studiosus seiner Lehre, welcher nun am Hofe des Fürsten Ferdinando de´ Medici, dem ältesten Sohn des Großherzogs Cosimo III., als Kurator tätig war.
Zum Abschied gab mir Giusti einen Gesellenbrief sowie genug Essen und Trinken mit auf die lange Reise, auf daß ich keinen Mangel zu leiden hatte. Und so machte ich, Giovanni Battista Ferrini, mich ganz allein auf den Weg, meinen eigenen Weg, eine Stadt zu entdecken, die abseits bäuerlicher Werte und Gepflogenheiten auf mich wartete: Florenz.
Der Fluß
Es war ein ganz gewöhnlicher Tag des Jahres 1701, einer jener Tage, an dem die Welt sich müde zu verkriechen suchte, ängstlich, aus ihrer Trägheit aufgescheucht zu werden. Die Sonne stand hoch und grell am Himmel, und die Natur stöhnte unter der Augusthitze, als ich den Strand am östlichen Lauf des Arno erreichte.
Wieder war ich drei Tage lang marschiert, und wieder hatte ich nur gerastet, um etwas zu schlafen und mich mit dem Nötigsten zu versorgen. Erschöpft blieb ich stehen und sah mich um. Vor mir lag die Stadt mit ihren flachen Dächern und spitzen Türmen, das Ziel meiner Reise, für das ich doch sowenig Neugier, geschweige denn Leidenschaft zeigte, wenn mir nicht ein Angebot unterbreitet worden wäre, das ich nicht abzulehnen imstande war. Selbst wenn ich es gewollt hätte, dieser Ort war einfach zu oft geküßt von den Musen der Künste, als daß ich ihn hätte ignorieren können. Und so befand ich mich jetzt hier und überlegte, welchen Weg hinein ich nehmen sollte. Ich entschied mich, über das verdorrte Lavendelfeld zur rechten Seite des Stein-Ufers hinüber zu gehen.
Dort angelangt, fand ich ein aufgeschlagenes Leinen-Zelt vor, aus dem zwei behaarte Beine ragten, regungslos über dem trockenen Grase ausgestreckt. Ich tippte mit meinem Stock an das linke Bein, um nach dem Weg zu fragen. „Scusi“, entschuldigte ich mich für die leicht ungebührliche Störung, „wie gelangt man am besten in die Stadt hinein?“ Das Bein zuckte zusammen, und der dazugehörige Kerl kam aus seinem Zelt gekrochen, erhob sich schläfrig und blinzelte mich an: „Buongiorno, Signore. Was begehrt Ihr?“ „Zu erfahren, wie man am besten in die Stadt gelangt.“
„Zu Fuß“, murmelte der Schläfer, „was denn sonst, wenn Ihr weder Pferd noch Wagen mit Euch führt, wie ich hiermit feststelle.“
Ich suchte das Ufer ab. „Gibt es denn kein Stadttor?“
„Signore, geht dort entlang über den Fluß, und laßt mich gefälligst in Ruh.“
„Welchen Fluß?“, erkundigte ich mich ungläubig.
„Den Arno, oder seht Ihr hier etwa noch einen zweiten?“, knurrte der Schläfer. Der Kerl, ein krausköpfiger Mann um die dreißig Jahre und von recht großer, etwas robuster Statur, deutete in die westliche Richtung: „Die Brücke da, spaziert einfach drüber hinweg, und schon seid Ihr mittendrin.“ Er verschwand wieder in seinem Zelt.
Ich sah mich erneut um. „Aber ich sehe hier keinen Fluß!“, rief ich mit leicht vorwurfsvollem Tone. Seiner Mittagsruhe beraubt, kroch der Schläfer abermals aus seinem Zelt hervor und baute sich in nun voller Länge vor mir, dem Wanderer, auf. „Signore, wollt Ihr mir etwa widersprechen? Ich sage es Euch nicht noch einmal, das dort ist der Arno!“, bedeutete mir der Kerl ungehalten und offenbar nur allzu bereit, seinen Standpunkt notfalls mit Fäusten zu verteidigen. „Es war immer der Arno, und es wird auch immer der Arno bleiben! Also laßt das dämliche Gefrage über den Fluß, sonst müßte ich Euch mit Eurem Kopf zuerst in denselbigen stecken!“ Ich taxierte schnell die körperliche Überlegenheit meines Gegenübers und sagte dann mit einiger Entschlossenheit: „Nun, nun, das könnte ein wenig schwierig werden. Darinnen ist nämlich gar kein Wasser.“