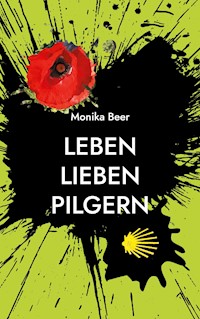
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die traumatisierte, jugendliche Ausreißerin im Haus von Martha und Carlos aufwacht, erinnert sie sich an nichts. Das Ehepaar gibt ihr den Namen Victoria und ein neues Zuhause. Victoria verleugnet ihre Familie, auch als die Erinnerung längst zurückgekehrt ist. Sie hadert mit der eigenen Wertschätzung, an der auch ihr Erfolg als Klavierspielerin und ihre Heirat nichts ändern. Nach einer kurzen Wanderung auf dem spanischen Jakobsweg begegnet sie ihrer großen Liebe. Ihr turbulenter Alltag scheint sich gerade wieder zu beruhigen, als sie von ihrer sterbenden Mutter Erschreckendes erfährt. Nach Antworten suchend wandert sie als Rucksackpilgerin den Camino Portuguès. Eine Reise, die sie nicht nur mit sich selbst versöhnt, sondern auch ihrem Leben eine Wende gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anmerkungen der Autorin zum Buch
Dieses Buch ist ein Roman und gleichzeitig ein Pilgerbericht über den Jakobsweg von Porto nach Santiago de Compostela. Die Handlung und die Personen sind frei erfunden.
Die Etappen und Herbergen auf dem Caminho Português sind so beschrieben, wie ich sie während meiner eigenen Pilgerwanderung erlebt habe.
Die Geschichte:
Als die traumatisierte, jugendliche Ausreißerin im Haus von Martha und Carlos aufwacht, erinnert sie sich an nichts. Das ältere Ehepaar gibt ihr den Namen Victoria und ein neues Zuhause. Victoria verleugnet ihre Familie, auch als die Erinnerung längst zurückgekehrt ist. Sie hadert mit der eigenen Wertschätzung, an der auch ihr Erfolg als Klavierspielerin und ihre Heirat nichts ändern. Nach einer kurzen Wanderung auf dem spanischen Jakobsweg begegnet sie ihrer großen Liebe. Ihr turbulenter Alltag scheint sich langsam wieder zu beruhigen, als sie von ihrer sterbenden Mutter Erschreckendes erfährt. Nach Antworten suchend wandert sie als Rucksackpilgerin den Camino Português. Eine Reise, die sie nicht nur mit sich selbst versöhnt, sondern auch ihrem Leben eine Wende gibt.
Der Wanderführer, aus dem u.a. Texte zitiert wurden, ist das Outdoor-Handbuch, Band 185 „Der Weg ist das Ziel“ von Raimund Joos, Caminho Português, ISBN 978-3-86686-383-5.
Die Sachinformationen über die Rheinhessischen Jakobswege und die St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland e.V.
(www.jakobusgesellschaft.eu) sind zum Teil der Broschüre „Jakobswege in Rheinhessen“ entnommen.
Monika Beer, verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern, war Standesbeamtin und lebt in der Nähe von Mainz.
Als Rucksackpilgerin ist sie immer wieder auf den Jakobswegen in Deutschland und Spanienunterwegs.
Gib dem, den du liebst
Flügel zum Fliegen,
Wurzeln, um zurückzufinden
und Gründe, um zu bleiben.
Dalai Lama
Für Wolfgang, Susanne, Thomas und Alexander
Inhalt
Die Muschel
Marie
Fabian
Katharina
Die Mutter
Martha und Carlos
Matthias
Jan
Burgos und der Camino Francés
Victoria
Anfang und Ende
Verheiratet
Der Rheinhessische Jakobsweg
Nele
Eltern
Caminho Português - Pilgerroute
Caminho Português
Der Vater
Umwege
Die Muschel
Die halbrunde Muschel schmiegt sich in ihren geöffneten Handteller und füllt ihn ganz aus. Sie betrachtet die kräftige Schale mit stiller Freude.
Die Muschel ist das Geschenk eines lieben Menschen. Sie gehörte einem Pilger, der seinen Weg bereits zu Ende gegangen ist.
Ihre Innenseite ist nach außen gewölbt, glänzend weiß, mit dunkelbraunem Saum. Strahlenförmige Rippen laufen zu einem Punkt hin und vereinen sich dort.
Die Außenseite der Muschel kann man jetzt nicht sehen.
Doch die Betrachterin weiß, dass diese die hellbraune Farbe von Meeressand hat. Auch dort finden die strahlenförmigen Rippen am Ende zusammen. Sie treffen sich zwischen zwei flachen, eckigen Schalenstücken, die wie kleine Flügel abstehen.
Diese Muschel ist eine ganz besondere: sie ist eine Jakobsmuschel und hat die Pilgerin auf einem wichtigen Stück ihres Lebens begleitet.
Die Schale ist kraftvoll, so wie das Tier, das einmal in ihr gelebt hat.
Im Gegensatz zu vielen anderen Muscheln, die auf dem Meeresgrund leben, können große Jakobsmuscheln sich gezielt fortbewegen. Durch festes Schließen und Öffnen ihrer Schalen gelingt es ihnen, zu schwimmen. Sie sind außergewöhnliche Geschöpfe unter den Muscheln.
Sie haben ein Ziel, wenn sie sich fortbewegen.
Sie laufen nicht einfach nur davon, so wie es die junge Frau in ihrem bisherigen Leben oft gemacht hat.
Im Mittelalter diente die Jakobsmuschel den Pilgern zum Wasserschöpfen. Heute baumelt sie an jedem Rucksack der Jakobspilger. Sie ist zu ihrem Markenzeichen geworden und weist ihnen die Richtung als Wegweiser auf den Pilgerpfaden nach Santiago de Compostela.
Die Muschel, die jetzt in ihrer Hand liegt, war an ihrem Rucksack befestigt, als sie Anfang Oktober 2013 zu Fuß von Porto nach Santiago de Compostela pilgerte.
Immer, wenn sie sie betrachtet, lächelt sie still vor sich hin, denn sie denkt an den Menschen, der viele Jahre vor ihr mit dieser Muschel zum Grab des Apostels gewandert ist. Ohne ihn wären die vergangenen zweiundzwanzig Jahre ihres Lebens anders verlaufen.
Ihre Geschichte beginnt im Dezember 1992.
Marie
1992
Jemand rüttelte an ihrer Schulter und drehte ihren Körper auf den Rücken.
„Mädchen! – Hörst du mich? – Aufwachen! Du kannst hier nicht liegen bleiben.“
Eine warme Hand klopfte wieder und wieder auf ihre Wangen. Die Männerstimme wiederholte ständig dasselbe Wort: „Aufwachen! Aufwachen!“
Sie blinzelte. Dicht über ihr schwebte ein Gesicht unter einer Mütze. Es verschwamm im Nebel. Ihre Augenlider waren bleischwer.
Irgendwer hob sie hoch, trug sie auf seinen Armen fort. Sie zitterte. Er legte sie ab.
Ein Hund bellte. Ein Motor sprang an. Sie wurde durchgeschüttelt. Ihr Kopf prallte gegen etwas Hartes. Sie war unfähig, sich zu bewegen, ließ alles geschehen und fiel zurück in das Nichts aus weißen Wolken, das sie wie ein schützender Kokon umgab.
Gerne wäre sie dort geblieben. Aber ein zweites Mal zerrte jemand sie heraus aus diesem Nirgendwo. Wieder wurde sie getragen und abgelegt. Sie hörte aufgeregte Stimmen und öffnete die Augen.
Eine Frau huschte geschäftig hin und her.
Ein Mann stand neben ihr. „Jetzt bist du in Sicherheit“, sagte er. Dabei strahlten seine wässrig blauen Augen sie an, als würde er sich freuen. Die grauen Haare waren straff aus dem Gesicht gekämmt, und das Ende eines dünnen Pferdeschwanzes wippte auf seiner Schulter.
Sie drehte den Kopf zur Seite.
Warum freute er sich so? Sie kannte ihn doch gar nicht.
Sonnenlicht drang durch vier kleine Fensterscheiben.
Dahinter war ein Hausdach. Der Schnee darauf glitzerte silbrig. Die Helligkeit blendete. Sie schloss die Augen wieder. Ihr Kopf schmerzte.
„Martha“, hörte sie den Mann sagen, „wir müssen ihr die feuchten Sachen ausziehen. Mach du das. Ich hole eine Wärmflasche.“
Wer war der Mann? Und wer war Martha? - Wo war sie überhaupt?
Sie versuchte, den Kopf zu heben. Ihr wurde schwindelig, und der Kopf fiel zurück auf die Matratze.
Eine Frau beugte sich über ihr Gesicht, hob ihren Kopf vorsichtig an und schob etwas unter ihren Nacken. Sie spürte, dass es weich und warm war. Ein bunter Ringelpullover erhob sich vor ihren Augen und die rundliche Frau mit kurzen, grauen Stoppelhaaren fragte sie: „Ist es besser so?“
„Ja“, krächzte sie leise.
„Ich zieh dir jetzt deine Kleider aus, damit sie trocknen können“, sagte die Frau und zog ihr in Windeseile die Arme aus der Strickjacke, das Shirt über den Kopf und die Hose von den Beinen. Wortlos rubbelte sie Arme und Beine mit einem warmen Tuch ab und legte ihr eine weiche Decke über den Körper.
Der Mann kam zurück, und die Frau drückte ihr eine Wärmflasche auf die Füße, bevor sie sie mit einem dicken Federbett zudeckte.
„Ich habe dir einen Tee gekocht“, sagte der Mann.
Die Frau hielt ihr die Tasse an die Lippen. „Nimm einen Schluck“, sagte sie. „Das wird dir guttun.“
Das Mädchen drehte den Kopf zur Seite und kniff die Lippen zusammen.
„Dann eben später“, sagte die Frau und stellte die Tasse auf den Nachttisch.
„Ich bin übrigens Martha, und mein Mann heißt Carlos.
Und wie heißt du?“
„Ich?“ In ihrem Kopf dröhnte und hämmerte es. Sonst war da nichts. „Weiß nicht!“, sagte sie.
„Hast du Kopfweh?“, fragte Martha.
„Ja.“
„Und deine Füße und Hände?“
Gefühllose Klumpen, in denen es pochte und piekte. „Sie tun weh“, antwortete sie und holte ihre weißen Finger unter der Decke hervor.
„Bleib ruhig liegen und versuche zu schlafen“, sagte Martha und nahm eine goldene Glocke aus dem Gesteck von Tannenzweigen, das auf einem Tischchen stand.
„Wenn dir übel wird oder sonst etwas nicht in Ordnung ist, läute bitte oder ruf ganz laut. Ich lasse die Tür geöffnet.“
„Danke!“, sagte das Mädchen und blickte der Frau nach, die hinter der alten, weiß glänzenden Tür verschwand.
Dann ließ sie ihre Augen langsam durch das Zimmer wandern. Neben der Tür hing ein Gemälde in einem Goldrahmen. Ein Mädchen in einem weißen Kleid spielte auf einem schwarzen Flügel. Unter dem Bild stand ein Tischchen mit zwei Korbstühlen. Daneben ein verschnörkelter Kleiderschrank, dunkelgrün angestrichen. Auf jede Tür hatte jemand ein leuchtend rotes Herz gemalt.
Die Schmerzen in Armen und Beinen wurden immer schlimmer. Der Rücken brannte wie Feuer. Sie drehte den Kopf. Tränen schossen ihr in die Augen, so dass die mit Büchern vollgepackten Regalbretter neben dem Fenster verschwammen und die bunten Kissen auf dem Sofa darunter zu einem farbigen Brei verschmolzen.
Wo war sie? Wer waren Martha und Carlos?
Und wer war sie? Warum fiel ihr ihr Name nicht ein?
Sie hörte Marthas aufgeregte Stimme und den beruhigenden Ton von Carlos. Die beiden standen offensichtlich im Flur. Satzfetzen drangen an ihr Ohr.
„… Viel zu lange… Telefonzelle besetzt…“
„…Krankenhaus Mainz?“
„Unmöglich… kein Durchkommen…“
„… wer weiß… selbst kümmern…“
„… du weißt doch, wie…“
„… später… sehen wir …“ Die Stimmen wurden leiser.
Ihr Herz klopfte aufgeregt, und ihre Gedanken irrten ziellos umher.
Sie war durstig und nahm die Teetasse hoch. Sie entglitt ihren gefühllosen Händen und zersprang auf dem Fußboden. Der Tee spritzte.
Martha stürzte ins Zimmer. „Ach, du meine Güte! Ich hätte dir helfen müssen. Das ist meine Schuld.“
„Nein! Ich habe…, ich wollte…“
„Ist schon gut, mein Kind. Ich mache dir einen neuen Tee.“
Ich bin nicht dein Kind, dachte das Mädchen. Oder?
Martha verließ das Zimmer und kam bald darauf mit einem Wischlappen und einer Tasse Tee zurück. Sie setzte sich auf die Bettkante.
Das Mädchen spürte ihre Wärme, als die Frau ihr sanft mit einem feuchtwarmen Tuch über Stirn und Wangen strich, und versank in dem wohligen Gefühl, umsorgt zu werden.
„Du hast ja eine Verletzung an der Stirn! Tut das weh, wenn ich darüberfahre?“, fragte Martha.
„Ein bisschen“, antwortete das Mädchen.
Mit dem Löffel flößte die Frau ihr den Tee ein. Dann besprühte sie die Hautabschürfung mit einer stinkenden Flüssigkeit.
„Bald wird es besser. Vielleicht kannst du ein wenig schlafen“, sagte sie. „Ich lasse dich wieder allein.“
Das Mädchen schloss die Augen.
Wirre Träume ließen sie nicht zur Ruhe kommen. Sie rannte durch dichtes Schneegestöber. Etwas Böses verfolgte sie. Überall war Schnee. Auch ihre Augen waren voll davon. Er ließ sich nicht wegwischen. Plötzlich steckte sie fest. Zentimeter für Zentimeter versank sie im Tiefschnee. Sie hatte Angst. Wollte schreien. Aber aus ihrer Kehle kam nur ein Krächzen.
Als sie die Augen aufschlug, stand Martha neben ihrem Bett.
„Du hast gerufen“, sagte sie. „Hast du noch Schmerzen?“
Das Mädchen nickte. „Wieso bin ich hier?“, fragte sie.
„Weil Carlos dich in Oppenheim am Rheinufer gefunden hat. Eigentlich bleibt er meistens hier in Nackenheim, wenn er mit dem Hund spazieren geht. Aber er hatte in Oppenheim etwas zu erledigen. Du hast großes Glück gehabt, dass Bella dich gesehen hat“, sagte Martha.
„Ja“, sagte sie nur. Was war davor gewesen? Wo war sie hergekommen? Oppenheim? Nackenheim?
Martha holte einen Schlafanzug und Socken aus dem grünen Schrank. Sie ließ die Tür aufstehen. Innen war ein Spiegel.
„Das sind Sachen von unserer Tochter. Die müssten dir passen“, sagte sie.
„Ihre Tochter? Wo ist sie?“
„Sie ist tot. Sie war vierzehn, als sie im Weiher ertrunken ist. Sie wollte mit Freunden Schlittschuhlaufen. Aber das Eis war nicht stark genug.“
Das Mädchen schluckte und sah Martha sprachlos an. Ihr fiel nichts ein, was sie dazu hätte sagen können.
„Das ist fast zwölf Jahre her.“ Marthas Stimme klang rau.
Sie räusperte sich: „Übrigens: du musst mich nicht siezen.
Es ist doch viel einfacher, wenn du mich auch duzt.“
„Wenn du das möchtest“, sagte das Mädchen.
Martha legte die Sachen auf das Bett. „Ich habe einige von Carlottas Lieblingsstücken aufgehoben. Kannst du aufstehen? Ich helfe dir beim Anziehen.“
Das Mädchen betrachtete seinen Körper im Spiegel der Schranktür. Das runde Gesicht mit den grünen Augen und die roten Locken. Den viel zu kleinen Busen, den runden Bauch und die dicken Oberschenkel, die aneinanderstießen.
Martha stand hinter ihr und starrte auf zwei blutrote Striemen, die quer über ihren Rücken liefen. An einer Stelle war die Haut aufgeplatzt. Auch auf einer Pobacke schien sich ein Bluterguss zu bilden.
„Wer hat dir das angetan?“, wollte sie wissen.
„Weiß ich nicht.“
Das Gummiband der Schlafanzughose war ausgeleiert.
Gut so, sonst hätte sie nicht hineingepasst. Das Mädchen, das da vor ihr im Spiegel zu sehen war, gefiel ihr überhaupt nicht.
Sie fühlte sich total schlapp. Alles tat weh. Das Zimmer drehte sich vor ihren Augen. Ihr wurde übel. Martha griff zum Eimer. Gerade noch rechtzeitig!
Das Mädchen ließ sich auf das Bett fallen. Martha deckte sie bis zur Nasenspitze zu und verließ das Zimmer.
Das Mädchen hörte ihre Stimme: „Na, Bella, du kannst jetzt nicht zu deinem Schützling. Vielleicht morgen. Ja, du bist eine Gute, bekommst auch eine Belohnung.“
Das Mädchen mochte keine Hunde.
Carlos legte die Zeitung aus der Hand, als Martha sich zu ihm auf das Sofa setzte.
„Sie schläft“, sagte sie. „Was machen wir jetzt? Den Notarzt oder die Polizei anrufen? Vielleicht ist sie ja schon als vermisst gemeldet worden.“
„So schnell geht das nicht. Außerdem: wenn ein Kind in der Kälte in dünnen Hausschläppchen und Strickjacke von zu Hause wegrennt, dann ist vorher etwas Schlimmes passiert. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich das Mädchen ins Unglück zurückstoße!“
„Da könntest du Recht haben. Sie hat Verletzungen auf dem Rücken. Die können unmöglich von ihrem Sturz sein.
Für mich sieht das so aus, als wäre sie geschlagen worden.
Aber trotzdem – wir machen uns strafbar, wenn wir sie nicht melden.“
„Papperlapapp! Vermisstenanzeigen gehen erst nach vierundzwanzig Stunden raus. Bei pubertierenden Kindern passiert das doch öfter, dass sie Reißaus nehmen oder bei Freunden untertauchen, wenn sie Frust mit den Eltern haben. Ich habe das öfter erlebt.“
Carlos war viele Jahre als beratender Kinder- und Jugendpsychologe an verschiedenen Schulen und Institutionen tätig gewesen.
„Du musst es ja wissen!“
Martha war insgeheim froh, dass Carlos noch nicht die Polizei verständigen wollte. Sie empfand es als ein Geschenk des Himmels, dass das Mädchen bei ihnen war.
„Lass uns bis morgen früh warten. Vielleicht erinnert sie sich ja dann wieder und erzählt uns, wer sie ist und was passiert ist. Dann können wir immer noch entscheiden, was wir machen. Jetzt ist sie doch erst einmal gut versorgt.
Du bist doch nicht umsonst Krankenschwester.“ Carlos nahm Marthas Hand in die seine. „Denkst du auch an Carlotta?“
Martha nickte. „Das Mädchen ist im gleichen Alter und hat ähnliche Locken.“
„Aber rote Haare und keine schwarzen.“
„Wir könnten sie Victoria nennen, wenn ihr ihr eigener Name nicht einfällt. Was meinst du?“
„Victoria, die Siegerin? Meinst du wegen der Bedeutung?“
„Nicht nur. Ich finde, der Name passt zu ihr. Ich werde sie fragen, sobald sich die Gelegenheit ergibt.“
Wässrige Schneeflocken blieben kurz an der Fensterscheibe kleben und rutschten dann auf den Holzrahmen, um sich aufzulösen. Es waren viele. Das Mädchen beobachtete das Schneegestöber vom Bett aus. Sie fühlte sich wie eine bleierne Ente. Unfähig, aufzustehen.
Jemand klopfte an die Tür.
„Ja?“
Martha kam ins Zimmer. „Guten Morgen. Gut geschlafen?“
„Ja danke, so einigermaßen.“
„Wie fühlst du dich?“
„Geht so.“
„Du hast fast vierzehn Stunden geschlafen.“
„Bin trotzdem noch müde.“
„Das ist gut, dann schläfst du dich wieder gesund. Magst du jetzt einen Tee trinken und ein Brötchen essen?“
„Ich habe keinen Hunger. Ich möchte nur was trinken.
Hast du Pfefferminztee?“
„Ja. Ich mache dir sofort einen. Carlos ist einkaufen gefahren. Er bringt ein Suppenhuhn und Gemüse mit.
Magst du Hühnersuppe?“
„Vielleicht.“
Martha fühlte ihre Stirn. „Fieber scheinst du nicht zu haben. Vielleicht etwas erhöhte Temperatur. Wir messen gleich mal.“ Martha ging zur Tür. „Bin sofort wieder da.“
Das Mädchen blickte ihr nach. Die Verletzung auf dem Rücken schmerzte, und ihr Körper schien von oben bis unten Muskelkater zu haben.
Die Besorgtheit, die die fremde Frau um sie an den Tag legte, tat gut. Sie fühlte sich geborgen, obwohl sie die beiden doch gar nicht kannte: Martha und Carlos. Wer waren sie?
Und wie heiße ich? Warum bin ich hier? Die beiden haben gestern etwas von einem Hund erzählt, der mich gefunden hat. Was war vorher? Auch von ihrer Tochter hat Martha geredet, die in einem Weiher ertrunken ist.
Martha kam zurück und stellte ein kleines Tablett mit Tee, Zwieback und Apfelstückchen neben das Bett.
„Vielleicht bekommst du ja doch Appetit“, sagte sie.
„Später, vielleicht.“ Das Mädchen nahm einen Schluck Tee. „Wieviel Uhr ist es?“
„Ungefähr halb elf.“ Martha holte einen kleinen Wecker aus dem Bücherregal und stellte ihn auf den Nachttisch.
„Damit du die Zeit nicht auch noch vergisst“, sagte sie dabei.
Das Mädchen sah sie irritiert an: „Wieso? Was meinst du damit?“
„Na ja, oder ist dir dein Name inzwischen wieder eingefallen?“
„Nein!“
„Aber die Uhr kannst du lesen?“
„Ja.“
„Das ist gut so.“
„Dann fällt dir alles andere bestimmt auch bald wieder ein.“
„Meinst du?“
„Ja, ganz bestimmt.“
„Wer ist das Mädchen auf dem Bild?“
„Carlotta. Unsere Tochter. Sie konnte wunderschön Klavier spielen.“
„War das hier ihr Zimmer?“
„Ja. Wir haben nur wenig verändert. Es dient uns jetzt als Gästezimmer. Wenn Carlos‘ Verwandte aus Spanien kommen, schlafen sie hier.“
„Kannst du auch Klavier spielen?“
„Ein wenig. Carlos spielt besser als ich.“
„Würdest du mir etwas vorspielen?“
„Okay, wenn es dein Wunsch ist… Aber du darfst nicht so genau hinhören. Ich mache immer so viele Fehler.“
„Das macht nichts. Ich auch.“
Martha sah sie erstaunt an. „Gut!“, sagte sie, „ich lasse die Tür auf, dann hörst du die Musik besser.“
Sie schlug ein paar Akkorde an. Die Töne klangen etwas verstimmt.
Martha spielte, und das Mädchen kuschelte sich in die Kissen. Sie kannte jeden Ton. Martha spielte eines ihrer Lieblingsstücke auf dem Klavier.
Hieß es nicht Elise? Ja: Für Elise, von Ludwig van Beethoven. Sie hatte es auf einem Flügel gespielt. Beim Weihnachtskonzert der Musikschule. Alle hatten wie wild geklatscht und begeistert „Zugabe“ gerufen. Sie liebte den Applaus und träumte davon, Pianistin zu werden.
Elise, Elisa, Elisabeth, Lisa, Lisa-Marie, Maria-Lisa, Marie.
Marie?
Sie schoss in die Höhe, war plötzlich hellwach. Das war ihr Name!
Sie hieß Marie. Marie Schneider. Ihr Herz klopfte wie wild.
Sie hatte Eltern und einen zwei Jahre älteren Bruder.
Fabian. Er war der beste Bruder der Welt, aber leider meistens nicht da, wenn sie ihn brauchte.
Ihr Vater arbeitete bei der Bank und war der Ruhepol in der Familie. Er redete zwar nicht viel, aber er nahm sie manchmal in den Arm. Manchmal genügte das.
Ihre Mutter arbeitete beim Sozialamt, hatte tausend Ehrenämter und war immer im Stress. Entweder war sie hektisch und zänkisch oder leidend und wehklagend. Mit ihr hatte sie häufig Streit. Nichts konnte sie ihr recht machen. Die Mutter leitete neben ihrem Beruf noch die Pfarrbücherei und organisierte Treffen für alleinstehende und hilfsbedürftige Personen. Es waren meist ältere Menschen, die dorthin kamen. Für deren Sorgen und Probleme hatte sie ein offenes Ohr. Mit denen unternahm sie etwas, für die hatte sie Zeit. Da lachte sie und war gut gelaunt, und alle erzählten ihr ständig, was sie für eine tolle Mutter habe.
Eigentlich müsste ich die alle einmal aufklären. Die haben ja keine Ahnung, wie sie sein kann. So, wie die mich behandelt, ist sie vielleicht gar nicht meine Mutter.
Bekomme ich ja oft genug zu hören: Dass ich nicht in die Familie passe.
Die Erinnerung traf sie mit Wucht.
Wie ein Tornado brausten die Gedanken durch ihren Kopf und verdichteten sich zu einem Entschluss: Sie würde sich einfach nicht mehr erinnern! Dann musste sie nicht mehr nach Hause gehen, sondern könnte bei Martha und Carlos bleiben.
Marthas Klavierspiel kam zum Höhepunkt des Stückes.
Die Musik wurde dynamischer und schwoll an, wie zu einem Wasserfall, um dann wieder gemächlich in die ruhige Hauptmelodie einzufließen.
Die Melodie liebkoste ihre dunklen Gedanken, konnte sie aber nicht wegzaubern.
Was mache ich mit Fabian? Ich werde ihn vermissen, und er mich auch. Und Papa? Wird er mich verstehen? Er versuchte immer, ihr zu erklären, dass Mama es „nicht so meinte“, dass sie, genauso wie er, beide Kinder gleich liebhabe, aber dass sie wegen der vielen Arbeit häufig überfordert sei, und dass es einfacher wäre, wenn sie, Marie, besser gehorchte und nicht immer mit dem Kopf durch die Wand wolle. Wenn Papa sie in den Arm nahm und sie sich an seinen dicken Bauch schmiegen konnte, war für einen Moment alles wieder gut.
Aber er entschuldigt Mamas Verhalten immer und sagt, dass sie krank sei! Er könnte ihr doch verbieten, so mit mir umzugehen! Aber nein! Er erwartet immer nur von mir Verständnis für ihre Ausraster und Beschimpfungen.
Immer bin ich selbst an allem schuld. Auch an den Schlägen.
Einmal hatte sie ihn gefragt, warum Mama ihr nicht selbst sagte, dass sie es nicht so meinte oder sich entschuldigte, wenn ihr mal wieder die Hand ausgerutscht sei oder sie ihr schlimme Dinge an den Kopf geworfen habe.
„Das weiß der liebe Gott“, hatte er da geantwortet.
Sollte sie den etwa fragen? Manchmal tat sie das ja. Am liebsten ging sie dazu in die Kirche, die gegenüber auf der anderen Seite des Marktplatzes stand. Sie erzählte dem lieben Gott alles, was sie sonst keinem sagen konnte, noch nicht einmal Fabian. Und manchmal hatte sie das Gefühl, dass Gott sie hörte. Dann fühlte sie sich auf eine besondere Art angenommen und geliebt.
Als sie Marthas schwerfällige Schritte die Treppe hinaufkommen hörte, stellte sie sich schlafend. Vorsichtig strich Martha über das Deckbett und murmelte: „Schlaf dich gesund, mein Mädchen.“
Dann verließ sie leise das Zimmer, ließ die Tür aber offenstehen.
Wenig später hörte Marie die Haustür zuschlagen. Carlos kam vom Einkauf zurück.
Vorsichtig stieg sie aus dem Bett und stellte sich in den Flur. Ein Schwindelgefühl überkam sie. Sie musste sich am Treppengeländer festhalten.
„Und?“, hörte sie Martha sagen, „gab es Neuigkeiten auf dem Markt?“
„Nein!“, sagte Carlos, „es hat noch niemand etwas von einem verschwundenen Mädchen erzählt.“
„Gut so“, erwiderte Martha und hielt das Suppenhuhn unter den Wasserhahn. „Sie schläft schon wieder. Was machen wir, wenn sie sich erinnert, wer sie ist?“
„Das entscheiden wir, wenn es so weit ist“, sagte Carlos.
Martha legte das Huhn in den Topf und begann, das Gemüse zu schnippeln.
„Und wenn sie dann nach Hause will?“, fragte sie.
„Dann müssen wir sie wohl nach Hause bringen“, erwiderte Carlos und seufzte.
Maries Herz klopfte bis zum Hals.
Nein, liebe Martha, dachte sie, ihr müsst mich nicht nach Hause bringen. Ich werde mich nicht erinnern!
Sie hatte genug gehört und legte sich wieder ins Bett.
Essensgeruch und Tellergeklapper weckten sie auf. Sie hatte Hunger. Martha und Carlos saßen bereits am großen Holztisch. Auf blauen Sets standen drei geblümte Suppenteller, die Terrine in der Mitte.
„Wie schön, dass du aufstehen kannst. Ich wollte dich nicht wecken. Ist dir auch nicht schwindelig?“, fragte Martha besorgt.
„Jetzt nicht mehr. Nur, als ich aus dem Bett gestiegen bin“, sagte sie.
„Dann setz dich. Die Suppe wird dir guttun“, sagte Martha und füllte einen Teller.
„Wie fühlst du dich?“, fragte Carlos.
„Geht so“, antwortete Marie und nahm einen Löffel Suppe.
„Schmeckt lecker.“ Sie hob den Kopf und sah Martha an.
„Kann ich bei euch bleiben?“
Martha schickte einen vielsagenden Blick zu Carlos.
„Sagen wir“, begann Carlos langsam und ließ sie dabei nicht aus den Augen, „bis dir eingefallen ist, wo du zu Hause bist.“
„In Ordnung“, antwortete Marie und bemühte sich, sich ihre Erleichterung nicht anmerken zu lassen.
„Was hältst du davon, wenn wir dich Victoria nennen, bis dir wieder eingefallen ist, wie du heißt?“, fragte Martha.
„Wir finden, dass der Name gut zu dir passt.“
„Victoria“, wiederholte sie langsam und lächelte. „Ja, der Name gefällt mir.“
Plötzlich schrak sie zusammen. Etwas Feuchtes und Kaltes berührte ihr Knie.
„Hallo Bella!“ begrüßte Martha den zotteligen Hund und streichelte sein dichtes, schwarzweißes Fell. „Sie will dich begrüßen und freut sich, dass du hier bist. Magst du Hunde?“
„Ich weiß nicht“, sagte das Mädchen.
„Du brauchst keine Angst vor ihr zu haben. Bella ist eine friedliche Hundedame, ein Border Collie. Sie ist ein Hütehund“, sagte Carlos. „Sie hat dich gefunden und wird jetzt auf dich aufpassen. “
„Sie mag dich“, meinte Martha. „Du kannst sie ruhig streicheln.“
Vorsichtig berührte sie mit den Fingerkuppen das Fell.
„Ich habe noch nie einen Hund gestreichelt“, sagte sie und bereute ihre Äußerung sofort wieder.
Martha und Carlos schienen sich nicht zu wundern. Glück gehabt.
„Vielleicht können wir morgen ja mit Bella einen Spaziergang machen“, schlug Carlos vor. „Bella braucht viel Bewegung.“
„Nun warte erst mal ab, bis Victoria wieder ganz gesund ist und sich das Wetter bessert. Bei dem Tauwetter bleibt ihr sonst noch im Matsch stecken“, warnte Martha.
Am nächsten Morgen stand es in der Zeitung:
Die vierzehnjährige Marie Schneider wird vermisst. Sie hat lockige, rotblonde Haare, einen etwas kräftigen Körperbau und ist 1,65 m groß. Sie trägt eine blaue Daunenjacke mit silberfarbigem Sternenmuster, dunkle Jeans und schwarze Winterstiefel mit weißem Pelzfutter. Wer hat Marie gesehen?
Meldungen bitte an: Es folgte die Telefonnummer der zuständigen Polizeidienststelle.
Carlos schob die Zeitung über den Tisch zu Martha.
„Lies das bitte“, sagte er.
„Unglaublich!“, sagte Martha, legte das Blatt zur Seite und sah das Mädchen an.
„Was ist unglaublich?“, fragte Victoria neugierig und kaute auf einem Stückchen Marmeladenbrot herum.
„Was da heute in der Zeitung steht“, sagte Martha.
„Heißt du Marie?“, fragte Carlos.
„Weiß ich nicht! – Ich heiße Victoria! – Das habt ihr doch selbst gesagt!“
Sie rannte aus der Küche und die Treppe hinauf. Oben angekommen bekam sie einen Hustenanfall. Sie knallte die Tür zu.
Martha stand auf. Carlos hielt sie zurück. „Gib ihr Zeit!“, sagte er. „Sie kommt schon wieder runter.“
„Da stimmt doch etwas nicht! War bekleidet mit Winterjacke und Stiefeln. Diese Lügner!“
„Sollten sie sagen, dass ihr Kind mit Hausschuhen und dünner Strickjacke in die Kälte hinausgelaufen ist? Dann klagen sie sich ja gleich selbst an.“
„Sollen wir sie weiterhin Victoria nennen?“
„Natürlich! – Vielleicht erinnert sie sich ja wirklich noch nicht.“
„Das glaube ich zwar nicht, aber du hast Recht.
Andernfalls würden wir sie als Lügnerin abstempeln und ihr Vertrauen zu uns wäre dahin.“
„Trotzdem müssen wir jetzt die Polizei verständigen. Das werde ich gleich mal machen. Ich gehe aber in mein Zimmer. Victoria muss das nicht hören, falls sie runterkommt.“
„Mach das. Ich gehe nach oben zu ihr.“ Martha war besorgt. „Das Mädchen gefällt mir nicht. Hast du sie soeben husten gehört? Ich habe den Eindruck, dass sie eine dicke Erkältung bekommt.“
„Das würde mich nicht wundern“, meinte Carlos und fügte ermahnend hinzu. „Aber bedränge sie nicht mit deinen Fragen.“
Auf ihr Klopfen bekam Martha keine Antwort. Sie betrat das Zimmer. Das Mädchen lag bäuchlings auf dem Bett, das Gesicht im Kissen vergraben.
„Ihr wollt mich wieder loswerden. Stimmt‘s?“, schluchzte sie.
Martha setzte sich auf die Bettkante. „Nein! Davon kann gar keine Rede sein, liebe Victoria. Wir wissen doch gar nicht, ob du die verschwundene Marie bist. Und bis das geklärt ist, musst du sowieso hierbleiben. Du glaubst doch nicht, dass wir dich wegschicken, nur weil in der Zeitung ein Mädchen mit lockigen Haaren gesucht wird!“
Nein, das glaubte sie nicht. Martha würde sie nicht anlügen. Sie drehte sich auf den Rücken und sah Martha mit verquollenen Augen an.
„Ruft Carlos die Polizei an?“, fragte sie heiser.
„Ja“, antwortete Martha zögernd.
„Warum?“
„Damit wir erfahren, ob du diese Marie bist. Das willst du doch selbst auch wissen, oder?“
Das Mädchen schüttelte den Kopf.
Martha ignorierte das und fuhr fort: „Eigentlich wollten wir damit warten, bis wir von dir erfahren, warum du von zu Hause weggelaufen bist, damit wir wissen, ob es dir gut geht, da, wo du herkommst. Es ist schließlich ungewöhnlich, dass ein Mädchen in deinem Alter bei Minusgraden in Hausschuhen und ohne Mantel aus dem Haus läuft. Aber wegen der Vermisstenanzeige…“
Martha legte ihre Hand auf den Arm des Mädchens und sagte: „Wenn dir wieder einfällt, was passiert ist, erzählst du es mir. Versprochen?“
Victoria nickte.
„Sicher machen deine Eltern sich jetzt schreckliche Sorgen um dich“, fügte Martha hinzu und sah, wie sie die Lippen fest zusammenpresste, so dass ihre geröteten Wangen noch röter wurden. Behutsam legte Martha ihre Hand auf Victorias Stirn.
„Du fühlst dich heiß an“, sagte sie. „Ich hole rasch ein Fieberthermometer.“
Die Tür fiel zu. Victoria schloss die Augen.
Kein Zweifel. Sie war das Mädchen Marie. Sie war weggelaufen. Und sie wusste auch wieder, warum.
Wie in einem Film wiederholte sich alles vor ihrem inneren Auge. Es fühlte sich an, als sei sie um ihr Leben gerannt.
Die Kälte kriecht durch die dünnen Sohlen ihrer Hausschuhe. Die Strickjacke wärmt nicht. Die Knöpfe gehen nicht mehr zu. Kein Wunder. So fett wie sie geworden ist!
Sie krallt die Finger um die Knopfleiste und zieht die Jacke vor dem Bauch zusammen, so gut es geht. Hätte sie doch bloß die Winterjacke angezogen!
Die kleine Oppenheimer Altstadt ist voller Menschen.
Weihnachtsrummel überall. Auf dem Marktplatz spielen drei Mädchen „Oh du fröhliche“ auf ihren Blockflöten. Die lange Katharina ist auch dabei. Typisch! Hoffentlich hat die doofe Streberin sie nicht gesehen.
Eine Frau hält sie am Arm fest: „Aber Kind! Bei der Kälte kannst du doch nicht…“.
„Das geht Sie gar nichts an!“ Sie reißt sich los und rennt weiter. Oh doch! Sie kann!!
„Du bist keinen Pfennig wert!“, dröhnen die Worte der Mutter in ihrem Kopf.
Automatisch bewegen ihre Beine sich schneller. Die rechte Pobacke schmerzt.
Mamas Fußtritt ist heftig. Damit hat sie nicht gerechnet.
Sie knallt mit dem Kopf gegen die Tür. Ihr wird schwindelig, und sie fällt auf die Knie. Bevor sie sich wieder aufrichten kann, prasseln Schläge auf ihren Rücken.
Sie kennt diesen Schmerz zu gut. Er kommt vom hölzernen Kochlöffel, zu dem die Mutter manchmal greift.
Wahrscheinlich ist es einfacher, die Tochter mit dem Holzlöffel zu verprügeln, als mit bloßen Händen.
Wie immer, beißt sie die Zähne zusammen und schreit nicht. Schreien und weinen hat sie sich schon lange abgewöhnt. Diese Genugtuung gönnt sie ihr nicht.
Stattdessen rappelt sie sich auf und rennt wie in Trance aus dem Haus.
„Verschwinde!“, schreit die Mutter hinter ihr her. „Ich will dich nicht mehr sehen!“
O ja, sie wird verschwinden! Und dieses Mal wird sie den Weihnachtsstollen nicht zu dem tütteligen Onkel Willi bringen, der immer versucht, ihr ekelige Küsse auf den Mund zu drücken, und den die Mutter selbst nicht besonders gut leiden kann. Warum dann der Stollen? Sie versteht das nicht. Warum erklärt ihr das niemand?
Jede Woche muss sie für ihn einkaufen und ihm Selbstgebackenes bringen. Sie hat einfach keinen Bock mehr auf den stinkenden Griesgram und sein Chaos. Auch wenn er einsam und allein ist. Sollen sie doch Fabian zu ihm schicken. Der pafft ja auch heimlich Zigaretten. Dann kann er sich zusammen mit dem alten Onkel eine reinziehen.
„Warum bist du nur so störrisch und faul?“
„Von mir hast du das bestimmt nicht!“
„Dich hat uns wohl der Kuckuck ins Nest gelegt!“
„Von wem sie wohl die roten Locken hat?“
„Fast könnte man sie für einen Pumuckl halten.“
„Von dem wusste ja auch niemand, woher er kam.
Hahaha!“
„Das sag mal lieber nicht laut. Sonst steigt Georg dir aufs Dach.“
„Kruse Haar und kruse Sinn, in de Mitte steckt de Deibel drin!“
„Das kann man wohl sagen!“
„Aber sie ist gut im Futter. Nascht wohl gerne, wie?“
„Ja, essen kann sie. Aber wenn es ums Arbeiten geht, hat sie zwei linke Hände. Am liebsten würde sie den ganzen Tag am Klavier sitzen oder rumspinnen.“
„Rumspinnen?“
„Na ja, Geschichten eben. Sie denkt sich Phantasiegeschichten von Gespenstern und Hexen aus. Manchmal sitzt sie auch nur da und stiert Löcher in die Luft. Sie guckt sich die Wolken an und hört Melodien oder sieht Bilder, sagt sie. Dann klimpert sie auf dem Klavier herum oder schmiert bunte Wasserfarben auf ein Blatt Papier.
Kein Mensch kann erkennen, was das sein soll.“
„Normal ist das nicht!“
„Sag ich doch!“
Die Stimmen kommen aus allen Richtungen. Werden lauter und lauter. Bedrohlich und brüllend. Schrillend und kreischend. Sie dröhnen und pfeifen in ihren Ohren.
Lauf! Lauf! Streng dich an! Das geht vorbei! Du musst weg von hier! Raus aus der Stadt. Weg von all den Verwandten und ihren grässlichen Stimmen.
Da ist der Bahnhof. Treppauf über die Überführung und wieder treppab. Darunter die Schienen. Ob es weh tut, wenn man sich vor einen Zug schmeißt?
Du musst auf die andere Straßenseite. Die Ampel ist gerade auf Rot gesprungen. Egal! Renn rüber! Ein Auto hupt. Bremsen quietschen.
Da ist die Schule. Es ist Samstag. Niemand da. Nur noch ein paar Häuser. Dann sieht dich kein Mensch mehr. Bald bist du im Wäldchen. Dort, wo im Sommer das dichte Farnkraut wächst. Lauf weiter, immer weiter bis an den Rhein, wo du als kleines Mädchen im Strandbad geplanscht hast, als das Leben noch schön war. Jetzt wartet dort ein menschenleerer Zufluchtsort auf dich.
Sie spürt die Kälte nicht mehr.
Eine dünne Schneeschicht bedeckt den Waldboden. Große Bäume winken mit grässlichen schwarzen Fangarmen.
Nein, sie wird sich nicht einfangen lassen. Von niemandem! Auch nicht von ihrer Angst. Sie wird ihr davonlaufen.
Ha! Sie drückt ihre Fäuste fest vor die Brust. Die Hände schmerzen. Ihre Tränen ballen sich zu einem dicken Kloß in der Kehle zusammen. Nein! Ihr kommt nicht raus!
Bleibt wo ihr seid! Ich weine nicht!
Weiße Atemwolken wabern vor ihrem Gesicht. Fast so weiß wie die Sträucher am Ufer des Flusses, auf deren Zweigen der Reif in der Sonne glitzert. Sie schenkt ihnen keine Beachtung. Sieht nur das Holzhaus mit der Terrasse, auf der man im Sommer im Schatten sitzen und Eis essen kann.
Jetzt sind Fenster und Türen verriegelt. Aber sie wird schon einen Unterschlupf finden. Eine Ecke, in die sie sich verkriechen kann.
Ihre Füße gleiten über gefrorenes Wasser. Sie schliddert.
Sie stolpert und fällt hin. Bleibt einfach liegen. Endlich ist Ruhe.
Sie versinkt im Nirgendwo und lässt sich davontragen von weißen Wolken, die ihren Körper umschlingen.
Wie lange sie dort wohl gelegen hat? Sie konnte sich nicht erinnern. Carlos hat sie herausgeholt aus diesem Nichts.
Sie wäre gerne noch geblieben. Aber er hat sie einfach ins Auto gepackt und mitgenommen.
Es klingelte an der Haustür. Carlos öffnete. Ein Polizist, ein Mann und eine Frau standen im Eingang.
„Na, das ist ja mal eine Überraschung!“, rief Carlos aus.
„Georg Schneider! Kommen Sie herein.“
„Sie kennen sich?“, fragte der Polizist und schaute verwundert von einem zum andern.
„Ja, ja, wir haben mal zusammen in einem Männerchor gesungen“, antwortete Carlos. „Ist schon ein paar Jährchen her. Stimmt’s, Georg?“
„Ja, das stimmt“, sagte Herr Schneider.
„Aha.“ Den Polizisten schien das weniger zu interessieren.
„Sie sind also Carlos González?“
„Ja. Wir haben telefoniert.“
Die Frau drängte sich zwischen die Männer in den Flur.
„Wo ist Marie?“, fragte sie aufgeregt und fuchtelte mit den Armen.
„Oben im Zimmer“, sagte Martha und hielt die Frau zurück. „Moment! Bleiben Sie bitte stehen. Ich muss Ihnen erst etwas sagen. Das Mädchen erinnert sich an nichts.
Sie weiß nicht, wie sie heißt und was passiert ist. Wenn es also Ihre Tochter ist, so gehen Sie bitte behutsam mit ihr um.“
„Ach du großer Gott! Auch das noch!“, stöhnte die Frau und eilte mit Martha die Treppe hinauf. Diese hatte alle Mühe, ihr zu folgen.
„Bleiben Sie ruhig“, bat sie beschwichtigend. Dann legte sie einen Finger auf den Mund und öffnete die Tür einen Spalt breit.
„Psst! Ich glaube, sie schläft. Sie hat Fieber“, flüsterte sie der Frau zu.
Frau Schneider drängte ins Zimmer und blieb neben dem Bett stehen. Lange sah sie das schlafende Mädchen an.
„Ja, das ist Marie. Unsere Tochter“, sagte sie leise und strich mit den Fingerspitzen über die Bettdecke. Dann schnäuzte sie sich und ging wieder hinaus.
„Habe ich Ihnen doch gesagt!“, sagte der Polizist. „Die meisten Vermissten tauchen innerhalb von achtundvierzig Stunden wieder auf. Dann brauchen Sie mich ja jetzt nicht mehr.“
Er verabschiedete sich und verließ das Haus.
Martha ging in die Küche, um Kaffee zu kochen.
Währenddessen erzählte Carlos den Eltern, wie er das Mädchen gefunden hatte.
„Wieso steht in der Zeitung, dass das Kind Winterjacke und Stiefel getragen hat?“, wollte er zum Schluss wissen.
Herr Schneider schaute seine Frau fragend an. Frau Schneider hob wie nichtsahnend die Schultern. Sie zuckte nervös. Als alle drei sie erwartungsvoll ansahen, begann sie zu reden.
„Ich habe das so angegeben“, sagte sie und seufzte. „Ich hatte eine Auseinandersetzung mit Marie und habe mit ihr geschimpft. Sie ist manchmal so störrisch wie ein Esel!
Das bringt mich zur Verzweiflung.“ Wütend rang sie mit den Händen. „Marie ist dann einfach aus dem Haus gelaufen.“
„Hat sie das schon öfter getan?“, fragte Carlos ruhig.
„Ja, ich glaube schon. Oder?“ antwortete Herr Schneider und sah zu seiner Frau.
Frau Schneider zögerte. „Ja“, sagte sie, „aber dann ist sie spätestens nach zwei oder drei Stunden wieder zu Hause gewesen“, sagte Frau Schneider. „Bevor es dunkel wurde, war sie immer wieder zurück.“
„Das hätte sie dieses Mal nicht geschafft“, sagte Martha und goss Kaffee in die Tassen. Einen Moment herrschte Stille.
„Ich danke dir von Herzen, lieber Carlos, dass du unserer Tochter das Leben gerettet hast“, sagte Georg Schneider.
„Ihre Tochter möchte bei uns bleiben“, sagte Martha. „Wir nennen sie übrigens Victoria.“
„Was fällt Ihnen ein?“ Frau Schneiders Stimme überschlug sich. „Sie ist unsere Tochter, und sie heißt Marie! Ich bin Ihnen zwar sehr dankbar, dass sie sich so rührend um unser Kind gekümmert haben, aber das geht ja gar nicht.
Wir nehmen sie wieder mit nach Hause. Und zwar sofort!“
Sie stand auf und zog ihren Mann verzweifelt am Ärmel.
„Georg komm!“
Georg blieb sitzen. „Ich glaube, es ist besser, sie bleibt hier, bis sie sich wieder an uns erinnert“, sagte er ruhig und bestimmt. Sie hielt seinem Blick nicht stand, schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte laut auf.
„Ich glaube, es ist für dich und Marie besser, wenn wir das Angebot von Carlos und seiner Frau annehmen“, fuhr er fort und legte seine Hand beruhigend auf den Rücken seiner Frau. „Es ist ja nur eine vorübergehende Lösung, bis sie wieder ganz gesund ist.“ Dann wandte er sich Carlos zu: „Natürlich komme ich für ihren Unterhalt auf, solange sie hier ist.“
„Einverstanden,“ sagte Carlos. Martha nickte, und senkte den Kopf. Sie konnte ihre Freude nur schlecht verbergen.
Frau Schneider wischte sich mit zitternden Händen die Tränen ab.
Martha sah sie an. „Ich bin Krankenschwester und werde gut für sie sorgen“, versprach sie. „Ich habe nur noch eine halbe Stelle im Schichtdienst und in dieser Woche sowieso frei. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich unseren Hausarzt bitten, sich Marie einmal anzuschauen.“
„Ja, ja, machen Sie das“, sagte Herr Schneider.
Seine Frau öffnete den Mund, sagte dann aber doch nichts.
„Vielleicht können Sie später noch ein paar Kleidungsstücke für Victoria, oh Verzeihung, für Marie vorbeibringen?“
„Ja, das erledige ich heute noch“, versprach Herr Schneider, „aber erst möchte ich zu ihr gehen.“
„Selbstverständlich. Ich komme mit Ihnen.“ Martha ging vor ihm her nach oben.
Marie schlief offensichtlich. Als Georg Schneider jedoch seiner Tochter sanft über die Haare strich, hob sie die Lider ein wenig und sah ihn einen Augenblick mit verschleiertem Blick an. Ihre Lippen bewegten sich. Hatte sie „Papa“ gesagt? Er gab ihr einen Kuss auf die Stirn und malte dann mit dem Daumen ein Kreuzzeichen.
„Der liebe Gott beschütze und behüte dich“, sagte er leise.
„Und werde bald wieder gesund, mein Schatz.“
Kurz darauf verabschiedeten Maries Eltern sich.
„Vielleicht wacht sie ja auf, bis ich wiederkomme“, hoffte Herr Schneider. „Ich werde mich auf jeden Fall beeilen.“
Zwei Stunden später stellte er einen Koffer vor dem grünen Kleiderschrank ab, zog sich einen Stuhl neben das Bett und beobachtete seine Tochter. Er sah ihre fiebrigen Wangen und zerzausten Haare. Er hörte ihren rasselnden Atem und sah ihre zuckenden Augenlider.
Marie wusste nicht, ob sie wachte oder träumte. Wie in Nebelschwaden eingehüllt sah sie den Vater an ihrem Bett sitzen. Aber sie konnte nichts sagen. Ihr Hals war wie zugeschnürt, und ihre schweren Augenlider klappten von selbst wieder zu.
„Schlaf dich gesund, mein Mädchen. Ich komme morgen wieder“, hörte sie ihn sagen, bevor sich die Tür wieder hinter ihm schloss.
„Möchten Sie noch einen Kaffee mit uns trinken?“, fragte Martha, „dann können Sie uns noch ein bisschen was von Marie erzählen.“
„Gern“, antwortete er.
Georg Schneider erzählte, dass seine Frau an einer Angstneurose leide, die sie manchmal gereizt und aggressiv mache. Sie neige dazu, sich ständig zu überfordern. Sie wolle immer perfekt sein, habe panische Angst, Fehler zu machen und nicht geliebt zu werden.
Dieser Zustand stürze sie häufig in Depressionen.
Marie hätte große Probleme, mit den Gefühlsschwankungen ihrer Mutter umzugehen. Sie sei ein eigenwilliges und verträumtes Mädchen, das die Erwartungen ihrer Mutter nicht erfülle, die sich von ihrer Tochter Verständnis für ihre Situation und Hilfe im Haushalt wünsche. Marie aber würde nur widerwillig ihre Pflichten erledigen und sich lieber ihren eigenen Interessen widmen.
„Ich finde, das ist ganz normal für ein Mädchen in dem Alter“, wandte Martha ein. „Was macht sie gerne?“
„Sie liebt Musik, malt und dichtet. Sie schreibt Liedtexte und begleitet sich selbst auf dem Klavier.“
„Das ist doch eine wunderschöne Begabung!“
„Ja, das sagen Sie! Meine Frau hat dafür nichts übrig. Für sie sind soziale Projekte das Allerwichtigste. Sie ist Sozialarbeiterin und engagiert sich ehrenamtlich für alte, alleinstehende und hilfsbedürftige Menschen in unserer Pfarrei. Außerdem leitet sie die Pfarrbücherei. Sie arbeitet viel zu viel, weil sie glaubt, damit ihre Angstzustände verdrängen zu können. Als Marie abends nicht nach Hause gekommen ist, hatte sie eine ganz schlimme Panikattacke. Wir mussten den Arzt holen.“
„Ich könnte euch eine gute Klinik empfehlen“, sagte Carlos.
„Wir haben eine Kur beantragt. Helga wird Anfang des neuen Jahres in den Schwarzwald fahren“, erwiderte Georg Schneider.
Martha und Carlos sahen sich an. „Dann kann Ihre Tochter ja so lange noch bei uns bleiben!“, rutschte es Martha spontan heraus. Sie biss sich auf die Zunge, als sie Herrn Schneiders überraschtes Gesicht sah. „Natürlich nur, wenn sie will und Sie damit einverstanden sind“, ergänzte sie schnell, „schließlich ist in einer Woche Weihnachten.“
„Weihnachten gehört Marie auf jeden Fall nach Hause“, sagte Georg Schneider.
Carlos räusperte sich. „Maries Rücken sieht aus, als sei sie verprügelt worden. Kann es sein, dass deine Frau das war?“, fragte er.
Georg Schneider erschrak. Nervös strich er mit den Fingern über die Tischdecke. „Ich würde es nicht ausschließen“, sagte er.
Auch am nächsten Tag schlief Marie, als der Vater sie besuchte.
Der Hausarzt war da gewesen, hatte sie untersucht und Medikamente verordnet. Kritisch hatte er sich die Verletzungen auf ihrem Rücken angesehen und gefragt, wie das passiert sei.
„Weiß ich nicht“, hatte das Mädchen geantwortet.
Später hatte der Arzt Martha und Carlos zur Seite genommen. Er äußerte die Vermutung, dass das Mädchen entweder auf einen harten Gegenstand gefallen sei oder geschlagen wurde.
„Letzteres glaube ich nicht, ich kenne die Familie“, beschwichtigte Carlos ihn.
„Das heißt gar nichts. Man kann sich auch täuschen“, antwortete der Arzt.
„Das Mädchen wird jetzt erst mal eine Weile bei uns bleiben. Vielleicht erinnert sie sich ja bald wieder, woher die Verletzungen sind“, sagte Carlos.
„Das ist anzunehmen“, sagte der Arzt und verabschiedete sich.
Marie schlief drei Tage lang, an denen Martha nur selten von ihrer Seite wich. Sie machte Wadenwickel und wischte ihr den fiebrigen Schweiß aus dem Gesicht. Sobald sie sich regte, flößte Martha ihr mit einem Löffel heilenden Kräutertee ein.
Am vierten Tag wachte Marie auf und verspürte einen Bärenhunger.
Zwei Tage vor Weihnachten standen der Vater und ihr Bruder Fabian vor der Tür, um sie nach Hause zu holen.
Marie tat, als kenne sie die beiden nicht.
„Ich bin Fabian, dein Bruder! Erinnere dich doch! Bitte, liebe Marie!!“, bettelte der Sechzehnjährige verzweifelt.
Marie sah ihn aufmerksam an. „Ich kenne dich nicht!“, sagte sie. Es fiel ihr schwer, ihm so weh zu tun.
„Wenn du mit uns nach Hause kommst, erinnerst du dich bestimmt wieder, wo du hingehörst“, sagte der Vater.
„Mama wartet auf dich.“
Marie senkte den Blick. „Ich möchte aber hierbleiben“, sagte sie.
Martha und Carlos standen daneben und sagten nichts.
Verstohlen drückte Martha Carlos‘ Hand.
Carlos bat Georg Schneider, ihm in die Küche zu folgen, weil er etwas Wichtiges mit ihm zu besprechen habe.
Als er zurückkam, wirkte Georg Schneider sehr bedrückt.
Einen Moment lang beobachtete er Fabian, der wie mit Engelszungen auf seine Schwester einredete. Sie stand stocksteif vor ihm und kniff die Lippen zusammen.
„Komm!“, sagte der Vater und zog seinen Sohn am Ärmel.
„Marie bleibt erst einmal hier.“
„Aber…“ Fabian war fassungslos.
Georg Schneider verabschiedete sich mit einem Händedruck von seiner Tochter. Seine freie Hand strich dabei sanft über ihre Schulter.
Sie stand reglos da und wartete darauf, dass die Haustür ins Schloss fiel.
Fabian
1992-1993
Weihnachten ohne Marie! Fabian raufte sich die Haare. Einfach unbegreiflich, dass seine Schwester lieber bei diesen Leuten bleiben wollte.
„Ich kenne dich nicht!“, hatte sie zu ihm gesagt und durch ihn hindurch gestarrt. Am liebsten hätte er sie geschüttelt.
Wäre Vater nicht dabei gewesen, hätte er sich bestimmt nicht so zurückgehalten.
Er musste unbedingt herausfinden, was wirklich passiert war. Die Mutter verschwieg ihm etwas, da war er sich sicher.
Nach dem Auffinden von Marie bei den González hatte sie getobt und Heulkrämpfe erlitten, und der Arzt hatte ihr Beruhigungsspritzen gegeben. Und jetzt? Nachdem feststand, dass Marie erst einmal bei den Pflegeeltern bleiben würde, hatte sie ganz lapidar gesagt: „Deine Schwester war schon immer ein schwieriges Mädchen. Sie kann sich nicht mehr an uns erinnern und bekommt jetzt die Therapie, die sie braucht.“ Gerade so, als wäre ihr das schnurzpiepegal.
Vater wusste scheinbar auch nichts Genaues, oder er wollte es ihm nicht erzählen. Jeder von ihnen vermied es, den Namen „Marie“ überhaupt auszusprechen. Er verstand seine Eltern nicht.
Überhaupt zog eine unsägliche Distanziertheit und Kälte durch das Haus, seit Marie nicht mehr da war. Daran konnten auch die vielen Kerzen nichts ändern. Selbst der Tannenbaum strahlte an Weihnachten nicht wie sonst, und Mutters Gänsebraten schmeckte fad. Die Tisch gespräche beschränkten sich auf Höflichkeitsfloskeln und allgemeines Blabla. Die Atmosphäre war erdrückend.
Ohne Marie waren die Feiertage nicht auszuhalten. Er merkte erst jetzt, wie viel seine Schwester ihm bedeutete.
Um möglichst wenig zu Hause sein zu müssen, hatte er viele Dienste in der Kirche und beim Chor übernommen.
Das lenkte ab, und er konnte sich anschließend mit Jan, seinem besten Freund, treffen. Die Freundschaft mit dem drei Jahre älteren Jungen war den Eltern ein Dorn im Auge. Und das nur, weil Jans Mutter ledig war. So ein konservativer Bullshit!
Außerdem waren die Eltern mit einem Lehrer befreundet, der Jan in der achten Klasse unterrichtet hatte. Jan hatte sich einen Spaß daraus gemacht, diesem Lehrer hin und wieder die Zigaretten zu klauen. Mal aus der Jacken- oder Manteltasche, mal aus dem Schreibtisch. Es hat wohl ziemlich lange gedauert, bis der Lehrer ihn erwischt hat.
Jan hatte danach die Schimpftirade des Lehrers auf dem Schulhof imitiert und natürlich die Lacher auf seiner Seite.
Fabian, zu der Zeit erst seit wenigen Monaten braver Fünftklässler, fand das damals überhaupt nicht lustig.
Heute, mit sechzehn, sah er das ganz anders, und fand die Geschichte zum Brüllen komisch.
Außerdem war Jan inzwischen sein bester Freund. Er hatte die Schule nach der Mittleren Reife verlassen und machte jetzt eine Ausbildung zum Automechaniker.
Jan riet ihm, Marie immer wieder zu besuchen und ihr Irgendetwas mitzubringen, das sie besonders mochte. Nur so könne er feststellen, ob und wann sie sich wieder an ihn erinnern würde.
Fabian erzählte seinem Vater von dieser Idee, natürlich ohne Jan zu erwähnen.
„Du kannst es auf jeden Fall versuchen. Am besten rufst du aber vorher an“, war die Antwort.
Martha González meldete sich am Telefon.
„Tut mir leid“, antwortete sie auf seine Frage, „Victoria ist mit Carlos und Bella spazieren gegangen. Aber ich sag ihr Bescheid, wenn sie zurück ist. Sie kann sich dann ja bei dir melden.“
„Victoria?“
„Ja, sie will nicht, dass wir sie Marie nennen. Weißt du das nicht?“
„Nein.“
„Okay, dann weißt du es jetzt. Mach’s gut. Auf Wiederhören.“
Zack, aufgelegt.
Er wartete. Einen Abend. Einen Tag.
Victoria meldete sich nicht.
Er versuchte es noch einmal. Niemand nahm ab. Er sprach auf den Anrufbeantworter. Wieder verging ein Tag.
Eine Woche.
Kein Rückruf, keine Antwort.
„Du musst ihr Zeit lassen“, war der einzige Kommentar des Vaters.
Mit der Mutter konnte er gar nicht über seine Schwester reden. Jedes Mal, wenn er sich anschickte, ihr eine Frage zu stellen, unterbrach sie ihn und sagte, dass sie jetzt keine Zeit habe oder Kopfweh oder zu müde sei.





























