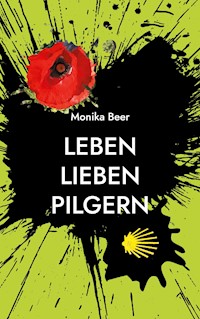Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Freundinnen wollen ihre Lebenssituation verändern: Sabine will sich von ihrem alkoholabhängigen Mann trennen, Andrea hat Probleme mit dem Alleinsein. Sie hoffen, durch eine Pilgerreise Abstand vom Alltag und Klarheit für ihre Entscheidungen zu gewinnen und machen sich zu Fuß auf den fast achthundert Kilometer langen Jakobsweg von den Pyrenäen nach Santiago de Compostela. Das Pilgerleben ist gewöhnungsbedürftig. Die körperlichen Strapazen sind jeden Tag eine neue Herausforderung. Sabine wird lange von Albträumen verfolgt, bis sie endlich das Gefühl hat, auf ihrem Weg angekommen zu sein. Andrea kämpft mit ihrer Angst vor Liebe und Enttäuschung. Humorvolle und spannende Erlebnisse wecken Erinnerungen. Unerwartete Begegnungen schaffen Sehnsüchte. Durch das einfache Leben bekommen alltägliche Dinge wie Duschen, Essen und Schlafen einen neuen Stellenwert. Dankbarkeit und Freiheit werden lebendig. Der Weg steckt voller Überraschungen und stellt viele Fragen. Zitat Andrea: "Der Weg verändert nicht die Menschen, sondern die Menschen, die ihn gehen, verändern ihren Weg." "Dieser Pilgerbericht in Form eines Romans nimmt den Leser gefangen", kommentiert die Fränkische Jakobusgesellschaft in ihrer Zeitschrift "unterwegs". Im Gästebuch der Autorin ist zu lesen: "Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen bis ich es ausgelesen hatte." "Das Buch hat mich motiviert, berührt und fasziniert." "Ein beeindruckender Roman."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anmerkungen der Autorin
Im Spätsommer 2009 bin ich mit einer Freundin den rund achthundert Kilometer langen Camino Francés von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago de Compostela gewandert. Die Erfahrungen dieser Pilgerreise habe ich in meinem Tagebuch festgehalten. Es ist die Grundlage zu diesem Roman.
Die spirituellen Momente, aufkommende Zweifel und Glück, Freiheit und Dankbarkeit, Erschöpfung und Lebensfreude genauso wie die außergewöhnliche Hilfsbereitschaft der Spanier und die atemberaubenden Landschaften habe ich so erlebt.
Die Romanfiguren und ihre Lebensgeschichten dagegen sind frei erfunden und die Begebenheiten erdacht oder so verändert, dass sie sich einfügen.
Monika Beer, geboren in Dinslaken, verheiratet und Mutter von drei Kindern, war im öffentlichen Dienst tätig und viele Jahre Standesbeamtin der Verbandsgemeinde Bodenheim. Sie lebt in der Nähe von Mainz.
Nicht, weil die Dinge unerreichbar sind,wagen wir sie nicht -weil wir sie nicht wagen,bleiben sie unerreichbar.
Lucius Annaeus Seneca
Ich widme dieses Buch
Maria-Theresia Ida,mit der mich eine langjährige Freundschaft verbindet,und meiner Pilgerschwester Rosi.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
01. Aufbruch
02. Paris
03. Aufstieg
04. Erkenntnisse
05. Gottvertrauen
06. Pilgergesichter
07. Sternschnuppen
08. Festtage
09. Kämpfe
10. Bekanntschaften
11. Kraftfelder
12. Wohnstätten
13. Erwartungen
14. Räuber
15. Irrtümer
16. Schutzengel
17. Freiheit
18. Naturereignisse
19. Leidensgefährten
20. Heulendes Elend
21. Gastfreundschaft
22. Einsamkeit
23. Wiedersehen
24. Tango
25. Freunde
26. Garderobenprobleme
27. Sehnsüchte
28. Ein Bettler
29. Der schwere Weg
30. Herausforderungen
31. Ein Handy
32. Dankbarkeit
33. Leben ist Pilgern
34. Neuigkeiten
35. Ermüdungserscheinungen
36. Am Ziel
37. Am Ende der Welt
38. Traum der Liebenden
39. Eine Socke voller Liebe
Epilog
Glossar
Text- und Liednachweis
Danke
Prolog
Sie öffnete die Etagentür zu ihrer Dreizimmerwohnung und trat ein. Am Ende des schmalen Flurs brannte noch Licht in der Küche.
„Hallo, da bin ich wieder!“, rief sie fröhlich und stellte den Koffer ab. Während sie ihren hellgrauen Sommermantel an den Haken hängte, polterte einige Meter hinter ihr etwas auf den Fliesenboden. Sie hörte ein geräuschvolles Schnaufen.
Mit schlurfenden Schritten näherte er sich.
Langsam drehte sie sich um.
Er konnte sich kaum auf den Beinen halten und stierte sie aus glasigen Augen an. In der rechten Hand hielt er ein Tranchiermesser. Sein massiger Körper wankte hin und her, und mit ihm bewegte sich das Messer. Sie wich einen Schritt zurück und spürte die Wand an ihrem Rücken.
Eine Alkoholfahne wehte ihr ins Gesicht.
Sie wollte schreien, aber ihr gelang nur ein Wimmern. Einen Augenblick lang war sie wie versteinert.
Ihre Stimme klang heiser, als sie ungläubig fragte: „Markus, was soll das?“
Sein Arm sank schlaff herab.
Um sich zu vergewissern, dass dies kein Alptraum war, berührte sie ihn kurz an der Schulter und drückte ihn zurück. Doch während er rückwärts taumelte, wuchs seine Aggression. Seine Augen quollen fast über, als er wütend wieder auf sie zu torkelte.
„Wer sin‘ Sie?“, lallte er.
Sie blickte ihn an: „Markus, ich bin es! Sabine! Ich bin deine Frau! Leg das Messer weg!“
Ihre Stimme erreichte ihn nicht.
Sie versuchte, ihm das gefährliche Werkzeug abzunehmen. Ruckartig zog er es wieder an sich und streifte dabei ihren Handrücken. Ein leichter Schmerz durchzuckte sie.
„Raus!“, schrie er sie an. Speichel lief aus seinem Mund.
Sabine sah in sein verzerrtes Gesicht. Ihr Herz raste wie wild.
Ein Blutstropfen spritzte auf den Fußboden.
Wie ein gereizter Bulle stand er da. Ein großer, dicker Mann, ungepflegt und total besoffen.
Ihr Mann!
Sein Anblick widerte sie an.
Ein Blick auf seine alte Jogginghose zeigte ihr, dass er sich eingenässt hatte.
Wie sie ihn hasste!!!
Wieder schwankte er auf sie zu und die Messerspitze richtete sich gegen sie.
Mit ihrer ganzen Kraft stieß sie ihn zurück. Er prallte rückwärts gegen die Wand. Sie hörte, wie sein Kopf gegen das Mauerwerk schlug und sah seinen Körper wie einen nassen Sack zu Boden sinken.
Jetzt erfasste sie Panik.
Sie stürmte die Treppe hinunter und rannte ziellos aus dem Haus. Sie wollte weg. Einfach nur weg, weg, weg… und lief hinaus in die dunkle Nacht.
Plötzlich fand sie sich vor einer Weinstube in der Ortsmitte wieder. Durch die Fensterscheiben drang warmes Licht nach außen. Völlig außer Atem und mit klopfendem Herzen betrat sie den Gastraum.
„Mein Mann…“, stammelte sie dem Wirt entgegen und lehnte sich erschöpft gegen den Tresen.
„Was ist passiert? Sie sind ja kreidebleich!“ Er stellte sich neben sie und legte seinen Arm einen Moment lang tröstend um ihre Schultern.
Die wenigen Gäste sahen beunruhigt und neugierig zu ihnen hin. Sabine nahm es nicht wahr.
Als sie ihre Arme auf die Holztheke legte, erschrak sie. Ihre Hand und die grüne Strickjacke waren blutverschmiert.
„Da, nehmen Sie die“, sagte der Wirt und reichte ihr einen Packen Servietten, bevor er in die Küche eilte.
Er kam mit Verbandszeug zurück und ergriff ihre Finger. „Darf ich? Ich mache Ihnen einen festen Verband“, sagte er und schaute sie an: „War er das?“
„Ja“, schluchzte sie.
„Setzen Sie sich erst einmal“, empfahl er und drückte sie sanft auf eine Bank. Ihre Knie zitterten.
Während er ihre Hand umwickelte, fühlte sie sich für einen kurzen Moment geborgen und hatte das Gefühl, alle Ängste würden mit den Tränen aus ihrem Körper fließen. Sie war dankbar, dass der Winzer keine weiteren Fragen stellte.
Nicht weit entfernt lag Markus in der Wohnung. Was war, wenn er durch den Aufprall gegen die Wand eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte?
Dann hatte er es verdient!!
Mein Gott, ich muss einen Krankenwagen rufen, schoss es ihr durch den Kopf.
Sie sah den Wirt an, der gerade den Verband mit einer Klammer befestigte. „Kann ich bitte telefonieren?“
„Selbstverständlich!“
Er reichte ihr das Telefon, und sie wählte die 110.
Nachdem die notwendigen Angaben gemacht waren, beendete sie mit einem tiefen Seufzer die Verbindung.
Der Winzer stellte ein Glas Traubenbrand auf die Theke. „Der wird Ihnen gut tun. Er ist von meinen eigenen Früchten. Betrachten Sie ihn als Medizin.“
Sabine rümpfte die Nase. Sie hasste diesen Geruch. Seit Ewigkeiten hatte sie keinen Weinbrand mehr getrunken.
Vor ihrer Abreise hatte sie Wohnung und Keller inspiziert und zwei Flaschen Wodka in Markus Werkzeugkasten gefunden. Als sie ihn damit konfrontierte, versprach er ihr hoch und heilig, keinen Tropfen anzurühren. Aber fünf Tage waren eine lange Zeit. Wahrscheinlich zu lang. Wie konnte sie nur immer wieder so naiv sein und ihm glauben? Wenn sie ehrlich war, hatte sie gewusst, dass er sich betrinken würde, sobald sie weg war. Also, warum wunderte sie sich jetzt?
Mit trotziger Gebärde setzte sie das Glas an und leerte es in einem Zug. Die Medizin verbreitete eine wohltuende Wärme in ihrem Innern.
„Geht es wieder?“, fragte ihr Helfer.
„Ich glaube, ja“, sagte sie langsam und erhob sich, „und vielen Dank für alles. Ich werde jetzt wieder nach Hause gehen, damit die Sanitäter nicht vor verschlossenen Türen stehen.“
Draußen umfing sie kühle Nachtluft.
Eigentlich zu kühl für einen Sommermonat, fand sie und schloss die Knöpfe ihrer dünnen Jacke. Gestern in der Pfalz war es wärmer gewesen. Seufzend dachte sie an die vergangene Woche, in der sie gemeinsam mit ihrer Freundin Andrea an einem musikpädagogischen Seminar für Lehrer teilgenommen hatte.
Wenn ich doch bloß nicht gefahren wäre! Ich habe es geahnt. Bin selbst schuld, dass mich jetzt wieder das schlechte Gewissen quält. Ja, aber ich bin doch nicht sein Kindermädchen!! Nein! Ich will das alles nicht mehr. Immer wieder diese falschen Hoffnungen und ständig die Angst vor seinen Alkoholexzessen. Nein! Nein! Und nochmals Nein! Jetzt ist Schluss damit! Endgültig!
Von weitem hörte sie ein Martinshorn. Fast gleichzeitig mit dem Krankenwagen erreichte Sabine das Haus.
Sie gab den Sanitätern ihren Schlüsselbund. Sie wollte nicht mit in die Wohnung gehen. Sie wollte nicht sehen, wie Markus jetzt da lag. Sie wollte ihn überhaupt nicht sehen. Nicht jetzt. Nie mehr!
„Kann ich hier warten?“, fragte sie die Notärztin, die gerade aus ihrem Auto stieg.
Dankend nahm sie das Angebot an, es sich auf dem Beifahrersitz bequem zu machen. Die drei Helfer verschwanden hinter der Haustür.
Wie auf Kommando gingen mit dem Zuschlagen der Tür in einigen Wohnungen die Lichter an. Im Nachbarhaus gegenüber wurde ein Rollladen hochgezogen.
Sabine rutschte unwillkürlich ein Stückchen tiefer in den Autositz. „Da hat Frau Meier wieder was zu tratschen, die neugierige Kuh“, dachte sie, „aber meinetwegen, soll sie doch.“ Im Moment war ihr das alles so egal, wie einem nur etwas egal sein konnte.
Sie starrte gebannt auf die Haustür und dachte wieder an Markus. Wenn er nun stirbt? Bin ich dann schuld daran? Hätte ich ihn vielleicht in die stabile Seitenlage bringen müssen? Und wenn er sich erbrochen hat und daran erstickt ist? Vielleicht ist er ja schon tot! Bei dieser Vorstellung konnte sie nicht mehr still sitzen. Sie stieg aus dem Auto und wanderte unruhig hin und her.
Als sich die Haustür endlich öffnete, blieb sie in einiger Entfernung stehen und sah zu, wie die Trage mit ihrem Mann in den Krankenwagen geschoben wurde.
Erst als der Krankenwagen mit Vollgas und eingeschaltetem Blaulicht davonbrauste, lief sie im Dauerlauf auf die Ärztin zu.
„Was ist mit ihm?“, rief sie ihr entgegen.
„Er ist noch nicht wieder bei Bewusstsein. Er hat eine Gehirnerschütterung und vermutlich eine Alkoholvergiftung. Ich habe seinen Kreislauf fürs Erste einigermaßen stabilisieren können. Alles Weitere geschieht in der Klinik. Aber kommen Sie, ich begleite Sie nach oben, wenn Sie damit einverstanden sind.“
Sabine nickte zustimmend. Es beruhigte sie, dass Markus nicht tot war. Trotzdem war sie froh, dass sie nicht allein in ihre Wohnung zurückgehen musste. Sie spürte, wie die junge Frau den Arm um ihre Schulter legte und sie leicht vorwärts schob.
Mit Hilfe der Ärztin schleppte sie sich die vier Treppen hoch. Sie fühlte sich wie eine Traumwandlerin. Die Wände bewegten sich vor ihren Augen. Dann überließ sie sich ganz dem beruhigenden, festen Arm, der sie hielt und versank in der Schwärze, die sie umgab.
Als sie die Augen wieder aufschlug, lag sie auf ihrem Bett und blickte in das freundliche Gesicht der Ärztin. „Sie hatten gerade einen leichten Schwächeanfall. Ich werde Ihnen später ein Aufbaupräparat und ein beruhigendes Mittel spritzen, damit sie heute Nacht schlafen können.“
Dann nahm sie Sabines Hand und noch während sie fragte: „Darf ich mir das mal ansehen?“, löste sie den Verband. Mit einem fachmännischen Griff desinfizierte sie die Wunde und versorgte sie mit Klammerpflaster. Sie gab Sabine eine Beruhigungsspritze und bat sie, sich für die Nacht fertig zu machen.
„Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich so viel Zeit für mich nehmen“, sagte Sabine, nachdem sie sich wieder ins Bett gelegt hatte, „Ihre Fürsorge tut mir gut.“
„Danke! Ist schon in Ordnung! Sie werden bald einschlafen. Ich habe Ihnen hier meine Nummer aufgeschrieben und lege Ihnen das Telefon für den Notfall auf den Nachttisch. Falls Sie mich noch einmal brauchen sollten, können Sie mich ruhig anrufen. Ich habe die ganze Nacht Dienst. Jetzt hole ich Ihnen noch ein Glas Wasser, und dann schlafen Sie erst einmal. Morgen ist ein neuer Tag.“
Die Ärztin verließ das Schlafzimmer. Sabine war bereits eingeschlafen, als die junge Frau die Wohnungstür hinter sich zuzog.
Am nächsten Morgen hätte Sabine die Wohnung am liebsten fluchtartig wieder verlassen. In der Küche lagen Scherben und leere Flaschen, der Fußboden klebte. Halbleere Kaffeetassen, Teller mit Essensresten und Töpfe, in denen angebrannte Speisen klebten, standen auf der verschmierten Arbeitsplatte. An den Schranktüren waren die Rinnsale undefinierbarer Flüssigkeiten inzwischen getrocknet.
Sie verließ die Küche und ging zum Telefon. Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass die Schulsekretärin bereits da sein musste. Frau Müller stellte keine neugierigen Fragen, als sie sich krank meldete, sondern beendete das Gespräch schnell wieder und wünschte der Lehrerin gute Besserung.
Für einige Kollegen dagegen bin ich heute sicher wieder Thema Nummer eins, dachte Sabine. Sie werden sich das Hirn zermartern mit ihren Spekulationen über meine Ehe.
Sie lehnte sich gegen den Türrahmen. Nein, sie konnte und wollte die Küche jetzt nicht gründlich reinigen. Es fiel ihr schwer, die Übelkeit zu unterdrücken. Widerwillig säuberte sie das Notwendigste und brühte einen Kaffee auf.
Mit der warmen Tasse in der Hand ging sie ins Schlafzimmer, um eine Reisetasche für Markus zu packen. Doch mit jedem Wäschestück, das sie anfasste, wuchs der Zorn in ihr. Hektisch und ohne zu überlegen stopfte sie alles in die Tasche. „Ich könnte platzen!!“, entfuhr es ihr, als sie den Reißverschluss zuzog.
Markus war in die Psychiatrische Abteilung eingeliefert worden und lag auf der Intensivstation. Er hatte das Bewusstsein inzwischen zwar wieder erlangt, war aber noch nicht ansprechbar. Sabine straffte ihren Körper und ging, ohne den kleinsten Seitenblick, an dem großen Glasfenster seines Zimmers vorbei.
Der rundliche Mittvierziger, der ihr entgegenkam, stellte sich als Dr. Martin vor. Er führte sie in einen kleinen Besprechungsraum.
Nachdem sie beide an dem großen Tisch in der Mitte des Zimmers Platz genommen hatten, begann der Arzt das Gespräch: „Ich kann Ihnen sagen, dass Ihr Mann momentan außer Lebensgefahr ist. Er wird ständig überwacht, und wir hoffen, dass sein Kreislauf auch in den nächsten vierundzwanzig Stunden stabil bleibt. Wegen der zu erwartenden massiven Entzugserscheinungen und der Gehirnerschütterung müssen wir ihn ständig ruhig stellen und seinen Zustand beobachten. Ich möchte Sie bitten, jetzt auf keinen Fall zu ihm zu gehen.“
„Ich habe auch nicht das Bedürfnis, ihn zu sehen.“
„Ich verstehe. Seit wie vielen Jahren hat er Probleme mit dem Alkohol?“
„Ich weiß es nicht genau. Vielleicht seit sieben oder acht Jahren.“
„Hat er schon einmal eine Therapie gemacht?“
„Ja, allerdings nur ambulant. Er war immer der Meinung, er schafft das auch so, und das bei ihm alles nicht so schlimm ist.“ „Jaja, das glauben sie alle“, sagte Dr. Martin achselzuckend. „Wenn er wieder ansprechbar ist, werde ich ihn fragen, ob er einer gründlichen Entgiftung seines Körpers zustimmt. Die Behandlung erfolgt mit speziellen Medikamenten, um so die schlimmen Entzugserscheinungen abzumildern und gleichzeitig ein Psychotherapie- und Entspannungsverfahren einsetzen zu können. Meiner Einschätzung nach würde das bei ihm sicherlich zwei Wochen dauern. Anschließend könnte er in eine Rehaklinik überwiesen werden. Sie wissen, dass eine stationäre Entwöhnungstherapie drei bis sechs Monate dauern kann?“
„Ja, allein diese Möglichkeit ist für meinen Mann immer eine Horrorvorstellung gewesen.“
„Na ja, noch sind wir nicht so weit. Er hat jetzt erst einmal eine schwere Zeit vor sich, wenn die Entzugserscheinungen einsetzen. Ich hoffe doch sehr, dass er der Behandlung zustimmt, wenn er erfährt, was passiert ist. Nach seinem Rauschzustand kann er sich wahrscheinlich an nichts mehr erinnern.“
Dr. Martin erhob sich und reichte ihr die Hand, um sich zu verabschieden: „Sie können jederzeit mit der Station telefonieren, wenn Sie wissen möchten, wie es Ihrem Mann geht. Falls etwas Wichtiges passiert, rufe ich Sie an.“
„Danke!“
Sabine verließ das große Gebäude und lief über den Parkplatz zu ihrem Auto. Irgendwie fühlte sie sich wie in einem falschen Film. Sie hatte ihre Gefühle eingefroren.
Mit stoischer Ruhe erledigte sie an diesem Vormittag alles, was nötig war. Pflichtbewusst und kontrolliert wie ein Roboter.
01. Aufbruch
Versonnen blickte Sabine aus dem Zugfenster. Grüne Wiesen und gelbe Getreidefelder zogen an ihren Augen vorbei. Der Hochgeschwindigkeitszug nach Paris machte seinem Namen alle Ehre.
Ihr war es gerade Recht, denn je weiter sich der Zug von ihrem Heimatort Nackenheim entfernte und je früher er in der Seine-Metropole ankam, umso besser. Es konnte für sie nicht schnell genug gehen.
Plötzlich fühlte sie sich von ihrem Gegenüber beobachtet. Andreas braune Augen ruhten auf ihrem Gesicht.
„Und, wie fühlst du dich?“, fragte die Freundin.
„Mit jedem Kilometer besser!“
Sabine räkelte sich, bevor sie die Hände mit einem zufriedenen Seufzer im Nacken verschränkte. Sie verschwanden unter ihren roten Locken, die sie mit einem dünnen Tuch zusammengebunden hatte. „Drei Wochen lang habe ich auf diesen Tag gewartet. Und jetzt ist es wie ein Befreiungsschlag: Täteretäää!!!“ Lachend spreizte sie ihre Finger am ausgestreckten Arm zum Siegeszeichen, bevor sie sie wieder als Kopfstütze gebrauchte. „Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, dass ich jetzt mehr als fünf Wochen lang Zeit für mich selbst habe. Hast du dir das schon mal so auf der Zunge zergehen lassen?“
„Hmm“, grinste die Freundin genießerisch und strich sich mit einer Hand über ihre kurz geschorenen, schwarzgrauen Haare. Sie streckte die Füße mit den dicken Wanderschuhen weit von sich. „Wenn ich so an mir runterschaue, werde ich ganz kribbelig und würde am liebsten sofort loslaufen.“
„Gemach, gemach! Dazu hast du ab morgen genug Zeit. Und dann darfst du jeden Tag laufen!“, versprach Sabine und schob eine lange Haarsträhne unter das Tuch.„Ich bin ja mal gespannt, ob wir uns da nicht zu viel vorgenommen haben. Achthundert Kilometer zu Fuß! Klingt schon ein bisschen größenwahnsinnig. Findest du nicht?“, und ohne eine Antwort abzuwarten fügte sie hinzu: „Ich glaube, ich fahre zwischendurch öfter mal ein Stückchen mit dem Bus. Bestimmt, wenn es so heiß ist wie heute.“
„Jetzt mach aber mal langsam!“, wunderte sich Andrea. „Wer hatte denn diese grandiose Idee, den Jakobsweg zu laufen?“
„Ja, ja, das will ich ja auch immer noch. Aber trotzdem…. ich mein ja nur…. Außerdem ist daran nur diese komische Heiligenfigur in deiner Kirche Schuld. Eigentlich wollte ich ja mit dir in die Einsamkeit der finnischen Wälder und Seen fliehen. Aber der fidele Wanderbursche auf dem Sockel hat mich total hypnotisiert. Sozusagen.“ Sabine bemühte sich, den zweifelnden, ernsten Ton in ihrer Stimme beizubehalten.
„Ach, und deshalb lebst du seit drei Wochen in Trance!?“, ungläubig grinste Andrea ihre Freundin an.
„Ja, so ähnlich.“
„Das glaub‘ ich jetzt aber nicht!“
„Wieso nicht?“, Sabines grüne Augen blitzten vergnügt auf, und ein paar kleine Sommersprossen verschwanden in den feinen Lachfalten, die sich auf ihrer Nase und an den Schläfen ausbreiteten.
Andrea beendete das alberne Geplänkel: „Weil du in dieser Zeit so voller Power und Tatendrang warst, wie man es im Traumzustand nicht sein kann. Ich habe dich sehr bewundert. Nach all dem, was passiert war.“
„Tja, das war auch ganz gut so, denn ich habe mich bewusst in die Arbeit gestürzt, um nicht viel Zeit zum Nachdenken zu haben. Sonst wäre ich womöglich doch noch schwach geworden und in die Klinik gefahren, um Markus zu besuchen“, gestand Sabine. „Vielleicht hat der alte Jakob mir aber auch mit der Vision die nötige Motivation dazu verabreicht.“
„Wer weiß?“
Drei Wochen vorher:
Am Nachmittag nach der Einlieferung ihres Mannes in die Psychiatrie hatte Sabine ihre Freundin in Dittelsheim-Heßloch besucht.
Andrea hatte auf der sonnigen Terrasse ihrer kleinen Souterrainwohnung den Kaffeetisch bereits gedeckt, als sie das Auto vorfahren hörte.
Auf dem Weg zur Tür zupfte sie ein paar verwelkte Blüten aus den großen Blumenkübeln, die vor der Hauswand standen. In dem Steingarten am kleinen Hang, der den tief liegenden Sitzplatz vom großen Garten der Hauseigentümer trennte, wuchsen üppige Sedumgewächse in den verschiedensten Formen und Farben. Andrea liebte die bizarren, fetten Blätter und kleinen Blüten dieser Pflanzen.
Seit ihre Tochter Magdalena vor drei Jahren nach München gezogen war, lebte sie allein. Sie hatte nie geheiratet und arbeitete als Musikpädagogin an der Musikschule Worms, wo sie Querflöte und Musikalische Früherziehung unterrichtete.
Sabine und Andrea waren seit ihrer Gymnasialzeit beste Freundinnen.
Die beiden Frauen begrüßten sich mit einer festen Umarmung, bevor sie an dem gedeckten Tisch Platz nahmen.
„Ach, blüht das wieder herrlich in deinem kleinen Paradies!“, bewunderte Sabine die leuchtende Blumenpracht.
„Ja, ich freue mich auch jeden Tag darüber“, entgegnete Andrea und schenkte Kaffee ein.
Dann sah sie ihre Freundin mit einem besorgten Blick an: „Aber jetzt erzähl mir erst einmal, was gestern Abend passiert ist. Deine Andeutungen heute Morgen am Telefon hörten sich ja schrecklich an.“
„Es war schrecklich!!“
Sabine begann, langsam und stockend zu erzählen. Je mehr sie redete, umso heftiger wurde sie von ihren Gefühlen überwältigt. Tränen liefen über ihr Gesicht. Vor ihrer Freundin brauchte sie nichts zu beschönigen und musste sich nicht zusammenreißen. Hier konnte sie sich gehen lassen.
Andrea hörte zu, ohne sie zu unterbrechen.
Nachdem Sabine sich schweigend zurückgelehnt hatte, fragte Andrea: „Hast du das deinen Kindern auch schon alles so erzählt?“
„Nein, ich habe Tanja nur kurz zwischen zwei Vorlesungen in der Uni erreicht, und ihr lediglich gesagt, dass Markus gestürzt ist und im Krankenhaus liegt. Meinen Großen habe ich im Büro angerufen und ihn leider mitten in einer Besprechung gestört. Der ist natürlich gleich wieder ausgerastet! Felix vermutete sofort, dass sein Vater betrunken war“, berichtete Sabine bekümmert. „Die Kinder kommen beide morgen früh zu mir. Felix bringt seine Freundin auch mit. Eva hat an diesem Wochenende keinen Krankenhausdienst. Ich habe den Eindruck, sie ist ihm eine gute Stütze bei dem problematischen Verhältnis zu seinem Vater. Beim Frühstück haben wir viel Zeit, und ich werde hoffentlich die nötige Ruhe aufbringen, um ihnen alles ausführlich erzählen zu können.“
„Und du wirst dieses Mal nichts beschönigen und Markus nicht in Schutz nehmen?“
„Ja, das habe ich mir vorgenommen.“
Nach dem Kaffeetrinken liefen die Frauen nebeneinander den Weg bergauf zu der kleinen, alten Jakobuskirche. Andrea hatte an diesem Nachmittag noch eine Probe mit Kindern und Jugendlichen in der Kirche des kleinen Weinortes.
Sabine freute sich auf die Ablenkung, auch wenn sie sonst aus den verschiedensten Gründen nicht mehr zu den Kirchgängern gehörte.
Unterwegs bemerkte sie an einer Abzweigung ein kleines blaues Schild mit einer gelben Muschelzeichnung darauf.
Kurz danach las sie das Wort „Pilgerhaus“, das in großen gelben Buchstaben von einer Hauswand leuchtete.
„Verläuft hier ein Jakobsweg?“, fragte sie ihre Freundin verwundert.
„Ja. Der rheinhessische Jakobsweg führt mitten durch unseren Ort. Die sechzig Kilometer lange Strecke von Bingen nach Worms ist erst vor wenigen Jahren neu gekennzeichnet und offiziell eröffnet worden.“
„Komisch, dass mir diese Zeichen noch nie aufgefallen sind.“
„Na ja, du bist ja wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr hierher gelaufen.“
„Da kannst du Recht haben.“
Die Jugendlichen warteten bereits vor der Kirchentür, als die beiden Frauen eintrafen. Andrea wurde sofort von ihnen umringt und verschwand kurz darauf mit der lebhaften Meute in der Kirche.
Sabine betrat zögernd hinter ihnen das Gotteshaus. Ihr gefiel der einfache, harmonisch gestaltete Innenraum sofort.
Hinter dem Altartisch befand sich ein riesiges Marienbild: Maria, auf einer Wolke sitzend, präsentiert ihren Sohn, während etwa zehn Frauengestalten andächtig zu ihr hoch schauen.
Vielleicht lauter heilige Mütter? Sabine wunderte sich, dass sie keinen einzigen Mann auf dem Gemälde fand.
Die Bankreihen in der Kirche waren in drei Gruppen so angeordnet, dass die Gläubigen im großen Halbkreis um den Altar sitzen konnten. Sie setzte sich links neben den Altar und beobachtete ihre Freundin und die Schüler beim Stimmen der Instrumente.
Dann erklang die erste Melodie. Die hellen Stimmen der jungen Sänger berührten sie. Oder war es der Text des irischen Segensgrußes, der schuld an ihrer aufkommenden rührseligen Stimmung war?
„Möge die Straße uns zusammen führen und der Wind in deinem Rücken sein, sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab, hab wenn es kühl wird warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht.
Hab‘ unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot, sei über vierzig Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt: Du bist schon tot.
Bis wir uns mal wieder sehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt, er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nicht zu fest.“
Dazwischen immer wieder der Refrain: „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand…“
Sie schluckte die Tränen hinunter und sah sich um.
An den Wänden hingen mehrere Podeste, von denen Heiligenstatuen in den Kirchenraum blickten. Sabines Augen blieben an einer Pilgerfigur hängen: Ein Mann mit einem Wanderstab in der Hand und einer Kalebasse am Gürtel. Ein Hut, an dem eine Jakobsmuschel baumelte, hing über seiner Schulter.
Sie vertiefte sich in seinen Anblick.
Der heilige Jakobus, dachte sie, und der rheinhessische Jakobsweg führt an der Kirche vorbei. In ganz Deutschland, Frankreich und Spanien hat man viele dieser alten Pilgerwege wieder begehbar gemacht und ausgeschildert.
Ihr fielen die Bücher ein, die sie über den spanischen Jakobsweg gelesen hatte. Egal, ob die spirituellen Erlebnisse von Paolo Coelho und Shirley McLaine oder die körperliche und mentale Herausforderung, die Hape Kerkeling beschrieb. Alle diese prominenten Pilger waren zuvor an einem Wendepunkt in ihrem Leben angelangt und sehnten sich nach einer Zeit, um Abstand vom Alltag zu gewinnen. Galt das nicht auch für sie?
Die langen Sommerferien standen vor der Tür. Vielleicht sollte ich diese Zeit nutzen, um den Jakobsweg zu laufen? schoss es ihr durch den Kopf. Nein! Was war das denn für eine Schnapsidee! Schnell schob sie den Gedanken wieder zur Seite. Pilgern war nicht ihre Sache.
Sie könnte mit Andrea nach Finnland fahren. Da wollten sie doch immer schon mal hin. In die Einsamkeit der herrlichen Natur, der finnischen Wälder und Seen. Wandern, Kanu fahren, Schwimmen, Saunieren und Lesen…, während Markus im Krankenhaus war. Ja, der konnte ihr jetzt sowieso mal gestohlen bleiben. Den würde sie am liebsten ganz vergessen. Zu viel war in den letzten Jahren passiert.
Sie hob den Kopf und blickte die Figur des Heiligen Jakobus an. Oder vielleicht doch den Jakobsweg in Spanien gehen? Laufen machte schließlich den Kopf frei. Sie müsste ja nicht jeden Tag in eine Kirche rennen!
Andrea würde bestimmt mitkommen. Hatte sie nicht sogar schon mal davon gesprochen, dass sie das gerne mal machen würde? Nur mit einem Rucksack auf dem Rücken einfach jeden Tag aufs Neue loslaufen und sehen, was passiert. Nichts planen, sondern sich einfach leiten lassen. Ob das bei ihr überhaupt funktionieren würde? Für sie musste möglichst alles zu kontrollieren und zu regeln sein. Sie konnte sich das „Einfachdrauf-los-laufen“ irgendwie nicht richtig vorstellen.
Obwohl der Gedanke, einmal nichts planen und organisieren zu müssen, sich um nichts kümmern und in den Tag hinein leben zu können, etwas sehr Verlockendes hatte. Eigentlich war es genau das, was sie jetzt brauchte. Ja, wenn sie ehrlich war, sehnte sie sich direkt danach…!
Unentwegt hatte sie die Statue angestarrt, während ihre Gedanken umherwanderten.
Plötzlich war ihr, als käme der Heilige von seinem Podest herunter und auf sie zu. Sie hatte sein Gesicht und den Hut mit der Muschel direkt vor ihren Augen.
„Begrab deine Zweifel! Es ist an der Zeit, dass du einmal etwas für dich tust! Mache dich auf den Weg! Laufe diesen langen Pilgerweg für dich! Es wird dir gut tun! Vertraue dir selbst! Gott wird dir helfen!“
Hatte er da gerade zu ihr gesprochen?
Laute, rhythmische Musik brachte sie schlagartig in die Wirklichkeit zurück. Sie war wie benommen von der Vision und den eindringlichen Worten. Vorsichtig schüttelte sie den Kopf und steckte eine Haarsträhne hinters Ohr. Dann sah sie zu Andrea hinüber.
Die Freundin war voll in ihrem Element und dirigierte die Jugendband mit viel Enthusiasmus. Ihre Begeisterung übertrug sich auf die Kinder. Sabine sah, dass die jungen Instrumentalisten eifrig bei der Sache waren, während die Sänger aus voller Kehle ihr Lied schmetterten.
Die Probe war zu Ende.
Sabine wartete, bis die jungen Musiker ihre Instrumente eingepackt und sich verabschiedet hatten. Erst als Andrea ihnen zum Ausgang hin folgte, stand auch sie auf und ging aus der Kirchenbank.
Wortlos liefen sie eine Weile nebeneinander her.
„Was ist? Hat dir unsere Musik die Sprache verschlagen?“, fragte Andrea nach einer Weile.
„Nee, das nicht, obwohl ich ganz begeistert von deinen Schülern bin. Ihr seid eine tolle Truppe. Aber ich überlege die ganze Zeit, ob ich dich etwas fragen soll.“
„Na, frag schon. Mach‘s nicht so spannend.“
„Würdest du in den Schulferien mit mir den spanischen Jakobsweg gehen?“
Ein ungläubiges Staunen lag in Andreas Gesichtszügen, als sie stotterte: „Ja, aber… wieso… jetzt? Na klar, würde ich! Gerne sogar!!“
Von dem Tag an lief alles fast wie von selbst. Die gemeinsamen Reisevorbereitungen lieferten viel Euphorie und die beruflichen Abschlussarbeiten in den Schulen, wie das Zeugnisschreiben, das Schulfest und die vorbereitenden Arbeiten für das nächste Schuljahr, alles klappte ohne Schwierigkeiten oder nennenswerte Probleme.
Sabine fragte sich, ob das an ihrer Vorfreude oder daran lag, dass Markus sich in der Klinik zu einer stationären Entgiftung und anschließenden Entwöhnungstherapie entschlossen hatte.
Andrea war überzeugt, dass es die Anziehungskraft des Jakobsweges war. „Wenn man sich einmal vorgenommen hat, diesen Weg zu gehen, gibt es keine Stolpersteine mehr, die einen daran hindern könnten. Der Camino übt eine Sogwirkung aus und die Sehnsucht loszulaufen wird immer größer“, sagte sie.
So kam es, dass sie sich jetzt im Zug gegenüber saßen und unterwegs nach Paris waren, um noch für ein paar Stunden Großstadtluft und Zivilisation zu schnuppern, bevor sie sich am nächsten Morgen in die Einsamkeit des Pilgerweges stürzen würden.
02. Paris
Die Freundinnen schulterten ihre Rucksäcke und stiegen nacheinander aus dem Zug. Sofort wurden sie von einer strömenden Menschenmenge erfasst und zum Ausgang gezogen.
Als sie endlich aus dem Gewühl heraus waren und auf dem Bahnhofsvorplatz standen, sagte Sabine: „Kneif mich mal.“
„Warum?“
„Damit ich merke, dass ich wach bin und nicht träume.“
„Okay!“, lachte Andrea und kniff kräftig zu.
„Aua! So fest nun auch wieder nicht.“ Sabine rieb über die rote Stelle an ihrem Arm.
„Riechst du sie auch?“, alberte Andrea.
„Wen soll ich riechen?“
„Na, die Pariser Luft natürlich!“
„Ja klar, du Scherzkeks!“, grinste Sabine und knuffte ihre Freundin in die Seite. „Und nun? Sollen wir gleich zum Montmartre hoch laufen?“
„Vielleicht kümmern wir uns erst einmal um Schließfächer für unsere Rucksäcke. Oder willst du den bei der Hitze durch die Großstadt schleppen?“
„Nein, das will ich ganz und gar nicht.“
Die Suche nach Schließfächern gestaltete sich als sehr schwierig; denn es gab keine mehr. Nach dem Bombenanschlag auf die Metro vor einigen Jahren hatte man alle Schließfächer abmontiert.
„Na, auch gut. Wir müssen uns sowieso an unsere Rucksäcke gewöhnen“, stellte Andrea fest.
„Ja, das müssen wir wohl. Die werden wahrscheinlich irgendwann zu uns gehören wie Arme und Beine.“
„Dann sind sie angewachsen.“
Voller Tatendrang machten sie sich zu Fuß auf den Weg zum Montmartre, nachdem Andrea versichert hatte: „Das ist nicht weit. Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir in einer halben Stunde oben.“
Eine halbe Stunde später befanden sie sich allerdings noch nicht oben, sondern in einem Araberviertel. Wieder waren sie in einem menschlichen Gewusel. Sie hielten sich fest an den Händen, um sich in dem dichten Gedränge nicht zu verlieren.
Tausend verschiedene Gerüche und Sprachen stürmten auf sie ein. Ständig wurden sie von Händlern angequatscht, die etwas verkaufen wollten. Aber sie verstanden kein Wort und hatten alle Mühe, die aufdringlichen Hände der dunkelhäutigen Männer abzuwehren.
„Mein Gott, was bin ich froh, wenn wir hier raus sind“, lamentierte Sabine.
Als sie endlich bei der Kirche Sacré-Coeur ankamen, die majestätisch über der Stadt thront, waren sie fix und fertig.
Sie suchten sich einen freien Platz auf der Grünfläche unterhalb der Basilika, ließen ihre Rucksäcke auf den Rasen fallen und sich selbst daneben.
„Ab jetzt fahre ich nur noch mit der Metro durch Paris!“, verkündete Sabine, „sonst bin ich ja schon kaputt, bevor ich einen Fuß auf den Jakobsweg gesetzt habe.“
„Okay“, räumte Andrea ein, „damit bin ich einverstanden. Ich habe mich mit der Entfernung wohl doch etwas vertan. Tut mir leid. Oder wir sind einen Umweg gelaufen.“
„Tja, das Gefühl habe ich auch. Du glaubst ja gar nicht, wie froh ich bin, dass wir das Gewicht unserer Rucksäcke auf acht Kilo beschränken konnten. Ich finde das Ding nämlich ganz schön schwer und sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allem bei der Hitze.“
„Du sagst es!“
Sie lagen im Gras und sahen von weitem den Jongleuren und Breakdancern zu, die ihre Kunststücke vor der Zuckerbäckerkirche zum Besten gaben. Überall wimmelte es von Touristen. Nicht nur auf der Rasenfläche, auch auf den Treppenstufen und Stützmauern saßen die Menschen. Andere strömten in Scharen in die Kirche. Irgendwann schlossen sich auch die Freundinnen der Masse an und machten einen Rundgang durch die zwar wunderschöne, aber übervolle Touristenattraktion.
Dann bummelten sie weiter durch das Künstlerviertel, sahen den Malern bei ihrer Arbeit zu und beobachteten das bunte Treiben und die vielen Menschen von einem Café aus. Hier, unter einem Baum, bei frisch gebackenen Waffeln und Kaffee ließ es sich wunderbar aushalten.
Erst als die Sonne nicht mehr so heiß war, stiegen sie langsam bergab zur nächsten Metrostation und fuhren in die Unterstadt. Sie spazierten zwischen vorbeieilenden Anzugträgern, stöckelnden Schönheiten, schmusenden Pärchen, gestressten Müttern mit Kinderwagen, trödelnden Schulkindern und Touristen durch die belebten Straßen. Sie schauten in die Auslagen der großen Kaufhäuser und kleinen Boutiquen, überquerten die Straßen zwischen hupenden Autos, bummelten durch den Botanischen Garten, schlenderten am Rathaus vorbei und zur Kathedrale Notre Dame. Die große, eindrucksvolle Kirche an der Seine hatte leider ihre Pforten für heute schon geschlossen. Am Fluss saß eine Gruppe junger Leute auf der Kaimauer und machte Picknick.
Aus einem kleinen Brunnen sprudelte frisches Trinkwasser. Die beiden Frauen stellten ihre Rucksäcke ab, um sich zu erfrischen.
„Ach du meine Güte!“, rief Sabine und fasste sich an die Stirn, „was ist denn jetzt los? Ich habe das Gefühl, ich falle gleich hinten rüber, so ohne das Gewicht auf dem Rücken. Wie soll das denn erst mal werden, wenn wir den Rucksack den ganzen Tag getragen haben?“
„Dann werden wir uns wohl einen Seemannsgang angewöhnen, um das Gleichgewicht zu halten“, lachte Andrea. „Aber mal was anderes: Ich habe dicke Füße vom Rumlaufen und genug gesehen. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt in ein gemütliches Lokal setzen, in dem wir uns ausruhen können?“
„Das ist eine Superidee!“
„Am anderen Ufer der Seine ist die Altstadt mit vielen, schönen Lokalitäten. Ich war dort vor ein paar Jahren schon einmal.“ Andrea schritt zielstrebig voran. „Lass uns hier über die Brücke gehen.“
Bald erreichten sie den historischen Stadtteil, der so gar nicht in die große Metropole zu passen schien. Die bunt gestrichenen Häuser hatten einen besonderen Charme. Zwischen den alten Mauern bummelten viele Touristen. In den kleinen Gassen fanden sie Andenkenläden mit überquellenden Schaufenstern und hübsche Boutiquen. Originelle und gemütliche Bars und Restaurants lockten zum Einkehren.
Die Freundinnen entschieden sich für eine Pianobar, deren Glastüren zur Straße hin weit geöffnet waren. Ein herrlicher Platz, um bei einem kühlen Bier und französischer Musik das bunte Treiben zu beobachten.
Der junge Pianist begleitete eine zierliche Sängerin zu ihren Chansons. Sie hatte es sich dazu auf dem schwarzen Flügel bequem gemacht und räkelte sich lasziv zur Melodie. Mal saß sie mit übereinander geschlagenen Beinen auf der Kante des Flügels, mal lag sie auf dem Bauch und streckte ihre Füße in die Luft. Hin und wieder warf sie ihrem Begleiter schmachtende Blicke zu. Ihre wohlklingende Stimme umfasste mehrere Oktaven und schwang sich von tiefen, rauchigen Tönen problemlos hinauf in glockenklare Höhen.
Sabine und Andrea beobachteten amüsiert das gekonnte Gehabe der beiden Künstler und genossen die Musik, die das Urlaubsfeeling und die Atmosphäre eines Sommerabends in Paris komplett machten.
„Das alles hier erinnert mich stark an unsere Abifahrt“, bemerkte Sabine und sah sich um.
„Genau daran habe ich auch gerade gedacht. Weißt du noch, wie wir nach dem Chansonabend bis spät in die Nacht hinein am Seineufer gesessen und mit den beiden netten französischen Jungs geflirtet haben?“
„Und ob! Der eine ist doch noch ans andere Ufer geschwommen, um dir zu imponieren.“
„Stimmt! Wir haben uns über ein Jahr lang Briefe geschrieben. Er hieß Jean. Ich habe ihn noch einmal getroffen, als ich einige Monate später mit dem Jugendorchester zu einem Konzert in Fontainebleau war.“
„War das damals nicht auch deine erste Begegnung mit Benjamin Bergengruen?“
„Ja, er war der Solist unseres Konzertes. Mein Gott, was habe ich ihn damals angehimmelt!“, lachte Andrea und schüttelte verständnislos den Kopf. „Wenn er Querflöte spielte, bin ich einfach nur so dahingeschmolzen. Aber das weißt du ja. Außerdem will ich über meine Jugendsünden jetzt gar nicht reden“, beendete sie den kurzen Abstecher in ihre Vergangenheit.
Andrea studierte nach dem Abitur an der Musikhochschule Mainz Querflöte. Nach besagtem Konzert in Frankreich war der begabte und gut aussehende Flötist Bergengruen ihr absolutes Idol. Als sie einige Monate später erfuhr, dass er einen Meisterkurs für Studenten abhielt, meldete sie sich sofort zu diesem dreitägigen Unterricht bei ihm an.
Am letzten gemeinsamen Abend, den sie mit den anderen Kursteilnehmern in feuchtfröhlicher Runde verbracht hatte, tat sie alles, um neben ihrem Meister am Tisch zu sitzen und seine Aufmerksamkeit zu erhaschen. Obwohl sie an diesem Abend bereits genug Wein getrunken hatte, lehnte sie seine Einladung zu einem letzten Glas Sekt nicht ab und fand sich am nächsten Morgen in seinem Bett wieder.
Benjamin war zehn Jahre älter als Andrea und Dozent an der Musikhochschule Weimar. Hin und wieder schickte er ihr eine Einladungskarte zu einem seiner Konzerte, aber sie konnte sich die teure Zugfahrt nur selten erlauben. Umso inniger lauschte sie bei diesen seltenen Begegnungen seinem vollendeten Flötenspiel und genoss die gemeinsamen Nächte in seinem Hotelzimmer.
Als er Soloflötist eines großen Sinfonieorchesters wurde und gleichzeitig eine Professur an der Musikhochschule Frankfurt erhielt, wechselte sie den Studienort, und er wurde ihr Lehrer. Andrea schwebte auf Wolke Sieben. Benjamin förderte ihre Begabung und ihr Flötenspiel wurde immer perfekter. Sie träumte davon, einmal mit ihm gemeinsam ein Konzert zu geben. Sie konnte ihr Glück nicht fassen, als dieser Traum in greifbare Nähe rückte.
Sabine sah sie in dieser Zeit eher selten.
Doch dann wurde Andrea schwanger. Ihr Geliebter reagierte sehr verärgert auf diese Tatsache. Er schlug ihr vor, das Baby abtreiben zu lassen, weil es ihrer Karriere im Weg stehen würde. Erst als sie sich weigerte, gestand er ihr, dass er bereits verheiratet sei und eine kleine Tochter habe. Er dachte nicht daran, sich scheiden zu lassen.
Für Andrea brach eine Welt zusammen.
Drei Tage lang verkroch sie sich in ihrem Studentenzimmer. Sie redete mit niemandem und heulte sich die Augen aus dem Kopf.
Als sie ihr Zimmer wieder verließ, hatte sie einen Entschluss gefasst.
Sie fuhr zu ihren Eltern nach Oppenheim, erzählte ihnen alles und bat um ihre Unterstützung. Die werdenden Großeltern freuten sich auf ihr erstes Enkelkind und nahmen ihre Tochter mit offenen Armen wieder zu Hause auf.
Andrea wechselte ihren Studienort und Studiengang. Sie schrieb sich wieder in Mainz ein. Statt des künstlerischen wollte sie jetzt einen pädagogischen Abschluss machen. Als Musikpädagogin hatte sie eher Aussicht auf eine feste Arbeitsstelle und konnte zudem Kindererziehung und Beruf besser unter einen Hut bringen.
Mit der Geburt ihrer Tochter Magdalena änderten sich Andreas Leben und ihre Beziehung zu Männern schlagartig.
Ab jetzt war sie es, die die Männer abblitzen ließ, wenn sie ihr zu anhänglich wurden. Sie hatte es sich verboten, sich noch einmal zu verlieben!
Langsam wurde es dunkel in Paris.
Sabine sah auf die Uhr: „Ich glaube, wir sollten uns auf den Weg zur U-Bahnstation machen und zum Gare d‘Austerlitz fahren, damit wir unseren Nachtzug nach Bayonne pünktlich bekommen.“
Am Ufer der Seine leuchteten die Laternen und unter bunten Lampions spielten Musikanten. Die Leute tanzten und feierten. Andrea sah ihre Freundin an: „Würdest du da jetzt auch gerne runter gehen?“
„Ja, und wie gerne!“
Aber die Zeit drängte. Sie mussten weiter, um ihren Zug nicht zu verpassen.
Andrea blickte auf den Fahrplan: „Mist! Wir müssen noch einmal umsteigen. Und jetzt sind wir auf dem falschen Bahnsteig!“
Wie zwei wilde Hühner rannten sie los, um den Übergang zu suchen. Nachdem sie endlich die richtige Treppe gefunden hatten und atemlos auf der gegenüber liegenden Seite ankamen, fuhr die Bahn gerade ab. Die nächste kam laut Fahrplan in zehn Minuten.
„Wenn der Anschlusszug pünktlich ist, müsste es noch klappen“, rechnete Sabine nach einem Blick auf die Uhr.
Andrea war sauer: „Dein Wort in Gottes Ohr. Tja, wir autofahrenden Landpomeranzen in einer Weltstadt! Wir sind aber auch so bescheuert! Können noch nicht einmal den Fahrplan richtig lesen! Ich könnte mir selbst in den Hintern beißen. Gut, dass wir ab morgen fernab der Zivilisation sind und uns an keine Fahrpläne mehr halten müssen!“
Drei Minuten vor Abfahrt des Nachtzuges erreichte die Metro den Gare d‘Austerlitz. Abfahrt des Zuges von Gleis 32!! Es war der letzte Bahnsteig des Sackbahnhofes!
Also hieß es noch einmal: Die Beine in die Hand nehmen und im Dauerlauf vorbei an einunddreißig Zügen und zwei Fahrkartenkontrolleuren.
„Halt!“
„Auch das noch!“
Rucksäcke absetzen, Billetts hervorkramen und vorzeigen. Ein amüsiert lächelnder Franzose knipste sie ab und wünschte: „Bon voyage!“.
Die Abteiltür schloss sich hinter ihnen, und der Zug setzte sich in Bewegung. Sie waren im letzten Schlafwagen eingestiegen. Ihre reservierten Plätze befanden sich ganz vorne, direkt hinter der Lok.
Sie konnten sich das Kichern nicht verkneifen, als sie durch geschätzte zwanzig Waggons, vorbei an mehr oder weniger schlafenden Reisenden auf hohen Etagenbetten in engen Kabinen, schlichen. Erleichtert plumpsten sie auf ihre Schlafsessel und hatten nur noch einen Gedanken: Morgen früh sind wir in Saint-Jean-Pied-de-Port, und das große Abenteuer kann endlich beginnen!
Was für eine Aussicht nach so einem Tag!!
03. Aufstieg
Nach einer erholsamen Nacht saßen die Freundinnen in der Bahnhofsgaststätte von Bayonne vor heißem Michkaffee und warmen Croissants.
In einer Stunde würde der Nahverkehrszug sie nach Saint-Jean-Pied-de-Port bringen. Ungeduldig richteten sie immer wieder ihre Blicke auf die Bahnhofsuhr. Aber die Zeiger bewegten sich einfach nicht schneller.
Sie waren nicht die einzigen Reisenden, für die die Zeit viel zu langsam verging. Mehrere Rucksackträger wanderten auf dem Bahnsteig auf und ab oder saßen vor dampfenden Kaffeetassen. Neugierig beäugten sich alle, aber keiner sprach ein Wort.
Als der Zug endlich einlief, sah man nur noch in strahlende Gesichter. Für Amerikaner und Asiaten, Franzosen und Italiener, Skandinavier und Holländer, Polen und Deutsche war der Beginn der Pilgerreise zum Greifen nahe gerückt.
In der Morgendämmerung machte sich die internationale Gruppe auf den Weg vom Bahnhof in die Innenstadt von Saint-Jean-Pied-de-Port.
Die weiß getünchten Häuser mit ihren rot und blau gestrichenen Fensterläden leuchteten in der aufgehenden Sonne. Auf den Fensterbänken blühten bunte Sommerblumen und hießen die Wanderer herzlich willkommen. Ein gelber Pfeil führte sie bergauf zum Pilgerbüro der Jakobusgesellschaft. Die Warteschlange reichte weit auf die Straße hinaus.
Die Frauen reihten sich ein, um sich registrieren zu lassen. Name, Herkunft und das geplante Ziel ihrer Pilgerreise wurden festgehalten.
„So können wir nicht verloren gehen“, sagte Andrea.
Der ältere Mann mit dem hageren, sonnengegerbten Gesicht, der ihnen Stempel in die Pilgerausweise drückte, fragte, wie weit sie heute gehen oder ob sie noch einen Tag in Saint-Jean verbringen wollten. Er schwärmte für seine kleine Stadt und ermunterte sie, wenigstens noch ein paar Stunden hier zu verweilen: „Bis Orisson lauft ihr höchstens drei Stunden. Und dort gibt es außer der Auberge nichts. Was wollt ihr also so früh am Mittag schon dort, wenn ihr Betten reserviert habt? Lasst euch ruhig mehr Zeit für unseren schönen Ort. Und denkt daran, genügend Proviant mitzunehmen; denn ihr müsst erst über die Pyrenäen, bevor ihr wieder etwas einkaufen könnt.“
Andrea und Sabine bedankten sich für diesen gut gemeinten Rat und bummelten über holperiges Kopfsteinpflaster bergab. Natürlich nicht, ohne jeden Andenken- und Töpferladen zu besuchen und die handwerklichen oder künstlerischen Arbeiten zu bestaunen.
„Wenn ich mit dem Auto hier wäre, würde ich bestimmt den ein oder anderen Blumenkübel mitnehmen“, meinte Andrea.
„Und, tut es dir leid, dass das jetzt nicht geht?“
„Nein! Ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass ich mich damit jetzt nicht belasten muss.“
„Jetzt müssen wir nur Proviant für unterwegs kaufen!“
In einem kleinen Supermarkt wanderten Äpfel, Baguette, Käse, Tomaten und zwei große Flaschen Wasser in ihre Rucksäcke.
„Puh, das sind mindestens zwei Kilo mehr als vorher!“, stöhnte Sabine.