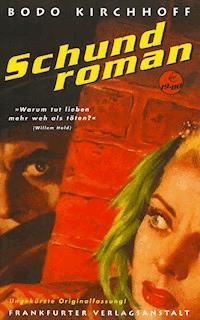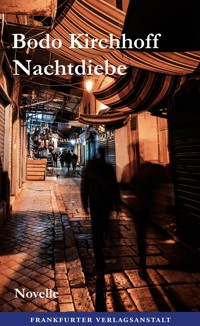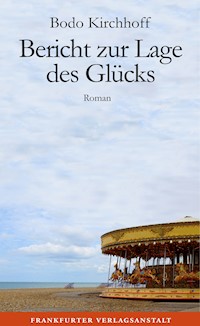Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Wintersemester 1994/95 hielt Bodo Kirchhoff im Rahmen der Frankfurter Poetikdozentur an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität vier Vorlesungen mit den Titeln "Das Kind und die Buchstaben", "Orthopädische Wahrheit", "Schreiben und Narzissmus" und "Dem Schmerz eine Welt geben", erstmals erschienen bei Suhrkamp 1995. Der seit langem vergriffene Band wurde für diese Neuauflage durchgesehen und um den Essay "Auf dem Weg zu einer Sprache der Sexualität" erweitert. Kirchhoff bietet eine lebhafte, sehr persönliche und elegante Mischung aus biobibliographischen Berichten und Selbstanalysen, Reflexionen über zentrale Leseerlebnisse und für ihn bedeutsame Schriftsteller. Ein ausgiebiger Blick in die Werkstatt in Form von Auszügen aus Kirchhoffs Romanprojekt und Gedanken zur Lage der Gegenwartsliteratur sowie eine feurige Philippika über den deutschen Kulturbetrieb runden die Vorlesungen ab. Kirchhoff legt die Triebfeder literarischen Schreibens bloß und bringt in einem eigens für diesen Band konzipierten neuen Essay die Geschichte des eigenen Missbrauchs zur Sprache. Klar umrissene Begrifflichkeiten für eine poetologische Systematisierung lehnt Kirchhoff ab, konzentriert sich auf die Körperlichkeit der Dinge, schreibt über den Männlichkeitswahn eines Hemingway, die Idiosynkrasien eines Kafka und über die Körperlichkeit der Werke moderner, zeitgenössischer Autoren wie Josef Winkler, Marguerite Duras und Hervé Guibert und kommt zu den die Literatur bestimmenden Fragen: "Weshalb bin gerade ich, hier und jetzt, in diesem Körper eingeschlossen? Wo komme ich her, und wo sollte ich hin? Was soll dieses Leben?" ... und: "Gibt es ein Recht auf Glück?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cover
Titel
BODO KIRCHHOFF
LEGENDEN UM DEN EIGENEN KÖRPER
Inhalt
INHALT
Vorwort zur erweiterten Neuauflage
IDas Kind und die Buchstaben
IIOrthopädische Wahrheit
IIISchreiben und Narzissmus
IVDem Schmerz eine Welt geben
VAuf dem Weg zu einer Sprache der Sexualität (2012)
Zeittafel
Vorwort zur erweiterten Neuauflage
VORWORT ZUR ERWEITERTEN NEUAUFLAGE
Im Wintersemester 1994/95 – eigentlich nur vor achtzehn Jahren und doch weiter zurückliegend, in einer Zeit ohne Mobilfunk und Casting-Shows, ohne Vernetzung mit der Welt und dafür dem konkreten Anderen als Spiegel – hatte ich an der Johann Wolfgang Goethe-Universität die traditionsreiche Frankfurter Poetikdozentur. Der Titel meiner Vorlesungen, Legenden um den eigenen Körper, war zugleich Quintessenz einer Poetologie: dass nämlich in jedem Schreiben, meinem ganz sicher, ein Bemühen steckt, sich einen zweiten, besseren Körper zu erschaffen und damit auch das Bild vom eigenen Körper zu korrigieren, soweit man es mit sich vereinbaren kann.
Das Oberflächliche erschien mir immer schon aussagekräftiger als alles Dahinterliegende, das einem als Ergebnis von Spekulationen entgegentritt. Es kommt nur darauf an, das Oberflächliche genau zu lesen und genau davon zu erzählen, dann entsteht, paradoxerweise, ein Sprachkörper mit eigenem Volumen und eigener Tiefe: etwas, das den Autor übertrifft. Getrieben von dem Verlangen, sich selbst zu verbessern, ist man als Schreibender eher ein Schöpfer aus dem Leeren als aus dem Vollen; ich möchte etwas, das ich noch gar nicht kann, aber gerade darum möchte ich es – der Mangel ist der Ansporn. In meinem Schreiben, ja vielleicht der Literatur überhaupt, fällt das, wozu man unfähig ist, ebenso sehr ins Gewicht wie das, wozu man fähig ist. Oder mit einem Vergleich aus der Körperwelt gesagt: Der Antrieb zu einem literarischen Werk, bis das letzte Wort geschrieben ist, ähnelt in seinem Fleiß, seiner Geduld und dem Stück Wahnsinn darin dem Antrieb eines Behindertensportlers, der erst durch das, woran es ihm aufgrund der Behinderung mangelt, zur Form seines Lebens aufläuft.
Die damaligen Vorlesungen (erschienen in der edition suhrkamp, NF 944, und aufgrund meines Wechsels zur Frankfurter Verlagsanstalt längst vergriffen, selbst im Internet und antiquarisch) haben diesem Synergieeffekt von Mangel und Fähigkeit nachgespürt, sowohl am Leben und Schreiben anderer Autoren (wie Kafka, Duras oder Hervé Guibert) als auch an meiner Biographie, wie es der Tradition der Frankfurter Poetikdozentur entspricht. Und in dem Zusammenhang habe ich erstmals über Erfahrungen mit etwas, das heute landläufig Missbrauch genannt wird, berichtet, auch deshalb, weil meine Erfahrungen in den seinerzeit entstehenden Roman Parlando einflossen; als dieser dann 2001 erschien, wurde das jedoch, als ein wichtiger Aspekt des Romans, in keiner einzigen Kritik aufgegriffen, es fehlte die Debatte dazu. Insofern ist Legenden um den eigenen Körper aktueller als damals, zumal in diesem Jahr, 2012, wieder ein umfangreicher Roman von mir erschienen ist, Die Liebe in groben Zügen, bei dem frühe sexuelle Gewalt als ein Aspekt zum Verständnis des Ganzen gesehen werden kann.
Es gibt also mehrere Gründe für eine Neuauflage – mit dem unveränderten Wortlaut der vier gehaltenen Vorlesungen, aber in neuer Rechtschreibung; die fünfte war eine Performance meines Monologs »Der Ansager einer Stripteasenummer gibt nicht auf«, sie wurde hier nicht übernommen, weil das Performative im Zentrum stand. Und nicht übernommen wurden auch die privaten Fotos in dem ursprünglichen Buch, beides zugunsten eines ergänzenden Kapitels (auf Vorschlag und Wunsch meines Verlegers J. U.), das den intimsten Abschnitt der Vorlesungen vertieft, man könnte auch sagen: das die fünfte Vorlesung, die seinerzeit entfiel oder in anderer, theatralischer Form stattfand, als Essay nachliefert.
Im März 2010 erschien im Spiegel (Heft 11) ein sehr persönlicher Beitrag von mir zum Thema Missbrauch unter dem Titel »Sprachloses Kind«, eine Kurzfassung vom Drama der sexuellen Details und ihrer Auswirkungen, die ich in diesem Essay erweitert habe, nicht zuletzt, weil das Echo auf den Artikel immens war, aber auch weil es in den letzten Jahren immer wieder zu Anfragen kam, die sich auf jenen eher kurzen Abschnitt in den Vorlesungen bezogen. Meine unversöhnliche Sicht auf das Internat, in das ich mit elf Jahren kam und das ich im Alter von zwanzig verließ, auf seinen damaligen, sich nicht den Außenstehenden, sondern nur den Ausgelieferten, Wehrlosen offen zeigenden Ungeist in Form versteckter und nackter Gewalt, hat etliche nicht Betroffene, ob ehemalige Lehrer, Erzieher oder Schüler, verstört, ja erbost: als hätte ich mir etwas zusammengereimt oder sei womöglich, typisch Schriftsteller, überempfindlich. Und die Neuauflage der Frankfurter Vorlesungen gibt mir Gelegenheit, in dem Epilog auch darauf einzugehen, wie ein bestimmtes sexuelles Schicksal einmündet in eine bestimmte Schreibgeschichte, die schließlich, und darin liegt das Hoffnungsvolle des Schreibens oder Erstaunliche der Literatur, ihre eigene Richtung einschlägt, sich also emanzipiert von einem Mangel und den Autor gleichsam mitzieht, ihn auf sein Schicksal zurückblicken lässt. Oder weniger gemütlich ausgedrückt: Wenn einen das eigene Schreiben am Ende nicht übertrifft, mehr Qualitäten aufweist als man selbst im Umgang mit dem Sein des Anderen, ist es auch als Legende um den eigenen Körper untauglich. (B. K., Torri del Benaco, Mai 2012)
I – Das Kind und die Buchstaben
I
DAS KIND UND DIE BUCHSTABEN
Guten Abend, meine Damen und Herren – fangen wir ganz einfach an, mit einem Satz aus der Rubrik »Vermischtes«: »In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen.«
Es fällt mir nicht schwer zu erklären, warum gerade solch eine Zeile, erschütternd lapidar, dieser Poetik-Vorlesung vorangestellt ist. Der Sog, den eben jener Satz, Beginn einer Erzählung, vor nun bald dreißig Jahren schon auf mich ausgeübt hat – mir stand damals, erstmalig, ein Weg offen, in der Welt herumzukommen: lesenderweise –, lag nämlich in dem Gefühl, auch an mir, der ich in mich vergraben war, sei in letzter Zeit das Interesse sehr zurückgegangen; und plötzlich sah sich der Leseanfänger eingeladen zu einer Erzählfahrt, in deren Verlauf, so durfte er hoffen, man doch manches erführe über die Ursachen eines derart zurückgehenden Interesses an einem selbst.
Später bin ich dann noch viel herumgekommen, lesenderweise, kehrte aber stets ins Land des Hungerkünstlers zurück; es hat mich bewegt, dieses Land, wie jene schroffen Gegenden, in die hineingeboren zu sein man sich so gern wie schaudernd vorstellt – »… an schönen Tagen«, heißt es dort, »wurde der Käfig ins Freie getragen, und nun waren es besonders die Kinder, denen der Hungerkünstler gezeigt wurde; während er für die Erwachsenen oft nur ein Spaß war, an dem sie der Mode halber teilnahmen, sahen die Kinder staunend, mit offenem Mund, der Sicherheit halber einander bei der Hand haltend, zu, wie er bleich, im schwarzen Trikot, mit mächtig vortretenden Rippen, sogar einen Sessel verschmähend, auf hingestreutem Stroh saß …« Dies kurze Stück (aus der berühmten Erzählung, erschienen 1922) veranschaulicht schon meine Thematik: Schreiben als Legendenbildung um den eigenen Körper, gleichgültig wie kraftvoll oder wie schmächtig, wie anziehend oder abstoßend dieser in den Augen anderer ist; der Schöpfer des Hungerkünstlers hielt bekanntlich nie große Stücke auf seinen Körper; an allem schien es ihm zu gebrechen, was den Körper seines Erzeugers, aufstrebender Prager Kaufmann, auszeichnete. Verglichen mit ihm, war er buchstäblich ein Nobody, wie es im Englischen treffend heißt – dann aber die Worte: »mit mächtig vortretenden Rippen«.
Auf einmal verwandelt sich, schreibend, der Körper dessen, der seinen Mangel an Stattlichkeit selbst herbeigeführt hat, in einen anderen, machtvoll imaginären Körper – den unumstößlichen der Literatur, in dem Fall: jener Erzählung, über die später noch zu sprechen sein wird; zunächst ein weiterer kurzer Text, doch erschienen nicht 1922, sondern 1979 – »Ich habe es wieder zu mir genommen. Es mit Hilfe eines Fotos, welches mich und meine Mutter zeigt, aufgelesen, mit dem kleinen Finger zusammengeschoben, es abgeleckt und verschluckt. Ich habe mir über den Mund gewischt, bin aufgestanden und begann zu posen, was ich jetzt immer noch mache. Ich schaue mich an, diesen unglaublichen Körper mit seinen sagenhaften Einzelheiten, und weiß inzwischen genau: Jene Angst, die alles begleitet, stammt überhaupt nicht von mir.«
Und auch in diesen Zeilen aus meinem Band Die Einsamkeit der Haut das Bemühen doppelter Neuerschaffung: eines unvergänglichen Körpers als Teil der Erzählung (so aussichtslos es sein mag, durch Schlucken des eigenen Samens dessen Verlust auszugleichen) und jenes imaginären, den der Gesamttext verkörpert: nämlich das zu Lesende, die Legende um den gegebenen, durch Torturen des Sports zwar zu verformenden, nie aber zu objektivierenden Körper; erinnern wir uns nur all der Versuche, uns einmal ganz von hinten zu sehen …
In meiner Arbeit ging es von Anfang an, darum das zweite Zitat, um Körper und Schrift, um die Spannungen zwischen Soma und Sema, vermutlich, weil es auch in meinem Leben schon recht früh um diese beiden Pole ging – »Das Kind und die Buchstaben«, heißt daher das heutige Thema. Beim nächsten Mal steht die Wahrheit als eine hergestellte, »Orthopädische Wahrheit« im Mittelpunkt, die Macht und Ohnmacht der Fiktion; in der dritten Vorlesung wird es um »Schreiben und Narzissmus« gehen – etwas, das für sich spricht; oder gegen mich. Und am vierten Abend der Versuch, das Leitmotiv meiner Poetologie, »Legenden um den eigenen Körper«, mit unserer Zeit in Verbindung zu bringen – »Dem Schmerz eine Welt geben«, lautet das Thema. Die letzte Veranstaltung dürfen Sie sich dann als eine Art Theaterabend vorstellen; sie wird an einem anderen Ort stattfinden und einiges von dem, was vorher behauptet wurde, demonstrieren, zum Beispiel, dass jedes Wort im Grunde ein Abtasten des Körpers ist – Titel: »Der Ansager einer Stripteasenummer gibt nicht auf«.
Das Kind und die Buchstaben – wie ließe sich da besser beginnen, als dass ich die Geschichten heranziehe, die mir den eigenen Körper grundlegend interpretiert haben und mich, auf Umwegen, zur Literatur führten, zu jener Art des Schreibens also, bei der man dem Publikum eine bestimmte Sache, seine, vor Augen hält, indem man ihm eine ganz andere zeigt.
Erste Geschichte. Mein Vater – Jahrgang 17 und früh überrollt von den Zeiten – hatte nur ein Bein; er verlor das andere Bein im Krieg, und so lernte das Kind diesen allem vorausgehenden Mann, der weiß Gott mit beiden Beinen im Leben stand, als Einbeinigen kennen. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist die, dass ich mit meinem Vater in Hamburg zum Prothesenbauer ging, wie dieser Besuch immer hieß – und was im Kind zunächst auch das Bild eines Bauern hervorrief, der auf dem Feld Arme und Beine anbaut; sprachlos durchstreifte es, während sein Vater diverse Beine probierte, ein verzweigtes Gewölbe, von dessen Decke Hunderte hölzerner Gliedmaßen hingen.
Etwa um diese Zeit, 1952, durfte das Kind zum ersten Mal mit den Eltern ins Kino; es sah die Geschichte vom hölzernen Jungen Pinocchio und glaubte, sich selbst zu erblicken; vor Aufregung machte es in die Hose, man musste das Kino verlassen – »Ich war’s nicht«, soll das Kind gesagt haben, die Eltern ließen das durchgehen, und schon gab es eine Markierung: Man konnte sich vom eigenen Körper zur Not distanzieren. Nach dieser Erfahrung begann das Kind zu zeichnen. Es zeichnete Schiffe im Querschnitt, die es Ozeanriesen nannte, und schuf sich damit provisorische Buchstaben, eine hieroglyphenartige Schrift, dem Schiffskörper entlehnt, schrägen Schornsteinen und p-förmigen Nebelhörnern, Anker und Bullaugen oder dem Kästchenmuster der Kabinen. Seine Tätigkeit war im Grunde mehr Schreiben als Zeichnen, ein Festschreiben jener Distanz zu allem Körperlichen, das ihm nicht geheuer war, seit es dessen Bestandteile von Gewölbedecken hatte herabhängen sehen – zwischen vier und fünf entwickelte das Kind ein Gefühl, das es erst zwanzig Jahre später, mit Hilfe eines anderen, Jacques Lacan, zu benennen vermochte, das Gefühl eines Mangels an Sein – des Mangels, den Heidegger Schuld nennt, unsere Schuld, darin bestehend, dass wir uns nicht selbst erschaffen haben; das Kind jedenfalls, durch künstliche Glieder früh schockiert und früh ermuntert, sollte die Selbsterschaffung fortan versuchen.
Zweite Geschichte. Die junge, schöne Mutter des Kindes strebte danach, eine berühmte Schauspielerin zu werden; sie war folglich mehr im Theater als zu Hause oder zu Hause so gut wie im Theater, laut ihre Rolle lernend, während im Nebenraum wieder ein Ozeanriese Gestalt annahm; und so erfuhr das Kind schon bald, dass Anwesenheit kein natürlicher, die Spitze einer Hierarchie bildender Zustand ist, sondern nur ein Sonderfall der Abwesenheit: eine für das Kind geradezu machtvolle Abwesenheit vorhandener Eltern.
Die Mutter, besessen von der Vorstellung, ihr Nobody-Sein zu beenden, spielte unentwegt Komödien, immerhin auch am Deutschen Schauspielhaus, wo das Kind, manchmal, während der Proben bei der Souffleuse sitzen durfte, und der Vater, besessen von dem Wunsch, etwas herzustellen, Fabrikant zu werden, stand unter dem Druck, Geld für das Nötigste zu verdienen (erstaunlich dicht unter der Oberfläche war er Künstler, mit Leidenschaft einem genauen Zeichnen verpflichtet und vom diffusen Theaterschein eher abgestoßen); er war eigentlich in allem das Gegenteil der Mutter, ohne den Krieg hätten beide nie zusammengefunden (eine neunzehnjährige Wienerin aus bürgerlich-nervösem Haus pflegte, zwangsrekrutiert, einen schwer kriegsverletzten, gutaussehenden Habenichts aus Hannover; dass man sich verliebte, lag so auf der Hand wie die folgende Heirat; und nicht mehr als ein Gerücht ließ dann das junge Paar nach Hamburg gehen).
Die dritte Größe im Leben des Kindes war die Mutter seiner Mutter, Das Ömchen, früher besessen von der Idee einer großen Opernkarriere; sie war auch Opernsängerin, an der Wiener Volksoper, bis die Standesregeln ihres Bräutigams, eines Majors aus Detmold, den der Krieg gleich verschlang, dieses Bühnenleben beendeten; übrig blieb eine schöne Stimme und das Phantasma des Erfolgs.
Jedes Wochenende holte sie das Kind bei den Eltern ab und ging mit ihm in die Grefflingerstraße. Dort sang sie ihm aus der Butterfly vor, während in einem vermieteten Hinterzimmer ein gewisser Dr. Branzger, den das Kind nie zu Gesicht bekam und darum auch nie vergaß, halb entzückt und halb empört vor sich hinbrummte. Wenn sie dann genug gesungen hatte, bezahlte Das Ömchen zwei Jungs dafür, dass sie mit dem Kind spielten, da das Kind nicht wusste, wie beim Spielen im Allgemeinen vorzugehen ist; häufig wechselnde Kindermädchen waren nur angewiesen, es unter der Woche mit Papier und Bleistift zu versorgen, ihm die vorläufige Schrift zu ermöglichen. So zeichnete es in aller Stille bis zur Einschulung Ozeanriesen, pochte nur darauf, dass sie stets auf seinen Namen getauft wurden, und lernte auf diese Weise als ersten, ordentlichen Buchstaben das O kennen, welches in diesem Namen gleich zweimal vorkam – als O, das eben den Bullaugen seiner Dampfer glich und jener Laut war, bei dem das Kind mit dem Gefühl »Ich-bin-es« aufschreckte; ein Buchstabe in Form eines leeren Versprechens, gleich geformt wie das Zeichen für Nichts – ein Gebilde, dem es augenblicklich, begehrend, verfiel, wie es einem ersten Freund verfallen wäre, wenn es diesen Freund gegeben hätte.
Umso bedeutsamer waren die weiteren Menschenkontakte des Kindes, die sich unmittelbar aus seinem Körper ergaben. Das Kind hatte ausgeprägte X-Beine und musste daher in die Gymnastik des Herrn Blomberg. Also lernte es, bei der Bestandsaufnahme des Schadens und dessen allmählicher, im Kreise anderer vollzogener Einrenkung, als Zweites den Buchstaben X, der dadurch von Anfang an in Beziehung zu Gleichaltrigen stand, denen das Kind in der Gymnastik atemberaubend nahe kam; das X stand so aber auch in Beziehung zu einer Deformation, die das Eigentümlichste, ja Attraktivste des eigenen Körpers zu sein schien. Und beides führte wohl dazu, dass sich das Kind schon früh darauf verstand, Klang und Form eines Buchstabens Gewicht beizumessen: noch ehe es lesen und schreiben konnte, war ihm das X jenes besondere, erregende Zeichen, ohne das zehn Jahre später das Wort Sex lange nicht die Wucht gehabt hätte, die es urplötzlich besaß.
Doch der eigene Körper brockte dem Kind noch mehr ein. Die vom künstlerischen Ruhm träumende weibliche Seite der Familie schickte das Kind in einen Gesichter-Wettbewerb für eine Filmrolle. Und das etwas Madenhafte und zugleich Leblos-Starre des Kindes entsprach derart genau dem Zeitgeschmack, dass der Sieg unvermeidlich war. Also saß das Kind bald neben Max Schmeling – Dreharbeiten zu dem Film Keine Angst vor großen Tieren – und musste, spaßeshalber, etwas boxen; die Made mit dem Baskenmützchen und dem starren Blick, neben Schmeling sitzend – festgehalten am 3.8.52 auf einem Standfoto, das zur Ikone einer Kindheit wurde –, gewann, drehbuchgemäß, gegen den Schwergewichtsweltmeister, und der eigene und zugleich fremde Körper dehnte sich, im Imaginären, wie ein Ballon – von der Außenwelt vollkommen unbemerkt, wurde das Kind mit viereinhalb größenwahnsinnig (und dass sich die Dinge später doch etwas glätteten, lag sicher an der Geburt seiner Schwester, eines unübersehbaren Anderen).
Im Alter von fünf konnte das Kind dann schon jedes Gruppenbild ruinieren. Ein Geburtstagsfoto, aufgenommen vor einem Tiroler Gasthof, zeigt es im Kreise fröhlicher Bauernbuben, vom Ömchen zu dieser Feier zusammengetrommelt, mit verkniffenem Mund und geballten Fäusten. Zwischen ihm und den anderen lag bereits ein leerer Raum, der bald noch größer werden sollte: Der Vater plante, in den Schwarzwald zu ziehen, er sah dort günstigere Bedingungen für seine inzwischen aus dem Boden gestampfte Fabrikation medizinischer Geräte, sah aber auch ganz allgemein dort das bessere Klima zum Leben.
Der Umzug war Anlass für ein erstes Auto, selbstverständlich ein Käfer, die Heckscheibe geteilt, und zu den beiden Buchstaben O und X kamen, auf einer für das Kind schier endlosen Reise von Hamburg nach Freiburg, zwei weitere, die ihm wie einer erschienen, hinzu, VW. Dieses unterschätzte Emblem, Koitus zweier Buchstaben, signifikant wie das O und X, wurde, in Verbindung mit dem unverwechselbaren Rasselgesang des Käfers, zu einem Doppelzeichen: des bisher größten Bruchs im Leben des Kindes – alles Bekannte entfernte sich, blieb für immer zurück, und das Neue, Unbekannte kam näher – sowie, späterhin, der Anwesenheit und Abwesenheit der Eltern, die mit dem VW vorfuhren, endlich da waren, oder um die Ecke bogen: mit jenem etwas überdrehten, hysterischen Motorengeräusch verschwanden, das sich dem Kind einprägte wie eine Stimme – eben dieser Rasselgesang, als sei da, im Innersten des Antriebs, ein Schräubchen lose, genau das Schräubchen, das auch bei ihm nicht fest genug schien.
Und so kam das Kind – in Hamburg protestantisch getauft und ’n bü’schen auch so ss-prechend, wie man dort eben so ss-pricht – 1955, unter dem Diktat von vier Signifikanten, die es als Buchstaben schon lesen und schreiben konnte, in eine alemannische Volksschule, gelegen in dem katholischen Flecken Kirchzarten, von dem es, in seinem Größenwahn, glaubte, er stelle mit diesem Namen ein natürliches Entgegenkommen an den eigenen Namen dar.
Kirchzarten, damals noch mit ungeteerten Straßen und einem Mann, der freitags die Ortsnachrichten ausrief, war für das Kind keine andere Welt, sondern der erste lebendige Kontakt überhaupt mit der Welt: ein Dorf, dessen Jungs den Neuzugang aus Hamburg fragten: »Wem g’körschsch du?«, worauf das Kind, knapp und kehlig, hätte antworten müssen: »Ins Kircch-hoffs!« Doch stattdessen erzählte es gleich von sich und Max Schmeling und bekam ebenso gleich eins auf die Fresse, von einem gewissen Sumser, dem Sumser-Willy, der dem Kind auf die Weise ein Stück Leben einbläute, ihm bei der Gelegenheit obendrein den Ausdruck »Heilandsack!« beibrachte (und das Alemannische ist, nebenbei gesagt, noch immer der einzige Dialekt, in dem ich mich geborgen fühle).
Dem Kind war nun endgültig eingeschrieben, dass nicht nur der Körper, sondern auch die Sprache von außen kam, dass es selber nichts war und folglich keine Heimat besaß; das wahre Sein schien jedenfalls ganz woanders beheimatet, und da das Kind zu klein war, es in der weiten Welt zu suchen, begann es dieses Suchen in der nahen Welt eines Gartens, zu dem Haus gehörend, das die Eltern gemietet hatten. Dort, in dem Garten, gab es einen Schuppen, und in diesem Schuppen grub es ein Loch, ein Loch, das durch die ganze Erde führen sollte – denn auf der anderen Seite, dachte das Kind, käme es noch einmal neu auf die Welt –, »Und dann ist alles, wie ich es will«, heißt es, zwanzig Jahre später, in einem ersten Theaterstück Das Kind oder Die Vernichtung von Neuseeland. Und natürlich musste dieses höchstpersönliche Loch, als das Kind auf Grundwasser traf und, schlammbesudelt, im Morast weitergrub, das Ganze allmählich an ein offenes Grab erinnerte, aber auch die Vereinigung mit Mutter Erde unübersehbar wurde, schleunigst zugeschüttet werden, womit das erste Selbsterschaffungsvorhaben des Kindes schmerzlich gescheitert war. Zurück blieb freilich eine Mulde im Boden, mit dem schützenden Schuppen darüber – idealer Schauplatz für erste Erkundungen am lebenden Objekt.
Das Kind suchte den Kontakt zu einheimischen Klassenkameraden und gewann dabei sogar einen Freund, Bertram, verlegte sich in seinem Schuppen auf Schamanen- und Doktorspiele und wurde zeitweilig von der ganzen Nachbarschaft konsultiert. Mit kleinen, von der Rinde befreiten feuchten Stöcken erforschte es das Zeichen O, das es in den Körperöffnungen wiederentdeckte, noch vollkommen gleichgültig gegenüber dem Geschlecht seiner Klientel. Es ließ die Nachbarskinder aber auch an seiner Märklin-Eisenbahn teilhaben und wurde im Gegenzug aufgefordert, sich der einen oder anderen Bande anzuschließen. So war das Kind endlich bei allem dabei und doch nicht; es blieb ein Sonderling, dem die Sprache weniger als Mittel zur Verständigung denn als Werkzeug, um etwas zu erfinden, nämlich sich selber, diente. Umgeben von einem Zuviel an Sprache, der tagtäglichen Kakophonie dreier ihm zugetaner Egozentriker – Vater, Mutter, Ömchen –, nahm das Kind aber auch Zuflucht zu einer eigenen Sprechweise: im alemannischen Dialekt erzählte es der kleinen Schwester – heute Neurochirurgin in Berlin – Geschichten, an welche diese fest glaubte.
In jener Zeit – das Kind war jetzt sieben oder acht, im Radio lief der Schlager Komm in das Traumboot der Liebe, fahre mit mir nach Hawaii – entstanden dann auch zwei erste Texte, natürlich nicht erhalten, wie die Zeichnungen der Ozeanriesen, da Kindererzeugnisse damals noch dem allgemeinen Abfall zugerechnet wurden; es handelte sich um einen mehrseitigen Psalm, geschrieben, nachdem das Kind, der evangelischen Diaspora angehörend, heimlich die Eucharistie der Katholiken beobachtet hatte, einen Kult, dem es nun, schreibend, zu huldigen versuchte; der andere Text war profan, ein Krimi, Titel: »Jagd um die Welt«.
Meine Damen und Herren, das Drama der Details dieser Jahre – vier überwiegend guter, ja glücklicher Jahre, von denen das Kind später zehren musste – ließe sich unendlich fortsetzen, für mich als Schriftsteller reizvoll, aber auch problematisch. Denn was dabei herauskäme, würde ja immer gemessen werden an dem, was bei der paradigmatischen Recherche dieser Art herauskam, und verstehen ließe es sich immer nur – oder fügen wir lieber hinzu: bis heute – mit den Werkzeugen der Psychoanalyse. Und das heißt, um diese Zwischenbemerkung abzuschließen: Die Bildungsgeschichte, die das Kind später durchlaufen sollte, kulminierte, unter anderem, darin, Proust und Freud zusammenzudenken.
Vier glückliche, besser gesagt, geglückte Jahre, ich wiederhole es – 1959 erfolgte die Vertreibung aus dem kindlichen Paradies, kam die unerwartete Wende im Familienroman, wenn nicht der Abbruch dieses Romans nach der Hälfte. Die Eltern des Kindes ließen sich scheiden, im Grunde eine Kriegsfolge, vierzehn Jahre nach der Kapitulation, das Kind erfuhr davon nichts, es erfuhr nur den Schnitt – im Alter von zehn musste es, ausgestattet mit einem weißen Hemd, neutraler Bettwäsche und einer Krawatte, ins Internat.
Eines stillen Sonntags wurde es dort abgesetzt, Gaienhofen am Bodensee, die melancholische Höri, Wahlheimat des jungen Hesse. Kaum waren die Eltern in ihrem Käfer – mit losem Schräubchen im innersten Antrieb – um die Ecke gebogen, wurde das Kind Zeuge einer erbarmungslosen Schlägerei; Sieger: ein gewisser Exner (mit X), sein Held und Folterer in den kommenden Jahren. Von einem Tag zum anderen, ja fast von einem Augenblick zum nächsten, fand sich das Kind in einer Umgebung wieder, die eine geheime Fortsetzung des Dritten Reiches genannt werden darf, unter protestantischen Vorzeichen. An der Tagesordnung war die Prügelstrafe, bei der alle Kinder des Stockwerks dem Sünder einen Schlag auf das nackte Hinterteil geben mussten, oft floss schon nach dem dritten Schlag Blut; daneben Gebete, die nichts weiter waren als Appelle auf wechselnden Antreteplätzen, Vorbeter: ein päderastischer Religionserzieher und Kantor, dem späteren Winnetou-Darsteller zum Verwechseln ähnlich; über allem ein Direktor, den niemand anzusprechen wagte, als sei er kein Mensch, und auf der untersten Stufe eine Inauguration des Neuzugangs, die zu erzählen wieder zum Thema Körper und Schreiben führt.
Während einer Adventsfeier, kurz nach Eintritt des Kindes in die Internatsanstalt, als sich die Schüler und Schülerinnen (gottlob gab es auch Mädchen, diesen Hoffnungsschimmer) mit Kaffee und Kuchen vollstopften, hielt jener Direktor eine Rede, die in dem Satz gipfelte: »Und die Adventszeit ist eine stille Zeit.« Er machte dann eine Pause, dies zu unterstreichen, und in dieser Pause machte das Kind, von anderen Kindern zum Lachen gereizt – was um jeden Preis unterdrückt werden musste –, ein dadurch fehlgeleitetes, durch das harte Gestühl in seinem Stakkato noch multipliziertes, im ganzen Saal zu hörendes katastrophales Geräusch, dessen Subversivität – der Direktor verlor jeden christlichen Faden – sich in aller Gedächtnis schrieb. Für das Kind der komplette Weltuntergang, den es durch eine sofortige Lüge – eine Lüge, die sich doch immerhin schon einmal bewährt hatte –, »Ich war’s nicht«, noch aufzufangen versuchte, wodurch sich die Strafe verschärfte; neben zehntägiger Isolation zwei Aufsätze mit einer für ein Kind bizarren Längenanforderung, fünfundzwanzig Seiten zur Frage: »Warum darf ich nicht lügen?«, fünfundzwanzig Seiten zum Thema: »Wie ich mich auf einer Adventsfeier zu benehmen habe«, also zwei frühe Tausend-Seiten-Romane, und damit fing es wohl endgültig an: Schreiben infolge körperlichen Mangels, in dem Fall, einer undichten Stelle. Die verlangte Textmenge war nur durch Fiktion zu schaffen, das Kind erfand die Fälle anderer Kinder, die aus vergleichbaren Situationen als Sieger hervorgingen; es brachte seine Strafe hinter sich, was blieb, war das Stigma, ein Stigma, das erst mit den Vorläufern des 68er-Geistes verschwand. Plötzlich gelang es, das Revolutionäre dieses somatischen Protests – innerhalb einer Erzählung von Ideen, wie das auch hier im Moment geschieht, also gebannt durch Theorie – zur Sprache zu bringen.
Das Kind hieß jedenfalls fortan »Advent«, aber trotz oder vielleicht gerade wegen dieser Schande wurde es – äußerlich schon lange nicht mehr madenartig, jetzt eher knabenhaft lieblich – von dem Winnetou-Kantor, der es auch gleich in seinen Chor eingliederte, mit ihm Carmina Burana