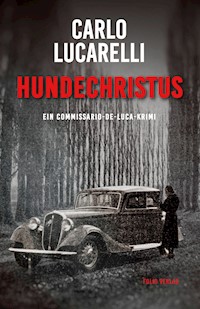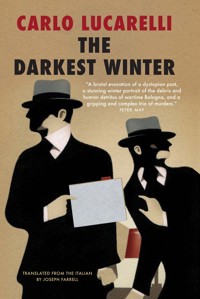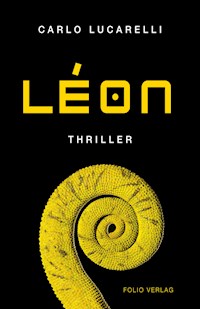
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Leguan, ein Serienkiller, ist entflohen – und will sich an derjenigen rächen, die ihn hinter Gitter gebracht hat. Grazia Negro liegt auf der Entbindungsstation, noch benommen von der Narkose, aber glücklich. Endlich ist sie, was sie immer sein wollte: Mutter. Keine Ermittlungen mehr, keine Mordfälle, keine Jagd nach Psychopathen. Doch ein normales Leben scheint ihr verwehrt. Kaum hat sie ihre Zwillinge gesehen, berichtet ihr ein Kollege vom Massaker, das der Leguan in der Psychiatrie angerichtet hat. Negro muss jetzt mit ihren Kindern an einen sicheren Ort gebracht werden, doch dort fühlt sie sich wie eine Löwin im Käfig. Die Gefahr, die auf sie lauert, könnte noch bedrohlicher sein, als sie glaubt. Lucarelli schickt seine Kultkommissarin auf eine Tour de Force.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto: Rosdiana Ciaravolo/Getty images
Carlo Lucarelli, 1960 in Parma geboren, lebt bei Bologna. Er ist Schriftsteller, Journalist, Regisseur und Fernsehmoderator. International bekannt wurde er durch seine preisgekrönten und verfilmten Kriminalromane, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Mitbegründer des „Gruppo 13“ und Lehrer an der „Scuola Holden“ für kreatives Schreiben. Zuletzt erschienen bei Folio Bestie (2014), Italienische Intrige (2018), Hundechristus (2020) und Der schwärzeste Winter (2021).
Karin Fleischanderl übersetzt aus dem Italienischen und Englischen, u. a. Gabriele D’Annunzio, Pier Paolo Pasolini, Giancarlo De Cataldo. Österreichischer Staatspreis für literarische Übersetzung.
Der Leguan, ein Serienkiller, ist entflohen – und will sich an derjenigen rächen, die ihn hinter Gitter gebracht hat.
Grazia Negro liegt auf der Entbindungsstation, noch benommen von der Narkose, aber glücklich. Endlich ist sie, was sie immer sein wollte: Mutter. Keine Ermittlungen mehr, keine Mordfälle, keine Jagd nach Psychopathen. Doch ein normales Leben scheint ihr verwehrt. Kaum hat sie ihre Zwillinge gesehen, berichtet ihr ein Kollege vom Massaker, das der Leguan in der Psychiatrie angerichtet hat. Negro muss jetzt mit ihren Kindern an einen sicheren Ort gebracht werden, doch dort fühlt sie sich wie eine Löwin im Käfig. Die Gefahr, die auf sie lauert, könnte noch bedrohlicher sein, als sie glaubt. Lucarelli schickt seine Kultkommissarin auf eine Tour de Force.
„Ein Thriller, der läuft wie ein Uhrwerk.“ Il venerdì/La Repubblica
„Der Leguan ist entflohen und sinnt auf Rache. Ein Ratschlag: Machen Sie es sich gemütlich, aber schließen Sie gut ab.“ Marie Claire
„Lucarelli stößt den Leser in das Dunkel der menschlichen Seele, in einer Art Waterboarding, dem er erst nach der letzten Seite wieder entkommt.“ Tuttolibri/La Stampa
CARLO LUCARELLI
LÉON
THRILLER
Aus dem Italienischen von Karin Fleischanderl
Für Bea und Francesco,die Erstleser dieser Geschichte,und den Enthusiasmus, den sie mirSeite um Seite vermittelt haben.
Inhalt
Teil eins:Der Leguan
Teil zwei:Ray Cooper
Teil drei:Die Maus
Anmerkung
Danksagung
Teil einsDer Leguan
Amor
You don’t find me
I’m a reckless
Are you knocking at the door?
Amor
Du findest mich nicht
Ich bin rücksichtslos
Klopfst du an die Tür?
MELANCHOLIA, Léon
Marta hockt unter der Spüle, eingeklemmt zwischen dem Abflussrohr und den Putzmitteln.
Der Carabiniere streckt die freie Hand aus, in der anderen hält er die Pistole, und berührt sie, doch sie starrt geradeaus, der Rand der OP-Maske streift die unbeweglichen Lider. Abwechselnd mit der rechten und der linken Hand streicht sie über die Haarstoppeln, vor und zurück.
Auch der zweite Carabiniere hat eine Pistole, in der anderen Hand hält er ein Handy, drückt es an das Ohr, als wolle er es hineinpressen.
– Nein, nein … Es ist ein Mädchen, klein, sie trägt T-Shirt, Hose und Crocs, alles in Weiß …
Der erste Carabiniere versucht unter die Spüle zu kriechen, er möchte Marta am Arm packen und sie herausziehen, wie ist sie da bloß hineingeraten, doch der andere schüttelt den Kopf, nein.
– Hör auf, das ist eine Krankenschwester.
– Komm schon, siehst du nicht? Sie steht unter Schock.
– Hör auf! Gleich kommt die Rettung und kümmert sich um sie. Der Capitano sagt, wir sollen beieinanderbleiben.
Marta starrt ins Leere, offenbar bewegt sie die Lippen unter der Maske, doch kein Laut ist zu hören. Wie um sich zu entschuldigen, streift der Carabiniere ihre Schulter mit den Fingern und steht auf, indem er sich auf den Knien abstützt.
In der Küche befinden sich zwei Türen, einander gegenüber. Die Tür, durch die sie hereingekommen sind und die auf den Park der Villa blickt, hat halb offen gestanden, und auch die Tür, auf die sie blicken, ist halb offen, davor steht ein Tisch mit Plastiktellern, kalte Makkaroni in gestockter Tomatensauce.
Der Carabiniere, der weiter vorne steht, drückt das Handy an die Schulter, damit man ihn nicht hören kann, und dreht sich mit nervös zusammengepressten Lippen zu dem anderen um.
– Die machen mich verrückt … Ihr müsst beieinanderbleiben, beieinanderbleiben … Du solltest hören, wie der Capitano schreit.
Er berührt die Tür mit der Schuhspitze und drückt sie auf, die Pistole gezogen, und der Kollege dahinter hält die seine ebenfalls mit beiden Händen.
Man hat ihm gesagt, die Wohnungen der Anstalt seien alle identisch, eine Reihe von kleinen Häuschen, den ehemaligen Pavillons des alten, aufgelassenen Irrenhauses von Imola.
Stimmt. Ein Schlafzimmer rechts, eines links, und das Bad ist am Ende des Gangs.
Das Zimmer rechts: leer, offene Tür. Ein Blick reicht: kein Schrank und das Bett ist zu niedrig, als dass sich jemand darunter verstecken könnte.
Das Zimmer links: halb offene Tür. Der zweite Carabiniere öffnet sie mit der freien Hand, er muss drücken, sie klemmt, der Teppich hat sich unter der Tür zusammengeschoben. Ein Schrank und zwei Betten nebeneinander, doch im Schrank sind nur ein paar Kleider und auch hier sind die Betten zu niedrig.
Die Tür zum Bad am Ende des Gangs ist jedoch geschlossen.
Versperrt, und der Schlüssel steckt nicht im Schloss.
– Küche und Schlafzimmer leer, abgesehen von der Krankenschwester. Wir gehen ins Bad.
Er steckt das Handy in die Jackentasche, flüstert seinem Kollegen zu, sie sagen, wir sollen vorsichtig sein, dann stützt er sich auf dessen Schulter, um das Gleichgewicht zu bewahren, hebt das Knie und versetzt der Tür einen Fußtritt, gleich neben der Schnalle, so fest, dass sie aus den Angeln springt.
Sie liegen in der Badewanne. Sie oben und er unten, ein Bein ragt über den Rand der Wanne, ein Schuh baumelt vom bestrumpften Fuß. In der Wanne ist Blut, viel Blut, aber nur in der Wanne.
Der Carabiniere nimmt wieder sein Handy.
– Zwei Leichen, Mann und Frau. Die Frau hat eine Plastiktüte auf dem Kopf, aber … ist gut, also der Mann. Halbglatze, untersetzt, ungefähr fünfzig … nein. Nein, Signor Capitano, zwei Leichen und die Krankenschwester. Nein, da ist kein weiterer Mann. Ich versichere Ihnen, Signor Capitano, da ist niemand!
Er stößt einen Fluch aus, flüstert seinem Kollegen zu, er will ihn sehen, und hält die Handykamera auf die Badewanne.
In diesem Augenblick verspürt Brigadiere Gualandi plötzlich Angst.
Grundlos, denn nichts ist passiert, kein Geräusch, keine Bewegung, er und sein Kollege stehen mit gezogener Pistole mitten in diesem Zimmer, und außerdem ist er schon eine Weile bei den Carabinieri, war immer auf der Straße, er hat schon Schlimmeres gesehen als zwei blutüberströmte Leichen in einer Badewanne, doch plötzlich wird sein Nacken aufgrund einer absurden Angst steif, er presst den Kiefer so fest aufeinander, dass es wehtut.
Noch nie in seiner Laufbahn hat er eine so heftige, physische Angst verspürt, auch nicht im Privatleben, nicht einmal als Kind.
Auch der Gefreite Marconi schnuppert, als ob er die säuerliche, stechende Angst riechen könnte, bis hinunter in den Schlund.
Angst.
Beide haben Angst, sie stehen Rücken an Rücken, im Bann einer unnatürlichen Angst, die Pistolen gezogen, bereit, auf jemanden zu zielen, doch auf wen, wo doch niemand da ist?
Marta unter der Spüle verkriecht sich noch weiter nach hinten. Sie starrt ins Leere und streicht sich unablässig über die Haare, die so kurz sind wie die Stacheln eines Igels.
Tonlos bewegt sie die Lippen unter der feuchten Baumwolle der Maske, das enge Gummiband zerrt an ihren Ohren, die so noch größer und abstehender wirken, als sie wirklich sind.
Sie singt einen Schlager, bring mich weg von hier, bevor ich ertrinke, sie versucht, sich an die fröhliche, Synkopen singende Kinderstimme zu erinnern, bring mich irgendwohin, bevor ich ertrinke, nur diesen Refrain, ausschließlich diesen, denn das Lied ist auf Japanisch, und Marta hat es nicht geschafft, die Sprache zu lernen.
Oku o tsuretette hita mi kondeshimau mae ni.
Grazia denkt: Endlich.
Sie hat nichts gespürt, bloß einen Stich ins Kreuz, als die Epiduralanästhesie gesetzt wurde, ein schnelles Kribbeln in den Beinen und einen kurzen heißen Schauer. Sie weiß nicht einmal, wie lange es gedauert hat, eine Stunde, eine Minute, wie lange sie die Neonröhre am Plafond des OP-Saals angestarrt und ja, danke geantwortet hat, als die Krankenschwester sie fragte, ob alles in Ordnung sei, ob sie ruhig sei, entspann dich bitte, alles okay?
Nein. Grazia denkt endlich, denn hinter dem grünen Vorhang, der sie vom Bauch abwärts abdeckt, haben der Arzt und die Krankenschwestern sich die ganze Zeit über ein neues Restaurant unterhalten, das vor Kurzem im Roveri-Viertel eröffnet worden ist, er hat am Abend davor dort gegessen, und sie hat Hunger bekommen, doch allein bei dem Gedanken an Essen hätte sie sich beinahe übergeben.
Deshalb denkt sie, endlich, als die Krankenschwester mit dem ersten Baby kommt und es ihr, fast Wange an Wange, ans Gesicht hält.
Sie hat das Baby gerade mal aus dem Augenwinkel gesehen, ein Engelchen, ein kleines, zerknautschtes Gesicht, bereit zu schreien, mit geballten Fäusten und zusammengekniffenen Augen, nur einen Augenblick lang, denn sie müssen auch noch das andere herausholen.
Und da denkt sie wieder, endlich. Ja, endlich ist sie die Last in ihrem Bauch los, wegen der sie gebückt gehen musste und die gegen ihre Rippen drückte, weil eines der beiden Babys oben lag, sie hatte es im Ultraschall gesehen, um das andere herumgewickelt. Sie betrachtete den Monitor nur ungern, deshalb wandte sie immer den Blick ab, wenn die klebrige Sonde ihr kalt über den Bauch glitt. Der metallische Herzschlag war ihr lieber als die Schwarz-Weiß-Silhouetten von Nasen und Wangen. Das hatte sie von ihrem Ex gelernt. Simone war von Geburt an blind, er hatte sie gelehrt, zu hören anstatt zu schauen. Während der Dauer ihrer Beziehung war er ein guter Lehrmeister gewesen.
Es waren nicht seine Babys. Sie hatten es lange versucht, doch es war nicht gelungen, schuld war Simone, schuld waren Grazia und ihre Arbeit, schuld war die Situation, alle flüchtigen Verbrecher, aber vor allem die Ungeheuer, wie sie sie nannte, die sie jagte. Der Lupo mannaro, der Kampfhund, die Bestie, der grüne Leguan, sie besaß einen ganzen Zoo davon, und selbst wenn sie sie festgenommen hatte – denn das war das Einzige, was sie interessierte, sie wollte sie festnehmen, nicht verstehen –, blieb ihr der Jagdinstinkt erhalten. Das war zu viel. Sie hatte alles hingeschmissen, Simone, die Polizei, ihre Ungeheuer, und sich eine Auszeit genommen. Sie hatte die Sache allein erledigt.
Dreiunddreißig Wochen, dann hatte ihr Doktor Scagliarini gesagt, sie seien bereit, Zwillinge kämen immer ein wenig früher zur Welt, und hatte in der Geburtenstation des Ospedale Maggiore einen Kaiserschnitt-Termin für sie vereinbart.
Endlich.
Auch das Zweite war ein Engelchen, wenn auch ruhiger, mit halb geschlossenem Mund und gespitzten Lippen wie für einen Kuss, offenen Händchen, auch es wurde ihr kurz an die Wange gelegt, und dann schnell unter das Plexiglas des Brutkastens, wie die Zwillingsschwester.
Grazia hat ein schlechtes Gewissen.
Sie hat so lange auf sie gewartet, sich so nach ihnen gesehnt, dass das Wort endlich doch nicht nur bedeuten kann, die Sache endlich hinter sich gebracht zu haben. Stimmt, das hat sie gedacht, doch es gefällt ihr nicht, sie hält es nicht für richtig, also öffnet sie den Mund, löst die ausgetrockneten Lippen voneinander, und sagt: Darf ich sie noch kurz halten?
– Darf ich sie noch kurz halten?
Aber vielleicht hat sie das nur gedacht, weil sie es nicht fassen konnte, wie heftig ihr die Krankenschwester das Baby entrissen hat. Deren erschrockener Gesichtsausdruck macht ihr Angst.
Etwas stimmt nicht.
Grazia hebt den Kopf und versucht sich hochzustemmen, um über den grünen Vorhang zu blicken, der ihren Köper noch immer zweiteilt, doch sie sieht gerade noch die Krankenschwestern, die die Brutkästen mit den Babys im Laufschritt hinausschieben.
Etwas stimmt nicht.
Grazia versucht etwas zu sagen, sie möchte sich nach den Babys erkundigen, geht es ihnen gut, geht es ihnen schlecht, was ist los, sie möchte den Arzt rufen, der sie rasch zusammennäht, so schnell, dass es fast wehtut. Doch aufs Neue wird sie von etwas abgelenkt, sie hat etwas gesehen, das soeben aufgetaucht ist.
Ein Polizist in Uniform hält die Tür auf, damit die Krankenschwestern hinauslaufen können.
Und neben ihr steht noch ein Polizist. Er schiebt den Galgen mit den Infusionen, um mit dem Bett Schritt zu halten, auf dem sie so schnell hinaustransportiert wird, dass ihr schlecht wird. Grazia ist verwirrt, sie hat keine Ahnung, was vor sich geht. Was ist los?
– Was ist los?
Diesmal hat sie die Worte wirklich ausgesprochen, sie sogar geschrien, denn der Polizist mit den Infusionen dreht sich augenblicklich um.
– Wir bringen Sie in Sicherheit, Frau Kommissar. Der Leguan ist ausgebrochen.
Mein Problem sind die Finger.
Ich hatte nie einen festen Griff. Aber kein Wunder, in fünfunddreißig Jahren habe ich nie Sport gemacht oder sonst was, das man annähernd als körperliche Aktivität bezeichnen könnte.
Nicht, weil ich blind bin. In der kurzen Zeit, in der ich unter Leute gegangen bin, habe ich Menschen kennengelernt, die wie ich von Geburt an blind waren und Baseball spielten. Mit den anderen Sinnen kann man alles machen, sogar einen Ball mit einem Glöckchen darin fangen und entlang einer gespannten Schnur von Base zu Base laufen. Vor allem mithilfe des Gehörsinns. Der definiert und modelliert die Welt genauso gut, wenn nicht gar besser als der Sehsinn. Die Ohren, sofern man sie zu gebrauchen versteht, sind genauso schnell und präzise wie die Augen, wenn nicht gar mehr.
Ich habe Reisen mithilfe des Gehörsinns unternommen. Und nicht nur mithilfe dessen, was Töne in mir hervorriefen. Musik zum Beispiel oder der Klang von Wörtern, die ich nicht kannte, die ich nicht kennen konnte, weil sie Farben bezeichneten. Wörtern wie rot, grün oder blau verlieh ich aufgrund des Geräuschs, das sie verursachten, ihres innewohnenden Klangs, einen Sinn und eine Form. Rot war etwas Großes. Grün brannte, und blau war Begeisterung.
Vor allem aber habe ich Reisen unternommen. Denn der Klang läuft, die Schallwellen verbreiten und entfernen sich mit großer Geschwindigkeit, und wenn man einen Scanner verwendet wie ich, der die Funkgeräte der Taxifahrer, den CB-Funk der Lkw-Fahrer, die Handys der Leute abhört, dann ist die Reichweite des Gehörsinns viel größer als die Reichweite eines eventuellen Fernrohrs. Der Sehsinn, hat man mir gesagt, ist auf eine Richtung beschränkt. Der Gehörsinn ist eine Panoramasicht.
So habe ich es gemacht. Ich saß allein in meiner Mansarde. Ich legte eine Schallplatte auf, immer dieselbe, Almost Blue, in der melancholischen Version von Chet Baker, machte den Scanner an und reiste, flog mithilfe der Formen und der Farben der Klänge, die ich hörte, in eine große, eine sehr große Stadt. Ein psychedelisches Bologna, wie Grazia sagte, als ich ihr davon erzählte.
Jetzt reise ich nicht mehr.
Es ist viel passiert. Ich habe mich in eine blaue Stimme verliebt, ich habe ihr geholfen, eine Stimme zu jagen, die so grün war, dass sie sogar jetzt noch in meinem Kopf knurrt, eine Stimme, die ich nie vergessen konnte.
Die Stimme des Leguans.
An die Stimme Grazias hingegen erinnere ich mich kaum.
Das habe ich bewusst herbeigeführt, ich habe mich darum bemüht. Es sind zwar viele Dinge passiert, sie hat noch weitere Ungeheuer gejagt, okay, und wenn sie das tut, denkt sie an nichts anderes, okay, wir haben versucht, ein Kind zu bekommen, es hat jedoch nicht geklappt, auch okay, doch nicht deshalb ist es zu Ende gegangen.
Um die Wahrheit zu sagen, weiß ich nicht, warum es so gekommen ist. Wir haben immer mehr gestritten, wir hatten keinen Sex mehr, wir haben nicht mehr miteinander gesprochen, uns nicht mehr gespürt, und da haben wir uns getrennt.
Beide waren wir überzeugt, dass nichts mehr zu retten war, sowohl sie als auch ich, okay, ist gut.
Aber es war unerträglich für mich.
Deshalb lausche ich nicht mehr den Klängen.
Ich muss mich um meine Finger kümmern. Das Metallstück so fest umklammern, als wollte ich mit den Fingerspitzen die Handfläche berühren. Ich darf nicht darauf vergessen.
Langsam gleite ich mit der Schuhsohle über den Boden, bis ich zwischen Schienbein und Ferse die Hantelstange spüre. Dann mache ich einen halben Schritt rückwärts, mitunter auch einen kleineren, damit die Stange genau quer vor den Füßen liegt. Ich muss die Stellung der Beine nicht anpassen, sie sind ausreichend weit gespreizt. Ich habe das schon mindestens hundertmal gemacht.
Seit mehr als einem Jahr stemme ich Gewichte.
Ich besiege die Schwerkraft mithilfe von Muskelkraft, in totaler Stille. Die Biegung des Rückens, die Schultern, die aneinandergepressten Schulterblätter und die Stellung der Beine, die Atmung. Ich konzentriere mich auf die Intensität der Bewegung. Das Gewicht ist egal, es ist nur eine immer größer werdende Zahl, eine Grenze, die ich überschreiten muss, um zu einer anderen, noch volleren, noch intensiveren Bewegung zu gelangen.
Ich mache es nicht wegen der Fitness, das interessiert mich nicht, und auch nicht wegen der Schönheit. Ich weiß nicht, wie ich aussehe, und es ist mir auch egal, ich kann mich nicht sehen.
Doch ich spüre mich.
Die Muskelfasern unter der Haut kontrahieren und verkürzen sich unter der Last der überschweren Gewichte und der Wiederholungen, sie blähen sich in dem Augenblick auf, in dem sie stoßen und ziehen, sie explodieren aufgrund einer Kraft, die löst und hebt, versteifen sich schmerzhaft, und all das bereitet mir Vergnügen. Ich habe das Gefühl, dass es mich gibt. Aber nicht draußen, wo ich nicht mehr sein will.
Sondern im Inneren.
Ich habe den Gehörsinn, der für mich der längste, unbegrenzte Sinn ist, durch den kürzesten Sinn ersetzt. Den Tastsinn. Nichts durchdringt meine Haut. Die Grenzen meiner Welt sind die meines Körpers. Es existiert nur das, was ich unter meinen Fingern spüre, die festen Kurven, die sich mit der Bewegung verschieben, die Formen, die sich unter den Fingerspitzen verändern, auch die Wärme, die mein Fleisch verzehrt, wenn ich nichts mache, und die mir hilft, zu spüren, dass ich da bin.
Unter der Haut, in der Haut. Ich lebe im Inneren. Wie die japanischen Jugendlichen, die ihre Zimmer nicht verlassen. Genau, ich bin ein Hikikomori.
Ein Körper-Hikikomori.
Ich beuge die Knie und die Hüften, bis ich mit den Hinterbacken beinahe den Boden berühre, und dabei halte ich den Rücken gerade, mit eingezogenen Schulterblättern, wie mich die freundliche Stimme des Viking anleitet, in dem Tutorial, das ich heruntergeladen habe.
Am Anfang war ich so übermotiviert, dass ich mir Schmerzen zugefügt habe. Schmerzen an den Schultern, an den Ellbogen. An den Lenden, unsinnige und falsche Übungen, zu schwere oder zu leichte Gewichte, ohne die richtigen Geräte. Da habe ich auf Amazon alles bestellt, was ich zu benötigen glaubte, und habe mir zu Hause einen Fitnessraum eingerichtet. Ich habe Listen, Programme und Kurse, biomechanische Anleitungen heruntergeladen, ich habe mich auf Prilepin-Tabellen verzettelt, fünf mal fünf, und ein modifiziertes Bill-Star-Training befolgt. Dann habe ich es sein lassen.
Das neurologische Geheimnis, aufgrund dessen das alles passiert, interessiert mich nicht. Ich will mir nicht einmal den Namen der Muskeln merken. Ich habe das gelernt, was ich brauche, und das mache ich, auf die Bewegung und die Hanteln und auf das konzentriert, was unter meiner Haut passiert.
In Stille.
Am Anfang summte die Stille in meinen Ohren, aber immer leiser, wie eine Mücke, die davonfliegt, bis sie nicht mehr zu hören ist. Es folgte ein flüssiges und kompaktes Schweigen. Ein Quecksilber-Schweigen.
Und so ist es mir gelungen, Grazias Stimme zu vergessen.
Die blaue Stimme.
Ich habe aufgehört zu lauschen.
Ich strecke die Arme aus, bis ich die metallene Stange spüre. Mit den Zeigefingern packe ich die Stange am Rande des gerillten Teils.
Ich muss mich auf meine Finger konzentrieren. Sie gut zusammendrücken, damit die Angst, den Griff zu verlieren, mich nicht ablenkt. Das Gewicht ist egal, es ist nur eine immer größer werdende Zahl, eine Grenze, die ich überschreiten muss. Ich muss mich auf die Bewegung konzentrieren. Tief einatmen, um die Wirbelsäule zu stärken. Mich fest mit den Beinen abstoßen, als wollte ich die Füße in den Boden pressen. Nach oben ziehen, ohne die gerade Linie des Rückens aufzugeben.
Genau in diesem Augenblick, in dem ich die Stange vom Boden löse, spüre ich sie.
Ich spüre sie mit der Haut. Die Angst überzieht meine Haut mit brennenden Schauern, die so dicht sind wie Knoten.
Irgendjemand ist in der Stille meines dunklen Zimmers.
Jemand.
Oder etwas.
Er hat bemerkt, dass ich da bin.
Er bewegt sich nicht, atmet nicht einmal.
Er spricht nicht.
Das letzte Geräusch, das ich gehört habe, war das Rascheln seiner Kleider, als er sich aufgerichtet hat.
Ich habe kein Geräusch gemacht. Das weiß ich. Ich habe die Kleider vor dem Zimmer abgelegt, ich habe die bloßen Hände und Füße auf den Boden gesetzt und habe mich lautlos genähert.
Er hat mich auf eine andere Weise wahrgenommen. Ich spüre, dass er Angst hat, ich rieche es mit meiner Mäusenase, die Angst ist so stark, dass ich flehme und sie zwischen die Zähne einsaugen könnte, doch ich will kein Geräusch verursachen, denn ich habe mich noch nicht entschieden.
Also denke ich nach.
Ich denke.
Ich denke.
Ich glaube, ich habe ein Geräusch gehört.
Als ob man feststellte, dass jemand schon seit geraumer Zeit spricht, man jedoch nicht verstanden hat, was er gesagt hat, weil man nicht zugehört hat.
Irgendwo, vergraben im Gedächtnis, ist da die Erinnerung an einen immer ferneren und undeutlicheren Klang, wie ein Traum nach dem Aufwachen.
Aber er war da, ich habe ihn gehört.
Da ist jemand bei mir.
Ich würde gern fragen, ist da jemand, doch ich schaffe es nicht, und nicht nur, weil meine Stimme infolge des tagelangen Schweigens heiser ist und meine Lippen versiegelt sind.
Mit einem Schlag sind alle Empfindungen von damals wieder da, der Geruch des Bluts meiner Mutter, die von diesem Ungeheuer umgebracht worden ist, seine heisere, grüne Stimme, die mir ins Ohr flüstert, die eiskalte Haut seiner nackten Schenkel, die mich umklammern, um mich festzuhalten, die Klinge, die die Luft vor meinem Gesicht durchschneidet, Gott, dieser Schrei!
ICH HABE ANGST.
Ich muss nicht fragen, ich weiß, wer hier bei mir ist, in der Stille meines dunklen Zimmers. Ich muss mich nicht einmal an das Geräusch erinnern, denn ich spüre es auf der Haut.
Ich weiß, es ist unmöglich, denn er ist in einem Irrenhaus eingesperrt, aus dem es kein Entrinnen gibt.
Doch er ist es.
Der Leguan.
Ich denke.
Ich dachte, er ist nicht die Person, die ich will.
Ich habe ein Messer mitgebracht, ein echtes, kein Plastikmesserchen wie das, mit dem ich dem Glatzkopf in der Badewanne die Gurgel durchgeschnitten habe.
Doch jetzt, wo ich ihn keuchen höre, wo ich seine Angst mit meinen Mausezähnen einsauge, stelle ich fest, dass ich überhaupt keine Lust habe, ihn umzubringen.
Ich bin nicht hinter ihm her.
Vor vielen Jahren hatte ich eine Maus namens Andrea. Eine weiße Maus aus dem Labor, in dem mein Vater arbeitete, er hatte sie mir zum Geburtstag geschenkt. Ich war damals fünf, glaube ich, ich erinnere mich nicht.
Ich machte ein Experiment mit Andrea. Ich öffnete ihren Käfig, stellte mich auf die andere Seite des Zimmers, rief sie und schlug mir dabei mit der Hand auf den Schenkel.
Andrea!
Sie kam augenblicklich gelaufen, stieg mir auf den Schuh, kroch in mein Hosenbein, kletterte über mein Bein, schlüpfte unter das T-Shirt und kam beim Halsausschnitt wieder raus. Diese Nummer, fast eine Zirkusnummer, wiederholten wir des Öfteren, mein Vater und meine Mutter lachten immer, auch ich lachte. Ich war glücklich. Ich liebte Andrea, meine weiße Maus.
Doch eines Tages biss sie mich, weil ich ihren Schwanz einklemmte, als ich sie zurück in den Käfig setzen wollte. Ich warf sie so heftig auf den Boden, dass ihr Blut aus dem aufgerissenen Maul trat. Dann zertrat ich sie mit dem Schuh.
Der Blinde hat mir jedoch nichts getan.
Und ich liebe ihn nicht.
Nein, nicht hinter ihm bin ich her.
Also setze ich Hände und Füße auf den Boden und ziehe mich geräuschlos zurück, im Rückwärtsgang.
Ich denke: Ich bin eine Maus.
Ich heiße Andrea und bin eine Maus.
Ansa.it.
Breaking News
Imola: Doppelmord in Wohnheim für ehemalige Psychiatriepatienten
Imola: Doppelmord, dritter Bewohner verschwunden
Imola: Dritter Bewohner hat in Vergangenheit mehrere Morde begangen
Imola: Fahndung nach Serienmörder Alessio Crotti, genannt der Leguan
Bologna 5
Roberto streckt den Arm aus und dreht sich auf der Suche nach der richtigen Einstellung um die eigene Achse. Das Licht ist okay, es ist noch nicht sehr dunkel und die Laterne auf dem Taxistandplatz auf der Piazza Re Enzo scheint extra dazustehen, um dem Bild Tiefenschärfe zu verleihen. Er streckt die Hand durchs offene Fenster und macht das Radio etwas lauter, gerade mal so viel, dass der fröhliche Elektro-Swing als Hintergrund dient, ohne seine Stimme zu übertönen. Er weiß, wie es funktioniert, er hat schon viele solcher Videos gemacht, in den Pausen zwischen den einzelnen Fahrten sagt er seine Meinung, erzählt, was ihm widerfahren ist, macht den Clown, wie er sagt, dann stellt er das Video auf Twitter.
Also macht er ein paar Schritte nach vor, damit die Notrufnummer der Casa delle Donne, die er auf den Kühler des Taxis gedruckt hat, deutlich zu sehen ist, positioniert seinen runden Kopf im Bildausschnitt und beginnt. Mit offenen Augen starrt er in die Handykamera, die Laterne wirft rötliche Reflexe auf seine Glatze, sein Mund inmitten des rötlichen Barts öffnet sich, und die Worte im Bologneser Dialekt sprudeln heraus. Hin und wieder ironisch, aber nicht immer, natürlich theatralisch, man hat ihm schon oft gesagt, er sollte Schauspieler werden.
– Das wird eine schreckliche Nacht, denn ich muss bis morgen früh mit einem kaputten Kartenlesegerät arbeiten … – er betont kaputt, hält das Gerät in die Kamera und dreht es vor seinem Gesicht, – bis gestern hatte ich ein altmodisches Lesegerät, doch dann holen mich die Bank und die Taxi-Zentrale zu sich, das alte wird nicht mehr aktualisiert, wir geben dir ein neues, guuut, – mit geschlossenem uu, – wir modernisieren uns, – mit stimmhaftem s wie in Bologna üblich, – sie werden mir ein Supermodell geben! – Er hält wieder das Gerät vors Gesicht. – Das ist ein Riesenbeschiss, – mit geschlossenen Vokalen. – Das ist eine RIESENSAUEREI!, schreit er, dann mit Grabesstimme: – Es funktioniert nicht. Es hat zwei Tage funktioniert, heute Abend nach der ersten Transaktion hat es den Geist aufgegeben, es funktioniert nicht mehr! Abgekackt, tot! – Mit weinerlicher Stimme zieht er sogar die Augenwinkel nach unten. – Eine Riesensauerei, ich will das alte zurück, das hat funktioniert, jetzt muss ich die ganze Nacht arbeiten und kann keine Karten annehmen, das heißt … – er hört auf zu jammern, böser Blick, – jetzt blamiere ich mich auch noch, weil ich eine Ausrede finden muss, – er singt eine Art Litanei, – ich habe ein kaputtes Lesegerät … – dann brutal: – ESIST WIRKLICH KAPUTT, EINE SAUEREI! ICH WILL MEIN ALTES ZURÜCK