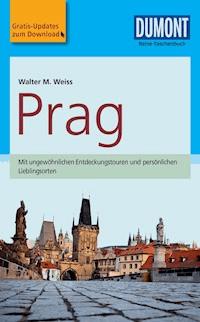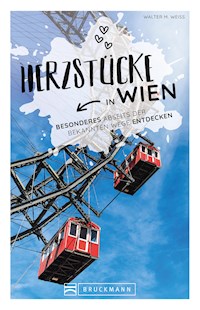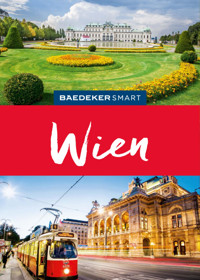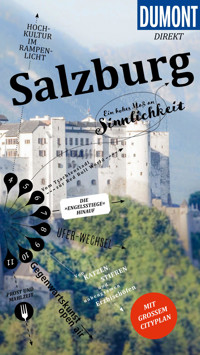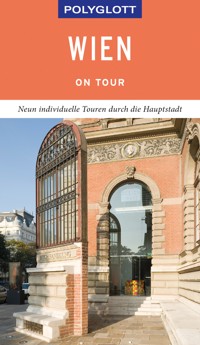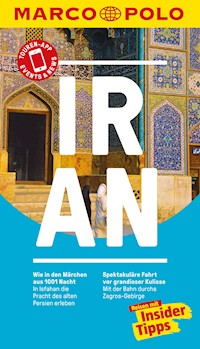9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Picus Lesereisen
- Sprache: Deutsch
Usbekistan, das sind prächtige Moscheen und Paläste, Basare voller Seiden, Teppiche und Karawanenzauber. Oasenstädte wie Samarkand bieten als Stationen der legendären Seidenstraße bis heute ebendies. Ansonsten wird dieses Kernland Zentralasiens immer noch als Durchgangsgebiet auf halbem Weg zwischen Iran und China gering geschätzt. Seine historische Rolle als Epizentrum der Zivilisationsgeschichte bleibt ebenso verkannt wie seine als noch junge Nation in den letzten Jahren erzielten Fortschritte. Walter M. Weiss wandelt auf den Spuren Timurs, Avicennas und des Urvaters der Algorithmen und besucht Miniaturenmaler, Papierschöpfer und Seidenweber. Aber er beleuchtet auch Schattenseiten wie das fatale Erbe des Baumwollwahns und das Öko-Desaster am Aralsee.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Walter M. Weiss
Lesereise Usbekistan
Fährtensuchen an der Seidenstraße
Picus Verlag Wien
Copyright © 2022 Picus Verlag Ges.m.b.H.
Friedrich-Schmidt-Platz 4/7, 1080 Wien
2., aktualisierte Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
Umschlagabbildung: © Walter M. Weiss
ISBN 978-3-7117-1113-7
eISBN 978-3-7117-5483-7
Inhalt
Eine Metropole als Experimentierfeld
Taschkent: Erste Tuchfühlung mit einer verkannten Nation
Menschenschlächter und Mäzen
Auf den Spuren Timurs, des altneuen Vaters der Nation
Samarkand, mon amour
Von Konigil über Afrosiab zum Registan
Avicenna und der Algorithmus
An der Wiege der persischen Renaissance
Meister des Manuellen
Basarbummel zu Bucharas Kunsthandwerkern
Die Heilkraft der Mystik
Der Miniaturmaler und der Sufi-Heilige
Koexistenz auf Zentralasiatisch
Die bucharischen Juden – eine Fährtensuche
Das Erbe Buddhas
Termiz: Ein Scharnier der Kulturen an der Grenze zu Afghanistan
Gewebte Regenbögen
Margilan im Fergana-Tal – am Knotenpunkt der Seidenherstellung
Zottelfell und Doppelhöcker
Ein Salut an die Helden der Seidenstraße
Ein märchenhaftes Räubernest
Freilichtmuseum islamischer Architektur: Chiwas Altstadt Itschan Kala
Weißes Gold, weißer Fluch
Ein Schadensbericht von den Ufern des Aralsees
Louvre in der Steppe
Karakalpakstan und das Igor-Savitsky-Museum in Nukus
Über den Autor
Eine Metropole als Experimentierfeld
Taschkent: Erste Tuchfühlung mit einer verkannten Nation
Nimmt man eine Karte Eurasiens zur Hand, zieht eine Linie von China bis zum Mittelmeer und eine zweite von Moskau nach Indien, so kreuzen sich die beiden in einer Region, die in jüngerer Vergangenheit ziemlich abseits des Weltgeschehens, in früheren Jahrhunderten jedoch nicht selten in seinem Brennpunkt lag. Diese Region – sie hieß bei den alten Griechen Transoxanien, bei den Arabern Mawarannahr, und bei den russischen Besatzern im 19. Jahrhundert ihrer großteils turksprachigen Bewohner wegen Turkestan – ist wie kaum eine zweite von extremen Gegensätzen geprägt. Ihre Kernzone formen zwei Wüsten, Kysylkum und Karakum, in denen Sand- und Schneestürme toben und Temperaturen zwischen minus und plus fünfzig Grad herrschen. An ihren Rändern dehnen sich endlose Steppen, liegen die mächtigen Gebirgszüge des Pamir und des Tien Shan und die Reste eines der einst größten Binnenseen der Erde, des Aralsees. Durchschnitten wird diese gewaltige Landschaft von zwei Strömen – Syrdarya und Amudarya. Sie sind beide gesäumt von fruchtbaren Oasen. Dort ist das Klima vergleichsweise mild und das Dasein angenehm. Die Bewohner dieser Oasen, sesshafte Bauern, lebten von Urzeiten an bis vor gut hundert Jahren im ständigen Konflikt mit den Nomaden, deren Heimat der leere, unwirtliche Raum jenseits der schmalen Grünzonen war. Hatten sie Kraft, gelang es ihnen, ihr Territorium zu verteidigen. Zeigten sie Schwäche, wurden sie von den berittenen Jägern überfallen und ihre verästelten Bewässerungskanäle, die Lebensadern ihrer Zivilisation, zerstört.
Noch mehr als an diesen lokalen Kriegen hatte der Raum stets an den Invasionen fremder Heere zu leiden. Alexander der Große und Dschingis Khan, Perser, Chinesen, Hunnen, Türken, Araber und Russen – die Eroberer kamen aus allen Himmelsrichtungen und wüteten oft mit einer Blutrünstigkeit, die in der Weltgeschichte ihresgleichen sucht. Immer wieder wurden Städte, ja ganze Völkerschaften ausgelöscht. Nicht wenige freilich, um bald umso vitaler wiederzuerstehen. Zentralasien im Allgemeinen und auch sein Kerngebiet, das heutige Usbekistan, werden aus europäischer Perspektive gerne als peripherer Raum verkannt – als vermeintlich substanz- und profilloses Durchzugsland zwischen den großen Kulturräumen Chinas und des Iran. Solche Sicht ignoriert nicht nur die landschaftliche Vielfalt dieser Großregion zwischen Kaspischem Meer und Tarim-Becken, Hungersteppe und Hindukusch, sondern mehr noch ihre historische Bedeutung. Wer im Westen hat schon von den Großreichen der Choresmier, Samaniden oder Timuriden gehört, die hier über Jahrhunderte blühten? Wer von dem Land als Heimat visionärer Denker von Weltrang oder als Schatztruhe der Kunst? Usbekistan, dieser fast eine halbe Million Quadratkilometer große, von der Natur mit Rohstoffen wie Erdgas, Gold, Kupfer, Uran reich gesegnete und erst seit 1991 unabhängige Binnenstaat (er ist übrigens der weltweit einzige nur von Binnenstaaten umgebene), bildet in Wahrheit eine Zentralzone der Zivilisationsgeschichte, ein Epizentrum des Geistes seit der Antike. Dies auch, aber beileibe nicht nur dank der legendären Seidenstraße, die sein Territorium über tausend Kilometer weit querte.
Ähnlich, wenngleich auf andere Weise unterschätzt wird für gewöhnlich auch Usbekistans Hauptstadt Taschkent. Wer als Neuankömmling im Kopfgepäck Bilder orientalischer Traumziele mit pittoresken Moscheen, Palästen, Basaren hierher mitbringt, wird rasch ernüchtert. Die Zweieinhalb-Millionen-Metropole ist nicht Buchara oder Samarkand, touristische Romantik ihre Sache nicht. Zwar blickt sie, wie jene, auf eine über zweitausendjährige Siedlungsgeschichte zurück und florierte im Mittelalter ebenfalls als Handelsstation und Handwerkerzentrum an der Seidenstraße. Doch von ihrer historischen Bausubstanz ist der Kapitale, der erst die Russen, als sie 1867 ihr Generalgouvernement einrichteten, Hauptstadtstatus verliehen, kaum etwas geblieben. Zwei Zäsuren sind hauptverantwortlich für den Verlust: Die eine gravierende war ein Erdbeben, das 1966 mit der Stärke siebeneinhalb nach Richter die Stadt, insbesondere ihren alten Kern, devastierte. Und zuvor schon, in der Frühphase des Großen Vaterländischen Krieges, hatte Stalin aus den von der Nazi-Besatzung betroffenen und bedrohten Gebieten eine Million Menschen sowie einen Gutteil der Schwerindustrie, insbesondere die Flugzeugproduktion, hierher evakuiert. Dadurch wandelte sich Taschkent zur bedeutendsten Industriemetropole Zentralasiens, und in seinem Grundcharakter.
Haben also jene Reisenden recht, die »die steinerne Stadt« als Ort des Ein- und wieder Wegfliegens abtun, Erstbesuchern zur alsbaldigen Weiterfahrt raten? Ja, wenn man vorrangig das Malerisch-Orientalische sucht. Nein, wenn man an der sowjetischen Moderne, speziell deren Architektur, interessiert und willens ist, sich auf ein Stadtgefüge der Ambivalenzen und Brüche einzulassen. Und ein doppelt unterstrichenes Nein, wenn man sich am Beginn oder Ende einer Rundreise Überblick über Geschichte und Künste des Landes verschaffen will. Der Gang durch die hauptstädtische Museumslandschaft allein füllt zwei Tage. Die einschlägigen Sammlungen bieten famose Einblicke in Epochen und Genres. Außerdem lässt sich in der Hauptstadt am intensivsten der frische Wind erspüren, der das Land seit Kurzem durchweht.
Ein Vierteljahrhundert, bis zu seinem Tod 2016, hatte Islam Karimow, ein autokratischer Apparatschik aus echt sowjetischem Schrot und Korn, mit eiserner Faust über seine Landsleute geherrscht. Menschenrechte, Meinungs- und Glaubensfreiheit lagen in Ketten, Korruption und Bürokratie trieben deprimierende Blüten. Die Reputation der noch jungen Republik war mehr als mies. Unter Schawkat Mirsijojew, dem neuen, 1957 geborenen Präsidenten, mutierte sie zwar nicht über Nacht – wie denn auch? – zur lupenreinen Demokratie. Doch in zentralen Bereichen wie Rechtsstaatlichkeit, Liberalisierung der Wirtschaft, politischer Teilhabe, Umwelt- und Denkmalschutz stellte die Regierung manche Weichen in Richtung Zukunft. Die Zivilgesellschaft und mit ihr kritische Medien, in- und ausländische ngos und Minderheiten, auch religiöse, dürfen seither deutlich freier atmen. Auch das Verhältnis zu den Nachbarländern hat sich entkrampft. Die Grenzen sind nach langjähriger Sperre wieder offen. Alte Dispute um deren Verlauf, vor allem mit Kirgistan und Tadschikistan im Fergana-Tal, sind dabei, gelöst zu werden. Unter den fünfunddreißig Millionen Usbeken nimmt die Angst ab und keimt Zuversicht. 2019 bewog das jähe Tauwetter den Londoner Economist, ihre Heimat zum »Land des Jahres« zu adeln. Usbekistan sei, so der unbestechliche Befund der Redaktion, nicht länger eine »altmodische Diktatur im Sowjetstil«. Kein anderer Staat sei jüngst auf dem Reformpfad »so sehr vorangekommen«.
Merklich entspannter und weltläufiger ist naturgemäß vor allen anderen Städten Taschkent geworden. Zugleich erweist sich diese einst nach Moskau, Leningrad und Kiew viertgrößte Metropole der udssr mehr denn je als ästhetisch und atmosphärisch hoch spannender Hybrid. Da sind zum einen die Mahallas: Die Zahl dieser traditionell in basisdemokratischer Selbstverwaltung organisierten Nachbarschaftsviertel schrumpft rapide. Schuld daran sind die wild wütenden Bulldozer zukunftstrunkener Bauherren. Doch es gibt sie noch. In ihren labyrinthisch engen, unasphaltierten Gassen stößt man nach wie vor auf ballesternde Buben und auf Händler mit Karren voll Wassermelonen und Kurut, den harten, kastaniengroßen Käsebällchen. Man kann noch Kühe brüllen und Schafe blöken hören. Es duftet nach Plov, dem so nahrhaften Nationalgericht, das die Großmütter hier noch mit tüchtig Hammelfett im Eisenkessel über offenem Feuer kochen. Und mit etwas Glück öffnet sich in einer der fensterlosen Lehmmauern ein Haustor und gibt den Blick frei auf einen Moment Leben, das ungestört im stillen Andante des Ostens dahinfließt – auf einen Hof etwa, darin zwei Alte im Schatten einer Weinlaube auf einem Tapchan, dem mit Teppich belegten Holzbett, bei grünem Tee über einer Schachpartie brüten.
Außerhalb dieser Refugien des Privaten dominiert allerdings die brachiale Leere realsozialistischer Stadtplanung. Nach der Bebenkatastrophe hatte man Taschkents Wiederaufbau zum nationalen Projekt erklärt, um Leistungskraft und Solidarität der sowjetischen Völkergemeinschaft unter Beweis zu stellen. Nach einem Generalplan stampften freiwillige Helfer, herbeigeströmt aus allen Ecken des Landes, im Rekordtempo eine Retortenstadt aus dem Boden. Sie geriet, dem Zeitgeist in Politik und Bevölkerung entsprechend, der Architektur ein ähnlich großes Ansehen wie dem Militärwesen und der Weltraumfahrt beimaß, zu einem städtebaulichen Schaufenster der revolutionären Moderne.
Über das Resultat kann man aus guten Gründen lästern: über das neue Zentrum, das in seiner Sterilität und Megalomanie ein von gewaltsamen Ideologien und Utopien geprägtes Staatsverständnis widerspiegelt. Über Klötze wie das ehemalige Lenin-Museum und den Sitz des zk der Partei oder den raketenhaften Mega-Fernsehturm. Oder auch über die hyperbreiten Prospekte, konzipiert vorrangig, so scheint es, für Mai-Aufmärsche, Panzerparaden und Präsidentenlimousinen mit ihren rasenden Eskorten, und in Permanenz supersauber gehalten von den allgegenwärtigen Besenbrigaden. Die Nase rümpfen kann man auch über die Entrücktheit, den Pomp und Kitsch der nach der Unabhängigkeit entstandenen Herrschaftsarchitektur – Repräsentationsbauten wie Parlament, Rathaus, Börse, Timuriden-Museum, die mit ihren neoislamischen Elementen eine rückwärtsgewandte nationale Identität beschwören. Und erst recht lästern kann man über die neuerdings wie Pilze nach dem Regen himmelwärts schießenden Banken-, Hotel- und Businesstürme (Paradebeispiel: das jüngste Geschäftsviertel namens Tashkent City), die genauso gut in Shenzhen, Houston oder Dubai stehen könnten. Und von denen niemand so recht weiß, wer sie eigentlich finanziert und den Profit abschöpft.
Fairer der Stadt und ihrer Genese gegenüber verfährt freilich, wer ihre Widersprüche als Qualität anerkennt und den Blick auf Vorzüge und Meriten richtet: auf ihren Wasserreichtum und das viele Grün zum Beispiel, sprich: die weitflächigen Parks und Alleen und vom Fluss Chirchiq gespeisten Kanäle; auf die Badeseen, Berge und Skipisten im nahen Umland; oder auf die inzwischen quicklebendige Kunst- und Kneipenszene. Zu würdigen gilt, dass sowjetische Urbanisten im Standardsortiment ihres Städtebaukastens auch Kultur- und Konzerthäuser, Kongress- und Messehallen, Sportarenen, Filmpaläste, Museen und, als glänzendstes Juwel, ein Bolschoi-Theater für Oper und Ballett mit nach Zentralasien brachten.
Als »Seismischer Modernismus« wird – nach seinem tektonischen Auslöser – bezeichnet, was Städteplaner und Architekten in den Sechzigern und Siebzigern in Taschkent zur Entfaltung brachten. Um ihre innovative Leistung zu verstehen, muss man nicht unbedingt – obwohl man es sollte – zu den ikonischen Bauten jener Jahre pilgern: der türkisblauen Riesenkuppel des Chorsu-Basars zum Beispiel, der Ufo-förmigen Rotunde des Zirkus oder dem Panoramakino (nicht versäumen: das von Regiedissident Mark Weil bereits 1976 als erste Avantgardebühne der Sowjetunion gegründete Theater Ilchom direkt vis-à-vis!). Es genügt, mit der Metro gefahren zu sein. Deren Stationen wurden mit großem Aufwand und ebensolcher Eleganz nach Moskauer Vorbild als wahre »Paläste der Werktätigen« ausgestaltet, die man seit dem letzten Präsidentenwechsel sogar fotografieren darf. Faszinierender noch ist, ein paar Plattenbausiedlungen die Parade abzunehmen. Denn obwohl es seinerzeit vor allem um die Schaffung bitter benötigten Wohnraums ging, drängte es deren Schöpfer offenbar, auch ungewöhnliche, revolutionäre ästhetische Ansprüche zu erfüllen.
Um die zweihundert großflächige, bunte Mosaike zieren den öffentlichen Raum der Stadt. An den Stirnseiten vieler Hochhausblöcke prangen, Dekoration und Agitation zugleich, Motive aus russischen Märchen neben Darstellungen von Kosmonauten und Helden der Arbeit, Allegorien von Gleichheit und Brüderlichkeit, Völkerfreundschaft, einer glor- und siegreichen Zukunft. Eingerahmt von geometrischen und vegetabilen Mustern, die augenfällig an islamische Ornamentik und auch textile Kunst der Nomaden anknüpfen, zeugen sie von ebenso unbändiger Experimentierlust wie die Gebäude selbst: Taschkent sei die Stadt mit den schönsten Plattenbauten der Welt, schwärmte der Schriftsteller Martin Mosebach angesichts der Vielzahl origineller »Schlafmaschinen« mit ihren »Erkern und Schmuckteilen aus Beton, den kühnen Treppentürmen, Atelierfenstern, runden Kajütenluken und unregelmäßig geformten, hundertfach übereinander getürmten Balkons«. Tatsächlich macht die immense Fülle verspielter Formen aus Taschkent ein aufregendes, in seiner Art einzigartiges architektonisches Versuchslabor. Was beweist, dass sich geballte Fantasie selbst unter den bleiernsten Verhältnissen eines Realsoz Marke Breschnew ein Betätigungsfeld zu finden und aufregende Ergebnisse zu zeitigen vermochte.
Menschenschlächter und Mäzen
Auf den Spuren Timurs, des altneuen Vaters der Nation
Wow! Da könnten sich die Herren Xi Jinping, Putin, Erdoğan und Konsorten noch einiges abschauen. Gemeint ist in diesem Fall freilich nicht etwa die Gabe des kompromiss- und ruchlosen Vorgehens gegen Widersacher. Die Analogie – die genau genommen gar keine sein kann, denn zwischen den Genannten und dem Potentaten, um den es hier geht, liegen mehr als sechs Jahrhunderte – bezieht sich vielmehr auf das Virus der architektonischen Geltungssucht. Einen Palast von solch grotesker Monumentalität muss man sich erst mal hinzuklotzen getrauen! Gigantische achtunddreißig Meter sind die beiden Pfeiler mit den angebauten Rundtürmen und integrierten Treppenhäusern hoch, und doch nur die Rudimente eines Portals, dessen Torbogen, bevor er unter dem eigenen Gewicht zusammenbrach, eine Spannweite von zweiundzwanzig und eine Scheitelhöhe von fünfzig Metern aufwies. Das zugehörige Palastgebäude dahinter, das ein missgünstiger Nachfolger übrigens schon bald darauf wieder abreißen ließ, besaß gar eine Grundfläche von hundertfünfundzwanzig mal zweihundertfünfzig Metern. An seiner Stelle blickt heute inmitten einer Parkanlage von nicht zu überbietender Sterilität der Schöpfer der ganzen Pracht von hohem Podest martialisch ins Land. Das Standbild, in seinen Dimensionen auch nicht gerade von schlechten Eltern, dient Brautpaaren als Lieblingskulisse für Hochzeitsfotos. Es wurde, welch Symbol für maskuline Unbeugsamkeit und Heldenmut!, 1996 errichtet. Als eine von drei Kolossalstatuen des Mannes im notabene bereits unabhängigen Usbekistan. Aber hier begänne schon eine neue, andere Geschichte … Und wir greifen vor. Alles schön der Reihe nach bitte, und tunlichst mit der geziemenden Demut erzählt! Amir Timur, der »glorreiche Fürst«, wie man ihn hierzulande neuerdings nennt, duldet keine Zweideutigkeiten und schon gar keine Ironie. Eine kleine Erwähnung nur sei noch erlaubt: dass es sich nämlich beim Ak-Sarai, dem »Weißen Palast«, dessen Reste wir hier in Shahrisabz bestaunen, in Timurs Geburtsort, der damals Kesch hieß und schon den Sogdiern Hauptstadt war, nur um einen Zweitwohnsitz für die heißen Sommermonate handelte. Seinen ursprünglichen Plan, nämlich Kesch zur Hauptstadt zu machen, hatte der Diktator zugunsten Samarkands irgendwann fallen gelassen. Seine Hauptresidenz ebendort (deren über die Jahrhunderte zerfallene Ruine man übrigens erst 1948 endgültig demolierte) hatte noch gewaltigere Ausmaße.
Auf der eineinhalbstündigen Fahrt von Samarkand südwärts nach Shahrisabz erklimmt der Wagen etwa auf halbem Weg den Tahta-Karacha-Pass. Von dessen Scheitel auf fast achtzehnhundert Metern Seehöhe schweift der Blick über die Serpentinenstraße und felsübersäte Abhänge hinab in das Tal des Tankhadarya. Dort unten verbrachte Temür ibn Taraghai Barlas, den die Nachwelt unter dem Namen Tamerlan oder auch Timur Lenk, »der Lahme«, kennt, seine Jugend. Es waren turbulente Jahre in einem notorisch von Gewalt geprägten Soziotop, in dem sich der in den 1330er Jahren geborene Spross eines turkstämmigen Clans erste Sporen verdiente. Wie Dschingis Khan scharte er als Anführer einen Haufen von Abenteurern und Freibeutern um sich – frühe Vorläufer, wenn man so will, der Basmatschi, jener »ruhmreichen Banditen«, die in den Zwanzigern den Bolschewiken und in der Folge sogar noch Stalin in Turkmenistan zu schaffen machten. Kraft diplomatischer Listen und skrupelloser Kühnheit formte der junge Timur allmählich einen starken militärischen Söldnertross, wurde 1370 auf einem Kurultai, dem mongolischen Reichstag, zum Großemir gewählt und schwang sich schließlich zum Alleinherrscher über das Zweistromland zwischen Syrdarya und Amudarya auf. Es folgte eine nicht enden wollende Kette von Feldzügen, mit denen er von Choresmien und Persien über den Kaukasus, Mesopotamien, Syrien und Anatolien, vom Fergana-Tal bis nach Nordindien ein immenses Territorium eroberte und heillos verwüstete. Berühmt ist etwa sein Sieg über den osmanischen Sultan Bayezid I. 1402 bei Ankara, wo dieser in seine Gefangenschaft geriet. Traumatisierend wirken bis heute seine Massaker nach, bei denen er unter anderem in Isfahan, Bagdad, Damaskus und Delhi große Teile der Stadtbevölkerung niedermetzeln und die Schädel der Opfer zu Pyramiden auftürmen ließ. Es wird vermutet, Timur habe sich mit dem Schrecken umgeben und den Nimbus verleihen wollen, der sich mit Namen und Taten des von ihm verehrten Dschingis Khan verband, und ihm deshalb auch auf dem Feld der Blutrünstigkeit nachgeeifert. Andererseits war er, obwohl selbst des Lesens und Schreibens unkundig, als großzügiger Förderer der islamischen Literatur und vor allem der bildenden Kunst aktiv.