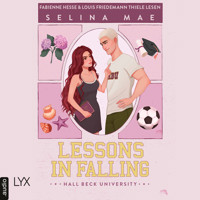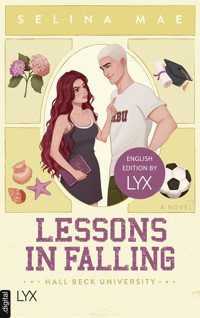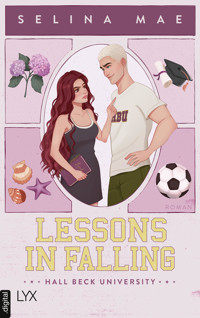11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hall Beck University
- Sprache: Deutsch
ES MUSS ECHT AUSSEHEN. FÜR ALLE. IN JEDEM MOMENT. NICHT NUR FÜR MEINEN BRUDER. IMMER
Eine Sache wünscht sich Athalia Pressley mehr als alles andere auf der Welt: ihrem Zwillingsbruder Henry wieder nahe zu sein. Seit dem Tod ihrer Eltern haben sie sich jedoch immer weiter voneinander entfernt, sodass sie an diesem tragischen Tag auch ihn verloren hat. Aber als Henry erfährt, dass Athalias neuer Statistiktutor ausgerechnet Dylan McCarthy Williams ist - sein Erzfeind im Fußballteam -, bekommt sie plötzlich Henrys ungeteilte Aufmerksamkeit. Athalia hat keine andere Wahl: Um Henrys Interesse an ihr möglichst lange aufrechtzuerhalten, unterbreitet sie Dylan einen brillanten Fake-Dating-Plan. Doch zwischen Fake-Dates und Nachhilfestunden wird ihr ursprüngliches Ziel langsam, aber sicher zur Nebensache ...
»Die Chemie zwischen den Charakteren und die Enemies-to-Lovers-Vibes sind perfekt. Ihr werdet dieses Buch nicht aus der Hand legen können!« DOM VON ITS_TN_BITCH
Band 1 der HALL-BECK-UNIVERSITY-Reihe von WATTPAD-Erfolgsautorin Selina Mae
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Bücher von Selina Mae bei LYX
Impressum
SELINA MAE
Lessons in Faking
Roman
Ins Deutsche übertragen von Maike Hallmann
ZU DIESEM BUCH
Eine Sache wünscht sich Athalia Payton Pressley mehr als alles andere auf der Welt: ihrem Zwillingsbruder Henry wieder nahe zu sein. Seit dem Tod ihrer Eltern haben sie sich jedoch immer weiter voneinander entfernt, sodass es sich anfühlt, als habe sie an diesem tragischen Tag auch Henry verloren. Aber als Athalia droht, ihren Statistikkurs nicht zu bestehen, und Henry erfährt, dass ihr neuer Tutor ausgerechnet Dylan McCarthy Williams ist, bekommt sie von einem Tag auf den anderen Henrys ungeteilte Aufmerksamkeit. Athalia ist selbst nicht sonderlich begeistert, mehrmals die Woche von Henrys viel zu attraktivem Erzfeind im Fußballteam Nachhilfe zu bekommen. Doch dass Dylan keine Gelegenheit auslässt, seinen Teamkollegen zu provozieren, macht ihn zum perfekten Kandidaten für einen waghalsigen Fake-Dating-Plan: Dylan spielt bis Silvester ihren Fake-Freund, aber zwischen gespielten Dates auf dem Fußballplatz und flüchtigen Berührungen in Dylans viel zu kleinem Büro wird ihr gemeinsames Ziel langsam, aber sicher zur Nebensache …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Selina und euer LYX-Verlag
Gewidmet all jenen, die mühelos lieben, ohne zu werten oder dafür irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Ich danke euch.
KAPITEL 1
Ich war mir über genau drei Dinge sicher.
Rache ist nur ein anderes Wort für Gerechtigkeit.Geld macht glücklich.Ich muss mich von Dylan McCarthy Williams fernhalten, sonst wird mein Bruder mich im Schlaf ermorden lassen.Und jetzt mal ehrlich, wie wichtig war das Ganze hier wirklich?
Faktisch gesehen würde ich in Statistik II durchfallen – ja. Und natürlich sagte Professor Shaw, diese wöchentliche Nachhilfe sei meine einzige Möglichkeit, den Kurs doch noch zu bestehen, nachdem ich die Zwischenprüfung »völlig vergeigt« hatte (seine Worte, nicht meine).
Aber Hand aufs Herz: Vielleicht war Studieren einfach nicht mein Ding. Trotz der Reputation meiner Mutter war es Statistik jedenfalls ganz sicher nicht. Ebenso wenig wie McCarthy.
Von der Tür aus beäugte ich den Typen kritisch und unterdrückte ein genervtes Stöhnen. Hockend auf einem viel zu kleinen Schreibtischstuhl beugte er seine hochgewachsene Gestalt über einen Papierstapel. Mit gerunzelter Stirn begutachtete er irgendwelche Dokumente, das kaffeebraune Haar fiel ihm dabei ins Gesicht. Bisher hatte er noch keinerlei Notiz von mir genommen. Nicht, als ich geklopft hatte. Nicht, als ich die Tür geöffnet hatte. Nicht, als ich …
»Athalia Payton Pressley«, murmelte er, ohne aufzublicken. Meine Körperspannung schien beim Klang seiner Stimme wie von selbst zu verpuffen. »Würdest du dich bitte einfach setzen?«
Er sagte es mit einer Art gereizter Gleichgültigkeit, während er etwas auf ein Blatt Papier kritzelte und den Rotstift dann lässig vor sich auf den Tisch warf. Irgendwie fühlte es sich absichtlich passiv-aggressiv an. Als würde er damit wortlos sagen: Wie kannst du es wagen, meine Arbeit zu unterbrechen?
»Oder hattest du vor, mich die ganze Stunde lang nur anzustarren?«, fragte er stattdessen, ließ sich nun dazu herab, endlich aufzuschauen, und sah mir direkt in die Augen. Provokant hob er die Brauen und bedachte mich mit einem herausfordernden Blick, bei dem ich am liebsten kehrtgemacht hätte und weggerannt wäre. Stattdessen zwang ich mich auf den Stuhl ihm gegenüber. McCarthy verfolgte höchst wachsam jede meiner Bewegungen. Wie ich Platz nahm und meine braunen Haare über die Schulter legte, um sie nicht zwischen Rücken und Stuhllehne einzuklemmen. Wie ich ein Bein über das andere schlug, dabei den Saum meines schwarzen Rocks festhielt und mit einer Hand über den Wollstoff meines langen Ärmels strich.
Unschuldig blinzelte ich ihn an. »Mir wurde Nachhilfe bei Shaws bestem und klügstem Studenten versprochen.« Ich versuchte gar nicht erst, die leise Verachtung in meiner Stimme zu verbergen. Lächelnd legte ich den Kopf schief und holte einen Stapel Notizen aus meiner Tasche. Er war nur halb so dick wie seiner, aber egal. »Hast du ihn zufällig irgendwo gesehen?« In der Hoffnung, dass es einen ähnlichen Effekt haben würde wie die Gereiztheit, mit der er seinen Stift hingeschmissen hatte, knallte ich meine Papiere auf den Schreibtisch.
Er stieß ein nicht sonderlich amüsiertes Schnauben aus und griff wieder nach seinem passiv-aggressiven Stift. Dann dachte McCarthy einen Moment lang nach, ehe er mich wieder ansah und den Mund zu einem breiten, falschen Lächeln verzog. Ein Lächeln, das mir wohl mitteilen sollte: Ich bin nicht hier, um mich mit dir herumzustreiten, sondern weil ich Shaw ein bisschen in den Arsch kriechen will. Außerdem beinhaltete dieses Lächeln: Allerdings würde ich dich eigentlich lieber umbringen und die Konsequenzen in Kauf nehmen. Die Drohung verbarg sich hinter tiefen Grübchen und den Worten: »Das überrascht dich jetzt aber nicht ernsthaft, oder?« Er deutete auf sich selbst, auf das schlichte schwarze T-Shirt, in dessen Ausschnitt seine silberne Kette verschwand. Als ich ihm wieder ins Gesicht sah, grinste er mich überheblich an.
Wenn Dylan McCarthy Williams irgendwas war, dann, was mein Bruder am meisten auf dieser Welt hasste. Mehr noch als Erdbeereis (»Das ist keine Geschmacksrichtung, Athalia, sondern eine Zumutung! Nein, darüber diskutiere ich nicht mit dir«). Mehr als Eric (meinen ersten festen Freund damals). Mehr als unsere toten Eltern (die er dafür hasste, dass sie … gestorben waren?).
Es gab ein paar nennenswerte Gründe dafür und ein paar Hundert weitere.
McCarthy hatte sich seine Trikotnummer unter den Nagel gerissen.McCarthy hatte ihm den Mannschaftskapitän-Titel aus den Händen gerissen.McCarthy hatte sich seine Freundin Paula unter den Nagel gerissen (drei Tage nach der Trennung).Natürlich war es reiner Zufall gewesen, dass McCarthy die Nummer sieben auf seinem Trikot trug, und am Ende hatte ihr Gezanke sie beide die Chance gekostet, Kapitän der HBU-Fußballmannschaft zu werden. Henry Parker Pressley war jedoch der festen Überzeugung, dass McCarthy es auf ihn abgesehen hatte; seit jenem Moment vor drei Jahren, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Ich wusste nicht genau, weshalb, aber es war mir auch ziemlich egal. Für mich zählte nur, dass ich mich mit ihm solidarisieren musste. Wenn McCarthy ganz oben auf Henrys metaphorischer Abschussliste stand, dann stand er auch auf meiner.
McCarthy und ich hatten nie viel miteinander zu tun gehabt. Mein Bruder scherte sich zwar eigentlich nicht großartig um mein Leben, aber dafür hatte er gesorgt. Das Wenige, was ich bisher von McCarthy mitbekommen hatte – seine Arroganz, sein Sarkasmus, überhaupt sein ganzes Auftreten –, erweckte in mir nicht den Eindruck, als hätte ich irgendwas verpasst.
Doch jetzt saß ich McCarthy direkt gegenüber.
Obwohl es mir normalerweise nichts ausmachte, mich Konflikten zu stellen, erschien mir der Gedanke, Professor Shaw um einen anderen Tutor zu bitten, sehr verlockend. Sein Büro war gleich nebenan. Oder ich könnte vielleicht einfach anklopfen, mich entschuldigen (dafür, dass ich … in seinem Kurs durchgefallen war?) und versprechen, bis zum Ende des Semesters eine gute Note zu erzielen – aus eigener Kraft.
Bei jedem anderen hätte das vielleicht funktioniert, aber Shaw hasste mich sowieso schon genug. Außerdem … wer sagte denn, dass ich es tatsächlich schaffen würde, allein durchzukommen? Meine Chancen standen denkbar schlecht.
Seufzend schüttelte ich den Kopf und ließ meine Augen durch den Raum schweifen. Ehrlich gesagt … selbst mit viel Mühe würde man am ganzen College wohl kein kleineres Kabuff finden als dieses. Es war die reinste Besenkammer, verglichen mit den riesigen Speisesälen der Hall Beck University (in denen ich insgesamt viermal gegessen hatte), der gewaltigen Bibliothek auf dem Hauptcampus (in die ich öfter hineingezwungen wurde, als mir lieb war) und den Vorlesungssälen, die Hunderten Studenten Platz boten (und dennoch immer schon völlig überfüllt waren, wenn ich zwei Minuten vor Vorlesungsbeginn eintraf). Und mehr, als sich gerade hier drin befand, würde auch beim besten Willen nicht hineinpassen: der Holzschreibtisch, übersät mit losen Papieren, zu meiner Linken ein Bücherregal voller verschiedenfarbiger Ordner und der Mann, viel zu groß für den Stuhl, auf dem er hockte.
Hinter McCarthy gab ein Fenster die Sicht auf einen der Innenhöfe der Universität frei und präsentierte uns das milde Herbstwetter an der Ostküste. In den Ecken sammelte sich Staub. Der Raum war viel zu klein und zu vollgestopft, und das hier würde nie im Leben gut gehen.
»Hältst du das für eine gute Idee?«
»Auf keinen Fall.« McCarthy zuckte mit den Schultern.
Der Gedanke, dass wir beide uns über irgendwas einig sein könnten – und sei es nur die Tatsache, dass wir nicht miteinander auskamen –, erschien mir seltsam.
Offenbar seltsam genug, dass ich unwillkürlich eine Grimasse geschnitten haben musste, denn er meinte nur: »Arme Prinzessin Pressley.« Ein Hauch Belustigung lag in seinem sonst so abweisenden Ton. Er legte den Kopf leicht schief. »Kann sich gar nicht vorstellen, dass irgendjemand auf dieser Welt nicht begeistert darüber wäre, Zeit mit ihr verbringen zu dürfen.«
Mein letzter Versuch, höflich zu sein, bestand darin, nicht auf diese Bemerkung zu reagieren. Man hatte mir schon schlimmere Beleidigungen an den Kopf geworfen als Prinzessin. Ich beobachtete, wie er schweigend die Handvoll Notizen durchblätterte, die ich in den ersten Wochen des Semesters gesammelt hatte, und hoffte, dass er meinen Blick spüren konnte, auch wenn er mich keines würdigte.
»Lieber Himmel.« Er brach sein Schweigen viel zu schnell wieder. »Wie um alles in der Welt hast du Statistik I bestanden?«
Offenbar war er bei meiner Zwischenprüfung angelangt, die mich überhaupt erst in diese missliche Lage gebracht hatte. Die Art, wie seine Mundwinkel sich nach oben bogen, verriet schon mehr als genug, aber er blätterte noch mal demonstrativ die Seiten um und schnaufte: »Eine Vier? Dein Ernst?«, und zwar auf die denkbar abfälligste Weise.
Meine Nase zuckte, bevor ich trocken erwiderte: »Du kannst mich mal.« McCarthy schnalzte nur amüsiert mit der Zunge.
Tja. Die wahre Geschichte, weshalb ich mich in dieser misslichen Lage befand? Professor Shaw war blind wie eine Fledermaus, und dazu fielen ihm ständig seine langen, fettigen Haare ins Gesicht. Wie hätte er da bemerken sollen, dass ich letztes Jahr mit meinem Handy unter dem Tisch Fotos von den Fragen gemacht und sie an jemanden geschickt hatte, der die Lösungen kannte? Ganz genau – er hatte es nicht bemerkt.
Mein oberschlauer Bruder, mit einem Stock im Arsch, der lang genug für uns beide war, würde das wahrscheinlich als Betrug bezeichnen. Ich hingegen fand es einfallsreich.
Das Problem war nur: Meine Leistungen während des Semesters und meine akzeptable Abschlussnote korrelierten leider nicht überzeugend miteinander (ha, Statistik). Und obwohl Shaw keine Beweise für meinen Betrug hatte, war er fest entschlossen, mich nicht noch mal damit durchkommen zu lassen. Daher die Sitzordnung, die er in der ersten Vorlesung von Statistik II eingeführt hatte … In der ersten Reihe war ich natürlich gezwungen gewesen, meine Zwischenprüfung fair und anständig zu absolvieren. Tja, und da waren wir jetzt also.
McCarthy schnaubte amüsiert, als hätte er meinen inneren Monolog gehört und würde die Antwort kennen, ohne dass ich etwas dazu sagen musste. »Natürlich.« Wissend nickte er und verdrehte die Augen. »Wann werfen die Pressleys nicht mit Daddys Geld nach ihren Problemen?«
»Es ist eigentlich Mommys Geld.« Unschuldig lächelnd sah ich zu, wie er meine Notizen auf den Schreibtisch zwischen uns legte, sodass wir sie beide betrachten konnten. »Und natürlich«, fuhr ich fort, »werfe ich damit nicht nach meinen Problemen, das wäre dir nämlich schon aufgefallen.«
»Witzig.« Er verzog keine Miene.
Und dann räusperte er sich, als würden wir das jetzt ernsthaft durchziehen. Als würde er mir wirklich A/B-Testing und Multi-Armed-Bandit-Algorithmen beibringen. Und als würde er tatsächlich erwarten, dass ich es kapierte.
Ich hatte ehrlich gesagt angenommen, er wäre ebenso sehr gegen diese Idee wie ich. Dass er im übertragenen Sinne schreien und um sich schlagen würde, bis Shaw ihn von dieser Aufgabe entband. Dass er sich notfalls wie ein Kleinkind auf den Boden werfen und toben würde, solange wir nur am Ende nicht gemeinsam hier sein müssten.
»Warum willst du uns denn so quälen?« Ich hoffte, meine Worte würden verhindern können, dass wir uns weiterhin auf Hypothesen und Variablen zubewegten. »Du bist verrückt, wenn du glaubst …«
»Das ist nun mal mein Job, Pressley«, unterbrach er mich ungerührt. Dann hob sich kaum merklich sein Mundwinkel … auf eine grausame, aber irritierend faszinierende Weise. »Du weißt schon«, spottete er. »Diese komische Sache, bei der man auftaucht, tut, was einem gesagt wird, und am Ende des Monats Geld dafür bekommt? Nach allem, was man über dich hört, weiß ich natürlich nicht, ob du mit dem Konzept vertraut bist …«
»Warte mal.« Ich fing gerade an, es zu begreifen. »Du bist offiziell Shaws Assistent?« Verwirrt schüttelte ich den Kopf. »Warum?« Ich spuckte das Wort praktisch aus.
»Warum nicht?«
»Du brauchst das Geld nicht«, warf ich ein und kniff die Augen leicht zusammen. Ich linste zu der Uhr an seinem Handgelenk, die wahrscheinlich ebenso viel gekostet hatte wie das Paar Miu Miu in meinem Kleiderschrank. »Du hast das Geld definitiv nicht nötig.«
»Und doch bin ich hier.«
Und doch ist er hier.
»Was ist mit dem süßen Master-Student aus dem letzten Jahr passiert? Ich mochte ihn«, jammerte ich und zog einen Schmollmund.
»Ob du es glaubst oder nicht – er hat seinen Abschluss gemacht.«
»Und ausgerechnet du musstest ihn ersetzen?« Mein selbstgefällig-spöttisches Lächeln war reine Fassade, die verhindern sollte, dass er mir den Schreck über meine Erkenntnis ansah: Ich hatte meine Chancen, einen anderen Tutor zu bekommen, schon vorher als gering eingestuft, aber wenn McCarthy ganz offiziell Shaws Assistent war … damit sanken sie gen null. Ich wollte sterben.
Er würde sich auf keinen Fall die Mühe machen, einen anderen Tutor zu beauftragen.
»Fühlte sich etwa sonst niemand dieser Aufgabe gewachsen?«
»Sie konnten sich erfolgreich drücken.« So langsam fing er an, sich zu ärgern, das merkte ich daran, wie ungeduldig er mit den Fingern auf dem hölzernen Schreibtisch trommelte und dann mit den Papieren auf dem Schreibtisch herumfuchtelte, um meine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. »Also, wenn es dir nichts ausmacht …«
»Mann«, seufzte ich mit einem triumphierenden Lächeln und zog das Wort extra in die Länge … ich konnte es nicht lassen. Ich lehnte mich in dem unbequemen Stuhl zurück, und als er verzweifelt aufstöhnte, hätte ich beinahe gelacht. »Shaws Assistent also, was? Das muss furchtbar sein.« Ich betrachtete die dunklen Schatten unter seinen Augen – es hatte den Anschein, als würde er in letzter Zeit nicht allzu viel Schlaf bekommen. Trotzdem sah er irgendwie besser aus als ich nach einer ganzen Nacht. »Kriegst du eigentlich Ärger, wenn du es nicht schaffst, deine Arbeit zu erledigen?«
Er stützte sich mit den Unterarmen auf dem Schreibtisch ab. Das dunkle Haar fiel ihm ins Gesicht, und der Anflug eines Lächelns umspielte seine Lippen – aber es war weder amüsiert noch fröhlich, sondern herausfordernd. »Das kommt ganz drauf an«, sagte er leise. »Handelst du dir Ärger ein, wenn du in seinem Kurs durchfällst?«
»Wie würde er dich bestrafen? Mit einer Lohnkürzung? Überstunden?«, fragte ich und ignorierte seinen Kommentar. »Oder wirst du einfach gefeuert?« Immer noch lächelnd, legte ich den Kopf schief. »Könnte ich dafür sorgen, dass du gefeuert wirst, McCarthy?«
Ich konnte sehen, wie sich die Zahnräder in seinem Kopf drehten. Sein Mundwinkel hob sich leicht, und sein Adamsapfel wippte auf und ab, ehe er antwortete: »Mach doch, was du willst.« Er verschränkte die Arme vor der Brust und zuckte mit den Schultern, während er sich in seinem Stuhl zurücklehnte. »Ich erledige meinen Job immer.«
Dann seufzte er, und ich rutschte auf meinem Sitz hin und her und schlug die Beine übereinander. »Und nur damit du es weißt«, begann er erneut und spähte rechts an mir vorbei, »diese Tür dort führt zu Shaws Büro.« Er deutete mit einem Nicken darauf. »Falls du sichergehen willst, dass er hört, wie du ihn beleidigst, sprich doch das nächste Mal etwas lauter.« Er schnaufte belustigt. »Du kannst dir ja sicher denken, wie dünn diese Wände sind.«
Ich versuchte, meinen Schock so gut wie möglich zu verbergen, und wandte den Blick schnell von der angeblichen Verbindungstür ab. Um ihn abzulenken, räusperte ich mich, beugte mich vor und blätterte in meinen Notizen.
»Also«, brachte ich mit Mühe über die Lippen und spürte, wie er mich selbstzufrieden musterte. »Was hattest du noch mal gesagt? Über …« Ich verstummte und überflog rasch meine halbherzigen Notizen aus der letzten Vorlesung. »Über den Vergleich von zwei Stichproben?« Ich sah auf. Auf seinem Gesicht lag exakt das triumphierende Lächeln, das ich erwartet hatte, und fast bereute ich, nachgegeben zu haben.
Doch wenn es etwas noch Schlimmeres gab als McCarthys Gesellschaft, dann war es der Zorn eines gewissen Professor Simon Shaw.
Mein Bruder würde das schon verstehen.
KAPITEL 2
Ich hörte meine beste Freundin, noch ehe ich sie entdeckte.
Das Klirren ihres viel zu großen Schlüsselbunds, als sie die Tür zu unserem gemeinsamen Loft am Rande des Campus aufschloss. Ihre eiligen Schritte, die nur kurz innehielten, als sie die Schuhe an der Tür abstreifte. Und schließlich ihre gereizte Stimme. »Das kann doch nicht dein Ernst sein.« Im nächsten Moment bog sie um die Ecke in die offene Küche.
»Leider doch.« Ich blickte von meinem Laptop auf und sah sie an. »Ich meine es todernst.«
Wren runzelte die Stirn und ließ langsam die mit Lebensmitteln gefüllte Tragetasche von ihrer Schulter rutschen. Zweifellos dachte sie gerade an die zahllosen Nachrichten, die ich ihr sofort nach Verlassen von McCarthys Büro geschickt hatte.
»Nein«, beharrte sie.
»Doch.«
»McCarthy?«
Ich nickte erneut.
Sie stieß geräuschvoll die Luft aus – offenbar hatte sie diese eine Weile zurückgehalten – und pustete sich dabei das kaum schulterlange Haar aus dem Gesicht. Sie trug es zweifarbig, auf der einen Seite schwarz, auf der anderen weiß … ein Selbstfärbeversuch noch aus der Zeit, bevor wir uns kannten. Es fiel ihr wieder ins Gesicht, als sie die Tasche zwischen uns auf die Kücheninsel manövrierte und anfing, sie auszupacken.
Mit einem Seufzer sprang ich vom Hocker, um ihr zu helfen. »Du hättest sein Gesicht sehen sollen«, sagte ich.
»Lieber nicht.«
»Es war einfach so …« Ich suchte nach Worten, um diese Mischung aus Arroganz, Selbstvertrauen und Selbstgefälligkeit angemessen zu beschreiben, und gab es mit einem frustrierten Stöhnen auf. »Als wäre sein Ego nicht schon groß genug.« Ein wenig zu energisch öffnete ich den Kühlschrank. »Jetzt streichle ich es jedes Mal, wenn ich aus Versehen etwas von ihm lerne – und das ist ja der Sinn der ganzen Sache, oder?« Ich schloss den Kühlschrank mit einem dumpfen Schlag. »Dass ich etwas lerne, meine ich. Und dank ihm will ich jetzt ausgerechnet das auf gar keinen Fall.«
Wren gab ihr Bestes, um mir ein mitfühlendes Lächeln zu schenken, was darin resultierte, dass ihre Nase zuckte und sie eigenartige Grimassen schnitt. Aber ich verstand, wie sie es meinte, holte zum ersten Mal seit meinem Tobsuchtsanfall tief Luft und ließ mich auf den Hocker zurückplumpsen.
»Ich bezweifle, dass er dir überhaupt was beibringen kann«, murmelte Wren und legte den Kopf schief. Wieder rümpfte sie die Nase, dann seufzte sie, ein Geräusch, das sowohl Mitleid als auch Entschlossenheit ausdrücken sollte. Sie wandte sich wieder mir zu. »Ich bin sicher, dass ich Statistik im Handumdrehen lerne«, behauptete sie. »Und dann gebe ich dir Nachhilfe. Scheiß auf McCarthy.«
Ich musste lachen, leise und ein bisschen verzagt.
»Ich meine es ernst«, beteuerte sie mit fester Stimme.
Eine Sekunde lang stellte ich es mir vor. Wren mir gegenüber in diesem Bürostuhl. Wren, die mir Fragen stellte, auf die ich keine Antworten wusste. Und sie stellte sie immer und immer wieder, bis ich es schließlich doch wusste. Kein McCarthy in Sicht. Eine wunderschöne, wenn auch ziemlich utopische Vorstellung.
»Ich weiß.« Ich zog das weiß in die Länge und klang dabei fast weinerlich. »Deshalb ist das Angebot auch so furchtbar verlockend.« Mein Schmollen verwandelte sich unter Wrens herausforderndem Blick in ein halbherziges Lächeln. Okay, und warum dann nicht?, fragte dieser Blick. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und entblößte das selbstgestochene Messer-Tattoo an ihrer Hand – ein Ergebnis unserer schweren Aufschieberitis während der Sommerprüfungen letztes Jahr.
Belustigt schüttelte ich den Kopf. »Ich kann nicht guten Gewissens so viel von deiner Zeit stehlen. Nicht schon wieder.«
Wren Inkwood war die Art Freundin, die dich zu jeder Party und jedem Treffen begleitete, obwohl sie nicht gern trank und keine Menschen mochte. Sie war die Art Freundin, die deinen Freund verprügelte, als sie herausfand, dass er dich betrogen hatte, bevor sie es dir mitteilte. Die Art Freundin, die dich zu Thanksgiving mit nach Hause nahm, obwohl sie dich erst seit wenigen Wochen kannte.
Und weil sie eindeutig zu der Art Freundin zählte, die alles gab, während ich selbst eine höchstens durchschnittlich gute Freundin war, hatte ich mir vorgenommen, weniger zu nehmen und mehr zu geben. Ich wollte endlich mal für sie da sein, nicht umgekehrt. Deshalb blieb ich stur.
»Das kann nicht dein Ernst sein, Athalia.«
»Oh doch.«
»Mach dich nicht lächerlich.«
»Tu ich nicht.«
Es klopfte an unserer Tür, und es kam mir vor wie eine Rettung in letzter Sekunde – die Möglichkeit, einen Streit abzuwenden, bevor er überhaupt begonnen hatte.
Mit einem vorgetäuschten bedauernden Blick sprang ich vom Barhocker und sprintete zur Tür. Als ich jedoch gleich darauf meinem finster dreinblickenden Zwillingsbruder gegenüberstand, sehnte ich mich sofort wieder nach dem kindischen Geblödel mit Wren, die gerade in ihrem Zimmer verschwand.
Ich hätte ihn gern öfter zu Gesicht bekommen, ja. Aber nicht, wenn er schlecht gelaunt war.
»Henry.« Als er wortlos in die Wohnung schlüpfte, zog ich die Brauen hoch. »Warum kommst du nicht rein?«, murmelte ich und machte eine völlig überflüssige einladende Geste, obwohl er bereits in die Küche abgebogen war und in Schränken und Regalen herumwühlte … ich konnte es vom Flur aus hören. Mit einem Augenrollen warf ich die Tür zu und folgte ihm. »Du weißt ja, ich liebe deine jährlichen Besuche, aber eine kleine Vorwarnung wäre … toll.«
Henry trug immer noch seine Sportklamotten … karmesinrote Shorts mit einer kleinen aufgenähten Acht und einen schwarzen Kapuzenpulli über dem dazu passenden Trikot. Wahrscheinlich war er verschwitzt und eklig, trotzdem sah er so gut aus wie immer. Sein hellbraunes Haar war wie üblich in der Mitte gescheitelt.
»Meine Besuche sind nicht jährlich«, erwiderte er schließlich nach vollen fünfzehn Sekunden und hielt inne, als er in dem ansonsten leeren Obstkorb eine schon ziemlich braune Banane entdeckte. Um sie herauszunehmen, war er gezwungen, den Papierstapel in seiner Hand auf die Kücheninsel zu legen, was meine Aufmerksamkeit darauf lenkte.
Unwillkürlich versteifte ich mich. »Woher hast du die?«
Rhetorische Frage.
Henrys Augen, ebenso grün wie meine, folgten meinem Blick scheinbar beiläufig, und er benutzte die Banane als Verlängerung seines Fingers, um halbherzig auf meine Statistiknotizen zu zeigen. »Ach, die?« Er zuckte mit den Schultern, nahm einen Bissen und fuhr dann mit vollem Mund fort: »Eigentlich eine lustige Geschichte.« Sein Gesichtsausdruck verriet deutlich, dass er es keinesfalls witzig fand. »McCarthy hat sie mir nach dem Training gegeben.« Als er den Namen aussprach, zog er eine verächtliche Miene. »Er teilte mir mit, meine kleine Schwester müsse sie in seinem Büro vergessen haben und ob ich nicht vielleicht so nett sein könnte, sie ihr zurückzubringen, falls ich vielleicht sowieso mal bei ihr vorbeischauen würde …«
»Nicht, dass du das vorhattest«, warf ich schnell ein. »Vorbeizuschauen, meine ich.« Denn ohne meine Notizen, die ihm McCarthy in die Hand gedrückt hatte, wäre er sicherlich nicht auf die Idee gekommen.
Henry ignorierte die Spitze geflissentlich, was mich nicht überraschte. »Ich soll dir ausrichten, dass er sich …« Mein Bruder als waschechter Dramatiker machte eine Pause, als bräuchte er einen Moment, um sich zu sammeln.
Ich schloss die Augen und ließ den Kopf zurückfallen, während ich mich mit beiden Händen auf dem Tresen hinter mir abstützte. Machte mich auf die Wucht der Nachricht gefasst, die McCarthy meinem Bruder hinterlassen hatte.
»Ich soll dir ausrichten …«, wiederholte Henry und wartete, bis ich ihn wieder ansah. »Dass er heute wirklich viel Spaß hatte – er freut sich sogar schon auf das nächste Mal.« Und als wäre das nicht schon schlimm genug, fügte er hinzu: »Aber erinnere sie daran, wie dünn die Wände sind, sagte er. Ich werde in Zukunft nicht mehr so nachsichtig mit ihr sein.«
Es hätte mich nicht gewundert, wenn die letzten Worte ein exaktes Zitat gewesen wären. Und der Hauptgrund, weshalb Henry überhaupt hier war.
Wir starrten uns ungläubig an – aus sehr unterschiedlichen Gründen.
Ich dachte: Ich kann nicht fassen, dass McCarthy meinem Bruder diesen Blödsinn erzählt.
Er hingegen dachte wahrscheinlich: Ich kann nicht fassen, dass meine Schwester mit meinem Erzfeind zusammen ist! (Wie schon gesagt, er konnte sehr dramatisch sein.)
Und als ich nichts zu meiner Verteidigung vorbrachte – weil ich immer noch zu fassungslos war, um auch nur ein Wort herauszubringen –, schoss es auch schon aus ihm heraus: »Du schläfst mit McCarthy!«
Diese ungefilterte Anschuldigung riss mich aus meiner Starre. »Großer Gott«, keuchte ich und schnitt eine Grimasse. »Ich schlafe nicht mit ihm!«
»Dann erklär mir das hier!« Verzweifelt wedelte er mit meinen Notizen durch die Luft. »Bitte.« Er klang so verzweifelt, wie er aussah.
»Nachhilfe!«, stammelte ich. »Er ist mein Tutor.« Ich holte tief Luft. »Statistik«, stieß ich hervor, als wäre das die einzige Erklärung, die es brauchte.
Ich beobachtete, wie die Erkenntnis in seinen Verstand sickerte. Seine Erleichterung war offensichtlich: Seine Schultern sanken herab, er atmete lange aus und schloss die Augen. Es sah aus wie ein stilles Gebet zu Gott, an den er allerdings nicht glaubte.
»Nachhilfe«, wiederholte er im Flüsterton, als spräche er mit sich selbst, dann biss er noch mal in aller Seelenruhe in die Banane, als hätte er nicht gerade einen waschechten Tobsuchtsanfall hingelegt. Er schluckte den Bissen runter und nickte. »Er ist dein Tutor.«
»Ja.«
Seine Stimme war bedächtig, sein Blick wanderte fast geistesabwesend durch den Raum, als er sagte: »Dann organisier dir einen anderen.«
Ich fragte mich, ob er wirklich annahm, dieser Gedanke wäre mir selbst noch nicht durch den Kopf gegangen. »Ich kann mir nicht einfach einen anderen organisieren«, entgegnete ich und setzte mich wieder.
»Warum nicht?«
»Weil …«, stöhnte ich. Mit hochgezogenen Brauen wartete Henry darauf, dass ich weitersprach. »Weil Shaw meinte, es wäre meine einzige Chance, seinen Kurs noch zu bestehen.« Ich musterte ihn, aber er wirkte völlig unbeeindruckt, als ginge es nur um eine unbedeutende Unannehmlichkeit und ich müsste mir nur ein klein wenig mehr Mühe geben, um sie aus dem Weg zu räumen. »Nachhilfeunterricht bei McCarthy. Einmal pro Woche.«
Henry schüttelte den Kopf, als wäre er bei dem Gespräch zwischen meinem Professor und mir dabei gewesen und wüsste ganz genau, dass Shaw das niemals so gesagt hatte. »Ich gebe dir Nachhilfe.«
Und hallo, Angebot Nummer zwei.
»Bist du jetzt auch Shaws Assistent oder was?«
»Nein«, gab er genervt zurück. Bevor ich etwas darauf erwidern konnte, fuhr er fort: »Aber ich bin besser in Statistik als McCarthy.«
»Du glaubst, du wärst in allem besser als er«, erinnerte ich ihn seufzend, legte die Arme auf die Kücheninsel und vergrub resigniert meinen Kopf darin.
»Weil ich es bin.«
»Na klar.«
»Athalia …«
»Was?« Ich hatte nicht vorgehabt, ihn so anzuschreien, vor allem, da er sich inzwischen wieder eingekriegt hatte. Dennoch tat ich es, und mein Kopf schnellte ruckartig zu ihm herum.
Kurz herrschte Schweigen, ehe Henry mir ein entschuldigendes Lächeln schenkte und die Kücheninsel umrundete. Er stellte sich neben mich und zerzauste mir mit einer Hand das Haar. Er liebte es, das zu tun, obwohl er genau wusste, dass ich es nicht leiden konnte.
Auch wenn es sich jedes Mal so anfühlte, war es nicht böse gemeint. Es war wohl einfach Henrys Art, mir auf geschwisterliche Weise klarzumachen: Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Nur sprach er es nie aus – ich konnte mich nicht erinnern, wann er es das letzte Mal tatsächlich zu mir gesagt hatte.
»Ich rede mit Shaw«, schlug er vor, so leise, als könnte selbst die kleinste Irritation mich wieder hochgehen lassen wie eine Bombe, die nur auf einen Grund zum Explodieren wartete. Vielleicht war es ja auch so.
»Das ist wahrscheinlich die dümmste Idee, die du je hattest, Henry«, murmelte ich betont ruhig … hauptsächlich, um meinen Ausbruch von eben zu kompensieren. »Shaw hasst dich fast genauso sehr wie mich.«
»Na und?«, fragte er. »Er sollte es besser wissen, als dich und McCarthy in denselben Raum zu stecken. Ich rede mit ihm.«
Ich schluckte die Bemerkung runter, dass Shaw wahrscheinlich andere Sorgen hatte als die alberne Rivalität zwischen seinen beiden Musterstudenten.
»Das bringt doch nichts.« Shaw würde keinen Millimeter nachgeben, genauso wenig wie McCarthy aufgeben. Es hatte überhaupt keinen Sinn.
Henry schlurfte zur Spüle und warf die Bananenschale in den Mülleimer darunter. »Ich rede mit ihm«, wiederholte er stur.
»Nein, tust du nicht«, erwiderte ich, plötzlich sehr entschlossen.
»Athalia«, stöhnte er.
»Henry.«
Verzweifelt warf er die Hände in die Luft und starrte mich so erbost an, dass es mir fast ein Lächeln entlockte. Henry war so leicht zu verärgern, dass ich fast verstand, weshalb McCarthy ihn so gern reizte. Und immerhin erlangte ich auf diese Weise seine Aufmerksamkeit. »Ich will nur nicht, dass dieser Arschpimmel …«
»Arschpimmel?« Jetzt grinste ich doch. »Sehr originell.«
Henry winkte halbherzig ab. »Wie auch immer«, schnaubte er. »Ich will diesen Typen einfach nicht in der Nähe meiner kleinen Schwester haben.«
»Ich bin nur zwölf Minuten jünger als du.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich brauche dich nicht als Babysitter. Eigentlich brauche ich überhaupt niemanden, der auf mich aufpasst. Ich kümmere mich selbst um die Sache mit McCarthy, so wie es jede Erwachsene tun würde.«
Er überhörte den letzten Teil geflissentlich. »Und doch bist du einen Tag nach mir geboren. Zwölf Minuten hin oder her, Athalia, du bist meine kleine Schwester. Punkt.«
»Henry …«
»Das wäre dann also geklärt …« Er zuckte lässig mit den Schultern, als hätte er mich nicht erneut unterbrochen, steuerte unbeirrt auf die Tür zu, ohne den Blick von mir abzuwenden, bis er um die Ecke verschwand. »Keine Sorge. Ich mach das schon, kleine Schwester.«
»Wage es ja nicht …« Ich eilte ihm hinterher. »Ich kümmere mich selbst darum!«
Unbeeindruckt öffnete Henry die Tür, hielt dann einen Moment inne, um mir zum Abschied noch mal unbefangen zuzulächeln.
Kleiner Mistkerl.
Ich stemmte die Hände in die Hüften. »Dylan McCarthy wird nicht in die Nähe deiner kleinen Schwester kommen«, beteuerte ich spöttisch. »Zumindest nicht näher als bis zum Schreibtisch, der uns trennt. Lass mich das allein regeln. Okay?«
»Klar.« Henry nickte, während er mir den Rücken zudrehte und ging, aber ich hörte genau, dass er es nicht so meinte.
KAPITEL 3
»Bist du sicher, dass das keine Kostümparty ist?« Wrens Stimme hallte durch die spärlich beleuchtete Straße. Aus dem Haus, vor dem wir standen, drang Musik.
Ich riss meine Aufmerksamkeit von den griechischen Buchstaben über dem Eingang los und grinste sie an. »Sicher. Aber selbst wenn …« Ich musterte sie in ihren Militärstiefeln und der dunklen Strumpfhose, die unter einem Rock verschwand, der dieselbe Farbe hatte wie alles andere, was sie trug: Schwarz. »Du könntest dich immer noch für Halloween qualifizieren.«
»Halt die Klappe.« Wren verdrehte die Augen. Zwar erwiderte sie mein Lächeln, aber als ich sie im nächsten Moment auf die Veranda und auf die Tür zuschob, stellte sie vermutlich spontan unsere dreijährige Freundschaft infrage. Breit grinsend sah ich sie noch mal an, und als sie mein Grinsen erwiderte, stieß ich die Tür auf.
Die Menge begrüßte uns mit großem Jubel. Und das nicht, weil sie wussten, wer wir waren (oder es sie interessierte), sondern weil mehr Leute einfach mehr Spaß bedeuteten. Mehr Gesang, mehr Tanz, mehr mögliche Flirts.
»Athalia!« Als mein Kopf zum Besitzer der Stimme herumschnellte, wurde ich bereits in eine stürmische Umarmung gezogen, und dann zerzauste eine große Hand mein Haar genau auf die Art, die ich verabscheute.
Henry.
»Ich wusste nicht, dass du auch hier bist«, murmelte ich gegen seinen Oberkörper. Allerdings hatte ich schon ein bisschen zu ordentlich vorgeglüht, um mich groß darüber zu ärgern, dass er gerade in nur wenigen Sekunden eine ganze Stunde Haarstyling komplett ruiniert hatte. Vielleicht war ich auch einfach von der Tatsache überrumpelt, in Henrys Armen zu liegen. Dass er mich wirklich umarmte.
Ja, mein Bruder umarmte mich, und ich konnte mich nicht erinnern, wann er das zum letzten Mal getan hatte. Wann er mir seine Zuneigung auf andere Weise gezeigt hatte als durchs Haarezerzausen.
Bevor ich ganz begriff, wie mir geschah – und warum –, zuckte Henry mit den Schultern und ließ mich los, um Wren ebenso enthusiastisch zu begrüßen.
Ich musterte meinen Zwilling. Sein braunes Haar war lässig gestylt, und ich wusste, dass er dafür fast ebenso lange gebraucht hatte wie ich für meine Frisur. Sein schwarzes Polohemd hatte er in die maßgeschneiderte Hose gesteckt und schaffte es irgendwie, in seinem Golfplatz-Outfit völlig leger rüberzukommen.
Während Wren ihm auf den Rücken klopfte und mit gerümpfter Nase darauf wartete, dass er sie aus seiner Umarmung entließ, ging mir etwas auf.
Henry war betrunken. Und Henry trank normalerweise nicht.
Hilfmir, formte Wren lautlos mit den Lippen und riss mich aus meinen Gedanken, ehe ich schlau aus Henrys Zustand werden konnte. Nicht dass meine Chancen sonderlich gut gestanden hätten, jemals richtig schlau aus meinem Bruder zu werden.
Dafür ließ er sich viel zu selten bei mir blicken.
»Alles klar!« Ich befreite Wren aus Henrys Griff. Sie holte tief Luft, es klang wie ein Keuchen. Ich schaffte es gerade noch, Henry ein »Wir sehen uns!« zuzurufen, bevor mich meine beste Freundin durchs überfüllte Wohnzimmer des Frathauses zerrte. Das Letzte, was ich sah, war, wie Henry mir zum Abschied salutierte.
Wren schnaufte und klopfte sich das schwarze Oberteil ab, als müsste sie es entstauben, und diese Bewegung war so typisch für sie, dass mir ohne weiteren Grund vor lauter Zuneigung das Herz schwoll. Als sie bemerkte, wie ich sie anstrahlte, wich sie zurück. »Athalia …«, warnte sie mich, aber ich folgte ihr. »Ich kenne diesen Blick. Wag es nicht …«
Doch bevor sie den Satz beenden konnte, schlang ich auch schon die Arme um sie und hörte sie ächzen. Mit ihren nicht mal eins sechzig war sie auf Augenhöhe mit meiner Schulter, gegen die sie jetzt resigniert ihren Kopf sinken ließ. »Das ist das, was ich am wenigsten an dir mag«, grummelte sie in mein Haar und fügte sich in das Unvermeidliche.
»Meine wunderbaren Umarmungen?«
Sie lachte. »Dass du so touchy wirst, wenn du trinkst«, korrigierte sie kichernd. »Anscheinend habt ihr das gemeinsam, du und Henry.«
Ich zuckte mit den Schultern und ließ sie los. Erfreut bemerkte ich, dass sie grinste. »Apropos trinken …« Ich zuckte mit den Brauen. Wren seufzte.
»Schon klar. Die Getränke stehen dort drüben.« Sie lachte und drehte mich sanft Richtung Kücheninsel. »Ich suche mal die Toilette, und wir treffen uns bei den Drinks.« Mit einem Klaps auf den Rücken setzte sich meine beste Freundin in Bewegung und drehte sich erst wieder um, als die Menge sie schon fast verschluckt hatte. Ihren durchbohrenden Blick kannte ich nur allzu gut. Meine Mundwinkel zuckten. »Übertreib. Es. Nicht!«, rief sie über die Musik hinweg, mit dieser typisch mütterlichen Betonung, bei der sie jedes Wort unterstrich. Was sie damit meinte, war: Wehe, du bist schon sturzbetrunken, wenn ich zurückkomme.
Natürlich honorierte ich ihre Ermahnung, indem ich einen Shot auf sie trank.
Eine Sache war bei Wren Inkwood fast so sicher wie der Tod und die Steuern: Innerhalb der ersten zehn Minuten nach ihrer Ankunft auf einer Party suchte sie zuverlässig nach einer Toilette.
Sie trank keinen Alkohol – hatte es nie getan –, doch während ich zu Hause zu unserer »Getting Ready«-Playlist vorgeglüht hatte, hatte sie nicht etwa gar nichts getrunken. Es geht ums Prinzip, Athalia, sagte sie stets und entschied sich statt für Alkohol einfach für Wasser.
Literweise Wasser. Vermutlich war ihre Haut deshalb wie Porzellan. Und sobald wir unser Ziel erreichten, musste sie unweigerlich die nächste Toilette aufsuchen. Wie ein Uhrwerk. Sie ging pinkeln, und ich wartete dort auf sie, wo sie mich abgestellt hatte.
Heute Abend wartete ich an der improvisierten Bar – einem Granittresen in der offenen Küche.
Der Alkohol brannte in meiner Kehle. Ich schüttelte mich und wischte mir die Lippen ab. Als ich mich wieder dem Tresen zuwandte, wusste ich schon vor dem Griff zum ersten Getränk, dass mein selbst zusammengemixter Drink viel zu stark werden würde.
»Oh, Himmel.« Der Kommentar wurde von der lauten Musik fast übertönt. Ich zögerte. »Das hat noch nie gut geendet.« Da erst verstand ich, dass die Worte an mich gerichtet waren, wirbelte herum und erschrak, weil er direkt vor mir stand.
Mein Blick wanderte über das weiße Hemd nach oben – die obersten beiden Knöpfe waren offen –, bevor ich ihn alarmiert anfunkelte. Er fixierte mich, ein spielerisches Grinsen auf den Lippen, und seine eisblauen Augen bohrten sich in meine.
Die meisten Leute hatten beim Gedanken an den Teufel sogleich Hörner und Hufe, rote Haut und noch rötere Augen im Kopf. Wenn ich jedoch an den Teufel dachte, war es einer mit blondem Haar, blauen Augen und perfekt definierten Locken. Zufälligerweise lief im Hintergrund genau in diesem Moment Highway to Hell, und lauter betrunkene Studenten grölten das Lied lautstark mit.
»Lass mich das machen.« Er riss mir den roten Einwegbecher aus der Hand, seine Finger streiften meine. Jede Wette, dass das Absicht war. Ich hatte damals etwas zu spät herausgefunden, dass Jason Montgomery immer alles mit Absicht tat. Ein wenig wehmütig fügte er hinzu: »Deine Drinks sind doch jedes Mal viel zu stark.«
Es schockierte mich, dass er aussprach, was ich eben noch selbst gedacht hatte, und vor lauter Schreck erwiderte ich nichts darauf und nahm den vollen Becher an, den er mir einen Moment später reichte. Vielleicht lag es daran, dass ich bereits angetrunken war. Aber vielleicht auch daran, dass seine Gegenwart mich zu meinem eigenen Ärger nach wie vor ganz schön durcheinanderbrachte.
Nach dem ersten Schluck musste ich widerwillig zugeben, dass mein Ex-Freund ebenso souverän Drinks mixte, wie er mich souverän betrogen hatte.
»Früher warst du gesprächiger.«
Exzellent beobachtet, hätte ich fast geantwortet. Die Möglichkeit, dass ich genauso viel mit anderen Leuten redete, wie ich eben gerade mit ihnen reden wollte, kam ihm offenbar nicht in den Sinn. Ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er auch nicht von allein auf diesen Gedanken kommen würde.
Wie betäubt von seiner Dreistigkeit – und der Unverschämtheit, dass er immer noch so eine Wirkung auf mich hatte – nickte ich nur stumm, die Lippen zu einer dünnen Linie zusammengepresst. Jason lehnte sich neben mich gegen den Tresen, während ich mich verzweifelt nach einem bekannten Gesicht in der Menge umguckte. Doch in den bunten, flackernden Lichtern konnte ich kaum etwas erkennen.
»Du hast deinen Mund oft benutzt, Pressley«, ergänzte er.
Ich stöhnte laut auf und legte den Kopf in den Nacken. Je mehr Stuss er von sich gab, desto mehr verwandelte sich meine Verwirrung in Wut. Ich bezweifelte, dass er mich bei dem Lärm – um es als Musik zu bezeichnen, war ich noch nicht betrunken genug – überhaupt hörte.
»Und zwar ziemlich geschickt.«
Gottverdammt.
Ich fuhr zu ihm herum, so schnell, dass ich fast das Gleichgewicht verlor. Rasch hielt ich mich mit einer Hand an der improvisierten Bar fest, und auf einmal spürte ich deutlich den Alkohol, den ich bereits konsumiert hatte. »Verdammt noch mal«, fauchte ich ihn an. »Du hast vielleicht Nerven.«
»Oh«, brummte Jason nur, sein Blick wanderte über die behelfsmäßige Tanzfläche. »Sie spricht.«
Ehrlicherweise hätte sein J-Name mein erstes Warnsignal sein müssen. Doch allen Widrigkeiten und früheren Überzeugungen zum Trotz hatte ich mich gerade mal drei Wochen nach Beginn meines ersten Studienjahres Hals über Kopf in Jason Montgomery verliebt. Höchstwahrscheinlich vor allem deshalb, weil meine Eltern ihn geliebt hätten und weil mein Bruder ihn geliebt hatte und weil mir praktisch jeder (außer Wren) bestätigt hatte, wir wären wie füreinander geschaffen.
Jetzt fand ich diesen Gedanken abstoßend. Aber damals, als ich nichts über Jason wusste – außer dass er der Goldjunge der Montgomerys war, vor dem eine glänzende Zukunft lag –, war er mir wie eine Offenbarung vorgekommen. Er war sein Leben lang darauf trainiert worden, seinen Charme spielen zu lassen, und außerdem sah er umwerfend gut aus.
»Das hier.« Ich deutete zwischen uns beiden hin und her, und seine Augen blitzten belustigt. »Das wird nicht passieren.«
»Was wird nicht passieren?« Jason hob demonstrativ die Hände, als wollte er kapitulieren. »Ich lege es doch gar nicht darauf an, dass irgendwas passiert, Athalia.« Unschuldig zuckte er mit den Schultern … Das Einzige, was ihn verriet, war sein subtiles, aber selbstgefälliges Grinsen. Ich hasste es, wie es klang, wenn er meinen Namen sagte. »Um ehrlich zu sein, bin ich davon ausgegangen, wir wären quitt, nachdem du mein Auto mit Eiern beworfen und einen Reifen aufgeschlitzt hast.«
Das mit dem Reifen war ein Unfall gewesen. Mehr oder weniger.
Er beugte sich weiter zu mir herunter, damit ich ihn über die Musik hinweg hörte, obwohl er jetzt etwas leiser sprach. »Ich möchte mich doch nur mit einer alten Freundin unterhalten.« Als er sich wieder aufrichtete, hoffte ich inständig, dass der Schauer, der mir in diesem Moment über den Rücken jagte, auf den Alkohol zurückzuführen war. Er baute sich vor mir auf und musterte mich eindringlich. »Wir sind doch Freunde, oder?«
Fieberhaft überlegte ich, wie ich ihn am besten darüber aufklären sollte, dass ich wohl lieber meine eigenen Füße essen würde, als mit ihm befreundet zu sein.
»Das wüsste ich aber.«
Kurz fragte ich mich, ob das meine eigene Stimme war, die da sprach. Sie klang so viel tiefer als üblich und triefte vor kühler Gleichgültigkeit. Perplex schlug ich mir eine Hand vor den Mund, ich war mir ziemlich sicher, keinen Ton von mir gegeben zu haben. Denn wenn doch, wäre es bestimmt etwas Unhöflicheres gewesen.
Dann legte sich ein Arm um mich, und die dazugehörige Hand hielt ein Bier, das plötzlich neben meiner Schulter schwebte. Ich erstarrte und wollte mich befreien, aber ein robuster Körper, der eben noch nicht da gewesen war, hinderte mich daran. Mein benebelter Verstand versuchte erfolglos, eins und eins zusammenzählen. Die Musik – inzwischen verdiente sie diesen Namen – war so laut, dass ich überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte.
Jason wich ertappt zurück. Und das gefiel meinem betrunkenen Verstand dann auf einmal doch so gut, dass ich mich unwillkürlich im Arm des Unbekannten entspannte und sogar ein Lächeln zustandebrachte. Mit einem Selbstvertrauen, das ich normalerweise in Jasons Gesellschaft nicht verspürte, bohrte sich mein Blick in seine durchdringenden blauen Augen. Allerdings sah er mich gar nicht mehr an.
»McCarthy«, stieß er abfällig hervor.
Bei der Erwähnung des Namens zuckte ich zusammen. Jason war noch immer ganz auf ihn konzentriert, und auch ich wandte nun vorsichtig den Kopf in Richtung des Typen neben mir. Schwarzes T-Shirt, eine darunter verschwindende silberne Halskette und dieser unverkennbar verkniffene Zug um den Mund.
Nachdem meine anfängliche Anspannung verflogen war, hatte McCarthy seinen Arm etwas fester um mich gelegt, ansonsten schien er mich praktisch nicht zur Kenntnis zu nehmen. Seine ganze Aufmerksamkeit galt Jason.
Unter anderen Umständen hätte ich McCarthy weggestoßen, sobald ich auch nur erahnt hätte, dass er es wäre. Aber jetzt, Jason vor Augen, der sich drohend zu seiner vollen Größe aufgerichtet hatte … In diesem Moment war McCarthy erstaunlich nützlich. Ich blieb, wo ich war.
»Dieses Bild werde ich für immer in Erinnerung behalten«, spottete Jason, riss den Blick von McCarthy los und betrachtete uns beide. Ich schluckte schwer, und der Raum drehte sich ein wenig um mich. Der Alkohol war schuld. »Hätte nie gedacht, dass dein herzallerliebster Bruder das gutheißen würde.« Jetzt guckte er nur mich an. »Wo steckt Henry eigentlich?«
Henry würde das auf keinen Fall gutheißen. Er würde sowohl mich als auch McCarthy umbringen, wenn er diesen Arm um mich sehen würde. Wenn er sehen würde, wie dicht wir standen. Ich musste mich zusammenreißen, um mich nicht sogleich panisch nach meinem Bruder umzusehen, sobald sein Name fiel.
McCarthy tat, was Jason am meisten hasste: Er ignorierte ihn. Statt zu antworten, richtete er seine Augen das erste Mal auf mich. Er hob die Brauen, ein Hauch von – sicherlich vorgetäuschter – Besorgnis lag auf seinem Gesicht. »Würdest du mich nach draußen begleiten?«, fragte er kühl und deutete mit einem Nicken zum Hinterhof.
Und es war nicht mal gelogen, als ich sagte: »Liebend gern.«
KAPITEL 4
»Ich würde dir ja danken …« Sobald wir draußen waren, hatte ich das Gefühl, als würde die frische Herbstluft die Wirkung des Alkohols bloß verstärken. Ich schwankte und bekam Schluckauf, noch bevor wir die Gartenbank erreichten. »Aber das hier ist wahrscheinlich genauso schlimm.«
Um ehrlich zu sein, gab es für mich nichts Schlimmeres, als auch nur eine Minute in der erdrückenden Gegenwart von Jason Montgomery verbringen zu müssen, aber das brauchte McCarthy nicht zu wissen. Also setzte ich noch einen drauf. »Vielleicht sogar noch schlimmer.«
»Du könntest auch einfach danke sagen.« Ich spürte, wie sich die Bank unter seinem Gewicht bewegte, als er sich neben mich setzte, und ich musste ihn nicht ansehen, um zu wissen, dass ein selbstzufriedenes Grinsen seine Lippen umspielte. Dasselbe Grinsen, das er nicht hatte unterdrücken können, als er merkte, dass ich aus der Nummer mit der Nachhilfe nicht mehr rauskam.
»Ich brauche deine Hilfe nicht«, stellte ich klar, weil mich dieses Grinsen furchtbar ärgerte.
»Natürlich nicht«, erwiderte er darauf selbstzufrieden.
»Ich hatte alles im Griff.«
»Aber selbstverständlich.«
Ich gab ein Ächzen von mir und wandte den Kopf, um ihn mit einem vernichtenden Blick zu durchbohren. Erwartete ein spöttisches Grinsen, konnte es praktisch schon vor mir sehen. Aber dann stellte ich fest, dass seine Augen auf den Nachthimmel über mir gerichtet waren, er guckte mich gar nicht an.
Die Stadt war zu hell erleuchtet, um dort oben irgendwas Bedeutendes zu erkennen, und selbst die wenigen Sterne, die normalerweise über uns aufblinken würden, versteckten sich heute hinter Wolken. Trotzdem musterte er den Himmel aufmerksam.
»Ich meine es ernst«, bekräftigte ich. Er schwieg. In meiner alkoholgetränkten Gereiztheit schien die darauffolgende Stille zwischen uns ewig anzudauern, wahrscheinlich waren es jedoch nur wenige Sekunden, ehe ich sie durchbrach. »Nach allem, was du weißt, könnte es ja sogar sein, dass du mir die Tour vermasselt hast.« Bei dieser Anschuldigung schaute er mich endlich an, und ich keuchte auf. »Oh mein Gott.« Die Worte klangen undeutlich. Anklagend richtete ich einen Finger auf ihn. »Genau das hattest du vor, oder?«
Resigniert schüttelte er den Kopf, und zum ersten Mal sah ich etwas auf seinen Lippen, das man als echtes Lächeln hätte bezeichnen können. »Erwischt.« Er hob die Hände und warf mir einen kurzen Blick zu, bevor er weitersprach: »Wenn ich ein Mädchen schutzlos Montgomerys Fängen überlasse, ohne sie heldenhaft zu retten, wäre das praktisch Beihilfe.« Er rümpfte die Nase über seinen eigenen Scherz.
»Wir waren mal zusammen.« Keine Ahnung, weshalb ich das Bedürfnis hatte, das klarzustellen, und während der kurzen Pause, die meine Aussage nach sich zog, kam ich mir ausgesprochen dumm vor. Aber ich konnte es nicht mehr zurücknehmen.
»Ich weiß.«
Ich zuckte zurück und sah ihn überrascht an. Dass McCarthy über mein Liebesleben Bescheid wusste, war … unerwartet. Ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen. »Natürlich weißt du …«
»Hast du mir gerade zugezwinkert?« Aufrichtig verblüfft lachte er auf. Wäre ich nicht so betrunken gewesen, hätte ich seine Überraschung vermutlich geteilt. »Oder ist dir was ins Auge geflogen?« In gespielter Sorge beugte er sich zu mir und tat so, als würde er mein Auge untersuchen. Unwillkürlich starrte ich ihn an, nahm seine dunkle Silhouette in mich auf. Dann trat ich leicht gegen sein Bein und erntete einen finsteren Blick, ehe er sich wieder auf der Bank zurücklehnte.
Das wilde Flackern aus dem Haus war unsere einzige Lichtquelle hier draußen, dennoch reichte sie aus, um seine hohen Wangenknochen, die Nasenspitze und das Kinn auszumachen. Seine Wangen waren von der kühlen Luft vermutlich leicht gerötet. Ab und zu blies er sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
Und als mein Kopf langsam wieder klarer wurde, fragte ich mich, wie ich hier eigentlich gelandet war: betrunken und allein mit Dylan McCarthy, der seit geraumer Zeit nichts mehr gesagt hatte, immer noch gen Himmel schaute und irgendwie … zufrieden aussah.
Ich schüttelte diese Gedanken ab und richtete meine Aufmerksamkeit träge auf die Schiebetür, die sich gerade öffnete. Eine Gestalt trat hinaus, blickte sich im Hinterhof um und zögerte, ehe sie dann mit entschlossenen Schritten auf uns zumarschierte.
»Athalia?«, schallte es durch die Dunkelheit, doch ich erkannte sie – und ihre Stimme – erst, als sie direkt vor mir stand. Der Alkohol war schuld.
»Wren!« Lächelnd sprang ich auf, um meine beste Freundin zu umarmen. Und obwohl sie es zuließ, konnte ich trotz des Alkoholdunstes spüren, dass sie es eigentlich nicht wollte, nicht mal auf ihre Wren-Art.
Ich löste mich von ihr und sah, wie sie einen Blick auf den Typen hinter mir warf, bevor sie wieder mich betrachtete. Sie blinzelte, warf McCarthy einen zweiten Blick zu.
»Was soll das werden?« Sie machte sich nicht mal die Mühe, leiser zu sprechen, damit McCarthy nicht mitbekam, wie wenig erfreut sie über ihr Zusammentreffen war – wahrscheinlich wollte sie sogar, dass er es hörte. Darüber musste ich lächeln und vergaß völlig, ihre Frage zu beantworten. »Das hier«, präzisierte sie. »Mit ihm.« Um es zu unterstreichen, warf sie ihm noch einen Blick zu.
Mir entwich ein amüsiertes Schnauben, und ich zuckte mit den Schultern. »Weiß ich selbst nicht so genau«, gab ich zu und neigte glucksend den Kopf. »Ich weiß es wirklich nicht.« Witzigerweise fragte ich mich ja dasselbe.
»Ebenfalls hallo, Inkwood«, zischte McCarthy sarkastisch und trank einen Schluck Bier, bevor er sich erhob. Mit hochgezogenen Brauen erwiderte er den Blick meiner besten Freundin, die ihn energisch anfunkelte.
Ohne etwas darauf zu erwidern, musterte sie mich prüfend, und ich registrierte nur vage, dass McCarthy an uns vorbei Richtung Haus schlenderte.
»Hatte ich dir nicht aufgetragen, es ruhig angehen zu lassen?«, schimpfte sie mit mir, aber als ich erneut mit den Achseln zuckte, erhellte sich ihre Miene ein wenig, und fast hätte sie gelächelt.
»Tut mir leid, Mom!« Lachend legte ich den Kopf auf ihre Schulter, und in diesem Moment fiel mir all das ein, was sie in ihrer Abwesenheit verpasst hatte. Mit einem lauten Aufstöhnen zerrte ich meine beste Freundin zurück ins Haus und erzählte ihr von meiner Begegnung mit dem blauäugigen Teufel … was mich so sehr beschäftigte, dass ich nicht mitkriegte, wie er auf der anderen Seite des Raums mit meinem Bruder sprach.
KAPITEL 5
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, erinnerte ich mich nicht mehr genau daran, wie ich eigentlich nach Hause gekommen war. Ich wusste nur, dass mir alles wehtat, mein Kopf dröhnte und ich mein bequemes Bett unter mir spürte.
Fünf furchtbar kurze Minuten lang dachte ich über meine Pläne für diesen Tag nach. Beim Gedanken daran, dass ich mir mehrere Stunden zum Lernen geblockt hatte und das auch noch in fetten Großbuchstaben in meinen Kalender eingetragen hatte (zweimal mit rotem Stift unterstrichen), echote in Wrens Stimme ein »Ich hab’s dir ja gesagt« durch meinen Kopf. Ich kriegte nicht mehr richtig zusammen, was ich zu meiner Verteidigung hervorgebracht hatte, als sie mich vor nicht mal zehn Stunden ausdrücklich davor gewarnt hatte, wie sehr ich es bereuen würde, am Abend vorher feiern zu gehen.
Und jetzt lag ich hier und hatte viel zu viel zu tun, um einfach im Bett zu bleiben. Schon wieder. Genau wie letzte Woche. Und in der Woche davor. Bis Montag musste ich noch jede Menge lesen, ein Essay schreiben, das zwanzig Prozent meiner Note für Internationales Management ausmachte, und für Statistik II lernen. Letzteres war natürlich das Schlimmste von allem.
Ich hätte gut und gerne ein paar tausend Wörter tippen können oder seitenweise lesen. Aber aus Korrelationskoeffizienten und dem anderen Zeug, das McCarthy für mich auf Lager hatte, wurde ich nicht schlau. Und ja, faktisch gesehen war es seine Aufgabe, es mir beizubringen, aber mir gefiel McCarthys selbstgefällige Miene überhaupt nicht, ebenso wenig wie sein amüsiertes Brummen, wenn ich keine Ahnung hatte, wovon er redete.
Wenn ich Shaw beweisen könnte, dass ich es ohne ihn auf die Reihe bekäme, mich mehr am Unterricht beteiligte und im nächsten Test eine akzeptable Note erreichte, bräuchte ich McCarthy vielleicht gar nicht mehr. Ich wäre diese lächerlichen Blicke und herablassenden Bemerkungen los. Das war Motivation genug, um mich endlich aus dem Bett zu schwingen.
Nur dass ich mich nicht wirklich schwang, sondern eher ganz langsam und bedächtig unter der Bettdecke hervorkroch, meiner um mich rotierenden Umgebung möglichst wenig Beachtung schenkte und stöhnend meinen pochenden Kopf festhielt. Kurz dachte ich, ich müsste mich übergeben, aber ich schaffte es irgendwie, mich in die Küche zu schleppen.
Die Sonne lugte durch die großen Fenster herein – eine Seltenheit im grauen, regnerischen Herbst an der Ostküste. Der perfekte Tag für einen Spaziergang zur Bibliothek, um an einem der Tische an der langen Glasfront zu sitzen und zu lernen. Leider war es ein furchtbarer Tag für einen Kater. Zu hell.
»Scheiße.« Ich hatte schützend die Hände vor die Augen gelegt, um sie gegen die Helligkeit abzuschirmen, und deshalb Wren fast umgerannt, die an der Kaffeemaschine stand. Langsam nahm ich die Hände runter. »Tut mir leid.« Ich bemühte mich inständig, Wren mein bestes Katerlächeln zu präsentieren, erntete aber nur ein knappes Nicken, bevor sie nach der dampfenden Tasse unter der Maschine griff. Ich runzelte die Stirn. »Wann sind wir gestern Abend nach Hause gekommen?«
Ein paar Sekunden verstrichen, ehe sie antwortete: »Gegen zwei.«
Ich blinzelte sie an und zögerte. Es lag eine wirklich unangenehme Spannung in der Luft. »Oh, okay.« Sie wandte sich zum Gehen, und ich kniff die Augen zusammen. »Danke.«
Sie hielt inne. Drehte sich zu mir um, ihre Tasse in Form des Kopfs von Lin-Manuel Mirandas Hamilton in beiden Händen. »Wofür?«
»Dafür, dass du mich nach Hause gebracht hast.«
»Ach so. Dafür doch nicht.« Wren nickte erneut und wandte sich wieder zum Gehen, aber vor ihrem Zimmer blieb sie noch mal stehen. »Ich konnte dich ja wohl kaum allein lassen angesichts deiner Gesellschaft.« Bei diesen Worten klang sie tatsächlich angepisst … Immerhin war ich mir jetzt absolut sicher, dass ich es mir nicht nur einbildete. »Allerdings schienst du dich bestens zu amüsieren.«
»Was soll das denn heißen?« Ich wollte sie nicht anblaffen, ich war wirklich neugierig. Und verwirrt. Allerdings machte mich der Kater noch ungeduldiger als sowieso schon, und ich klang ganz schön zickig.
Wren lachte trocken auf, obwohl sie nicht sonderlich amüsiert wirkte. »Nichts«, pfefferte sie zurück und fügte noch hinzu: »Vergiss einfach, dass ich was gesagt habe.« Und damit warf sie die Tür hinter sich zu.
Na großartig.
Heute war nicht der richtige Tag für Streitereien. Ich hatte viel zu erledigen und war nicht in der Stimmung, mich zu streiten oder mich mit jemandem herumzuschlagen, dem irgendeine Laus über die Leber gelaufen war. Und das war bei Wren eindeutig der Fall.