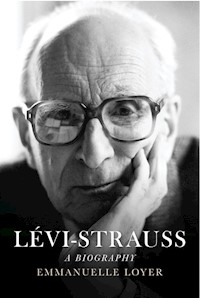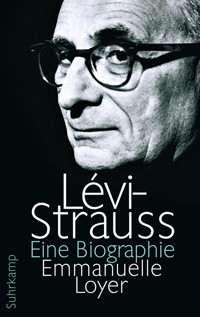
59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wissenschaftler, Schriftsteller, Melancholiker, Ästhet – Claude Lévi-Strauss (1908-2009) hat nicht nur Wissenschaftsgeschichte geschrieben, sondern auch unseren Blick auf uns selbst und auf die Welt verändert. In ihrer preisgekrönten Biographie durchmisst die Historikerin Emmanuelle Loyer das Leben und den intellektuellen Werdegang des weltberühmten Anthropologen.
Auf Basis bisher unveröffentlichter Quellen schildert Loyer fesselnd die Persönlichkeit und die Entwicklung von Lévi-Strauss: seine Kindheit im jüdisch assimilierten Elternhaus, seine vielversprechende Jugend- und Studienzeit sowie seine ersten politischen und intellektuellen Suchbewegungen. Es folgen die inzwischen legendäre Expedition ins Innerste Brasiliens, das Exil in Amerika, die Begründung des Strukturalismus. Nach dem Krieg und der Rückkehr nach Frankreich beginnt die Zeit des Schreibens, des Ruhms und der Ehrungen. Die Traurigen Tropen erscheinen und werden ein Welterfolg. Lévi-Strauss avanciert zu einem französischen Nationalhelden. Doch in seinen vielfältigen öffentlichen und politischen Interventionen bewahrt er sich stets den »Blick aus der Ferne«. Loyers Biographie erzählt von einem Leben als intellektuellem Abenteuer – einem Abenteuer, das fortwirkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1663
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Emmanuelle Loyer
LÉVI-STRAUSS
Eine Biographie
Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer
EinführungDIE WELTEN VON CLAUDE LÉVI-STRAUSS
Ich hätte mich gern einmal richtig mit einem Tier verständigt. Das ist ein unerreichtes Ziel. Es ist fast schmerzhaft für mich zu wissen, daß ich nie wirklich herausfinden kann, wie die Materie beschaffen ist oder die Struktur des Universums. Das hätte es für mich bedeutet, mit einem Vogel sprechen zu können. Aber da ist die Grenze, die nicht überschritten werden kann. Diese Grenze zu überschreiten würde für mich das größte Glück bedeuten. Wenn Sie mir eine gute Fee bringen würden, die mir einen Wunsch erfüllt, dann würde ich diesen nennen.
Claude Lévi-Strauss,Gespräch mit Fritz J. Raddatz1
Die Reise um die Welt
Lange Zeit verbrachte Claude Lévi-Strauss die Nachmittage in seinem Büro, bei sich zu Hause im fünften Stock der Rue des Marronniers Nr. 2 im 16. Arrondissement von Paris. In Miniaturform bildete dieses Arbeitszimmer mit seiner gewaltigen, fast enzyklopädischen Bibliothek, seinen ausgewählten Objekten, seinen Mineralien, seinen »Kuriositäten«, seinen Kunstwerken die Welt nach.
Betreten wir das Heiligtum. Ein großer rechteckiger Raum mit einer Rundung an der Fensterseite. An den Wänden Regale voller Bücher, gebundener Zeitschriften, Enzyklopädien und Wörterbücher. Der Schreibtisch, ein in New York erworbenes hispanisierendes Möbel aus dunklem Holz, steht schräg im hinteren Teil; hier schreibt Lévi-Strauss, und hier hält er sich auf, um zu lesen oder wiederzulesen, in einem Sessel mit Rollen, der es ihm ermöglicht, sich zu einem Sekretär voller Papiere und zu einem kleinen runden Tisch aus Stahl zu bewegen, auf dem eine Schreibmaschine (mit deutscher Tastatur) thront. Aus dem Radio dringt leise die unerlässliche klassische Musik. Zurückgelehnt an seinem Schreibtisch sitzend, auf den er manchmal die Füße legt, hat Lévi-Strauss eine große Abbildung der »Tara« vor sich, einer geschlechtslosen grünen Gottheit aus Nepal, die er in den 1950er Jahren im Auktionshaus Drouot erworben hat, ein Bild der Heiterkeit und der Ruhe. Ein thailändisches Krokodil, eine riesige holzgeschnitzte Wurzel aus China, japanische Graphiken und Säbelscheiden vervollständigen die Anwesenheit des Fernen Ostens; auch einige seltene ethnographische Gegenstände, die Haïda-Keule aus Zedernholz, die dazu dient, den Fisch zu erschlagen, und die in einer der ästhetischen Meditationen von Das wilde Denken vorkommt, bringen das Anderswo ins Haus. Auf dem Schreibtisch einige Steine, darunter ein Lapislazuli-Kubus, ein Dolch. Keine Pflanzen. Zwischen Kuriositätenkabinett und Künstleratelier ist das Büro ebenso wie seine visuelle und auditive Umgebung eine Hymne an die Schönheit, wo in der gedämpften Stille des Nachmittags alles miteinander in Beziehung treten, sich alles in der Utopie eines geschlossenen Orts vereinen kann, der eine Welt im Kleinen enthielte: die Bibliothek. Tatsächlich kann Lévi-Strauss, wenn er diesen Papiertempel betrachtet, um die Welt reisen, wie Xavier de Maistre in seiner Reise um mein Zimmer schrieb, ohne sein Büro zu verlassen: an der Wand zur Linken Afrika, Ozeanien und Asien; vor ihm die Periodika und Karteien; rechts Südamerika; hinter ihm in der Ecke Nordamerika, während der Rest der Wand den Enzyklopädien und Wörterbüchern vorbehalten ist, die er durch eine einzige Halbdrehung seines Rollsessels erreichen kann. »Meine Bibliothek war ein Wunderwerk«, wird er später sagen.2 In der Tat ist hier an den Wänden die ganze Welt vertreten, und jedes Werk steht an dem Platz, den die betreffende Population auf der Landkarte eingenommen hätte. Die geographische Anordnung (nach Kontinent) wird also weiterverfolgt, um zu einer Art Anamorphose zwischen der Landkarte und der Bibliothek zu gelangen – zwei homologe Darstellungen, die von der Fülle und dem Reichtum der Welt zeugen.
Die ausgeklügelte Anordnung dieser weltumspannenden Bibliothek darf ihren lebenswichtigen Charakter nicht vergessen machen: Die 12 000 Bücher, vor allem aber auch die vollständigen Jahrgänge internationaler Zeitschriften, besonders Man oder American Anthropologist, sowie die Tausende von Sonderdrucken versorgen ihren Besitzer mit dem für die wissenschaftliche Arbeit notwendigen Material. Keine Erkenntnis ohne die Kanäle, durch die diese regelmäßig auf Karteikarten übertragenen Daten übermittelt werden. Wie seine Zeitgenossen ist Lévi-Strauss ein großer Arbeiter der Karteikarte, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts für jede vergleichende Studie zu einem der unabdingbaren Werkzeuge geworden ist. Er besitzt einen Karteischrank, der in Zusammenfassungen alle Werke enthält, die er während der Kriegsjahre in der New York Public Library gelesen hat, das heißt mehrere tausend. »Ich kann sagen, dass mir zu einer bestimmten Zeit, in den 1940-1950er Jahren, nichts entging, was auf dem Gebiet der Ethnologie veröffentlicht wurde.«3 Um die Welt reisen und Kenntnisse sammeln: Lévi-Strauss' Bibliothek ist das Archiv einer gelehrten Praxis, für die noch der Anspruch auf Vollständigkeit gilt. Anfang der 1960er Jahre flogen ein paar Papageien frei in dieser Höhle des Wissens herum. Sie waren gerade aus Amazonien gekommen, mit Hilfe von Isac Chiva, Lévi-Strauss' Assistenten im Laboratoire d'anthopologie sociale am Collège de France, und komplizierter Kriegslisten am Rande der Legalität. Chiva weiß, dass sein Kollege und Freund die Tiere liebt, dass er in Gesellschaft von Affen gelebt hat, die er aus Brasilien mitgebracht hatte, dass, wenn es nach ihm ginge, Hunde, Katzen und alle möglichen Tierarten in seinem Büro Zuflucht finden und sein Arbeitszimmer in eine Menagerie verwandeln würden. Und genau das trifft leider ein: Die Papageien klauen ständig die Brille des Anthropologen und beschmutzen alles. Lévi-Strauss muss sich ihrer entledigen, ebenso wie seines Traums von einem menschlichen Leben, das nicht von der Welt der Tiere getrennt ist. Er wird in der Lage sein, dieses Hirngespinst wiederaufleben zu lassen: durch Eintauchen in die Welt der amerindianischen Mythen, in der Tiere und Menschen wiedererschaffen werden, die am selben Universum teilhaben.
Das Geheimnis Lévi-Strauss
Dieses studiolo der Renaissance, das Claude Lévi-Strauss' Büro ist, belehrt und erstaunt uns: Es »passt« nicht zu dem avantgardistischen Bild vom Pionier des Strukturalismus – dieser hochfliegenden Theorie, die häufig mit dem modernistischen Kontext der 1950er-1960er Jahre assoziiert wird und die darauf abzielt, die Voraussetzungen des symbolischen Denkens mit Hilfe einer neuen Kunst des Vergleichs zu rekonstruieren: Es ist nicht, wie man allzu oft meint, die Suche nach den Invarianten der Gesellschaften, sondern vielmehr die Suche nach ihren als Variationen aufgefassten Unterschieden, unter Bevorzugung der Beziehungen, die sie ineinander übergehen lassen. Der Strukturalismus, der sich ursprünglich in der Linguistik herausgebildet hat und sich nicht nur auf die Anthropologie, sondern auch auf verschiedene Räume des Wissens (Literaturkritik, Psychoanalyse, Geschichtswissenschaft …) bezieht, geht auch zurück auf den Sieg der Wissenschaft und speziell den der anthropologischen Disziplin, die dank Lévi-Strauss in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Eingang in den Pantheon der Sozialwissenschaften fand. Das sind die Grundzüge des Strukturalismus Lévi-Strauss'scher Prägung, dessen wesentliche Episoden sich, wie man überrascht entdeckt, im Arbeitszimmer eines Mannes der Renaissance abgespielt haben …
Wer also ist Claude Lévi-Strauss? Ein Kind des Jahrhunderts, 1908 in Brüssel geboren und hundertundein Jahr später, 2009, in Paris gestorben. Er wächst in einer israelitischen Familie auf, die den klassischen Weg des sozialen Aufstiegs à la française hinter sich hat, vom Elsass nach Paris. In dieser bürgerlichen, ganz im 19. Jahrhundert verankerten Welt entfaltet sich Claude als umhegtes Einzelkind, auf dem alle Hoffnungen einer zum Teil deklassierten Familie ruhen. Sein Vater ist Maler, ebenso zwei seiner Onkel. Wenn man sich nicht der Kunst hingibt, macht man Geschäfte. Eine herzliche, weitverzweigte, zusammengeschweißte, ihrem säkularisierten Judentum verhaftete und patriotische Verwandtschaft bevölkert seine Kindheit. Als sehr guter Schüler kommt er in die literarischen Vorbereitungsklassen des Lycée Condorcet, verzichtet jedoch darauf, sich auf die Aufnahmeprüfung zur École normale supérieure vorzubereiten, womit er die erste jener existentiellen Wendungen vollzieht, deren Geheimnis er alleine kennt. Er wird nun ein dilettierender Student, indem er ein doppeltes Studium in Jura und in Philosophie absolviert, das ihn 1931 zur agrégation führt. Vor allem aber ist er in jenen Jahren ein glühender aktiver Sozialist, der unter den Auspizien von Marx und der SFIO [Section française de l'Internationale ouvrière] die Welt verändern will. Im Gegensatz zu vielen seiner Kommilitonen, zum Beispiel dem Ehemann seiner Kusine, Paul Nizan, wird er nie Kommunist. Statt die Welt zu verändern, verlässt er 1935 die seine. Das Angebot, in Brasilien zu unterrichten, ermöglicht es ihm, die Indianer zu studieren, von denen man in Paris annimmt, sie bevölkerten die Umgebung von São Paulo … Diese existentielle und intellektuelle Abzweigung – er gibt die alte Philosophie für die junge Ethnologie auf – ist natürlich entscheidend: Mit ihr beginnt eine zweite Periode seines Lebens, in den neuen Welten, zuerst in Brasilien, dann während des Zweiten Weltkriegs in den Vereinigten Staaten.
Derartige biographische Fundamente heben Lévi-Strauss' Lebensweg in seinem Jahrhundert heraus. Welchen Platz soll man zum Beispiel der doppelten Abweichung dieser ersten Lebenshälfte zuweisen? Die erste besteht in einer Distanzierung vom ursprünglichen Judentum seiner Herkunft. In der Geschichte der Sozialwissenschaften ist Lévi-Strauss bei weitem nicht der einzige Intellektuelle, der mit der Synagoge bricht, doch wie verbinden sich in seinem Fall die Neubildung der Identität eines nichtjüdischen Juden mit der Neuheit seiner problematischen, theoretischen Formulierungen?4 Die zweite Abweichung ist jene, die ihn von Europa entfernt und dem alten Kontinent die neuen Welten – zuerst die brasilianische, dann die nordamerikanische – entgegensetzt, im Dreieck Europa-Südamerika-Nordamerika, in dem die strukturalistische Perspektive ihren wirklichen Ursprung hat. Der Werdegang dieses überaus französischen Intellektuellen, der nach seinem Tod als nationales Monument gewürdigt werden sollte, weist eine lange Periode gewollter oder erzwungener Expatriierung auf: Zwischen 1935 und 1947 lebt Lévi-Strauss fast ständig außerhalb Frankreichs. Von 1935 bis 1939 durchstreift er den Busch des brasilianischen Sertão, dann lebt er von 1941-1947 im Exil in New York als social scientist, bevor er zum ersten Kulturbeauftragten des befreiten Frankreichs in der 5th Avenue wird. Diese Sozialisierung ist außergewöhnlich unter den französischen Intellektuellen, die zur damaligen Zeit einem Habitus anhängen, der umso stubenhockerischer ist, als sie überzeugt sind, sich im Mittelpunkt der Welt zu befinden. Fest steht, dass dieser Cocktail aus alter und neuer Welt, klassischer französischer Philosophie, brasilianischer ethnologischer Erfahrung unter Einbeziehung der amerikanischen Anthropologie – die wiederum stark von deutschen Traditionen durchdrungen ist – dazu beigetragen hat, eine starke und einzigartige geistige Persönlichkeit herauszubilden.5
Die Rückkehr in die Alte Welt im Jahre 1947 läutet die Zeit des Schreibens eines Werks ein, das diese transatlantische biographische Geschichte verarbeitet. Es folgen mehrere Jahrzehnte intensiver Arbeit, in deren Verlauf Lévi-Strauss, nun in Paris ansässig, zahlreiche Niederlagen hinnehmen muss, bevor er 1959 feierlich am Collège de France inthronisiert wird. Einige Jahre zuvor, 1955, hat er in einer Geste der Befreiung innerhalb weniger Wochen mehr als 400 fiebrige, von seiner brasilianischen Odyssee besessene Seiten geschrieben: Traurige Tropen wird ein Klassiker des Denkens des 20. Jahrhunderts und macht seinen Autor bald in der ganzen Welt berühmt. In den 1960er Jahren rückt Lévi-Strauss, zu einer öffentlichen Figur der französischen Intelligentsia geworden, die strukturale Anthropologie in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen und politischen Debatten der damaligen Zeit, zwischen der Revision des Marxismus und dem Ende der Entkolonialisierung. Der strenge Gelehrte, mit dem Nimbus einer geheimnisvollen und stillen Persönlichkeit umgeben, ein leichtes Dandy-Gebaren kultivierend, sorgt bei den jungen Generationen, die hier ihr Amerika zu finden meinen, für eine wahre strukturalistische Kristallisation. An seiner Seite sind Roland Barthes, Michel Foucault, Louis Althusser und Jacques Lacan zu einem »strukturalistischen Bankett«6 versammelt. Die Human- und Sozialwissenschaften befinden sich auf dem Höhepunkt ihres Prestiges. Der von Jean-Paul Sartre verkörperten Philosophie wird von diesen Wissenschaften hart zugesetzt, sie wollen sie relativieren, wie Lévi-Strauss selbst es auf einigen Seiten am Ende von Das wilde Denken tut. Seine polemische Verve kontrastiert mit dem Bild, das sich allmählich durchsetzen sollte, dem eines kontemplativen Gelehrten und Ästheten, der allergisch ist gegen den globalen politischen Interventionismus und genüsslich seine kalkulierten Provokationen pflegt. Politisch schwer einzuordnen, sehen die linken Studenten nach 1968 in ihm einen unverbesserlichen Reaktionär. Wie um ihnen recht zu geben, tritt er 1973 in die Académie française ein.
Da ist er fünfundsechzig Jahre alt. Er sollte noch über fünfunddreißig Jahre leben. Diese Langlebigkeit erklärt die erstaunlichen Wandlungen in der Rezeption seines Werks. Während der Strukturalismus einem mehrere Jahrzehnte währenden Fegefeuer anheimfällt, entgeht die Person Lévi-Strauss dieser intellektuellen Abwertung. In den 1980er Jahren wird er zu einer Art Zen-Mönch der französischen Intelligentsia, die um all ihre großen Männer trauert – Raymond Aron, Roland Barthes, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault sterben zwischen 1980 und 1985. Nach und nach wird der alte Mann – dann der sehr alte Monsieur – zu einer nationalen Berühmtheit, zieht sich zurück und bekennt sich mehr und mehr zu seiner Ferne vom Jahrhundert. Doch seltsamerweise erlaubt ihm gerade diese Distanz, einen der schärfsten und subversivsten Blicke auf unsere trauernde Moderne zu werfen. Je älter Lévi-Strauss wird, desto aktueller wird er.
Die Perlen der Halskette
Der Plan zur Niederschrift dieser Biographie hängt stark mit der Öffnung von Claude Lévi-Strauss' persönlichem Archiv zusammen, das heißt 261 in der Abteilung der Manuskripte der Bibliothèque nationale de France hinterlegten Kästen, die das Kernstück dieses Buchs bilden, seinen Schatz – auch wenn noch andere Archive konsultiert wurden: die des Laboratoire d'anthropologie sociale des Collège de France, aber auch, in Brasilien, die zahlreichen Spuren, die die französische Universität in São Paulo und die ethnographischen Expeditionen im Mato Grosso hinterlassen haben; schließlich in New York alle Archive, die sich auf die französische Emigration in die Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs beziehen. Mit einem solchen Gewicht an neuen und häufig zum ersten Mal konsultierten Dokumenten beladen, grenzt sich das biographische Unterfangen vom autobiographischen Faden der Traurigen Tropen ab, indem es ihn in eine Geschichte einfügt, die seinen Status, seine Bedeutung und Tragweite zu erneuern hofft. Das Genre der Biographie hat seit langem vieles wiedergutzumachen. Pierre Bourdieu hat die Kritik der »biographischen Vernunft« am direktesten formuliert, ihre Illusionen der Kohärenz, ihre Tendenz, Lebenswege zu rationalisieren, »Berufungen« auszugraben, einen »Sinn« des Lebens zu konstruieren, was bald dazu führte, jedwedes Leben in einen Bildungsroman* zu verwandeln.7 Alle diese Klippen existieren. Doch wenn man sich auf neue Ego-Dokumente – Briefwechsel, Hefte, Memoiren, Karteikarten, Kalender, Vorbereitungen auf Vorlesungen und Manuskripte, Zeichnungen, Photographien usw. – bezieht, die geeignet sind, Zusammenhänge zu modellieren, die das Leben der Person begleitet haben, dann bleibt die biographische Untersuchung als leistungsfähige Erkenntnisweise in der Geistesgeschichte bestehen und drängt sich sogar auf.
Es ist sehr schwierig, sich den jungen Lévi-Strauss vorzustellen: Die Person ist vorzeitig in einem Ernst erstarrt, der als Los des Alters gilt. Sehr früh schien er alt zu sein. Nur die Frische des Briefwechsels mit seinen Eltern erinnert heute an den jungen Lehrer, der die Mädchen von Mont-de-Marsan, seinem ersten Posten, Philosophie lehrt. Denn für Lévi-Strauss' erste Lebenshälfte gibt es keinen Zeugen mehr, außer in Brasilien Antonio Candido de Mello e Souza, der eine große Gestalt der brasilianischen Intelligentsia geworden ist und sich noch an den bärtigen jungen Dozenten erinnert, der 1935 mit seiner Frau in São Paulo eintraf, um Soziologie zu lehren. Lévi-Strauss selbst sagte mir Anfang der 2000er Jahre, als ich ihn für eine frühere Arbeit nach seinen New Yorker Jahren fragte, vermutlich sei er der letzte Zeuge jener erstaunlichen Welt des französischen Exils in den Vereinigen Staaten während der Kriegsjahre.8 Wie einige Indianer, denen er begegnet ist, die letzten Zeugen einer verschwundenen Welt waren, die sie als Ganzes in ihrem Gedächtnis trugen, ist Lévi-Strauss auf seine Weise für die Welt von vor 1940 dieser letzte Zeuge geworden. Dagegen sind viele von denen, die das Abenteuer der französischen Anthropologie ab 1960 an seiner Seite erlebt haben, zum Glück noch am Leben. Soweit es mir möglich war, habe ich sie getroffen. Da ich keine Anthropologin bin, habe ich mich ihnen ohne die Bürde dieses beruflichen Über-Ichs vorgestellt. Und die Ethnologen haben mich ihrerseits mit dem Wohlwollen empfangen, das denen vorbehalten ist, die nicht zur Zunft gehören! Bei Gelegenheit dieser Begegnungen habe ich die außergewöhnliche professionelle Aura ermessen können, die den Namen von Lévi-Strauss umgibt und die sich nicht ganz mit seiner intellektuellen Berühmtheit deckt. Anhand Tausender Details brachte die Erinnerung meine Gesprächspartner immer wieder zu dem besonderen Menschen zurück, der er war, und zu dem einschüchternden Schatten, den er auf die gesamte Disziplin wirft.
Und doch hat das Subjekt dieser Biographie, Claude Lévi-Strauss, häufig zum Ausdruck gebracht, welch geringe individuelle Identität er sich zugestand und welch geringe Achtung er dem »Individuum« der westlichen Moderne letztlich entgegenbrachte, diesem Gegenstand aller Sorgen und aller Hoffnung der Philosophie, der von dem Anthropologen und von einem Teil seiner Zeitgenossen wie Michel Foucault dazu bestimmt wurde, zu Staub zu zerfallen, von der Bühne zu verschwinden. »Gehen Sie weiter, es gibt nichts (mehr) zu sehen!« Hier ist das Individuum also weniger eine Entität an sich als vielmehr die Gelegenheit, die Dinge auf mikrohistorischer Ebene zu beobachten; kein vorgängiges Substrat, sondern ein Maßstab für den Blick. Wie der Photograph in Antonionis Film Blow up durch die Vergrößerung einer Reihe von Aufnahmen die Anfänge einer anderen Geschichte entdeckt, so wünschte ich, dadurch dass ich für den Fall Lévi-Strauss die Brennweite vergrößerte, ein anderes Bild der Geschichte der wissenschaftlichen und künstlerischen Szene des 20. Jahrhunderts sichtbar werden zu lassen, zu der der Anthropologe einen wunderbaren Kontrapunkt bildet.9 Hierin hoffe ich, ihn nicht zu verraten. Und tatsächlich würde ich gern eine Art japanische Biographie zustande bringen, mit Bezug auf jene »zentripetale« Philosophie des Subjekts, die Lévi-Strauss in Japan zu erkennen glaubte: »[es] geht alles so vor sich, als konstruierte der Japaner sein Ich von außen her. So erscheint das japanische ›Ich‹ nicht als ursprüngliche Gegebenheit, sondern als Resultat, das man anstrebt, ohne sicher zu sein, es zu erreichen.«10
Eingebettet in die Genealogie einer Familie und einer Disziplin, will diese biographische Untersuchung keinesfalls der Tempel eines Demiurgen sein. Alles in allem gibt es ein Werk, das als meisterhaft anerkannt ist. Darin zeigt sich das Subjekt Lévi-Strauss, jedoch erst am Ende des Wegs: als die Summe der Erfahrungen, Reisen, Lektüren in vielfachen Kontexten, die aufs Lebhafteste mit der Geschichte des Jahrhunderts zusammenhängen. Denn es ist reizvoll, festzustellen, wie sehr dieser zur Zeit des Engagements vom geistigen Leben große »Degagierte« von der Geschichte herumgestoßen wurde, besonders im Augenblick des Zweiten Weltkriegs, als der im Vichy-Frankreich herrschende Antisemitismus ihn wie viele andere zwang, den Weg des Exils einzuschlagen.
Lévi-Strauss selbst trägt im Übrigen seinen Teil zur Verteidigung und Veranschaulichung des Genres der Biographie in der Anthropologie bei. Seit den 1940er Jahren sind in den Vereinigen Staaten zahlreiche »Eingeborenenbiographien« erschienen, im Allgemeinen vom Ethnologen zusammen mit seinem bevorzugten Informanten, oft einem zum Teil »zivilisierten« Indianer, geschrieben. So hatte der Ethnologe Leo Simmons den Hopi-Indianer Don Talayesva darum gebeten, einen Bericht seines Lebens zu schreiben, eines zwischen zwei Welten zerrissenen Lebens, von einer geistigen Krise erschüttert, die ihn in sein Geburtsdorf zurückführte, wo er zum »sorgsamen Hüter der alten Bräuche und Riten« wurde.11 In seinem Vorwort zu diesem Text rühmt Lévi-Strauss leidenschaftlich den Wechsel des Maßstabs: »Das Besondere darin ist aber, daß dem Bericht des Talayesva von vornherein etwas gelingt – und dies mit unvergleichlicher Ungezwungenheit und Anmut –, wovon der Ethnologe zeitlebens nur träumen kann und was ihm nie vollständig gelingt: die Rekonstruktion einer Kultur ›von innen heraus‹, das heißt so, wie das Kind und dann der Erwachsene sie erleben. So als würden wir, die Archäologen der Gegenwart, die durcheinandergeworfenen Perlen einer Halskette ausgraben und uns wäre plötzlich die Fähigkeit gegeben, sie in ihrer ursprünglichen Anordnung aufgereiht und sanft bewegt an dem jugendlichen Hals zu entdecken, zu dessen Zier sie ursprünglich bestimmt waren.«12 Die Metapher der Perlenhalskette drückt die unverkennbar erotische Erregung aus, die das Versprechen des »gelehrten Traums« hervorruft, des Traums von Lévi-Strauss13: die Beschreibung eines sozialen Systems mit der Art und Weise zu versöhnen, wie es in jedem seiner Mitglieder vielfach gebrochen und verinnerlicht erscheint, und die gelehrte Objektivität in den Subjektivitäten der Eingeborenen zu resorbieren – ohne einer von ihnen den Vorzug zu geben. Die Biographie wäre also der Ort, an dem die Verbindungen zwischen Zwängen und Freiheiten, zwischen sozialen Determinationen und individuellen Positionierungen der Akteure, zwischen dem Auftauchen eines zweifellos »genialen« Denkens, aber auch dem kollektiven Sockel seiner Entstehung in ihrer zarten und verflochtenen Textur erscheinen können, nach dem Bild der indianischen Körbe, die Lévi-Strauss in seinen Expeditionsheften gern skizzierte.
Ethnographisches Wissen und ethnologische Disziplin: der Andere als Objekt
Claude Lévi-Strauss' Biographie ist die Geschichte eines Individuums, aber auch die einer wissenschaftlichen Disziplin mit riesigen Ambitionen, denn sie will den ganzen Menschen erfassen. Ihr Name variiert je nach den nationalen Traditionen: In Frankreich wird Lévi-Strauss dazu beitragen, den Terminus »Anthropologie« durchzusetzen, aber auch der Terminus »Ethnologie« ist weiterhin üblich.
Ethnologen und Anthropologen des 20. Jahrhunderts sind die Erben eines großen Feldes ethnographischer Neugier, die sich seit der Renaissance auf unterschiedliche Schauplätze erstreckt, handle es sich nun um die räumliche Erkundung exotischer Welten, um die soziale Erkundung des Anderswo bei sich zu Hause oder auch um das messianische Interesse der religiösen Orden, Heiden zu Christen zu bekehren. Seit Forschungsreisen möglich sind, lagen Unternehmungen, die den Anderen zum Gegenstand haben, alle möglichen ethnographischen Regungen zugrunde. Auch wenn man im Allgemeinen annimmt, dass sich die Ethnologie als Wissenschaft ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit den Arbeiten von Henry Morgan und Edward Tylor im angelsächsischen Raum sowie von Durkheim und Mauss in Frankreich herausbildete, so bleibt sie doch lange Zeit mit dem gelehrten System der curiositas verbunden, dem ungewöhnlichen, verblüffenden Ding, das das erworbene Wissen erschüttert und hinterfragt.14 Daher die berühmten Kuriositätenkabinette, die im klassischen Zeitalter die libido sciendi des gesamten gelehrten Europas beherbergten.
Zu sagen, auch Claude Lévi-Strauss' Arbeitszimmer ähnele einem Kuriositätenkabinett, heißt einzuräumen, dass bei ihm ebenso wie in der Ethnologie, die er verkörpert, mehrere Systeme gelehrter Zeitlichkeit nebeneinander bestehen: die Neugier, aber auch die Forderung nach Genauigkeit, die Ordnung des Maßes, das ethnographische Sammeln von »Tatsachen«, die regionale Synthese des ethnologischen Niveaus und schließlich das letzte Stadium der Verallgemeinerung, das die Regeln der Verwandtschaft oder der Mythen sein können, die den Gesetzen der Newton'schen Physik gleichen: Ebendies nennt Lévi-Strauss Anthropologie, womit er für sich den angelsächsischen Terminus übernimmt.15
Mehr als das »exemplarische Leben« eines Theoretikers, der die harte Wissenschaft in die soziale Welt exportiert, muss man im Gegenteil, wie ich glaube, in Lévi-Strauss den Ort zahlreicher und zuweilen widersprüchlicher Spannungen zwischen unterschiedlichen Praktiken der Wissenschaft erkennen und in seiner Biographie eine Art Archäologie einer Disziplin unter freiem Himmel sehen, ausgehend von ihrem berühmtesten Vertreter. Denn einerseits fügt sich Lévi-Strauss in die Methode der Forschung ein, die einen distanzierten Blick von außen auf die anderen wirft, so wie Herodot sie erfunden hat; er zeigt, inwiefern die strukturale Anthropologie auf der kontrastiven Beschreibung und der Untersuchung der differentiellen Abweichungen beruht. Doch andererseits ist seine Anthropologie mit Affekten, Träumen und Alpträumen umgeben, die ihn zu einem anderen Forschungsprojekt führen, demjenigen, das Daniel Fabre das »Paradigma der Letzten« nennt.16 Es ist die Idee (das Phantasma?), die er auf seiner Brasilienreise häufig äußerte, der zufolge der Ethnologe dem »letzten« Indianer gegenübersteht, dem potentiellen Informanten über eine ganze Welt, aber auch dem Endergebnis einer apokalyptischen Geschichte, deren Tragödie Traurige Tropen zum Ausdruck bringt und gleichsam die Verantwortung dafür übernimmt.
Auf der einen Seite das Laboratorium, das Lévi-Strauss als neuen Ort einer »Wissenschaftsfabrik« für die Ethnologie einrichtet, als er 1960 das Laboratoire d'anthropologie sociale am Collège de France gründet; auf der anderen sein Arbeitszimmer, die Höhle des humanistischen Denkers, wo sich der Anthropologe über die Jahrhunderte hinweg mit Montesquieu, Rousseau und Chateaubriand, der Anthropologie der Aufklärung unterhält, und, mehr noch, rückblickend über zwei Jahrhunderte Entdeckungen hinweg, mit dem Forschungsreisenden Jean de Léry, einem der ersten Entdecker der brasilianischen Küste, dessen frischer Blick nur dem Montaignes gleichkommt, dem Gefährten der letzten Jahrzehnte seines Lebens. Schon zu oft wurde auf die Modernität des intellektuellen Projekts von Claude Lévi-Strauss hingewiesen, um hier nicht auch die Archaismen seines Vorgehens hervorzuheben, da er alles erfassen will und in ihm verschiedene Schichten des Wissens der klassischen abendländischen Moderne aufeinanderprallen.
Die Struktur einer Existenz und eines Werks
Lévi-Strauss verband eine lebenslange Freundschaft mit dem Linguisten Roman Jakobson. Kurz nach dessen Tod im Oktober 1982 schreibt der Anthropologe: »Denn was meinen wir, wenn wir von einem ›großen Mann‹ sprechen? Gewiss nicht nur eine einzigartige und fesselnde Persönlichkeit; ebenso wenig den Autor eines beträchtlichen Werks, das man aber nur mühsam mit der Persönlichkeit seines Schöpfers in Verbindung bringt. Was allen, die Roman Jakobson nahekamen, als Erstes auffiel, war im Gegenteil die erstaunliche Verwandtschaft zwischen dem Menschen und seinem Werk«17: »Vitalität, überwältigende Großzügigkeit und demonstrative Kraft, schließlich ein mitreißender Schwung gingen sowohl von dem Menschen wie von dem Werk aus«, fährt Lévi-Strauss fort. Diese »erstaunliche Verwandtschaft« zwischen dem Menschen und dem Werk gilt ebenso für den Fall Lévi-Strauss, und sie wird verstärkt und bestätigt durch eine Homologie zum Gegenstand des Werks selbst oder vielmehr zu seinem ethnologischen Unterbau: den Amerindianern, die dank der Ethnologie mit ihren Lippenpflöcken, ihrer Sanftmut und ihrer Not gleich einer Reue und einer Hoffnung in die Legende des Jahrhunderts eingegangen sind. Am Ende des Wegs hat Lévi-Strauss die tiefe Inspiration des mythischen Materials definiert, das er in seinen Mythologica bearbeitete, und skizziert, was in Lévi-Strauss' Teppich ein Muster bildet: einen Dualismus, der jedoch zwei Teile in einer immerwährenden Schaukelbewegung, die für die Indianer das Universum in Bewegung setzt, einander gegenüberstellt.
Diese unausgewogene Zweiteilung ist auch die bevorzugte Form seines geistigen Motors und Grundlage seiner Persönlichkeit: zwischen der Aufmerksamkeit für das Detail, der strengen Empirie, dem Geist botanischer Beobachtung und der starken theoretischen Energie, den fiebrigen Aufschwüngen ins Allgemeine und den gewagten Hypothesen; zwischen der buddhistisch inspirierten Weisheit, der Abkehr von der Welt, der kontemplativen Epiphanie der Natur, dem Glück der Selbstauflösung und dem Handeln in der Welt, der sozialistischen Jugend, der Gründung von Institutionen und den beruflichen Verantwortlichkeiten; zwischen dem Wunsch nach Privatsphäre und ihrer Ablehnung; zwischen bedingungsloser Abstraktion und bebender Sensibilität; zwischen dem Wunsch nach sinnstiftender Ordnung und der metaphysischen Intuition des Unsinns; zwischen der Suche nach Universalität und der Logik der Unterschiede; zwischen der Wissenschaft und der Kunst. Dieser letztere Gegensatz hat viele Kommentare hervorgerufen, besonders als Claude Lévi-Strauss in die Académie française eintrat, dank einem gelehrten Werk, dem man literarisches Talent zwar zugestand, aber nicht so recht wusste, ob dies ein Plus oder ein Minus war. In einem jüngeren Essay hält Patrick Wilcken es für originell, in Lévi-Strauss einen »artiste manqué« (französisch im Text), einen Beinahe-Künstler zu sehen, welcher der akademischen Sphäre ebendie künstlerische Sensibilität eingegeben habe, die er sich bewahrte, seit er in der Adoleszenz, mangels Talent, beruflich nicht die Künste wählte.18 Damit verkennt man die Wirkkraft dieses unausgewogenen Dualismus und begreift nicht, dass Lévi-Strauss mit dieser Spannung zwischen Kunst und Wissenschaft Wiederentdeckungen im Auge hatte, die zum alten System der schönen Künste gehörten, in dem sich die Vorzüglichkeit eines Wissens nicht von der Kunst unterschied, mit der man es darlegte. Ist Buffon nicht mit einer Abhandlung über den Stil in die Académie française eingetreten?19
Mit einem Vogel sprechen
Affektiv und von Hause aus im 19. Jahrhundert verwurzelt, verdrossener Zeitgenosse des langen 20. Jahrhunderts, beschäftigt sich der Anthropologe genussvoll mit den Chroniken der Reisenden des 16. Jahrhunderts, mit der Frische einer Renaissance, die sich, zumindest ihre besten Teile, vom Anblick des Primitiven aufrütteln lässt; gleichzeitig ist er an den wissenschaftlichen Fortschritten seiner Zeit beteiligt und verfolgt sie mit Leidenschaft. Dennoch zögert er nicht, auf regressive Wege hinzuweisen und sogar privat eine »Rückkehr ins Neolithikum« zu empfehlen! In seiner Art, Wissenschaft zu treiben, in den Mäandern seiner Biographie, aber auch in seiner Geschichtsphilosophie – sofern es sie gibt – oder in seiner politischen und ideologischen Positionierung komponiert Claude Lévi-Strauss eine einzigartige Partitur aus »Surmoderne« – so wie sein Freund André Breton die Surrealität anstrebte – und Archaismus in einer Negierung der modernen Aufspaltung in ihre verschiedenen Formen (Rationalität gegen Obskurantismus, Wissenschaft gegen mythisches Denken, Evolutionismus gegen zyklische Zeit, Fortschritt gegen Stabilität usw.). Seine Zeit, wie die dieser Biographie, schreitet in der Dauer voran, jedoch gleich einer Spirale durch wuchernde Wiederholungen von Fetzen der Vergangenheit – »da unser Leben ja so wenig chronologisch verläuft«20 –, wo das sehr Alte näher erscheinen kann als die sehr junge Vergangenheit. Und auch sein Werk »hat eine der Vergangenheit der Disziplin zugewandte Seite und krönt sie, und eine andere der Zukunft zugewandte, die es vorwegnimmt«.21
Insofern scheint mir der Neubegründer der Anthropologie in unserem kopflosen und gebeutelten 21. Jahrhundert, das mit technologischen Revolutionen kämpft, die es nicht beherrscht, heute von neuer Aktualität. Lévi-Strauss ist ein Weltmann aufgrund des vagabundierenden Wegs der ersten Hälfte seines Daseins; ein Zeitmensch aufgrund seines sehr langen kontrastreichen Lebens und vor allem aufgrund dessen, was er seinen »Donquichottismus« nennt, das heißt das »quälende Verlangen, hinter der Gegenwart der Vergangenheit wiederzubegegnen«.22 Diese mannigfachen Zeiten, die nebeneinander in ihm existieren, befinden sich, ebenso wie die Vielfalt der durchquerten Räume, inmitten seiner so besonderen philosophischen und existentiellen »Dezentrierung«: Niemand vor ihm hatte die tiefgreifende Infragestellung unseres historischen Weges und seiner Sackgassen so weit getrieben. Auch wenn der Anthropologe keinerlei Rezept und keinerlei Programm liefert, ermahnt er uns, die kulturelle, natürliche, soziale Vielfalt als ein kostbares Gut zu betrachten und zu bewahren, das auf die Zufälligkeit unseres eigenen Systems hinweist. Schon 1976 bewies er erstaunliche politische Phantasie, als er vorschlug, nach dem Beispiel der exotischen Gesellschaften, die auch die Nichtmenschen zu integrieren verstanden, die Definition der »Rechte des Menschen« durch die der »Rechte des Lebenden« zu ersetzen23: der Mensch als Lebewesen und nicht mehr als moralisches Wesen, an der Seite der Tiere, der Pflanzen, der Mineralien, der Dinge, statt diese auszuschließen. Lévi-Strauss' Denken zeigt uns einen wahrhaft versöhnten, unserem Anthropozän gemäßen Humanismus.
Also mit einem Vogel sprechen: Der Denker, den man häufig auf den Denker des unverbrüchlichen Gegensatzes zwischen Natur und Kultur reduzierte, hat sich im Laufe seines Weges weiterentwickelt, um in seinem Leben wie in seinem Werk die Lektion der Einbeziehung der amerindianischen Mythen zu erfahren, die, erinnern wir uns, für den Ethnologen, aber auch für die Indianer selbst Geschichten aus einer Zeit sind, in der die Menschen und die Tiere einander verstanden …
IDIE HINTERWELTEN(…-1935)
1DER NAME DES VATERS
»Doch solange ein großer Name nicht erloschen ist, wirft er sein volles Licht weiterhin auf alle, die ihn trugen; und bestimmt beruht zum Teil das Interesse, das in meinen Augen die Berühmtheit dieser Familien besaß, darauf, daß man vom heutigen Tag ausgehend sie schrittweise bis weit über das vierzehnte Jahrhundert hinaus zurückverfolgen und Memoiren und Korrespondenzen aller Vorfahren von Monsieur de Charlus, dem Fürsten von Agrigent, der Prinzessin von Parma in seiner Vergangenheit wiederfinden kann, in der undurchdringliches Dunkel die Ursprünge einer bürgerlichen Familie bedecken würde, in der wir aber unter dem rückwirkenden Scheinwerferlicht eines Namens den Ursprung und das Fortbestehen gewisser charakteristischer Eigenschaften des Nervensystems, gewisser Laster und Verirrungen der oder jener Guermantes zu unterscheiden vermögen.«
Marcel ProustGuermantes.1
Die Hinterwelt: eine Gesamtheit von Berichten, Erinnerungen, Bildern, Gerüchen, Träumen, Abneigungen, Befürchtungen, Körper- und Geisteshaltungen, Seins- und Denkweisen, die man am Tag seiner Geburt zusammen mit seinem Namen erbt. Ein dunkles oder helles Land, eine nährende oder drückende Erde aus Familienlegenden, die durch das soziale Gedächtnis und die nationale Geschichte gefiltert werden und von denen man sich später vielleicht gern freimachen würde, die vorerst aber der Bereich des Privaten schlechthin sind.
Die Geschichte von Claude Lévi-Strauss, am 28. November 1908 in Brüssel geboren, beginnt also nicht erst an diesem Tag. So wie er gesteht, Sehnsucht nach Epochen zu haben, die er nicht gekannt hat, ebenso ist er, wie jedermann, angefüllt mit einer Geschichte, die er zwar nicht erlebt, aber in sich aufgenommen hat. Diese Geschichte wird ihm in Form eines Doppelnamens geboten, der aus der Verbindung eines sozialen Schicksals und eines individuellen Schicksals entstanden ist: eine jüdisch-elsässische Hinterwelt, erleuchtet vom Erfolg eines ihrer Mitglieder, Isaac Strauss, des Urgroßvaters von Claude, dessen Vater sich den Namen »Strauss« angeeignet hat, um ihn dem seinen, »Lévi«, anzuhängen. Es ist ein jüdischer, genauer ein israelitischer Name, der die Gewissheit der künstlerischen Berufung der Sippe in sich birgt. Auch ein unbeständiger Name, der sich spät festgesetzt hat und in seiner patronymischen Fragilität die Höhen und Tiefen des modernen französischen Judentums zum Ausdruck bringt. Ein Name, den es also im eigentlichen wie im übertragenen Sinn zurückzuerobern galt. Einige historische Zickzackwege sollen die logische Allmacht dieses Namens nachzeichnen, zwischen den Grundstrichen und den Haarstrichen des Lebens, seinen Legenden und seinem Schweigen.
Der Lichthof des Namens
»Mit dem Namen, den Sie tragen!«
Die Episode geht auf den September 1940 zurück: Niederlage, Demobilisierung in Montpellier. Claude Lévi-Strauss, Philosophielehrer, war für das neue Schuljahr an das Lycée Henri-IV in Paris berufen worden. In der Südzone einquartiert, begibt er sich deshalb nach Vichy, um die Genehmigung zu erhalten, in die Hauptstadt zurückzukehren und dort seine Stelle anzutreten: »Das Ministerium war in einer Gemeindeschule untergebracht, und die Leitung der Sekundarstufe befand sich in einem Klassenraum: Der Verantwortliche sah mich verblüfft an: ›Mit dem Namen, den Sie tragen‹, sagte er, ›wollen Sie nach Paris fahren? Das ist doch nicht Ihr Ernst?‹ Erst in diesem Augenblick begann ich zu begreifen.«2 Wie häufig bei Lévi-Strauss ist dieser Augenblick des Begreifens ein Augenblick des Stillstands und des Umschwenkens. Eines biographischen Umschwenkens (wie bei Tausenden als Juden geborenen Franzosen), aber auch eines intellektuellen Umschwenkens, das ihn von einer Art historischer Naivität zur Bewusstwerdung des von nun an stigmatisierenden Charakters seines Namens führt. Eines gefährlichen Namens, der wie alle Namen klassifiziert und erfasst, aber in einer Situation polizeilicher Personenkontrolle auch verrät. Die Ironie der Geschichte will, dass die neue Wahrnehmung seines Namens, verursacht durch das Entsetzen des Beamten, für Lévi-Strauss in Vichy erfolgt, der Stadt des einstigen Familienruhms, wo der Urgroßvater Isaac Strauss im Jahre 1861 Napoleon III. persönlich empfangen hatte, in seiner Villa Strauss, die inzwischen in eine Niederlassung der Vichy-Verwaltung umgewandelt war.
Kaum ein Jahr später hat Claude Lévi-Strauss Frankreich verlassen und ist in die Vereinigten Staaten emigriert. In New York wird er von der neuen Institution empfangen, in der er in den folgenden Jahren unterrichten wird, nicht ohne dass man ihn auffordert, seinen Namen in »Claude L. Strauss« abzuändern. Warum? »The students would find it funny«3, lautet die Antwort, wegen der blue-jeans! So ist das mit den Missgeschicken des Namens, fragilen graphischen Spuren historischer und biographischer, manchmal tragischer, manchmal grotesker, aber immer bedeutsamer Abenteuer: Der Name, sein Klang, sein homonymes Potential können einen im Europa des Kriegs ins Konzentrationslager bringen oder, weniger tragisch, zu einer Verwirrung führen, die das Selbstbewusstsein des werdenden Intellektuellen auf eine harte Probe stellt: »Lévi-Strauss, the pants or the books?« ist ein Refrain seines amerikanischen Nachkriegslebens.4
Vernünftigerweise darf man annehmen, dass diese Erfahrung des Stigmas und der onomastischen Verstümmelung Claude Lévi-Strauss besonders empfänglich machten für die Frage und, besser gesagt, für das Problem des Namens. In Kapitel VI von Das wilde Denken befasst er sich mit der letzten Ebene der Individuation, der Zuweisung eines Eigennamens. Anders als manche Anthropologen, die ihn für unwichtig hielten, postuliert die Lévi-Strauss'sche Theorie, dass der Eigenname einen Sinn hat. Ob der Name nun ein klares Identifikationszeichen trägt, das die Zugehörigkeit eines Individuums zu einer bestimmten sozialen Gruppe, einem Clan, einer Kaste bestätigt, oder ob er eine freie Schöpfung desjenigen ist, der benennt, in beiden Fällen geht es darum, zu klassifizieren (entweder die anderen oder sich selbst) und folglich zu bezeichnen.5 Zum Beispiel die Wahl des Namens seines Hundes: »Ich kann natürlich meinen, daß es mir freisteht, meinen Hund nach Gutdünken zu benennen; doch wenn ich Médor wähle, stufe ich mich als banal ein; wähle ich Monsieur oder Lucien, so stufe ich mich als Original oder als Provokateur ein; und wähle ich Pelleas, als Ästheten.«6 Im zeitgenössischen ethnologischen Bereich stellt Lévi-Strauss also eine Theorie auf, in der sich die klassifikatorische Dynamik bis auf die elementarste Ebene erstreckt, die des Individuums, das einen ihm eigenen Namen trägt.
»Claude Lévi, genannt Claude Lévi-Strauss«
Bei der anthropologischen Frage des Namens geht es also immer um die Zuweisung eines Platzes in der Taxonomie der Welt. Diese Logik des Namens kann auch Anlass zu einem positiven Akt der Wiederaneignung sein, zum Beispiel bei den Namensänderungen durch die postrevolutionäre Verwaltung, die, wenn auch in sehr geringem Maße, denkbar geworden sind. In Frankreich »ist es für einen französischen Staatsbürger keine leichte Sache, offiziell seinen Namen zu ändern«.7 Man braucht Geduld und stichhaltige Gründe. Das Gesetz vom 11. Germinal des Jahres XI (1803) hat für das Prinzip der Unabänderlichkeit des Namens eine Ausnahmeregelung vorgesehen, doch die Entscheidung liegt bei einer »freiwilligen Gerichtsbarkeit und stellt eine reine Gunst dar, die die Behörde stets nach Gutdünken verweigern kann«.8 Das Verfahren ist langwierig, denn der erwachsene Kandidat, der seinen Namen zu ändern wünscht, muss eine Mitteilung in den Journal officiel einrücken, die (auf seine Kosten) seinen Wunsch zusammenfasst, und dann beim Justizministerium ein Gesuch einreichen, in dem er die Gründe für die Preisgabe des ursprünglichen und die Annahme des neuen Namens erläutert, unter Vorlage einer Notorietätsurkunde, von Geburtsurkunden seiner Vorfahren sowie Kopien von Unterlagen, die seine Identität und seine Staatsangehörigkeit nachweisen. Diese lange Prozedur hat Claude Lévi-Strauss auf sich genommen, wie sein persönliches Archiv bezeugt.
Die Sache ist kurios und wenig bekannt9: Im Laufe der 1950er Jahre weigert sich die Administration anscheinend, den üblich gewordenen, in Wirklichkeit aber offiziösen Namen von Claude Lévi-Strauss, der durch die Anfügung des Namens »Strauss« an den von »Lévi« durch seinen Vater Raymond entstanden war, offiziell zu bestätigen. Die einstige patronymische Laxheit ist nicht mehr die Regel; was als Pseudonym betrachtet wurde, wird nicht mehr akzeptiert, daher die vielen administrativen Schwierigkeiten, die mit der Geburt von Lévi-Strauss' zweitem Sohn, Matthieu, im Jahre 1957 noch zunahmen. Auf Bitten seiner Frau Monique und mit Hilfe einer Anwältin, Suzanne Blum, beantragt deshalb »Gustave Claude Lévi, genannt Lévi-Strauss, Professor am Collège de France«, am 24. Oktober 1960 beim Justizminister in seinem Namen und dem seiner Kinder, Laurent Jacquemin, geboren am 16. März 1947 in New York (im Konsulat unter dem Namen »Lévi-Strauss« registriert), und Matthieu Raymond, geboren am 25. August 1957 in Paris (unter dem Namen »Lévi« registriert), offiziell die Genehmigung, seinem Familiennamen den Namen »Strauss« anzufügen.
Drei Argumente werden geltend gemacht: Erstens hat sein Vater, geboren 1881 in Paris, ständig den Namen Lévi-Strauss getragen, wie es zahlreiche von ihm selbst signierte Porträts bezeugen, die Tristan Bernard, Victor Margueritte, Louis Jouvet gehören …, sowie offizielle Papiere im Besitz von Berufsverbänden (zum Beispiel der Fédération des artistes). Zweitens wünschte »mein Vater, als er den Namen Lévi-Strauss annahm, dass in unserer Familie der Name seines Großvaters mütterlicherseits weiterlebte, Isaac Strauss, geboren am 2. Juni 1806 in Straßburg«, Geiger, Dirigent und berühmter Walzerkomponist. Schließlich erklärt der Professor am Collège de France nachweislich, dass seine administrative und wissenschaftliche Karriere unter dem Namen Lévi-Strauss verlaufen ist: »Ich füge hinzu, das alle meine literarischen und wissenschaftlichen Werke, das heißt fünf Bücher (darunter die in neun Sprachen übersetzten Traurigen Tropen) und 150 Aufsätze, unter dem Namen Lévi-Strauss erschienen sind, von dem ich ohne Anmaßung glaube sagen zu dürfen, dass sie dem Ansehen der Wissenschaft und dem französischen Denken in der Welt nicht geschadet haben […]. Schließlich hat die Aufnahme, die die wissenschaftliche Welt meinen Arbeiten zuteilwerden ließ, Arbeiten, die unter einem Namen erschienen, mit dem inzwischen bestimmte Theorien und bestimmte Entdeckungen verbunden sind, diesem Namen unabhängig von der Person seines Trägers eine öffentliche Existenz verliehen. Der Name Lévi-Strauss ist zum Bestandteil der wissenschaftlichen Disziplin geworden, der ich mein Leben gewidmet habe, und selbst wenn es nötig wäre, stünde es mir nicht mehr frei, ihn abzulegen.« Davon unterrichtet, dass die Rechtsprechung des Obersten Verwaltungsgerichts Doppelnamen ebenso ablehnend gegenüberstehe wie fremdländisch klingenden Namen, baut Lévi-Strauss diesem Einwand vor und fügt am Ende seines Antrags einen Absatz hinzu: »Der fremdländische Klang des Namens Strauss könnte ein zweites Argument gegen mein Ersuchen sein. Deshalb weise ich darauf hin, dass dieser Name von meinen Ururgroßvater Loeb Israël, geboren am 22. Januar 1754 in Straßburg, angenommen wurde, der sich Ende des 18. Jahrhunderts den Namen Léon Strauss zulegte, als er seine Söhne Maurice und Isaac, geboren 1801 und 1806, unter diesem Namen eintragen ließ. Ein Name, der seit fast zwei Jahrhunderten von einer alteingesessenen elsässischen Familie getragen wird, gehört meines Erachtens zum onomastischen Erbe der Nation.«10 Die Sache wird 1960 bearbeitet und der positive Bescheid des Obersten Verwaltungsgerichts am 24. August 1961 im Journal officiel bekanntgegeben. Alle offiziellen Urkunden werden berichtigt.
Diese Geschichte einer administrativen Schikane wäre lediglich burlesk, fiele sie nicht mit der Geschichte der französischen Familien am Ende des Kriegs zusammen. Im folgenden Jahrzehnt machten manche von dem ihnen in einem günstigen juristischen Kontext gewährten Recht Gebrauch, ihren Familiennamen zu ändern. Weisen wir außerdem darauf hin, dass die meisten Juden, die ihren Namen änderten, ehemalige Juden aus Mittel- und Osteuropa waren, die in der Zwischenkriegszeit nach Frankreich gekommen waren, fremdländisch klingende Namen trugen und den Wunsch hatten, das Trauma des Kriegs auszulöschen und gleichzeitig der eventuellen Wiederkehr schlimmer Zeiten vorzubeugen. Nur wenige israelitische Familien versuchten es. Im Fall von Lévi-Strauss lässt sich seine Geste mit den erwähnten trivialen Gründen erklären, die wichtig sind (wiederholte kleine bürokratische Demütigungen), vor allem aber zeugt sie von seiner Verwirrung über das Verbot, offiziell einen Namen zu tragen, der zu seinem Wesen gehörte. Tiefgreifender unterrichtet sie uns von der entscheidenden Rolle, die die Familiengeschichte, und besonders die herausragende Rolle von Isaac Strauss, bei der Identitätsbildung von Claude Lévi, »genannt Lévi-Strauss«, spielt. Zweifellos geht es hier nicht darum, sein Judentum zu verdunkeln oder es einzufordern, sondern vielmehr darum, sich in eine angesehene Genealogie des französischen Judentums einzureihen. Vergessen wir nicht, dass er zu jener Zeit fünfzig Jahre alt und Professor am Collège de France ist. Die Entschiedenheit der letzten Zeilen, die leichte Verärgerung und der bebende Stolz auf sein Werk deuten überdies darauf hin, dass er diese Prozedur als eine Form von Negierung der Staatsangehörigkeit empfindet (zumal von ihm verlangt wird, eine Urkunde über seine Staatsangehörigkeit vorzulegen).
Bei dieser merkwürdigen Affäre einer Namensänderung geraten Identifizierung und Abstammung in dem Augenblick durcheinander, als sich Claude Lévi-Strauss bereits »einen Namen gemacht« hat und das Licht des Namens seines Urgroßvaters Isaac Strauss weithin strahlt. Dieser Name, der ihm, wie er sagt, nicht mehr gehört, reiht ihn indes in eine jahrhundertealte Geschichte der Emanzipation und Akkulturation der elsässischen Juden ein, die das ganze 19. Jahrhundert hindurch exemplarische französische Staatsbürger geworden sind.
Eine Genealogie
Aus dem von Claude Lévi-Strauss aufbewahrten Familienarchiv – Geburtsurkunden, Eheverträge, Briefwechsel, Stammbäume, Erbscheine, Pässe, Briefe – geht eine ganze Welt hervor, die Ende des 18. Jahrhunderts im Elsass lebt, außerhalb der großen Städte, die den Juden untersagt waren, in Ortschaften wie Brumath, Ingwiller, Bischheim im Departement Bas-Rhin oder Rixheim, Dürmenach im Departement Haut-Rhin. Man sieht Gestalten von Rabbinern oder diversen Händlern vorüberziehen, von Hausierern, Verkäufern gebrauchter Kleider, ungerechnet die Getreide- oder Viehhändler, die fast ausschließlich Juden waren. Die Mutter von Isaac Strauss, geborene Judith Hirschman, war die Tochter eines großen Rabbiners, Rabbi Raphaël, der im ganzen Elsass des 18. Jahrhunderts berühmt war. Die elsässische kleine jüdische Welt (1784 etwa 20 000 Personen) lebt im Rhythmus des jüdischen Kalenders, spricht Jiddisch und beachtet bis zur Französischen Revolution die Vorschriften des rabbinischen Gesetzes. Theoretisch ist ihnen Eigentum untersagt, doch manchmal erwerben sie welches mittels Tilgung ausstehender und durch Grund und Boden abgesicherter Darlehen. So bestätigt Élie Moch, Vorfahre mütterlicher-, aber auch väterlicherseits, der Urgroßvater von Claude Lévi-Strauss' Mutter, in einem Rechnungsbuch, für seine Felder Pachtzinsen erhalten zu haben. Alles ändert sich mit der den Juden gewährten Emanzipation im Jahre 1791. Von nun an geht diese Gemeinschaft in beschleunigtem Rhythmus »vom westlichsten Posten der jüdischen Welt der Aschkenasim zu einem modernen und national definierten Judentum« über.11
Innerhalb von ein oder zwei Generationen emigrieren viele elsässische Juden nach Paris, über Straßburg, wo sie sich nach dem Kanon eines städtischen bürgerlichen Lebens integrieren, nicht ohne viele Aspekte des ursprünglichen Identitätsspektrums beizubehalten. Die Familie von Claude Lévi-Strauss folgt diesem Weg, der gewaltige Veränderungen der Lebensbedingungen und geistigen Horizonte mit sich bringt. Ihr Stammbaum veranschaulicht einen großen Teil der Geschichte der französischen Israeliten: durch die Geographie (vom Elsass nach Paris über Bayonne), die historischen Umstände (die Emanzipation, das Kaiserreich und die Organisation des Sanhedrin, der Krieg von 1870), ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolge, das Ausmaß ihrer Möglichkeiten, den veränderlichen Grad der jüdischen Identität in einem geliebten, da emanzipierenden Vaterland. Doch es gibt einen Namen, der inmitten all der Moch, Lévy, Lévi und Hauser im Gedächtnis des jungen Mannes und der ganzen Familie mit besonderem Glanz erstrahlt: der seines Urgroßvaters, Isaac Strauss, der heute vergessen ist, doch dessen Andenken durch seinen Nachkommen aufgefrischt wird. Als Claude Lévi-Strauss beginnt, ihn in den 1980er Jahren in seinen Gesprächen zu erwähnen, wird ihm die ganze schillernde Welt seiner Kindheit wiedergeschenkt – eine Welt der Musik und der Zerstreuungen, stark im bürgerlichen 19. Jahrhundert verwurzelt, die er, alt geworden, zutiefst als die seine erkennt, auch wenn er seinen Urgroßvater nicht persönlich gekannt hat.
Isaac Strauss: »Der Strauss aus Paris«
Wer also ist derjenige, den man den »Béranger der Tanzmusik« nannte?12 Isaac Strauss wurde 1806 in Straßburg geboren. Sein Vater, Loeb Israël, transkribierte seinen Namen in Léon und den seiner Söhne in Maurice (Moshé) und Isaac (Isaïe), womit er dem kaiserlichen Dekret (20. Juli 1808) zuvorkam, das die Juden zwang, ihre Vor- und Nachnamen festzulegen und sie beim Standesamt ihrer Gemeinde zu deklarieren. Es war ihnen untersagt, die Patronyme des Alten Testaments zu verwenden und sich in irgendeiner Weise hervorzuheben: Deshalb wurde »Isaïe« zu »Isaac«, »Loeb« zu »Léon«, »Lazare« zu »Gustave«, »Moshé« zu »Maurice« usw. Zwar spielt sich ein Teil von Isaacs Kindheit in Bischheim ab, doch sein Talent als Geiger, das er sehr früh zu erkennen gab, führt ihn 1828 nach Paris an die königliche Musikhochschule in die Klasse von Baillot, bevor ihn nach einem Wettbewerb das damals von Rossini geleitete Orchester des Théâtre-Italien als ersten Geiger einstellt: »Meine Großmutter [die Tochter von Isaac Strauss] erzählte gern, sie habe im Alter von sieben Jahren, glaube ich, nachdem Rossini sie auf die Stirn geküsst hatte, geschworen, sich nicht mehr zu waschen, um die Spur der göttlichen Lippen zu bewahren.«13 Von nun an stützt sich Isaacs unaufhaltsamer Aufstieg auf zwei Dinge: die Erfindung der Tanzmusik, insbesondere des Walzers, und die künstlerische Konzentration der mondänen Welt ab den 1830er Jahren in den Kurorten. Denn nach der bewegten Zeit der Revolution und des Kaiserreichs konnten die Tänze des Ancien Régime nur altmodisch wirken. Unter Ludwig XVIII. und unter Karl X. wurde sehr wenig getanzt. Erst Louis-Philippe, der Bürgerkönig, lässt die fürstlichen Feste wiederaufleben. Isaac kommt zur richtigen Zeit, indem er dazu beiträgt, den Walzer zu erfinden, dem sich die Polkas, Mazurkas, Ecossaisen, Märsche, Quadrillen, Redowas und Galopps hinzugesellen, all jene Tänze, die die europäischen Höfe, aber auch die bürgerlichen Salons der Hauptstadt herumwirbeln lassen, ganz zu schweigen von der aristokratischen Kundschaft der Kurorte, die unter dem Vorwand, den Empfehlungen der Medizin zu folgen, vor allem die Vergnügungen des mondänen Lebens sucht. So erhellt Isaac Strauss die Melancholie der Genesenden von Plombières und Aix-la-Chapelle, vor allem aber wird Vichy zum Sprungbrett seiner Karriere. Als er 1843 hier eintrifft, ist das Thermalbad ein wenig entvölkert. Ein paar Jahre später ist es erneut the place to be: Die Musik und die gute Geschäftsführung des sowohl praktischen wie enthusiastischen Isaac Strauss haben Wunder gewirkt. Im Dezember 1847 tritt er auf Verlangen von Louis-Philippe die Nachfolge des berühmten Philippe Musard (1792-1859) an, des Dirigenten der Bälle des Hofs, aber »er sollte der königlichen Familie nicht zum Tanz aufspielen. Die Klänge des Orchesters wurden vom Tosen der Revolution erstickt«.14 Die verschiedenen Regierungswechsel änderten nichts an der Entscheidung Louis-Philippes, und der Präsident der Republik, der künftige Kaiser Napoleon III., darf sich beglückwünschen, sie bestätigt zu haben: In den zwanzig folgenden Jahren bringt Isaac Straus die Jugend der Hauptstadt zum Tanzen, ebenso die alten und neuen Aristokratien des Kaiserreichs und des mondänen Europas.
Er ist nun eine Art Gott der kaiserlichen Lustbarkeit. Als leutseliges Symbol des triumphierenden Parisertums und seines festlichen Trubels ist er bekannt, anerkannt, von allen vergöttert; er ist eine Gestalt des Boulevards, ein eifriger Kunde von Drouot, ein Mann, der seinen Zeitgenossen zufolge von vollendeter Höflichkeit ist und keine Feinde hat. »Ein kleiner Mann mit lebhaften, intelligenten Augen, die über die Gläser seines Lorgnons hinweg leuchten, einer etwas breiten Nase über einem spöttischen Mund«15 und mit einem elsässischen Akzent, den er nie ablegte – Issac Strauss ist das Entzücken der Kolumnisten und Karikaturisten wie Gavarni und Cham. Seine weiße Krawatte wird von den Chronisten als Zeichen der Zeit beschrieben, wie »der Spazierstock von Voltaire, das Lorgnon von Balzac, die Haarsträhne von Girardin oder die Brille von Thiers, und außerdem besang man die Krawatte des Großvaters nach der bekannten Melodie der Casquette au père Bugeaud: ›As-tu vu / La cravate / La cravate / As-tu vu / La cravate au père Bugeaud?‹«16
Karikatur von Isaac Strauss, Leiter der Opernbälle: Lithographie von Paul Hadol (1835-1875), veröffentlicht bei Bertauts (um 1854?).
Auch wenn Isaac Strauss als Komponist von über vierhundert Musikstücken gewürdigt wird, darunter der berühmten Quadrille aus Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach, auch wenn Berlioz in seinen Memoiren den Schöpfer »von mitreißenden und unübertrefflich instrumentierten Walzern mit köstlichen koketten Rhythmen«17 preist, so ist er doch ebenso ein Arrangeur, der die modischen Themen aufgreift und sie nach dem Geschmack der Zeit abändert. Seine Berühmtheit wächst, nach dem Prozess der »Starwerdung« der Dirigenten: Von ihm lässt sich, wie von Louis Antoine Jullien oder von Musard, sagen, dass das Publikum sie ebenso sehr sehen wie hören will. Ihre ungestüme Stabführung (Strauss zerbrach mindestens zwei bei jedem Konzert), ihre wilden Bewegungen entsprechen durchaus der bacchantischen Atmosphäre, die die Opernbälle zur Fastenzeit bisweilen annahmen; die Halbmasken der Frauen erlaubten so manche Kühnheiten … An der Spitze der Opernbälle, einer Institution des Ancien Régime, die bis zur III. Republik fortlebte, verfügt Isaac Strauss über eine erhebliche Macht, die Melodien, die in Mode waren, zu verbreiten. Ansonsten sichert ihm und seinen Erben die Veröffentlichung zahlreicher Partituren für Klavier bei Heugel bedeutende Autorenrechte, für eine Dauer, die das Gesetz von 1866 auf fünfzig Jahre nach dem Tod des Urhebers festgesetzt hat. Abweichend von der Familienlegende, die die Figur des großen Künstlers kultiviert, verkörpert Isaac Strauss also in der Musikwelt einen außergewöhnlichen Erfolg, dessen ökonomische Kraft und bestimmende Macht bei weitem über die künstlerische Legitimation hinausgehen.18
Reich geworden ist er dank seinem musikalischen Talent, seinem Gespür, seinem Geschäftssinn, aber auch dank seiner Nähe zur kaiserlichen Familie, der er eine Reihe von Musikstücken widmet: Eugénie Polka (der Kaiserin gewidmet), den Marche impériale usw. Sein ganzes Leben scheint im Zeichen der kaiserlichen Machtentfaltung zu stehen, auch wenn wir von seiner Urenkelin Henriette Nizan hören, er sei Freimaurer gewesen, eingeweiht von seinem Meister Baillot. Geprägt von der Erklärung der Menschenrechte und seinem philosophischen Ideal der Toleranz, der Brüderlichkeit und der Gleichheit, verbindet er also seine Grundüberzeugungen mit den Windungen der kaiserlichen Politik. Henriette Nizan besitzt von diesem Freimaurer-Engagement noch »seinen Schurz«, einen ungewöhnlichen Gegenstand, »neben einem von meiner Vorfahrin hinterlassenen herrlichen Ballkleid«19, gleich einem geheimnisvollen Diptychon des Schicksals der Familie Strauss: ebenso ambivalent wie die Operette selbst, die, ihrem Ethnologen Siegfried Kracauer zufolge, sowohl die gesellschaftliche Revanche des Outsiders der großen Opernform als auch vergnügtes Getöse ist, das die bleierne Ruhe der kaiserlichen Diktatur überdeckt; die Leichtigkeit der Operette hat die Kraft, die Masken herunterzureißen, sie ist ein »Gemisch aus Heiterkeit und Satire, revolutionärem Auflösungsdrang und rückwärts gewandter Zärtlichkeit«.20 Schließlich wird Isaac Strauss im Januar 1870 zum Ritter der Ehrenlegion ernannt, zu einer Zeit, da er von seinem Posten als Direktor der Opernbälle zurücktritt und sich aus freien Stücken sechs Monate vor dem kaiserlichen Fiasko im Ruhm seiner »zepterschwingenden Regentschaft« zurückzieht: ein perfektes Zeitmaß für ein erfülltes Leben.
Als er im August 1888 stirbt, wird in etwa zwanzig Artikeln seiner gedacht, jedoch in der kurzen Form einer Pressemeldung in der Klatschspalte: Man preist nicht den Tod eines großen Künstlers. Im Sterbehaus »ehrt der Rabbiner den Philanthropen, der einer der Gründer der Elsass-Lothringer Gesellschaft und mehrerer Wohltätigkeitsvereine war«.21 Seine Verbundenheit mit der kaiserlichen Ära ist auf biographischer wie künstlerischer Ebene derart, dass er mit ihr zu sterben scheint. Die III. Republik, die wenig Gefallen am tänzerischen Rausch und der boulevardhaften Bissigkeit der Operette hat, zieht es vor, sein zweites Leben als Kunstsammler (das man auf die Liebe zum Nippes beschränkt) und seinen Ruhestand als Patriarch in seinem Haus in der Rue de la Chaussée-d'Antin 44 hervorzuheben – es wurde 1895 für den Durchbruch der Rue Réaumur abgerissen –, im Kreis seiner großen Familie und von fünf Töchtern bewundert.
Napoleon III., von der Terrasse der Villa Strauss aus die Menge grüßend.
Von allen vergessen, hauptsächlich wegen der Namensgleichheit mit der »Strauss-Familie« aus Wien, deren Berühmtheit in ganz Europa die seine auslöscht, bleibt Isaac Strauss doch Gegenstand eines Familienkults. Dieser wird genährt von der Langlebigkeit mehrerer seiner Töchter, besonders Léas, Claude Lévi-Strauss' Großmutter, 1932 gestorben, die eine lebendige Brücke zu diesem Erbe bildet, dessen materieller und symbolischer Ruhm in umso hellerem Glanz erstrahlt, als er nur noch in Form von »Bruchstücken«, »Überbleibseln« oder Erinnerungen existiert: »Ich bewahre einige Bruchstücke davon auf; so das Armband, das Napoleon III. meinem Urgroßvater überreichte, um sich für die Gastfreundschaft in der Villa Strauss in Vichy zu bedanken. Diese Villa Strauss, in der der Kaiser zu Besuch weilte, existiert noch heute. Sie ist zu einer Bar oder einem Restaurant umgestaltet worden, ich weiß nicht mehr, aber ihren Namen hat sie behalten.«22 Die Episode des Aufenthalts des Kaisers bei der Familie Strauss in Vichy ist in der Familienchronik der Höhepunkt seiner Nähe zum Thron geblieben, bekräftigt durch jenes Armband, das aus einem Strumpfband mit einer Diamantbrosche besteht, »von großer Vornehmheit«, wie Madame Strauss in einem Brief vom 30. Juni 1861 präzisiert. Ein anderes Erinnerungsstück aus einer doppelt versunkenen Welt, denn auch dieses ging verloren: der Ring, den die junge Königin Isabella von Spanien Isaac Strauss zum Dank für den Walzer Double mariage gab, den er ihr zur Hochzeit 1846 in Madrid schenkte. Isaac Strauss' Urenkelin, Henriette Nizan, erinnert sich: »Ein mit Diamanten verzierter Rubin. Ein Ring, dessen Geschichte ein regelrechtes Symbol ist: Hundert Jahre später sollte ich, die andere Henriette der Familie [auch Isaacs Frau hieß Henriette] ihn versehentlich wegwerfen und im Ofen meines Hotels verbrennen lassen, als ich vor den Deutschen floh.«23
Familienchronik
Fahren wir mit Claude Lévi-Strauss' Stammbaum fort und wenden uns den Großeltern zu.24 Mütterlicherseits leben Sarah Moch, verheiratete Lévy, und Émile Lévy, Rabbiner, nachdem er sich wie viele seiner Glaubensgenossen 1871 für Frankreich entschieden hatte, in Verdun, wo ihre fünf Töchter zur Welt kommen – Hélène, Aline, Lucie, Louise und Emma, Claudes künftige Mutter. Der Krieg von 1870 bleibt ein intensiver Augenblick im Leben dieser patriotischen Juden, festgehalten in Sarahs Album Amicorum neben poetischen Texten, Freundschafsbezeigungen und verschiedenen Zeugnissen. Dieses überaus deutsche Genre des intimen Schreibens endet symbolisch mit einem Gedicht von Sarah über die Niederlage von 1870 und ihrer eigenen Welt: »Überall war Kanonendonner zu hören / Und als die Sonne ihren Lauf beendete / Sah man kriegerische Truppen herbeieilen / Alle voller Blut, Rauch und Feuer / Und den Bewohnern zurufen, rette sich wer kann / Alles ist verloren.«
Väterlicherseits verbindet sich die berühmte Familie Strauss über ihre Tochter Léa (1842-1932), Claudes künftige Großmutter, mit Gustave Lévi (1836-1890), einem der fünf Kinder von Flore Moch, verheirateter Lévi, und Isaac Lévi, dessen gesellschaftlicher Aufstieg von Ingwiller aus (wo noch sein Sohn Gustave zur Welt kommt) nach dem Tod Flores, Claudes künftiger Urgroßmutter (1892), am Inventar abzulesen ist. Dieses Inventar beschreibt eine klassische bürgerliche Einrichtung, ausgeschmückt mit einigen Extravaganzen nach der japanischen Mode des letzten Drittels des Jahrhunderts: ein Nussbaum-Sekretär, eine Alabaster-Standuhr, blau-weißes Porzellan aus Japan, ein Mahagoni-Nähtisch, eine Stehlampe, Bronzekandelaber, ein Polstersessel, ein Betthimmel und Tafelsilber. Dieser Aufstieg in die bürgerliche Welt zeigt sich auch am Ausweis der Nationalgarde des Departements Seine von Gustav, Claudes Großvater, undatiert, auf dem lediglich die Adresse, 10, Rue de la Victoire, und der Beruf, Börsenmakler, vermerkt sind. Pässe weisen auf Reisen hin. Die Integration in ein lokales politisches Leben und die Börse zeigen die neue Pariser Welt der Großeltern an, eine Welt von Angestellten, Maklern, Händlern im Konfektionsgeschäft, wo der gegenseitige Beistand der Familie eine große Rolle spielt, wenn es darum geht, eine Stelle zu finden, Geld zu verleihen oder Beziehungen zur Verfügung zu stellen. Die Familienendogamie ist auch eine wirtschaftliche. Gustave Lévis schlechte Geschäfte an der Börse und sein früher Tod erklären einen gewissen gesellschaftlichen Niedergang Léas, der jungen Witwe und Mutter von fünf Kindern – André (1866-1928), Pierre (1873-1912), Jean (1877-1933), Hélène (1867-?) und dem Jüngsten, Raymond (1881-1953), Claudes künftigem Vater.
In Wahrheit »wäre es richtiger, von einer Familie statt von zweien zu sprechen«25; zum einen, weil Claudes Eltern Geschwisterkinder zweiten Grades sind: Sie sind durch einige gemeinsame Vorfahren verbunden, Élie Moch und Esther Dreyfus; vor allem aber durch den sehr starken Zusammenhalt dieses Mikrouniversums aus dem Elsass stammender und in Paris in einem oft begrenzten Radius lebender jüdischer Familien. Jenseits des 2. Arrondissements von Paris (eher Arbeits- und Erholungsstätte mit seinen Theatern und Cafés) konzentrieren sich viele dieser Haushalte im 16. Arrondissement. So wohnte Claudes Großmutter mütterlicherseits, Sarah Moch-Lévy, nicht weit von ihrer Tochter Emma entfernt: erstere in der Rue Narcisse-Dias, während die zweite, Claudes Mutter, sich nach ihrer Heirat im Jahre 1907 in einem benachbarten Viertel in der Rue Poussin niederlässt. Claude Lévi-Strauss' engere Familie besteht aus einer riesigen Verwandtschaft mit zahllosen Onkeln und Tanten, Scharen von Vettern und Kusinen, aber auch Großtanten (mehr als Großonkel, deren Lebenserwartung geringer ist), alle zusammengeschweißt durch ein intensives Familienleben, das von einer kohärenten Gesamtheit von Riten, Gewohnheiten, gegenseitiger Hilfe, manchmal einer Ersatzverwandtschaft beherrscht ist.
Stammbaum: »Es wäre richtiger, von einer Familie zu sprechen statt von zweien.« Auf mütterlicher wie auf väterlicher Seite hat die Familiengenealogie im elsässischen Judentum Ende des 18. Jahrhunderts gemeinsame Wurzeln.
Bei der Lektüre der Libres Mémoires von Henriette Nizan, aber auch der Archive der Familie Lévi-Strauss ermisst man den Wert dieser Welt, der durchaus in den künftigen Arbeiten des Anthropologen nachhallt. So erkennt man mit Erstaunen in der Korrespondenz seines Großonkels Alfred Lévi mit seiner Schwester Palmyre (beide sind Geschwister von Gustave) aus Anlass des einzigen Kindes der letzteren, René Kahn, eines sich verzettelnden jungen Mannes, der im Begriff ist, vom »rechten Weg abzukommen«, genau die Position des Onkels mütterlicherseits, wie sie ein Jahrhundert später von Lévi-Strauss in einem Artikel in La Repubblica beschrieben wurde anlässlich von Earl Spencers, Dianas Bruder, Rede nach deren Tod.26 Er sieht darin das Wiedererscheinen einer alten strukturalen Funktion, eines Vermittlers im Fall des Konflikts zwischen Verwandten und Kindern, einer väterlichen Ersatzautorität, die jedoch nach einem nichtautoritären Modus argumentiert, eine Art »väterliche Mutter«. Die Worte Alfreds entsprechen völlig dieser Haltung, da er in Abwesenheit des Vaters seine Mittlerdienste anbietet, wobei er jedoch »sanfte Ermahnungen« und die »Kraft der Überzeugung« statt »energischer Maßnahmen« empfiehlt.27 Ebenso darf man vermuten, dass Claude Lévi-Strauss' Überlegungen zur Organisation von Verwandtschaftssystemen, in allen ihren Feinheiten dargelegt, zum Teil auf dem recht raffinierten Modell beruht, über das er aus eigener Erfahrung verfügte: das Familienandenken an die Welt seiner Vorfahren (ländlicher elsässischer Juden Ende des 18. Jahrhunderts, von denen seine Familie auf beiden Seiten abstammt), die einen Typus der Heirat zwischen »entfernten Cousins« praktizierten, die das Individuum auf angemessene Weise in die soziale Gruppe einzugliedern vermochte. Nicht nur waren seine beiden Eltern aus Geschwisterkindern ersten Grades hervorgegangen, später entdeckte er auch, ohne sich besonders darüber zu wundern28, dass seine dritte Frau, Monique Roman (über ihre Mutter aus einem Guggenheim-Zweig stammend), ebenfalls aus diesem Mikrokosmos kam. Das hieß, a posteriori wiederzuentdecken, dass sich der in den exotischen primitiven Gesellschaften untersuchte Organisationstypus in den ländlichen europäischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts, insbesondere in seiner eigenen Genealogie, wiederfinden ließ. Der Gedanke ist nicht abwegig, dass diese Genealogie, im Familiengedächtnis präsent, einen umso fruchtbareren Boden bilden konnte, als er unbewusst war.
Dieses Familiengedächtnis ist stark von den Frauen strukturiert, deren außergewöhnliche Langlebigkeit für eine lebendige Übermittlung zwischen den Generationen sorgt. Die Frauen sind die Hauptinstanzen der Korrespondenz, des lebenswichtigen Familienbandes, als die Eltern noch in Straßburg sind und die Söhne in Paris leben. Flore Lévi, die Urgroßmutter väterlicherseits, überhäuft ihren Sohn Alfred mit Ratschlägen und Bitten, geistlichen Empfehlungen und trivialen Nachfragen (ein ganzer Brief über die Pantoffeln!), eine liebevolle, lebendige Mischung, die man in der ebenso reichhaltigen Korrespondenz von Claude Lévi-Strauss mit seinen Eltern wiederfindet. Die beiden Großmütter des jungen Claude sind fast hundert, als sie sterben, Léa Strauss (verheiratete Lévi) 1932 und Sarah Moch