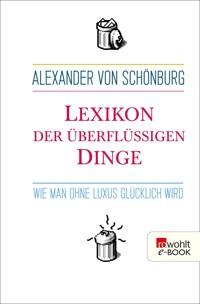
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Unser Alltag ist überfrachtet mit Dingen, die wir nicht wirklich brauchen, die Zeit, Geld und Lebensqualität stehlen. Ein Handy muss heute fotografieren, mailen, im Internet surfen, waschen und bügeln, Filmclips abspielen und MP3-Musikdateien wiedergeben können. Vor jeder Ampel drängen sich Geländewagen, mit denen man Sibirien durchqueren könnte, und bevor wir uns zum Frühstück niedersetzen, bedienen wir ein Dutzend Küchengeräte. Mit Witz und Ironie lichtet Alexander von Schönburg das Dickicht, das uns ständig umgibt. Sein Lexikon reicht von A (wie «Anrufbeantworter») bis Z (wie «Zigarette danach»). Dazwischen finden sich so überflüssige Dinge wie «Beziehungskrisen», «Dekotomate», «Horoskop», «Lavalampe», «Pikkolöchen» oder «Zahnbürste, elektrische», auf dem Prüfstand stehen Verhaltensweisen (nachts zu Fuß allein vor einer roten Ampel warten), Geisteshaltungen (sich unnötig Sorgen machen) und Redewendungen («Ich sag mal so»). Eine Gebrauchsanweisung für den modernen Menschen, die hilft, mit Anstand und Würde durchs Leben zu kommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Alexander von Schönburg
Lexikon der überflüssigen Dinge
Wie man ohne Luxus glücklich wird
«Je suis superflue mais irremplaçable.»
Anne de Noailles, geb. Prinzessin von Brancovan
(1876–1933)
Einleitung
Überfluss – welch schönes Wort. Man sieht eine steinerne Brunnenschale vor sich, über deren Rand das Wasser quillt und in ein größeres Becken darunter rinnt. Dies Überfließen gibt dem Brunnen sein Leben. Wäre nur genug Wasser in dem Becken, um es bis zum Rand zu füllen, der Brunnen bliebe eine tote Plastik. Überfluss ist Merkmal von Zivilisation. Wer braucht schon eine Gabel, wenn man auch mit den Fingern essen kann? Das Bedürfnis nach Überfluss ist der Grundantrieb der menschlichen Kultur. Aus der Notwendigkeit, sich in regelmäßigen Abständen etwas in den Mund zu stopfen, wurde das Kochen auf künstlerische Höhen entwickelt. Aus der Notwendigkeit, um das nackte Überleben zu kämpfen, entwickelten sich die Ideen des Heldentums, des Martyriums, der Selbstaufgabe, der Ritterlichkeit und des fairen Streits. Aus unserem Begehren, übereinander herzufallen und unsere Körper zu genießen, machten wir die Liebe, die manchmal sogar dazu imstande ist, auf ihre Erfüllung zu verzichten.
Dies alles sind Überflüssigkeiten im Sinne streng biologischer Gesetze, und die Erklärung der Evolutionisten, die unser kulturelles Verhalten als biologisch zweckmäßig zu deuten versuchen, sind von hoher Komik. Kann es sogar sein, dass das einzig wirklich Notwendige ausschließlich das Überflüssige ist?
Wer hat überhaupt zu bestimmen, was Luxus und was notwendig ist? Eltern verstehen nicht, warum ihre Kinder allen möglichen elektronischen Schnickschnack haben «müssen». Der Sozialstaat ist der Überzeugung, dass Menschen, die nichts besitzen, Anspruch auf ein Fernsehgerät und ein neues Sofa haben. Es gibt sehr reiche Leute, die das Fernsehgerät nur für das Kindermädchen kaufen, denn sie selber halten es für überflüssig; dafür meinen sie nur schwer existieren zu können, wenn sie ihre Sammlung von Frührenaissance-Bronzen nicht beständig komplettieren können. Es gibt Millionenstädte, die mit vier Opernhäusern gut auszukommen meinen, während andere ein Opernhaus für grundsätzlich überflüssig ansehen. Im Mittelalter baute jede Stadt so viele Kirchen, dass das gesamte Stadtvolk zehnmal hineingegangen wäre, während die modernen Bischöfe leere Kirchen für überflüssig halten und sie in Lofts umbauen lassen und gewinnbringend verkaufen.
So viele Geister, so viele Überflüssigkeiten. Hinter jeder Überflüssigkeit stehen eine Doktrin und eine Rangleiter der Werte. Gelegentlich siegen Kräfte, die es für überflüssig halten, wenn es mehr als eine solcher Rangleitern gibt. Sie erkennen darin Kräfteverschwendung (wenn sie Kapitalisten sind) oder moralischen Relativismus (wenn sie Glaubensfanatiker sind) oder eine Pseudofreiheit zur Täuschung der Massen (wenn sie Kommunisten sind). Als Alexandria von den Muslimen erobert wurde, hat man die beste der berühmten Bibliotheken mit der Begründung vernichtet: Was nicht mit dem Koran übereinstimme, sei schädlich, und was mit ihm übereinstimme, sei überflüssig, denn man habe ja bereits den Koran. Gesellschaften, in denen eine Zentralinstanz bestimmt, was überflüssig ist, nehmen schnell ein trauriges Aussehen an.
Als Ende des achtzehnten Jahrhunderts der Fürst von Monaco, damals Herrscher über nicht viel mehr als ein Fischerdorf, auf die Einladung des Königs von England nach London kam und die vielen Lichter auf den Straßen erblickte, glaubte er, die ganze Beleuchtung sei ihm zu Ehren veranstaltet worden. Aus heutiger Sicht mag das lächerlich klingen. Historisch gesehen ist die Reaktion des Fürsten völlig verständlich: Er konnte sich nicht vorstellen, dass das, was ihm als unvorstellbarer Luxus erschien, für die Londoner alltäglich und ganz selbstverständlich war.
Luxus war den größten Teil der Weltgeschichte entweder das Privileg einer sehr überschaubaren Gruppe oder: verpönt. Im antiken Rom war das Konsumverhalten der Bürger zum Beispiel genau reguliert. Eines der vielen Anti-Luxus-Gesetze, die Lex Oppia aus dem Jahre 215v.Chr., schrieb vor, dass keine Frau mehr als eine Unze Gold besitzen dürfe, keine farbigen Gewänder tragen und sich innerhalb der Stadt nicht in einer Kutsche chauffieren lassen dürfe. Die Frauen Roms bildeten eine Lobby, um 195v.Chr. dieses Gesetz zu kippen. Cato d. Ä. hielt dagegen, Frauen seien «ungezähmte Kreaturen» mit «unkontrollierbarem Verlangen». Dem sei Einhalt zu gebieten, andernfalls, so der Staatsmann, werde es dazu kommen, dass überall Neid entstehe und Frauen versuchten, sich gegenseitig durch zügellosen Luxus zu überbieten.
Die Definition, was Luxus ist, also über das Notwendige hinausgeht, ist zwangsläufig willkürlich. Nur totalitäre Ideologien maßen sich an zu bestimmen, was der Mensch zum Leben braucht. Unter Sozialisten gilt Luxus als verweichlichend und dekadent, aber auch Konservative sind traditionell Feinde des Luxus. Die Oberklasse, als es sie noch gab, fürchtete die soziale Sprengkraft, die Luxusentfaltung mit sich bringt. Man klagte, ebenso übrigens wie die Snobs, über die zunehmende Durchlässigkeit sozialer Schranken in Zeiten, in denen sich der Status hauptsächlich am zur Schau gestellten Überfluss ablesen ließ. Die Protzsucht des absolutistischen Zeitalters hat, wie man bei Soziologen wie Werner Sombart und Norbert Elias nachlesen kann, die Entstehung des modernen Kapitalismus befördert. Der Zwang, durch augenfälligen Luxus im Blickfeld des Königs zu bleiben, ruinierte den französischen und englischen Adel, deren Reichtum ging auf die nachrückenden Schichten über. Luxus wurde zum Motor sozialen und ökonomischen Wandels, indem er neue Bedürfnisse und ganze Wirtschaftszweige schuf.
Was gestern noch Luxus war, ist morgen schon Notwendigkeit. Die Grenze zwischen beidem ist sehr schwer zu ziehen. Wird zum Beispiel in Deutschland im Jahre 2009 ein Fernsehapparat mit flachem Bildschirm und digitaler Auflösung noch Luxus sein? Ein Auto mit automatischer Gangschaltung, elektrischer Fensterhebung und Anti-Blockier-System? Ein Highspeed-Internetanschluss? Die Weltbank hat sich vorgenommen, bis zum Jahr 2010 mindestens 100Millionen Indern in den Slums am Rande der großen indischen Städte Zugang zum Internet zu verschaffen. Die Entwicklungshilfe-Propheten der Weltbank sind davon überzeugt, dass ein Internetanschluss ebenso wichtig ist wie Wasser und medizinische Versorgung. Ein wenig mag dies an die Marie Antoinette in den Mund gelegte Anregung erinnern, das Volk solle doch Kuchen essen, wenn es nicht genug Brot gebe – andererseits zeigt es, wie sehr die Grenzen zwischen Überfluss und Notwendigkeit in Bewegung sind.
Das, was man landläufig als Luxus bezeichnet (Dinge wie «edle» Parfüms, «feine» Stoffe, «exklusive» Reisen) sind inzwischen so gewöhnlich und so weit verbreitet, dass Überfluss die Reichen bereits zu quälen beginnt – eine Einsicht, die so geläufig ist, dass Hollywood schon Filme darüber macht (wie «American Psycho» oder «Fight Club»). Im Zeitalter des Alles-überall-und-jederzeit-Erhältlichen muss die Luxusgüterindustrie sich Tricks wie der künstlichen Rarifizierung bedienen, um ihren Produkten wenigstens den Anschein der Unerreichbarkeit zu verleihen. Asiatische oder russische Touristen dürfen bei Louis Vuitton in Paris höchstens zwei Taschen pro Person erstehen.
Eines der tröstlichsten Merkmale des Überflusses ist, dass er erst dann wirklich genießbar wird, wenn er einen nicht ständig umgibt. Für den Angestellten, der einmal im Jahr anlässlich einer Messe im Vier- oder Fünfsternehotel übernachtet, bedeutet der Aufenthalt dort Luxus. Zimmerservice, Fernseher am Bett, flauschige Handtücher. Für den abgebrühten Vielreisenden, der in seiner Stuttgarter Villa selber über flauschige Handtücher verfügt, ist der Aufenthalt im gleichen Hotel ein Bequemlichkeitskompromiss.
Die größten Schwierigkeiten, Überfluss zu genießen, haben die Superreichen. Ab einer gewissen Schmerzgrenze macht zusätzlicher Überfluss keinen Unterschied mehr. Es verbessert dann auch nicht mehr die so genannte Lebensqualität, wenn man sich, wie einst Heini Thyssen, Picassos ins Klo hängt oder wie ein Königssohn aus einem der Golfstaaten Tiger Woods für ein paar Golfstunden einfliegen lässt.
In dem Film «Die große Stille» von Philip Gröning wurde einem staunenden Großstadtpublikum das Leben der Kartäusermönche in der «Grande Chartreuse» im savoyardischen Hochgebirge bei Grenoble vor Augen geführt. Wie man weiß, sollen Mönche und Nonnen arm, ehelos und gehorsam sein, aber diese Grundsätze lassen sich höchst unterschiedlich auslegen: Vom barfüßigen Bettelmönch bis zum Abt im Barockpalais reicht die Spannweite der Möglichkeiten, und die Kartäusermönche praktizieren ein Höchstmaß an Radikalität. Sie leben jeder für sich in kleinen Häuschen. Die Woche über sprechen sie kein Wort, und nur am Sonntag sind sie für ein paar Stunden zusammen. Sie essen niemals Fleisch, tragen ein raues Gewand, und das Öfchen in ihrer Zelle heizen sie mit selbst gespaltenem Holz. Das Leben wird in seiner strengstmöglichen, seiner geradezu nackten Form geführt. Nirgendwo ist dem Überflüssigen ein härterer Kampf angesagt. Im Film hatte man sogar die sonst unvermeidliche Musikuntermalung und erklärende Kommentare weggelassen. Mit der Armut war hier wirklich Ernst gemacht worden.
Man könnte das Leben der Kartäuser natürlich auch ganz anders schildern, und zwar vom Standpunkt eines modernen Großstadtbewohners aus. Da wäre zunächst die Lage des Klosters mit dem überwältigenden Blick auf eine unzerstörte Berglandschaft, «unverbaubar», wie der Immobilienmakler neidisch sagen würde. Die Häuser in ihrer einfachen, aber perfekt proportionierten Architektur sind so schön wie auf einem Dürer-Aquarell. Die Stille – ein Luxusgut par excellence. Auf den Tisch kommt nur selbst gezogenes Gemüse und selbst gebackenes Brot, Butter und Milch vom eigenen Vieh, das alles von starkem, unverfälschtem Geschmack – unbezahlbar. Ein Leben aus dem Bio-Laden ist nichts dagegen. In den Zellen kein einziger hässlicher Gegenstand, nichts Modisches, Leeres, Schwächliches; alte Holztäfelung und in ihrer Einfachheit edle Möbel – kein Innenarchitekt bekäme das so schön hin. Die Kutten aus dicker selbst gewebter Schafwolle, maßgeschneidert. Zeitungsdruckerschwärze und Bestseller berühren niemals ihre Hände. Die Mönche verfügen über das Luxusgut Zeit in solch raffinierter Weise, dass es ihnen für die wichtigen Dinge des Lebens in vollem Umfang zur Verfügung steht, ohne Langweile und Leere zuzulassen. Leben nun die Kartäuser im Luxus, weil sie sich auf das Notwendige beschränken? Kein Zweifel. Kein Zweifel?
Die ersten Fabriken stellten die schönsten Dinge der Welt her: Sèvres-Porzellan, Aubusson-Teppiche und Roentgen-Möbel. Auch Ming-Vasen wurden für den Export nach Europa schon ziemlich massenhaft fabriziert. Es dauerte noch eine Weile, bis man entdeckte, dass man mit schönen und kostbaren Dingen nicht reich werden konnte. Das gehört zu den wichtigsten ökonomischen Gesetzen der Neuzeit: die Erzeugung von wertlosem Ramsch zur Grundlage der Volkswirtschaften zu machen. Zunächst ging es tatsächlich darum, den großen Markt der Kleinverdiener zu entdecken und Waren zu entwickeln, die für kleines Geld massenhaft verkauft werden konnten. Aber dann fand man offenbar schnell heraus, welchen Charme es hatte, billig zu produzieren und den Massen Artikel zu verhökern, die noch nicht einmal das wenige Geld wert waren, das man ihnen dafür abverlangte.
Ein Kaufmann musste an seine Waren glauben, wenn er großen Erfolg damit erzielen wollte. Quacksalber und Bauernfänger sahnten nur bescheidene Beträge ab. Ein gewaltiges Umdenken musste beginnen. Das konnten Fabrikanten und Kaufleute und Politiker nicht allein bewirken, dazu brauchte es die Männer des Geistes. Ein neuer Stil musste geistig fundamentiert werden, um eine neue Wertordnung zu begründen. Der Wert musste von den Gegenständen gelöst und in abstrakte Sphären überführt werden. Man erlebte den geisterhaften Vorgang, dass mit wertlosen Produkten unerhörte, in der Geschichte noch niemals zuvor gesehene Wertballungen erzielt werden konnten. Der reichste Mann der Welt ist nicht Bill Gates, sondern der Schwede Ingvar Kamprad. Der erfand Schränke, Tische und Stühle, die aus möglichst minderwertigen Materialien wie Pressholz hergestellt wurden und jeder handwerklichen Qualität spotteten.
Noch nie gab es eine solche Überfülle an Waren von Wert- und Wesenlosigkeit. Auch reiche Leute geben sich längst mit Kulissen und Attrappen zufrieden. Es scheint überhaupt nur noch Austauschbares, Wegwerfbares, Ersetzbares zu geben – und damit Überflüssiges. Wer heute viele Sachen bei sich anhäuft – Kunstwerke, Unterhaltungselektronik, Autos, Möbel, Kommunikationsmaschinerie, Kleider, Küchenmaschinen–, vermüllt sein Leben. Das Elend der toten Sachen, der Gegenstände, denen jede Bedeutung, jedes Lebensgewicht mangelt, offenbart sich an den Sperrmülltagen: Es ist nicht zu fassen, welche Berge von Wegwerfartikeln wir um uns herum dulden! Der Wunsch, Dinge zu besitzen, zu benutzen und zu tragen, die ein ganzes Leben halten und durch ihr Altern nur noch schöner werden und die zur Freude der Erben an eine nächste Generation weitergegeben werden können, hat beinahe schon subversiven Charakter angenommen; er wäre, wenn er die Phantasie einer nennenswerten Menge von Menschen erfüllte, eine Gefahr für unsere Wirtschaft.
Unsere Warenwelt des Überflüssigen mag schemenhaft und unwirklich sein, aber diese Warengespenster umdrängen uns in solcher Fülle, dass sie den Blick auf die Welt verschatten können. Der folgende Versuch, das Überflüssige zu benennen, ob dies nun Objekte, Angewohnheiten oder Geisteshaltungen sind, hat deshalb etwas von den magischen Prozeduren an sich, mit denen japanische Mönche die Dämonen um sich herum vertreiben: Sie nehmen ein scharfes Schwert und schwingen es um ihren Körper herum. Angesichts der tausend Köpfe, die das Ungeheuer Überflüssigkeit in die Lüfte reckt, hat unsere Methode etwas Willkürliches, und wir dürfen auch nicht immer hoffen, mit unserem Lufthieb getroffen zu haben. Unsere Kämpfergebärde richtet sich denn in Wahrheit auch weniger gegen allfällig Überflüssiges, sondern sie soll uns selbst trainieren. Wir versprechen uns von dem geheimen Wissen, all das von uns als überflüssig Erkannte tatsächlich nicht zu brauchen, den Genuss einer großartigen Empfindung, mag sie auch eine Illusion sein: der Empfindung, frei zu sein. Und damit einen beträchtlichen Lustgewinn.
A
Abschiede, ohne zu gehen
Wir alle haben schrecklich viel zu tun. Das übermäßige Beschäftigt- und Verpflichtetsein ist eine solche allgemeine Selbstverständlichkeit, dass man nicht mehr darüber sprechen muss. Man setzt es einfach voraus, solange nicht etwas eintritt, mit dem wir vor lauter Hektik nicht gerechnet haben: Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man sich auch als Arbeitsloser nach kurzem fragt, wo man früher die Zeit zum Arbeiten hergenommen hat.
«Leider können wir nicht lange bleiben», sagen unsere Gäste, «morgen müssen wir ganz früh wieder raus; wir haben schrecklich viel zu tun.» Schade ist es schon, wir haben uns schon eine ganze Weile nicht gesehen, und meine Frau hat etwas Gutes gekocht. Aber wir wollen den Druck, unter dem unsere Freunde stehen, nicht vergrößern. Also ziehen wir das Essen einfach vor und setzen uns ohne Aperitif an den Tisch.
Die Unterhaltung läuft gut, obwohl die Gäste gelegentlich auf die Uhr sehen. Unterhaltungen, die solcherart befristet sind, stehen unter einem eigenen Gesetz. Man will möglichst schnell mit allen anstehenden Themen durchkommen, denn es wäre doch schade, die Zeit bis zum drohenden Aufbruch nicht effektiv zu nutzen.
Unsere Gäste suchen einander mit Blicken und nicken sich zu. Jawohl, es ist so weit; wir waren darauf vorbereitet, bieten aber noch ein letztes Glas an. Ein letztes Glas, nun gut. Das letzte Glas ist schnell geleert. Vorsichtig, nicht drängend, nähere ich mich nochmals mit der Flasche – das erneute Einschenken wird gar nicht registriert, das Gespräch ist wieder in Gang gekommen.
«Wir wollen euch nicht aufhalten», sage ich nach einer Weile. «Ja, wir müssen jetzt wirklich los», ist die Antwort. Eine Zigarette ist aber noch drin, und zu einer trockenen Zigarette gehört noch ein Glas.
Was soll man sagen – es wurde zwei Uhr, und bis dahin saßen wir gleichsam die ganze Zeit auf gepackten Koffern. Nachdem wir dann weitere zwanzig Minuten unten an der Haustür gestanden hatten, sah es kurz sogar danach aus, dass wir noch einmal in die Wohnung zurückkehren würden. Aber dazu war leider die Zeit zu knapp.
Adlon
Das Hotel Adlon ist ein hervorragendes Beispiel für die typische Berliner Sehnsucht nach dem Glamour der zwanziger Jahre, ein eindeutiger Beweis für das Fehlen jeglicher Identität im Heute. Um die kuschelige und pompöse Kulisse der roaring twenties wiederherzustellen, schufen überambitionierte Investoren einen Betonklotz und gaben ihn als exakte Replik des alten Adlon aus, das der Krieg geholt hatte. (Ähnliches soll demnächst mit dem von den DDR-Herrschern gesprengten Stadtschloss geschehen.) Dabei entspricht nicht einmal die Fassade dem Original, und der einzigartige, legendäre Stil des Adlon ließ sich in Ermangelung eines salonfähigen Bürgertums erst recht nicht wiederherstellen. Vielmehr wimmelt es in der busbahnhofartigen Lobby nun von herangekarrten Touristen, die ein wohliger Schauer überkommt, wenn sie die hohen Teepreise sehen. Der Traum vom alten Adlon ist unerfüllt geblieben. Das Adlon ist kein Grandhotel, sondern eher die Wachsfigur eines Grandhotels und würde daher besser in das Kabinett der Madame Tussaud passen.
Amuse-Gueule (Gruß aus der Küche)
Mit dem «Gruß aus der Küche» entziehen sich viele Köche der Spitzengastronomie ihrer gesellschaftlichen Pflicht, dem Gast persönlich ihre Aufwartung zu machen. Stattdessen bekommt man ungefragt und ohne sich dagegen wehren zu können, Häppchen serviert, die man nicht bestellt hat und deren Zutaten sich meist nur schwer ermitteln lassen. Eine Impertinenz. Die einzig mögliche Antwort auf diese Aufdringlichkeit lautet: «Viele Grüße zurück.»
Andy-Warhol-Porträt
Es muss einmal klar gesagt werden: Die Ahnengalerien wohlhabender Aristokraten und Bürgerfamilien bestanden keineswegs nur aus Meisterstücken von Raphael Mengs, Lucas Cranach, Ingres oder Reynolds. Es hingen dort oft schaudervolle Porträts herum, lieblos gemalt von Handwerkern, denen man diesen Ehrentitel eigentlich nicht zuerkennen möchte. Mit der Zeit jedoch wuchs ihren Stümpereien eine gewisse Atmosphäre zu, und so haben sie allein durch ihr Alter eine Daseinsberechtigung erworben und müssen nicht auf dem Dachboden verschwinden.
Ich bin also keineswegs der Meinung, früher sei mit der Porträtkunst alles zum Besten bestellt gewesen. Und zu Modemalern, die viel Geld verlangten, ist man immer schon gegangen; in unzähligen Salons hängt eine Urgroßmutter, auf braunes Packpapier von Lenbach husch, husch hingeworfen.
Dass reiche Leute sich von Erfolgskünstlern schlecht bedienen lassen, ist völlig in Ordnung. Genau genommen kann es gar nicht anders sein, denn reiche Leute steigen bei einem Künstler erst ein, wenn er bereits Erfolg hat, und Erfolg haben heißt, schlechtere Arbeit für mehr Geld abliefern. Aber das Andy-Warhol-Porträt, das sich Fabrikanten und Verleger, Fürsten und Bankiers auf der ganzen Welt angeschafft haben und das nun in tausend Hallen und «Wohnbereichen» hängt, um zu beweisen, dass die Porträtierten «auch einmal jung waren» und mutig genug, sich «mit der Kunst unserer Zeit auseinander zu setzen» – das muss dann doch in die Reihe der überflüssigen Dinge aufgenommen werden.
Warhol gehörte altersmäßig zu jener Generation von Kunstlehrern, die mit den Kindern vor allem «neue Techniken» ausprobierten: Da wurde dann gespritzt und gesprenkelt und mit Kartoffeln gedruckt, und das sah dann ganz, ganz toll aus. Aber dass solcher Kitsch das Bild der gesamten Machtelite in die Zukunft tragen soll, ist dennoch bedauerlich: Man hätte sich diese Leute gern etwas genauer angeschaut.
Angst
Die Zeiten, in denen unablässig von Angst die Rede war, sind Gott sei Dank vorbei. Anstatt zu sagen, dass man eine Stationierung weiterer amerikanischer Atomraketen auf deutschem Boden für nicht mit den deutschen Interessen vereinbar halte, sagte man, man habe «Angst» davor. Anstatt zu sagen, dass ein Krieg gegen den Irak das prekäre politische Gleichgewicht des Nahen und Mittleren Ostens stören werde, erklärte man, davor «Angst» zu haben. Andererseits wurde Angst von den Medien als verkaufsfördernde Maßnahme entdeckt. Am Montag empfehlen die Gesundheitsseiten der Zeitschriften Fisch wegen der wertvollen Omega-3-Fette, ohne die man in kürzester Zeit an Arterienverkalkung sterben werde, am Dienstag wird vor der hohen Belastung der Fische durch Schadstoffe gewarnt. Am Mittwoch wird Vitamin B als «Stress-Buster» empfohlen, der den drohenden Herzinfarkt verhindere, am Donnerstag heißt es, zu viel Vitamin B sei krebsfördernd.
Was ist eigentlich, wenn etwas geschieht, vor dem man wirklich Angst haben muss? Keine Ahnung. Es ist für den ungeübten Medienkonsumenten nicht mehr zu unterscheiden, ob Vogelgrippe nun eine ernsthafte Bedrohung darstellt oder ob es sich wieder nur um eine herkömmliche Hysterie handelt.
Ich erinnere mich noch an ein Foto, das ich zu Zeiten von BSE in einer Zeitung fand. Darauf war eine betroffen in die Kamera blickende Hausfrau zu sehen, die ein riesiges Steak mit spitzen Fingern über den geöffneten Mülleimer hielt, als wolle sie ihn füttern. Ich weiß nicht mehr, ob die Angst vor Rinderwahn damals so groß war wie die vor der Vogelgrippe, aber wenn sie dazu führt, dass solche Fotos entstehen, lohnt es sich, sich hin und wieder ein bisschen zu fürchten.
Animateur
Anima heißt Seele. Der oberste Animateur, der Seeleneinbläser schlechthin, ist Gott, aber von dem soll im Folgenden nicht die Rede sein. Vielmehr geht es um einen Beruf in der Touristikindustrie, der in Club-Méditerranée-artigen Ferienhäuschen-Ansammlungen und auf →Kreuzfahrten zum Einsatz kommt, um die Urlauber zu beschäftigen und damit irgendwie zu beseelen. Es handelt sich also um ein neuzeitliches Phänomen, auch wenn ich vermute, dass der dahinter stehende Gedanke von den luxuriösen Weekend-Einladungen der englischen Oberschicht stammt.
In England wird das Bewirten von Gästen verdächtigerweise als entertainment bezeichnet. Daran ist schon zu sehen, dass es nicht beim bloßen Zusammensein bleiben soll. Animateur pflegte hier die Hausfrau zu sein, die sich einen Ruf als «blendende Gastgeberin» erwerben wollte. An den Wochenenden kommen in den großen englischen Landhäusern gelegentlich immer noch zwanzig bis dreißig Gäste zusammen, die nun in Trab gebracht werden sollen. Nur einfach da zu sein, spazieren zu gehen, sich in der Bibliothek umzusehen, mit andern Gästen zu plaudern oder auch einen schönen Mittagsschlaf zu halten – das genügt nicht. Es muss etwas geschehen to enliven the party. Es muss Krocket auf dem Rasen gespielt werden, es muss ein Kartenturnier veranstaltet, auf Tontauben geschossen, ausgeritten werden. Sonst könnte ja der Augenblick von Entspannung und Frieden eintreten, in dem ein unüblicher Gedanke gefasst werden könnte.
Dieses edwardianische Landhausmodell ist in Gestalt des Animateurs nun demokratisiert worden, die Situation jedoch ist gleich geblieben. Mit den englischen Landhausgästen teilen die Club-Méditerranée- und Kreuzfahrt-Gäste die soziale Homogenität. Manche von ihnen mögen etwas ungeübter im Umgang mit Fremden sein als die englischen Aristokraten, aber da wird Hilfe geboten, und mit dem Segen des Animateurs und nach vielen herrlichen Volleyball-Turnieren am Strand bilden Uschi und Torsten aus Duisburg und Tanja und Tom aus München eine einzige große Familie.
Animateur und Animateuse sind junge, sportliche Menschen mit vor allem einer Eigenschaft: Sie sind nett und unkompliziert – im Unterschied zu der leicht unnahbaren englischen Hostess. Doch ich möchte weder von unkomplizierten, netten noch von kultivierten, unnahbaren Menschen zum Hopsen und Springen angeregt werden.
Anwaltskosten
Kaum jemand hat sich so verdient um die Advokatenzunft gemacht wie die Familie Thyssen; die Advokaten dieser Welt müssten ihr eigentlich ein Denkmal setzen. Allein die Honorare für Scheidungsanwälte, die der fünfmal verheiratete Kunstsammler Heinrich Thyssen ausgab, summieren sich zu einem Betrag, von dem sich Generationen von Juristen mühelos ernähren könnten.
Baron Hans Heinrich («Heini»; →Spitznamen) hatte Anfang der achtziger Jahre die Aufsicht über sein weltweit verzweigtes Firmenkonglomerat seinem Sohn aus erster Ehe, Georg Heinrich («Heini junior»; →Spitznamen), überlassen. 1985 heiratete er die zweiundzwanzig Jahre jüngere Carmen, genannt Tita (→Spitznamen), eine Dame von undurchsichtiger Herkunft, die schon die fünfte Gattin von «Old Shatterhand» Lex Barker gewesen war. Tita überzeugte den altersschwachen Baron, dass sein Sohn Geld unterschlage. Schließlich streute sie via Wall Street Journal sogar das Gerücht, Heini junior sei gar nicht der leibliche Sohn ihres Mannes.





























