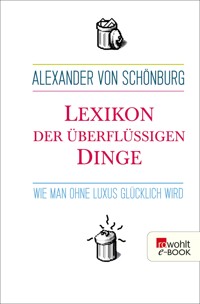Alles, was Sie schon immer über Könige wissen wollten, aber nie zu fragen wagten Hörbuch
Alexander Graf von Schönburg
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wie kommt es, dass nach dreihundert Jahren Aufklärung, nach all unseren Bemühungen, sämtliche Rätsel der Welt zu lösen, ausgerechnet das Königtum noch immer einen Zauber bewahrt hat, dem man sich selbst als eingefleischter Republikaner nicht entziehen kann? Alexander von Schönburg versucht dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Dabei erkundet er nicht nur das Wesen des Königtums – von den mythischen Figuren wie König Artus oder König David bis zu den Medien-Royals unserer Tage –, sondern beantwortet auch zahlreiche handfeste Fragen: Wie wird man König? Warum tragen Könige eigentlich Kronen? Und warum sollten Könige nicht allzu gescheit sein? Alexander von Schönburg kennt sich aus in der Welt der gekrönten Häupter – seine Frau ist eine Großnichte der Queen, auf seiner Hochzeit tanzte Königin Sophia von Spanien. So kann er aus eigener Anschauung berichten: von seinem Aufenthalt am Hofe des Sultans von Brunei, einem merkwürdigen Abend mit Rania von Jordanien oder seinem Besuch beim nepalesischen König – kurz vor dessen Abdankung. Am Ende entsteht ein ebenso unterhaltsames wie intelligentes Sittengemälde des Königtums, das auf amüsante Weise Kulturgeschichte und Klatsch vereint. Denn wer wollte nicht erfahren, was Royals tun, wenn sie «unter sich» sind, ob es stimmt, dass Prinz Charles mit Blumen spricht, und weshalb auf Schloss Windsor die Toasts keinesfalls eckig sein dürfen?
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander von Schönburg
Alles, was Sie schon immer über Könige wissen wollten, aber nie zu fragen wagten
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Es war einmal …
Kapitel eins. Wie redet man Könige an?
Kapitel zwei. Wie wird man König?
Kapitel drei. Wie wachsen Könige auf?
Kapitel vier. Warum darf ein König nicht allzu klug sein?
Kapitel fünf. Und warum sitzt ein König auf einem Thron?
Kapitel sechs. Warum tragen Könige eigentlich Kronen?
Kapitel sieben. Gibt es unter Königen Rangunterschiede?
Kapitel acht. Müssen Könige unbedingt im Palast wohnen?
Kapitel neun. Was tun Royals, wenn sie «unter sich» sind?
Kapitel zehn. Warum machen Könige so ein Brimborium?
Kapitel elf. Sind Könige auch beim Sex höflich?
Kapitel zwölf. Wie angelt man sich einen Kronprinzen?
Kapitel dreizehn. Was hat die Queen in ihrer Handtasche? (Und andere royale Geheimnisse)
Kapitel vierzehn. Warum haben Könige keine Kreditkarten?
Kapitel fünfzehn. Warum haben Könige Pferde lieber als Menschen?
Kapitel sechzehn. Dürfen Könige eine politische Meinung haben?
Kapitel siebzehn. Wie hat ein König zu sterben?
Und wenn sie nicht gestorben sind …
Kurze Kunde europäischer Herrscherhäuser
Statt einer Bibliographie
Für Irina
ES WAR EINMAL…
Queen Mary, die Großmutter der jetzigen Königin von England, eine geborene Prinzessin von Teck, hatte eine seltsame Angewohnheit. Immer wenn sie sich nach dem Befinden eines ihrer Untertanen erkundigte, fragte sie: «Wie geht es Ihrer armen Mutter?» Oder: «Wie geht es Ihrer armen Tochter?» Sie benutzte das Adjektiv «arm» so häufig, dass man sich bei Hofe fragte, was genau sie damit wohl meinte. Dabei ist die Sache ganz einfach: Arm, im Sinne von Queen Mary, war schlicht jeder, der nicht königlicher Herkunft war. Wie recht sie doch hatte! Bei meinem ersten Zusammentreffen mit Königin ElisabethII. musste auch ich das einsehen. Es war am Vorabend der Hochzeit von Prinz Edward mit Sophie Rhys-Jones. Edward erhob als jüngster Sohn der Queen keinen Anspruch auf einen Staatsakt, und die Royals waren vermutlich erleichtert, dass man diese Hochzeit als Familienfest feiern durfte. Es waren auch eine Handvoll deutscher Verwandter nach Windsor eingeladen. Darunter die Großnichte der Queen, Prinzessin Irina von Hessen, und der seit ein paar Wochen mit ihr verheiratete Mann, ein Journalist. Ich. Als Journalist bei Familienfeiern auf Schloss Windsor dabei sein zu dürfen ist ungewöhnlich. Eher erhält ein Lude aus St.Pauli eine Einladung zum Tee beim Papst. Es gibt wohl keinen Berufsstand, der in Windsor eine derart uneingeschränkte Geringschätzung genießt wie der des Reporters. Eine besonders dezidierte Meinung zum Thema Journalismus hat Irinas Großonkel Prinz Philip. Als ihm bei einem Besuch in Gibraltar der berühmte Affenfelsen gezeigt wurde, sagte er, so laut, dass ihn die ganze Horde der ihn belagernden Presse-Fotografen hören konnte: «Also, welche sind nun die Affen und welche die Reporter?» Bei einem Staatsbesuch in Pakistan stürzte ein Paparazzo von einer hohen Leiter, der von dort oben einen besseren Winkel für seine Fotos hatte haben wollen. Philips zartfühlender Kommentar: «Hoffentlich hat er sich das Genick gebrochen.»
Ich werde mich also hüten, nun die schlimmsten Befürchtungen meiner großzügigen Gastgeber zu bestätigen, indem ich Einzelheiten meines Aufenthalts in Windsor ausbreite. Eine solche Verletzung des Inner Sanctums kann die schwerwiegendsten Folgen nach sich ziehen. In einem der folgenden Kapitel werde ich erzählen, was mit denen geschah, die das gewagt haben. Hier will ich nur schildern, wie es mir ergangen ist, wie es in mir aussah, als ich mich plötzlich inmitten der englischen Königsfamilie wiederfand. Sich an einem Königshof zu bewegen verlangt äußerste Konzentration, ständig ist man darauf bedacht, ja nicht das Falsche zu tun, das Falsche zu sagen. Jede Bewegung, jeder Atemzug ist kontrolliert, man möchte ja niemandem missfallen, alle Nerven und Sinne sind darauf ausgerichtet, in einem fort das Verhalten der anderen Höflinge zu deuten, von morgens bis abends befindet man sich in einer ständigen Habt-Acht-Stellung. Das alles ist sehr, sehr anstrengend.
Gleich am ersten Abend in Windsor wurde ich neben die Königin platziert. Offenbar wollte die Queen den Mann ihrer Großnichte begutachten. Sie ist in der seltsamen Lage, dass sie außerhalb ihrer Familie so gut wie nie jemandem begegnet, der in ihrer Gegenwart unverkrampft ist. Eine ihrer Hofdamen erzählte mir später, dass sie sich über die Jahre an die kuriosesten Reaktionen hat gewöhnen müssen. Selbst mächtige Staatsmänner stottern plötzlich, wenn sie vor ihr stehen, andere sagen aus lauter Verlegenheit Sachen, für die sie sich im Nachhinein jahrelang schämen. Glücklicherweise gehört es zu den ureigenen royalen Tugenden, anderen Menschen möglichst rasch jede Verlegenheit zu nehmen und sie, wenn nötig, aus peinlichen Situationen zu retten. Als General de Gaulle kurz vor dem Ende seiner Amtszeit einmal mit seiner Frau Yvonne bei einem Abendessen in Windsor war, fragte jemand Madame de Gaulle quer über den Tisch, worauf in ihrem Ruhestand sie sich besonders freue. Madame de Gaulle antwortete – und hier muss man sich jetzt bitte einen sehr starken französischen Akzent dazudenken: «Ä penis!» Stille. Blankes Entsetzen. Selbst die Diener blieben verdattert stehen. Bis die junge Queen die Situation rettete und übersetzte, was Madame de Gaulle in ihrem gebrochenen Englisch zu sagen versucht hatte: «Ah, happiness.»
Als ich nun neben der Queen saß, war das Gefühl, vor dem Jüngsten Gericht zu stehen, dank der vor dem Essen gereichten Dry-Martini-Cocktails einem gewissen Übermut gewichen. Ich war redebereit. Aber worüber redet man eigentlich mit der Königin von England zwischen Vor- und Hauptspeise? Die Antwort: erst mal über gar nichts. Ich saß in meinem uralten, aber freundlicherweise von einem königlichen Diener aufgebürsteten Smoking neben ihr und wartete darauf, dass die Königin mich eines Wortes würdigte. Oder wenigstens eines Blickes! Doch das geschah nicht. Ich war Luft für sie. Was ich nicht wusste (das hätte mir vorher ruhig jemand sagen können!): Die Konversation am englischen Hof gehorcht anderen Gesetzen als auf dem Kontinent. Während man auf dem europäischen Festland möglichst mühelos abwechselnd mit seinem rechten und dem linken Tischnachbarn redet, ist es hier üblich, dass man die erste Hälfte des Essens mit seinem Nachbarn auf der rechten und die zweite Hälfte des Essens mit seinem Nachbarn auf der linken Seite plaudert. Ich saß an der linken Seite der Queen. Als sie sich mir endlich zugewandt hatte, befand ich mich bereits in einer Art Schockstarre. An genaue Details unserer Unterhaltung kann ich mich daher beim besten Willen nicht erinnern.
Ein Erlebnis der apokalyptischen Art war auch die Dreiviertelstunde, zu der ich ein andermal als Tischherr der Princess Royal, also der ältesten Tochter der Queen, verurteilt war. Auch bei Anne stehen Journalisten auf dem Speiseplan ganz oben. Überhaupt gilt sie nicht gerade als Menschenfreund. Ihr Vater hat einmal über sie gesagt, dass die einzigen Wesen, für die Anne etwas übrighat, Heu kauen, vier Beine haben und furzen. Ich blickte meiner Tischkonversation mit Prinzessin Anne also mit der Entschlossenheit eines Menschen entgegen, der nichts zu verlieren hat. Das Ergebnis war ein entzückender Abend, was – wenn von Begegnungen mit der Princess Royal die Rede ist – einfach bedeutet, ohne Blessuren überlebt zu haben. Meine Überlebensstrategie war: Ich habe ausschließlich über Pferde geredet.
Auch wenn ich an dieser Stelle der Versuchung widerstehe, meinen Abend in Windsor weiter auszubreiten, werde ich in diesem Buch nicht umhinkommen, manche Geheimnisse königlicher Hoheiten zu lüften. Und das, obwohl ich ahne, dass ich damit der Institution, die ich beschreibe, schade. Schließlich, so notierte bereits 1867 der große englische Staatsrechtler Walter Bagehot, macht «das Mysterium den Kern des Königtums aus, wir dürfen kein Tageslicht eindringen lassen». Wahrscheinlich können sich selbst eingefleischte Republikaner der Faszination, die Königshäuser ausüben, deshalb nicht entziehen, weil sie in unserer durch das Scheinwerferlicht der Fernsehkameras ausgeleuchteten Welt die letzten Institutionen sind, die noch über ein gewisses Mysterium verfügen. «Prominent» zu sein bedeutet heute schließlich überhaupt nichts mehr. In unserer Zeit der Rund-um-die-Uhr-Beschallung durch Sendungen, die jedem von uns versprechen, reich, berühmt und schön zu werden, und angesichts der unendlichen Selbstdarstellungsmöglichkeiten im Internet ist «prominent» sein heute wirklich nichts Außergewöhnliches mehr. Die Welt ist voller Berühmtheiten. Die einen sind dafür berühmt, dass sie reich sind, die anderen für ihre Schönheit, wieder andere für ihre Leistungen oder für ein Verbrechen; manche sind sogar fürs Berühmtsein berühmt. Die Royals sind die Einzigen, die ihren Ruhm schlicht und einfach ihrem Sein verdanken, die nichts tun müssen, um von einer unauslotbaren Bedeutung umgeben zu sein. Gerade in unserer Zeit der industrialisierten Plastik-Prominenz haben die verschlossenen Tore von Balmoral, Zarzuela und Fredensborg einen letzten, echten Reiz.
Nimmt dieser Reiz mit jedem Lichtstrahl ab, der das Innere der Paläste erhellt? Als Ende der sechziger Jahre der englische Dokumentarfilmer Richard Cawston den offiziellen Auftrag des Hofes erhielt, einen Film zu machen, der die Royals «als ganz normale Familie» porträtieren sollte, warnte Filmemacher David Attenborough ihn, mit diesem Film werde er der Monarchie schaden. Attenborough sprach mit der Autorität des Dokumentarfilmers, der etliche Filme über Naturvölker gedreht hatte. «Die ganze Institution der Monarchie», erklärte er, «basiert auf der Mystik des Häuptlings in seinem Häuptlingszelt. Sobald ein Mitglied des Stammes das Innere dieses Zeltes zu sehen bekommt, ist das System des Häuptlingswesens hinfällig – und der Stamm wird daran zugrunde gehen.»
Was nun, wenn ich auf den folgenden Seiten erzähle, wie Royals sind, wenn sie «unter sich» sind, oder wenn ich den Spitznamen verrate, mit dem die Königin von England von ihrer Familie bedacht wurde? Ist das eine Harmlosigkeit? Eine Indiskretion? Oder mehr? Die ägyptischen Pharaonen trugen stets zwei Namen. Einen, den das Volk kannte. Und einen Geheimnamen. Die Geschichtsschreibung weiß bis heute die Namen der alten Könige Siams nicht, so streng geheim wurden sie gehalten.
Sei’s drum. Die Queen wird von ihren Vettern und Cousinen «Lillibet» genannt, ihr Mann hat das Vorrecht, sie «Sausage», Würstchen, zu nennen. Im alten Burma hätten mich diese zwei Zeilen den Kopf gekostet.
Doch die Zeiten ändern sich. Das zeigt schon der Raum, in dem ich diese Zeilen verfasse. Ich sitze an einem Schreibtisch aus Pressholz, der Fußboden ist aus Laminat. Die einzigen Einrichtungsgegenstände in diesem Raum sind der Schreibtisch, ein Schrank und ein Bett. Ich befinde mich in einem Fünfziger-Jahre-Anbau eines der größten und ältesten Klöster Europas, Stift Heiligenkreuz in Niederösterreich. Ich bin hierhergekommen, weil ich mir in den Kopf gesetzt hatte, den Grundriss dieses Buches in der berühmten Bibliothek des Stifts zu verfassen. Und zwar in deren barockem Goldenen Saal. Ich malte mir aus, wie ich diese Zeilen umgeben vom Geruch jahrhundertealter Bücher zu Papier bringen würde. Nun aber sitze ich in dieser Zelle in der Klausur der Mönche. Längere Aufenthalte in der Bibliothek ohne Atemschutzmaske sind untersagt, denn: Die Bestände sind von Schimmelpilz befallen. Die Ursache des Pilzbefalls, der die unschätzbaren Werte dieser Bibliothek bedroht? Irgendwann setzte man sich in den Kopf, den Dachstuhl der Bibliothek zu modernisieren. Das tat man dann mit einer solch gnadenlosen Effizienz, dass die Luftzirkulation, wegen der die Säle immer so zugig waren, unterbunden wurde. Die einzigen Gäste, die sich derzeit in der Bibliothek aufhalten, heißen Rhizopus stolonifer, Aspergillus glaucus und Botrytis cineria.
Ist nicht auch die Idee des Königtums von solchen Pilzen befallen? Glaubt heute noch jemand an die «Erhabenheit» von Königen? Glauben die Mitglieder der Königshäuser selbst noch daran? Es sind ja nicht so sehr die gelegentlichen Exzesse mancher Prinzen, die das Königtum gefährden. Bedrohlicher ist, dass die Könige selbst darauf erpicht zu sein scheinen, ihre eigene Banalisierung zu betreiben. Sie wollen möglichst gewöhnlich sein. Es ist nicht nur «Volksnähe», auf die sie aus sind. Sie wollen «sein» wie das Volk.
Im Juli 2007 wunderten sich die Leser der spanischen Illustrierten Hola! über Bilder ihrer Königsfamilie beim Sommerurlaub. Man hatte sich an von Paparazzi alljährlich mit Teleobjektiven aufgenommene Fotos gewöhnt, die die Königsfamilie an Bord ihrer Segelyacht «Bribon» zeigten. Plötzlich aber sah man König Juan Carlos und Königin Sophia es sich wie Hinz und Kunz aus Wuppertal an einem öffentlichen Strand bequem machen, stilecht mit in Alufolie gewickelten Butterbroten. Die Wirkung dieser Bilder war kalkuliert. Die Botschaft lautete: Seht, wir sind wie ihr!
Wenn der spanische Thronfolger Felipe und seine Frau Letizia Interviews geben, endet jeder zweite Satz mit «como todo el mundo», also mit der gebetsmühlenartigen Beteuerung, dass bei ihnen alles genauso ist «wie bei allen anderen Leuten» auch. Prinz Charles und seine Söhne geben Fernsehzeitschriften Interviews, in denen sie über ihre Kochgewohnheiten berichten, erzählen, wie sie Spiegeleier braten und dass sie gerne im Supermarkt einkaufen. Die holländische Königin fährt – demonstrativ – mit dem Fahrrad durch die Hauptstadt, statt sich chauffieren zu lassen. Die Royals unserer Tage wollen mit aller Gewalt gewöhnlich wirken.
Verraten die Könige durch ihre Assimilierung an ihre Untertanen die einzige, die letzte wirklich unbestreitbare Aufgabe, die ihnen zukommt? Nämlich die, eben nicht gewöhnlich zu sein? Oder benötigt das Königtum all das um sie herum geschaffene Brimborium überhaupt nicht? Kann das Lüften des Schleiers, vor dem Attenborough warnte, dem Königtum womöglich gar nichts anhaben, weil ein König immer ein König bleibt, ganz gleich, ob er in vollem Staatsornat in einer Wolke von Weihrauch über uns thront oder in einer Küchenschürze in einer Kochsendung auftritt? Vielleicht ist das verschlossene Häuptlingszelt ja nicht zu seinem, sondern zu unserem Schutz da? Weil es uns hilft, das Mysterium zu ertragen? Oder ist vielleicht das Königtum, in dem der Monarch das Haupt und die Mitte des Staates darstellt, längst passé? Schon allein deshalb, weil so ein Königtum auf einem hierarchischen Weltverständnis fußt, das ebenfalls passé ist?
Wirkt es andererseits nicht ein wenig verspätet, am Anfang des 21.Jahrhunderts einen Nachruf auf das Königtum anzustimmen? Zu Beginn der letzten zwei Jahrhunderte hätte das jedenfalls sehr viel überzeugender geklungen. Man nehme das Jahr 1801: Frankreich hatte sich – nach über tausend Jahren ununterbrochener Tradition – der ältesten europäischen Erbmonarchie entledigt. In England brachte GeorgIII. seine Tage in einer Zwangsjacke zu. In Madrid regierte KarlIV., weil der eigentlich rechtmäßige König, sein älterer Bruder Philipp, offiziell für wahnsinnig erklärt worden war, in Kopenhagen herrschte ChristianVII., der ein Faible dafür entwickelt hatte, die Möbel seines Palastes kurz und klein zu schlagen, und im Palast von St.Petersburg hauste PaulI. und hatte Spaß daran, die Teller durch den Speisesaal zu schleudern, um amüsiert zuzusehen, wie seine Diener eilig alles aufwischten. Der Anfang des 19.Jahrhunderts war ganz offensichtlich eine denkbar ungünstige Zeit, um sich überzeugend für den Erhalt der erblichen Monarchie starkzumachen.
Hundert Jahre später sieht es nicht viel besser aus. Das 19.Jahrhundert endete für Europas Königshäuser mit der Ermordung des russischen Zaren AlexanderII. und Kaiserin Sissis von Österreich. Das 20.Jahrhundert begann mit dem Attentat auf UmbertoI. von Italien. Wenige Jahre später ereilten KarlI. von Portugal und den König von Griechenland das gleiche Schicksal. Der Erste Weltkrieg wurde durch einen Chauffeur ausgelöst, der in Sarajevo eine falsche Abzweigung genommen hatte und unglücklicherweise seinen Wagen genau dort wendete, wo ein Attentäter mit einer halbautomatischen Pistole stand. Kurz darauf lagen in dem offenen Auto ein toter österreichischer Thronfolger und seine Frau, meine Urgroßtante.
Und heute? Ein paar wacklige Neo-Monarchien wie die griechische und die persische sind verschwunden, dafür stehen alle anderen so solide da wie seit 1789 nicht mehr. Zwar würde jeder ernsthafte Staatstheoretiker den Gedanken an einen mystisch-religiösen Kern der modernen Monarchie lächerlich finden, aber das nicht theoretisierende Volk lebte unbeeindruckt in den Jahren der Diana-Manie seine Sehnsucht nach einer geradezu mittelalterlichen Königsidee aus: Besuchte sie ein Krankenhaus, wurden der Prinzessin von Wales kranke Kinder entgegengestreckt, damit sie sie berühre. All die handgefertigten Altäre, Abertausende Blumen und Bittgesuche an den Toren des Kensington-Palasts nach Lady Dianas Tod – bei ihrer Beerdigung die weltweit über drei Milliarden Menschen vor den Fernsehschirmen–, Symptome von Massenhysterie? Oder einer im Volk verwurzelten Sehnsucht?
Irgendetwas scheint dem Wesen des Königtums eigen zu sein, das es gegen die Verwerfungen der Moderne immun macht. Es ist ja fast schon ein Gemeinplatz, dass es nach über zweihundertjährigem Dauerbeschuss aus den Kanonen der Aufklärung, des Liberalismus, des Sozialismus, des Materialismus und unzähliger weiterer Ismen sowie nach jahrhundertelangen Mühen, sämtliche Geheimnisse der Welt zu lüften, eine Sehnsucht des modernen Menschen nach dem Numinosen, dem Unerklärbaren, dem Spirituellen gibt. Zweifellos profitiert das Königtum von dieser diffusen Sehnsucht.
Ich weiß nicht, ob es mir hier gelingt, alle Fragen zu beantworten, die sich mir gestellt haben, besonders wenn ich mich in so überaus bedeutende Regionen verirre wie die Sakralität des Königtums oder den Inhalt der Handtasche der Queen. Auch bitte ich um Nachsicht, falls meine Schilderungen manchmal etwas respektlos klingen. Ich würde dieses Buch nicht schreiben, hätte ich nicht eine gewisse Schwäche für Könige. Ich erinnere mich, wie aufgewühlt ich als neunjähriger Junge auf die Nachricht reagierte, dass beim Fest zum fünfzigsten Geburtstag meines Vaters der «König von Sachsen» da sein werde. Der erwartete Gast war natürlich kein König im strengen Sinne, sondern der Markgraf von Meißen, der König gewesen wäre, hätte Sachsen seine Monarchie behalten, aber das war mir egal. Ich war starr vor Ehrfurcht, als ich ihm dann endlich gegenüberstand, obwohl ich, ehrlich gesagt, auch ein wenig enttäuscht war, einen älteren, irgendwie unspektakulären Herrn ohne Krone und Zepter, dafür mit Krückstock, vor mir zu sehen.
Bei aller Schwäche für das Königliche muss ich aber auch zugeben, dass ich nicht ganz frei bin von jener antiroyalistischen Missgunst, die in meiner Klasse, also jener Schicht knapp unterhalb der königlichen Hoheiten, Tradition hat. Es wird ja gerne angenommen, der Adel hege eine besondere Sympathie für Könige. Dieses in bürgerlichen Kreisen verbreitete Klischee beruht auf einem klassischen Missverständnis. Viel typischer für den Hochadel ist dessen Feindseligkeit den Königshäusern gegenüber. In der europäischen Geschichte sind die Adeligen meist die schlimmsten Gegner der Könige gewesen. Wenn sich Kaiser und Könige bei Hofe mit hohen Adeligen umgaben und sie in Dienst nahmen, dann nicht, weil man den Adel schätzte oder ihm gar vertraute, sondern um die Gefahr, die von ihm ausging, zu zähmen und ihn wahlweise durch Gefälligkeiten und Belohnungen gefügig zu machen oder durch Demütigungen kleinzuhalten.
Man muss sich nur vor Augen führen, wie ein Vorfahre von mir, Fürst Michael Galitzin, von seiner Herrin behandelt wurde… Er hatte Russlands Zarin Anna Iwanowna dadurch verärgert, dass er eine italienische Katholikin heiratete. Als die frühzeitig gestorben war, wir schreiben das Jahr 1740, zwang ihn die Zarin, ein weiteres Mal zu heiraten. Diesmal aber eine Dienstmagd, die zu allem Übel noch, schenkt man zeitgenössischen Beschreibungen Glauben, außergewöhnlich hässlich gewesen ist. Die Hochzeit, verkündete die Zarin, sollte das vollkommenste Spektakel werden, das Russland je gesehen hätte. Mein Ahne und die Magd wurden von einer gigantischen Prozession durch die Straßen St.Petersburgs begleitet, angeführt von Schweinen, Ziegen, Hunden und Kühen. Der kaiserliche Hofpoet war eigens mit einer Ode beauftragt worden, die den Titel «Jubel für das idiotische Hochzeitspaar» trug. Nach der Trauung wurden die beiden an den Ort ihrer Hochzeitsnacht geführt, einen gigantischen, eigens für den Anlass errichteten Eispalast. Die Zarin begleitete sie in das Innere des schmucken Kühlschranks, befahl ihnen, sich auszuziehen und auf einem aus Eis gehauenen Bett die Nacht zu verbringen. Die beiden überlebten diese Tortur nur knapp. Die Zarin amüsierte sich köstlich.
Ganz sicher bin ich nicht, wie mein Experiment ausfällt. Werde ich mit all dem, was ich über die Könige zusammentrage – den Legenden und dem Hintertreppenklatsch–, in meinem Herzen einen royalen Scherbenhaufen aufhäufen, oder werde ich ihnen ein Denkmal errichten? Ich bin gespannt.
Heiligenkreuz, im November 2007
It’s not easy being a Princess
Aufschrift auf dem Lieblingskissen
von Prinzessin Margaret
Kapitel eins
WIE REDET MAN KÖNIGE AN?
Ein Abendessen in Paris. Wir befinden uns in der alpinen Zone des europäischen Sozialgefälles. Madame Chirac, die Frau des ehemaligen Präsidenten, ist da, Lee Radziwill (die Schwester von Jackie O.), eine Handvoll Rothschilds, der Herzog von Marlborough, einer der vielen Brüder des saudischen Königs. Alles spricht also dafür, dass dies ein netter Abend wird.
Obwohl hier niemand ist, der sonderlich von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt wird, ist eine gewisse Nervosität spürbar. Denn der Ehrengast des heutigen Abends ist die zurzeit vielleicht glamouröseste Monarchin der Welt. Rania von Jordanien. Vor ihrer Ankunft gibt die Gastgeberin einem jungen Rothschild noch ein paar Anweisungen.
«Eine kleine Marschorder für später», sagt sie, «die Königin legt keinen gesteigerten Wert darauf, besonders behandelt zu werden. Also bitte keine allzu tiefen Verneigungen. Ein simpler Handkuss genügt.»
Ob man im Umgang mit ihr etwas beachten müsse, will er wissen.
«Tja,… nein, eigentlich nicht. Sie ist, wie gesagt, völlig unkompliziert. Allerdings müssen Sie wissen, dass die Königin sich über die geringfügigsten Kleinigkeiten aufregen kann. Also bitte etwas Vorsicht bei den Gesprächen.»
«Gibt es denn ein paar Anhaltspunkte? Ein Thema, das man besser umschiffen sollte?»
«Nein, nein, ich sagte doch, sie ist ganz unkompliziert, sehr aufgeschlossen, geradezu liebenswürdig. Manchmal kriegt sie halt etwas in den falschen Hals, da muss man eben ein bisschen aufpassen.»
«Aha, ich verstehe, aber wenn man nicht genau weiß…, ich meine, dann ist es doch schwer, überhaupt etwas zu sagen. Ach, und übrigens: Wie rede ich sie eigentlich an?»
«Also, das wäre schon mal ein grober Fehler. Selbstverständlich warten Sie, bis Sie angesprochen werden!»
«Natürlich, natürlich. Also, wenn ich ihr gegenübersitze, mit übereinandergeschlagenen Beinen, einen Drink in der Hand…»
Die Gastgeberin wird langsam nervös: «Mit übereinandergeschlagenen Beinen würde ich an Ihrer Stelle nicht dasitzen!»
Der junge Mann, inzwischen vollends verunsichert: «Vielleicht wäre es das Beste, ich würde gleich nach dem Essen verschwinden. Oder würde das unangenehm auffallen?»
«Nein, nein», sagt die Gastgeberin, «keineswegs.»
Ausgestattet mit diesen für den Umgang mit königlichen Hoheiten eigentlich universell geltenden Instruktionen, erwarten wir gespannt das Eintreffen Ihrer Majestät Rania Al-Abdullah, Königin von Jordanien, der Ehefrau des haschemitischen Herrschers und direkten Nachkommen des Propheten Mohammed, AbdullahII. bin Al-Hussein von Jordanien. Als sie endlich kommt, in einem hauchdünnen Chloé-Kleid, kaum Schmuck, dafür aber ein huldvolles Lächeln auf den Lippen und eine Hermès-Tasche unter dem Arm, lässt sie sich jeden Gast einzeln vorstellen. Als ich an der Reihe bin, murmele ich verlegen ein paar unverständliche Worte und verbringe den Rest des Abends in einer Art Trance.
Ich habe schon ein oder zwei wirklich schöne Frauen in meinem Leben gesehen. Aber Rania von Jordanien, that’s a whole new ballgame, wie man in Brooklyn sagen würde. Die Frau hat Charme. Und klug ist sie auch noch. Und dann diese aufreizend unnahbare Art. Als einer der Dienstboten mit einem Tablett neben ihr auftaucht, gebraucht sie gerade mal zwei Finger, um ihn fortzuscheuchen.
Den jungen Rothschild, der den Großteil des Abends neben ihr klebt und sie anhimmelt, würdigt sie keines Blickes. Ich glaube, so etwas nennt man in Paris allure. Sagt man in Paris von einer Dame, sie habe «allure», ist das bewundernd gemeint, das Wort hat hier eine ganz andere Bedeutung als das deutsche «Allüren». Im Laufe des Abends kommt es, wie es kommen muss, natürlich zu einem Fauxpas. Irgendjemand hat die Stirn, die Königin auf die Ressentiments anzusprechen, die man auch in aufgeklärten arabischen Kreisen gegenüber dem Westen hegt. Die Königin reagiert pikiert und verlässt das Abendessen vor dem Dessert.
Grundsätzlich ist es im Umgang mit königlichen Hoheiten empfehlenswert, gar nichts zu sagen. Nur dann kann man garantiert nichts falsch machen. Einmal habe ich erlebt, wie der Vetter meiner Frau, der «gefürchtete» Prinz Ernst August von Hannover, einem sogenannten Berliner Society-Event beiwohnte. Es war die «Aids-Gala», die jedes Jahr in der Deutschen Oper stattfindet. Irgendjemand hatte den Chef des Welfenhauses unvorsichtigerweise überredet, daran teilzunehmen. Ich konnte beobachten, wie eine der hiesigen Society-Größen ihn von der Seite anredete: «Wie soll man Sie eigentlich ansprechen?» Er würdigte ihn keines Blickes und sagte: «Am besten gar nicht!» Damit sprach er gelassen eine große Wahrheit aus.
Sein Onkel Prinz Georg von Hannover, der langjährige Direktor des Internats Salem am Bodensee, löste das Problem anders. Nie ließ er es sich entgehen, persönlich am traditionellen Hockey-Turnier Lehrer gegen Schüler teilzunehmen, seine Mitspieler hatten aber verständlicherweise enormen Respekt vor ihm und haderten mit der Frage, wie sie ihn auf dem Spielfeld rufen sollten. «Herr Direktor», «Königliche Hoheit» oder auch nur «Hoheit» war im Eifer des Spiels eher unpraktisch. Also legte er sich – für die Dauer des Spiels – ein Pseudonym zu: Max Pumpe. Mit diesem Namen ging der legendäre – und sehr sportliche – Direktor von Salem in die Annalen des Internats ein.
Im Grunde genommen ist es ein schmerzliches Defizit der deutschen Sprache, dass man hier niemanden höflich ansprechen kann, ohne seinen Namen zu wissen, «mein Herr» klingt ja leider etwas sehr kellnerhaft. Seit der Barockzeit hat sich im deutschen Sprachraum eine Anredevielfalt entwickelt, die es jedem, der sich nicht in sämtlichen Verzweigungen des Zeremoniells auskannte, fast unmöglich machte, die richtige Anrede zu finden. Die deutsche Neigung, die Anredeformen («hochfürstliche Durchlaucht», «erlauchtigste Majestät»…) ins Phantastische zu komplizieren, hat dazu geführt, dass jeder, der nicht zum Hofmarschall berufen ist, der Frage der korrekten Anrede von königlichen Hoheiten mit Unsicherheit und Unbehagen gegenübersteht – mit dem Ergebnis, dass das ganze Thema als Last empfunden und gleich alle Form über Bord geworfen wird. Als Königin Silvia von Schweden einmal bei «Wetten, dass…?» auftrat (hier bitte ein Stirnrunzeln dazudenken!), wurde sie von Thomas Gottschalk hartnäckig als «Hoheit» angeredet – und das war eben falsch. Hoheiten sind allenfalls die Mitglieder an der Peripherie einer Königsfamilie. Es gibt eine richtige Anrede: «Herr». Beziehungsweise: «Herrin». Streng genommen gibt es überhaupt keinen höheren Titel als «Herr». Eine Königin ist also «Herrin», «Madam», «Madame», «Señora» oder auf Schwedisch «Mästarinna».
In England spricht man den König als «Sire» an (ausgesprochen «Sai-er»), die Königin als «Madam». (ausgesprochen «M’am» wie Mäm). In Frankreich lautete die Anrede für den Chef des Hauses Bourbon «Sire». (ausgesprochen «Ssihr») und für seine Frau «Madame». (was ja eine Kurzform von «Mea Domina» ist, also eigentlich: «meine Herrin»), in Spanien «Señor» beziehungsweise «Señora».
In Russland wurde der Zar von den Bauern früher übrigens geduzt, also «Zar» und «Du». Das galt als besonderes Privileg der Bauern, die den Zaren auch zärtlich «Väterchen Zar» nannten.
Die Frage der Anrede von gekrönten Häuptern führt uns zu einer anderen Nuss, die noch zu knacken wäre. Was tut man eigentlich, wenn man in die Verlegenheit gerät, einem König oder einer Königin etwas schenken zu müssen? Die Antwort: entweder etwas absurd Extravagantes, ganz und gar Überflüssiges und sehr, sehr Teures. Oder einen gänzlich wertlosen Scherzartikel. Aber keinesfalls etwas, das irgendwie dazwischenliegt! Maßstäbe gesetzt in puncto passende Geschenke für Könige hat der Kalif Harun Al-Rashid, dessen Herrschaftsbereich zu Beginn des 9.Jahrhunderts von den Ufern des Indus bis zu den östlichen Gipfeln des Atlas reichte. Als ihm ein Gesandter vom Hofe Karls des Großen seine Aufwartung machte, war der Kalif entzückt über diese Abwechslung und gab dem Mann aus dem fernen Abendland einen weißen Elefanten für den Frankenkönig mit auf dem Weg. Der Elefant namens Abul Abbas überlebte die lange Reise sogar, und als er in Aachen ankam, wurde er zu der Sensation an Karls Hof. Karl war begeistert von dem Geschenk und führte den Elefanten auf Reisen gern als dekoratives Element mit sich. Erst Jahre später zog sich Abul Abbas leider eine Lungenentzündung zu und ging ein. In Aachen ist man bis heute stolz darauf, den ersten Elefanten nördlich der Alpen besessen zu haben.
Ein ähnlich gelungenes Geschenk brachte SigismundII. von Polen FerdinandI. von Österreich mit, als er diesen 1540 in Wien besuchte: das fast zweieinhalb Meter lange Horn eines Einhorns. Bis ins 17.Jahrhundert, als ein spielverderberischer dänischer Naturforscher namens Ole Worm nachwies, dass es sich bei den damals hundertfach in Gold aufgewogenen Geweihen des Fabeltiers in Wahrheit um Stoßzähne von Narwalen handelte, galt das Geweih eines Einhorns als kostbarste Substanz auf der Welt. Bis dahin zweifelte niemand an der Existenz des «seltenen» und «scheuen» Tieres, und man sprach ihm magische Fähigkeiten zu. Man glaubte, dass Einhörner als Einzelgänger in verzauberten Wäldern lebten, in denen ewiger Frühling herrsche und in denen es einen See geben müsse, in dem sich das zur Eitelkeit neigende Tier gerne im Spiegel betrachte.
FerdinandI. ließ das Horn nach Innsbruck schicken, um es beim ersten Bildhauer des Landes, Silvester Lechner, in ein reichverziertes, aufrecht stehendes Schmuckobjekt zu verwandeln. Das «Ainkhürn» ist heute in der Schatzkammer der Wiener Hofburg zu besichtigen und trägt dort ernüchternderweise die Inventarnummer XIV 2.
Hat man kein Einhorn (oder wenigstens ein Fabergé-Ei) zur Hand, sollte man einem König lieber nichts allzu Wertvolles schenken. Man bringt ihn damit nur in Verlegenheit, weil das ganze geschenkte Zeug, egal, wie scheußlich es ist, schließlich irgendwo aufgehoben werden muss, damit es bei einem eventuellen Gegenbesuch hervorgeholt werden kann (wie die abscheuliche Miniaturversion des indonesischen Präsidentenpalastes aus Weißgold, den Königin ElisabethII. einmal aus Jakarta mitbrachte). Auch sollte man tunlichst kein Tier schenken. Auf ihren Staatsbesuchen werden der Königin von England immer wieder Tiere aufgedrängt, die sie dann aus Höflichkeit nicht ablehnen darf. Sie landen grundsätzlich im Londoner Zoo. Wie der weiße Bulle, den ihr der König der Zulus 1995 bei ihrem Besuch in Südafrika schenkte, ein Elefant mit dem originellen Namen Jumbo (ein Präsent des Präsidenten von Kamerun) sowie etliche Schildkröten, drei Faultiere, zwei Grizzlybären, ein Krokodil und ein Zwerg-Hippopotamus.
Da die Schenkerei von Tieren bei Staatsbesuchen überhandgenommen hat, versuchen sich die Protokollbeamten am Hof von Buckingham bereits vor Reiseantritt mit den Gastgebern abzustimmen und raten inzwischen ihren Gegenübern von lebenden Tieren – mit Verweis auf die britischen Quarantänegesetze – ab. Die Königin selbst nimmt meist etwas «Persönliches» mit, etwa Wollschals mit schottischem Muster oder kleine, hölzerne Schmuckkästchen (aus der Manufaktur ihres Neffen David Linley). Allzu großzügige Geschenke werden als Wink mit dem Zaunpfahl grundsätzlich mit äußerst bescheidenen Gegenpräsenten beantwortet. Auf einer Reise nach Saudi-Arabien wurde Prinz Charles vom damaligen Kronprinz Abdullah ein Aston Martin im Wert von knapp hundertdreißigtausend Euro aufgedrängt. Charles schenkte ihm im Gegenzug eines seiner Aquarelle. Imelda Marcos bedachte Charles einmal mit einem Speedboat, er nahm es höflich an und ließ es (als der Marcos-Clan abgesetzt war) zugunsten einer Wohltätigkeitsorganisation versteigern.
Innerhalb der englischen Königsfamilie schenkt man sich zu Weihnachten grundsätzlich nur Scherzartikel. Als die Queen bei einem der zurückliegenden Weihnachtsfeste auf Schloss Sandringham das Paket ihres Enkels Harry aufmachte, zog sie zur großen Erheiterung der ganzen Familie eine Duschhaube mit der Aufschrift «Life’s a bitch» hervor. Seinem Onkel Andrew schenkte Harry vergangene Weihnachten ein G-String-Badekostüm, wie es Sacha Baron Cohen als Borat berühmt gemacht hat. Die Königin schenkte ihrer Schwester Margaret einmal ein kleines Kissen mit der Aufschrift «It’s not easy being a Princess». Margaret liebte dieses Kissen. Als vor ein paar Jahren «Big Mouth Billy Bass», der singende Fisch, in Geschenkläden auftauchte, war die Queen begeistert, ließ sich zwei Dutzend davon kaufen und verschickte ihn zu Weihnachten an ausgewählte alte Freunde.
Wenn «normale» Untertanen ihrer Königin Geschenke machen (jedes Jahr werden zwischen achttausend und zwölftausend Objekte unaufgefordert, aber hübsch verpackt, zum Buckingham-Palast geschickt), bereitet das den Hofbeamten vor allem eines: Mühe! Schließlich müssen die Dinge zunächst alle einzeln auf Sprengstoff untersucht, katalogisiert und irgendwo verwahrt werden. Und dann muss einer der Sekretäre auch noch artig Dankesbriefe schreiben. Aber es gibt Ausnahmen. Kürzlich besuchte die Königin das Queen Elizabeth Hospital in King’s Lynn (Norfolk) und bekam von einer Patientin namens Betty Hyde eine Banane geschenkt. Das empfand die Queen als sehr aufmerksam. Betty Hyde revanchierte sich damit nämlich für eine Banane, die sie ihrerseits als fünfjähriges Mädchen von der jungen Prinzessin Elisabeth geschenkt bekommen hatte, als diese mit ihrer Mutter während des Krieges ebenfalls ein Krankenhaus besucht hatte. Es gibt sie also, passende Geschenke für gekrönte Häupter. Aber man bewegt sich hier auf hauchdünnem Eis. Man muss schon sehr genau wissen, was man schenkt.
Royals sind ein sehr eigenartiger Menschenschlag. Ganz werden wir sie nie verstehen. Um es wenigstens zu versuchen, werde ich mein Thema nun etwas systematischer angehen.
Wie groß sind die Könige,
wenn sie wissen, wovon sie sind,
durch wen sie es sind und warum
sie es sind!
Louis de Bonald
Kapitel zwei
WIE WIRD MAN KÖNIG?
Am 16.August 1923 erschien in der Londoner Tageszeitung Evening Standard folgende als Stellengesuch aufgemachte Meldung: «Gesucht: ein König. Englischer Landedelmann bevorzugt. Bewerbungen sind an die albanische Regierung zu richten.» Über siebzig Bewerbungen gingen ein. Leider waren die meisten Anwärter nicht Landedelleute, sondern Bewohner des Londoner Speckgürtels. Immerhin waren auch ein konservativer Parlamentsabgeordneter sowie ein amerikanischer Blechdosenfabrikant darunter.
Ende des 19. und Anfang des 20.Jahrhunderts, als das Osmanische Reich peu à peu zerfiel, gab es mehrere neue Throne in Europa, die besetzt werden wollten. Die Krone Griechenlands wurde, nachdem der unglückliche König Otto aus dem Hause Wittelsbach in Athen gescheitert war, unter Fürstenfamilien in ganz Europa wie Sauerbier angeboten. Schließlich fiel die Wahl auf Prinz Georg von Schleswig-Holstein. Der wollte zwar nicht nach Athen ziehen, aber als sein Onkel, der König von Dänemark, ihm mit der Streichung seiner monatlichen Apanagen drohte, nahm er die Stelle doch an.