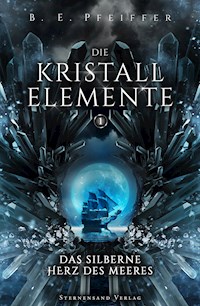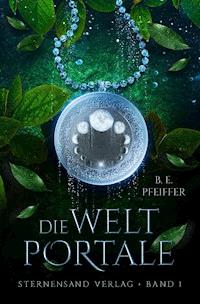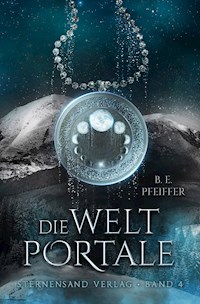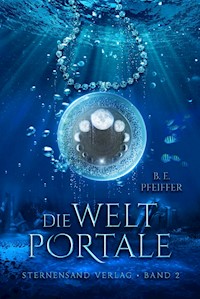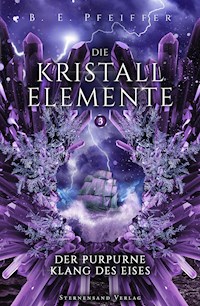4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eigentlich will Hermes nur ein ruhiges Leben führen, unbehelligt von den anderen Göttern und mit gelegentlichen Spezialaufträgen als Dieb. Denn diese Aufträge lenken ihn von der einen Sache ab, die er nicht haben kann, und zwar Shenan, seine Vorgesetzte im Museum. Als eines Tages der wohlhabende Mr Bourne auftaucht, um Hermes für einen Diebstahl anzuheuern, weiß dieser bereits, dass etwas mit seinem Auftraggeber nicht stimmt, und will ablehnen. Doch Mr Bourne nutzt die Zuneigung des Gottes zu Shenan und bringt ihn so dazu, gemeinsam mit ihr nach Bangkok zu fliegen, um ein Armband zu stehlen. Allerdings ahnt Hermes zu diesem Zeitpunkt noch nicht, mit welchen Mächten er sich einlässt, und stolpert so ungewollt in ein lange verschollenes Geheimnis: jenes der Libellenmagie. Libellenmagie ist nicht nur der Auftakt einer neuen Trilogie, in der es um den Gott der Diebe geht, sondern auch das Selfpublishing Debüt von B.E.Pfeiffer, die damit einen neuen Weg beschreiten möchte, jenseits der Verlagswelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
LIBELLENMAGIE
GOTT DER DIEBE BAND 1
B.E. PFEIFFER
Copyright © 2022 by Bettina Pfeiffer, Wiener Straße 25/1 2500 Baden – Österreich www.bepfeiffer.com [email protected]
Umschlaggestaltung: Vivien Summer
Lektorat: Diana Steigerwald
Korrektorat: Carolin Diefenbach
Satz: Bettina Pfeiffer
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form sind vorbehalten. Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Erstellt mit Vellum
Für meine Göttinnen. Weil ihr mir den Mut gegeben habt, meine Flügel auszubreiten und zu fliegen.
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Willst Du wissen, wie Hermes und Shenan sich kennengelernt haben?
So geht es weiter …
Danksagung
Bücher von B.E. Pfeiffer
Über den Autor
1
Es knackt unter meiner Schuhsohle. Verflucht, ich habe schon wieder eine Falle ausgelöst! Wie hätte ich aber auch damit rechnen sollen, dass diese Ruine einer vergessenen Zivilisation, deren Namen ich nicht einmal aussprechen kann, so gespickt mit Fallen ist?
Dabei bin ich schon so oft in Tempel wie diese eingebrochen, um einen ach-so-wichtigen Gegenstand an mich zu bringen. Wie viele solcher Aufträge ich schon gemeistert habe, weiß ich nicht. Es ist auch gleichgültig. Ich ärgere mich nur, weil ich einen solchen Anfängerfehler begangen habe.
Bedächtig hebe ich den Fuß an, prüfe, wann der Schalter, den ich aktiviert habe, nachgibt. Ich lasse meinen Blick gleichzeitig über die von Schlingpflanzen überwucherten Wände und die Decke über mir gleiten. Für gewöhnlich waren die Architekten solcher Tempel nicht sehr einfallsreich, was ihre Fallen anbelangt. Normalerweise lösen Trittfallen wie diese irgendwelche Pfeilmechanismen aus, die Leute wie mich durchbohren. Manchmal gleitet eine Klinge aus der Wand heraus, die einen enthaupten soll. Obwohl ... manchmal soll die Klinge einen auch einfach nur in zwei Teile spalten. Ja, und ganz selten fallen irgendwelche Dinge von oben herab. Riesige Felsbrocken etwa, die einen unter sich begraben. Barbarische Todesurteile, wenn man mich fragt. Aber das macht ja keiner.
Ich schiebe den Gedanken beiseite und konzentriere mich wieder. Ich entdecke allerdings keine Schlitze, die auf Pfeile oder etwas anderes hingedeutet hätten, das aus der Wand fahren kann, um mich zu töten. Möglicherweise ist diese Falle genauso ein Blindgänger, wie die letzten zwei, die ich ausgelöst habe. Wohlgemerkt absichtlich ausgelöst habe, um die Kreativität der Tempelbauer zu testen. Entweder hatten sie nie vor, das, was sie hier verstecken, wirklich zu beschützen, oder sie wollten Diebe in Sicherheit wiegen. Da die Anlage hier allerdings ziemlich alt ist, könnten die Mechanismen einfach kaputt gegangen sein. Nennt sich wohl Alterserscheinung, trotzdem sollte ich mich nicht darauf verlassen, dass keine einzige Falle mehr funktionstüchtig ist.
Deswegen prüfe ich den Sitz meines Ausrüstungsgürtels und der Tasche, die ich quer über meinen Oberkörper befestigt habe. Ich will nichts verlieren, falls ich gleich schnell laufen muss, schon gar nicht hier. Nachdem ich sicher bin, dass alles gut sitzt, werfe ich meinen Kopf nach links und rechts, bis meine Halswirbel knacken und spanne meinen Körper an.
Ganz langsam ziehe ich den Fuß zurück und schlucke, weil der Schalter erneut knackt. Aber nichts geschieht. Noch einmal atme ich tief durch. Nein, scheinbar ist auch diese Falle kaputt. Ich will schon erleichtert weitergehen, als ein Tropfen auf meiner Nasenspitze landet. Er klebt ein wenig und riecht einfach nur ekelhaft. Noch ein Tropfen landet auf meinem Kopf.
Ich wische ihn mit meinen Fingerspitzen ab und betrachtet ihn. Er schimmert grünlich-schmierig und riecht nach Fäulnis und ... Petroleum?
»Verdammte Mistkerle«, zische ich und laufe jetzt doch los.
Immer mehr von dieser Flüssigkeit regnet aus der Decke herab. Wenn ich Glück habe, ist nicht mehr genug von dem Zeug übrig, um hier alles in Flammen aufgehen zu lassen. Eine brillante Falle, das musste ich den Architekten lassen. Pfeilen kann man theoretisch ausweichen, Flammen fressen alles, das sich nicht schnell genug in Sicherheit bringt, auf.
Unaufhaltsam tropft es von der Decke, überzieht alles mit einer dünnen Schicht Petroleum. Meine Schritte werden unsicherer, ich rutsche mehrmals fast aus und schaffe es, mir meine nagelneue Hose zu zerreißen.
»Das wird teuer für den Kerl«, schnaube ich.
Wieso muss eigentlich immer ich von zwielichtigen Ganoven aufgesucht werden um irgendwelche verlorengeglaubte Schätze zu suchen? Ach ja, weil ich diese Art von Typ bin, der jeden Auftrag annimmt. Besonders, wenn er eine Reise einbringt und nach einem Himmelfahrtskommando klingt. Ich brauche das vermutlich für mein Ego. Wie auch immer ...
Als hinter mir ein Knacken erklingt und ich ein Zischen höre, ist mir klar, dass ich zu langsam bin. Gleich wird hier alles in Flammen stehen, inklusive mir. Ich kann viel aushalten, aber zu verbrennen ist selbst für mich tödlich.
»Na gut, ich tue das nicht gerne, aber es geht nicht anders«, sage ich zu mir selbst und schnippe mit den Fingern.
Hellblaues Licht umfängt mich augenblicklich und gleichzeitig ziehen sich meine Eingeweide zusammen. Aber ich habe keine Wahl, wenn ich nicht als Barbecue Spieß enden will.
Flügel brechen aus meinen teuren Lederschuhen heraus. Zum Glück waren die ohnehin schon durch das Petroleum ruiniert und somit kein großer Verlust. Deswegen zische ich nur leise, als ich mit Lichtgeschwindigkeit – im wahrsten Sinne des Wortes – durch einen Felsbrocken, der herabfällt und mir den Weg versperrt, hindurch schieße und mir die Nase gebrochen hätte, wenn ich in dem Moment nicht unverwundbar gewesen wäre.
Ja, in diesem Augenblick bin ich ein Gott. Einer, der es nicht sein will. Aber ohne den göttlichen Schub wäre ich nie rechtzeitig aus diesem Raum gekommen, der hinter mir bereits in Flammen aufgeht. Was ich nicht sehen kann, ich rieche nur das Petroleum, das alles verbrennt und höre das Knacken des Holzes und das Zischen der Pflanzen, die vom Feuer verschlungen werden.
Ich erreiche den nächsten Raum, schnippe erneut, und meine Göttlichkeit verschwindet wieder. Zurück bleiben brennende Eingeweide und Stiche wie aus tausend Nadeln auf meiner Haut. Keuchend sinke ich zusammen und wälze mich über den Boden.
Göttlichkeit fordert einen Preis. Das weiß ich und die anderen Götter vermutlich auch. Aber nachdem mir bewusst wurde, was es kostet, seine Göttlichkeit einzusetzen, entschied ich mich, keiner mehr sein zu wollen. Was ich vor rund zweitausend Jahren getan habe und so gut wie nie bereue. Besonders nicht, wenn ich den Preis zahlen muss, wie jetzt.
»Verfluchter Mist«, stöhne ich und bleibe auf dem Rücken liegen.
Meine Hände zittern und ich muss mich stark beherrschen, um mich nicht zu übergeben. Ich hätte meine Kräfte auch anders rufen können. Aber das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Nicht, seitdem ich gesehen habe, was es anderen Lebewesen antut, wenn sie für meine Göttlichkeit leiden müssen.
Nein, ich will kein Gott mehr sein. Nie wieder. Vielleicht wäre es anders, wenn ich unter den obersten Göttern nicht derjenige gewesen wäre, den sie wie einen Spielball verwendet haben, um sich gegenseitig etwas anzutun. Oder sie nett zu mir gewesen wären. Aber dieser verlogene Haufen kann mir gestohlen bleiben. Ich lebe lieber als Mensch unter Menschen. Auch, wenn das bedeutet, alle paar Jahre seine Identität zu wechseln.
Denn obwohl ich meine göttlichen Kräfte nicht nutze, altere ich nicht. Hätte man mein Blut in Flaschen abgefüllt und sich ins Gesicht geklatscht, wäre man auch für einige Jahre alterslos gewesen. Hoffentlich finden die Kosmetikkonzerne das nie heraus. Wobei ... die Werbung dafür wäre bestimmt lustig gewesen. In einem Labor von meinem gesamten Blut beraubt zu werden wohl eher weniger. Aber hey ... ich bin irgendwie unsterblich. Großteils. Also, mein Körper heilt schneller als der von Menschen. Deswegen überlebe ich diese grauenhaften Schmerzen wohl auch, die in mir toben.
Rauch steigt mir in die Nase und ich setze mich auf, als ich meinen Körper endlich wieder im Griff zu haben glaube und nicht ständig denke, ich würde mich gleich übergeben.
Ich werfe einen Blick auf das Inferno, das bei der Tür, durch die ich gekommen bin, Halt macht. Offensichtlich war das Feuer dazu gedacht, alles in dem Gang, aus dem ich komme, zu verbrennen und anschließend den restlichen Tempel mit Gestank zu verpesten. Ich befürchte allerdings, dass es sich dabei nicht bloß um den Gestank nach faulen Eiern handelt, sondern irgendein Gift, das mich vermutlich bald umbringen wird. Gott hin oder her, wenn ich meine Göttlichkeit nicht einsetze, bin ich sterblich. Nicht so leicht sterblich, wie ein Mensch, aber ... ich kann umkommen. Besonders durch Gift.
Ich stoße den Atem aus. »Wieso muss auch irgendjemand eine Pfeilspitze eines ägyptischen Gottes hier in einem Tempel am Rand der Zivilisation verstecken?«, brumme ich und stehe auf. »Was macht die überhaupt hier? Ägypten ist zu Fuß etwa drei Jahre entfernt! Und ein Meer liegt auch dazwischen. Von dem elenden Regenwald, den man erst mal durchqueren muss, rede ich gar nicht!«
Meine Welt dreht sich noch ein wenig und ich stoße den Atem erneut aus. Die Nachwirkungen des göttlichen Geschenks schmerzen immer noch in meinen Gliedern. Oder vielmehr die Nachwirkungen, diese Gabe wieder abgelegt zu haben. Bewusst nicht weiterhin zu gebrauchen. Dieser Entzug ist irgendwie immer das Schlimmste. Den Schmerz vergisst man schnell, aber das Verlangen, doch wieder göttlich zu sein, bringt mich jedes Mal fast um den Verstand.
Ich huste und versuche, mich in dem von Qualm vernebelten Raum zu orientieren. Ich bin durch einen Korridor aus der Hauptkammer bis hierher gekommen. Da ich durch den Rauch nichts mehr erkennen kann, weiß ich nicht, welchen Zweck dieser Ort erfüllt hat. Und somit kann ich nur raten, wo genau ich mich jetzt befinde. Ich zermartere mir das Hirn, ob dies wohl schon der Opferraum des Tempels ist, oder nur eine Vorhalle davon. Wenn ich Glück habe, liegt hinter der nächsten Tür die Schatzkammer. Wenn ich Pech habe, eine weitere Falle.
Aber welche Alternativen bleiben mir, nun, da der Weg, dem ich her gefolgt bin, in Flammen steht?
Ich gebe mir Mühe, etwas in dem dunstigen gräulich-blauem Nebel zu erkennen, das auf eine weitere Falle hingewiesen hätte. Aber meine Augen brennen von dem Rauch und dem Gift so verflucht schmerzhaft, dass ich so gut wie nichts sehe.
Immer noch hustend erreiche ich eine Wand und taste sie ab. Nirgendwo eine Vertiefung, die auf einen Ausgang hingewiesen hätte und der Rauch wird mit jedem Herzschlag dichter.
»Großartig, ich werde hier zu Räucherschinken und sehe nichts«, keuche ich und klatsche in die Hände.
Ein orkanartiger Wind kommt auf und meine Schläfen pochen wie verrückt, während ich mir einen Moment Sicht durch meine göttliche Gabe verschaffe. Dieser Raum besitzt nur eine einzige Tür. Jene, aus der ich gekommen bin.
Ich rufe mir die Pläne dieses Orts ins Gedächtnis, die mein Auftraggeber mir gegeben hatte. Der Tempel ist zu groß, um hier zu enden. Es muss noch einen Ausgang geben.
Der Wind legt sich und ich werfe mich sofort auf den Boden, robbe über die glatt geschliffenen Steine, bis meine Finger seltsame Muster auf einem Stein ertasten. Ein Quadrat aus vier Bodenplatten, das vermutlich mit Schriftzeichen verziert ist. Da ich immer noch nichts sehe, muss ich mich auf gut Glück verlassen. Aber ich habe nicht viele Alternativen. Deswegen hebe ich meine Faust und schlage mit aller Kraft zu.
Es knirscht und da ich keinen Schmerz empfinde, gehe ich davon aus, dass der Boden unter mir bricht und nicht meine Hand. Noch einmal schlage ich zu, diesmal stoße ich aber einen derben Fluch aus, da meine Handkante nun doch brennend heiß pulsiert. Trotzdem hebe ich meine Faust erneut und prügle auf den Boden ein.
Die Platten brechen endlich und kühle, modrige Luft steigt aus dem Loch vor mir auf. »Alles ist besser, als hier geräuchert zu werden«, feuere ich mich selbst an, drehe mich um, damit ich meine Füße in die Öffnung schieben kann und gleite mit den Beinen voraus in das dunkle Loch.
Es ist nicht tief, und obwohl ich kein Hüne von einem Mann bin, kann ich nur auf allen Vieren darin Platz finden. Ich knipse meine Taschenlampe an und beleuchte die Umgebung. Ich sitze in einer Art Weggabelung mit drei Korridoren. Einer zu meiner rechten, einer hinter mir und einer vor mir.
Mir ist klar, dass nur ein einziger nicht in den sicheren Tod führt. Ich weiß nur nicht, wie ich mich entscheiden soll. Vor meinem inneren Auge rufe ich wieder den Grundriss des Tempels auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Korridor hinter mir unter dem Gang hindurch führt, der jetzt in Flammen steht. Also muss ich mich ›nur‹ zwischen dem vor mir und dem zu meiner Rechten entscheiden.
»Ene, mene, muh«, grinse ich und schüttle den Kopf. Das Gift, das mit dem Rauch die Luft erfüllt, scheint meine Denkkraft lahm zu legen. Wenn ich mich nicht bald bewege, werde ich hier sterben. Außer, ich würde zum Gott werden. Aber wo bliebe da der Spaß?
»Hermes, du bist ein Trottel«, lache ich vor mich hin und betrachte die Dunkelheit des Gangs rechts. Sie kommt mir weniger dunkel vor, als jene aus dem Korridor vor mir. Eine großartige Begründung, aber irgendwie fällt mir nichts Besseres ein.
Ich zucke mit den Schultern und setze mich in Bewegung. Nur weg von dem Rauch und dem Gift, das mich um den Verstand bringt.
Während ich mein eigenes Lachen höre, wird die Luft frischer und die Gedanken klarer. Ich versuche gerade zu überlegen, wie weit ich wohl gekrochen bin, als meine Hand nicht den Boden unter mir berührt, sondern ins Leere greift und ich wohl mit dem Gesicht aufgeschlagen wäre, wenn ich nicht bereits über eine Rutsche nach unten geschlittert wäre.
»Scheiße«, brumme ich und reiße die Augen auf, als vor mir helles Licht erstrahlt.
Entweder sterbe ich jetzt oder ich bin in Sicherheit.
Mit einem lauten Knall schlage ich auf dem Bauch auf und halte mir die Nase. »Nur angeknackst«, keuche ich erleichtert, weil ich kein Blut schmecke, und hebe den Kopf, um mich umzusehen.
Sonnenlicht bricht durch die Decke und das Zwitschern der Vögel des Dschungels dringt an meine Ohren. Unmittelbare Gefahr entdecke ich nicht.
Ich komme auf meine Knie und taste meinen Körper ab. Nachdem ich sicher bin, dass - von meiner Nase abgesehen - nichts gebrochen ist, stehe ich auf.
Immerhin kann ich hier aufrecht stehen, obwohl der Raum alles andere als groß ist. Langsam zweifle ich daran, dass ich diese verfluchte Pfeilspitze hier finden werde. Denn, von ein paar Lianen und abgenagten Knochen abgesehen, ist dieser Ort vollkommen leer.
Mein Blick fällt auf die Gebeine, die fast säuberlich aufgeschichtet sind und mir wird übel. »Menschenknochen?«, flüstere ich und ziehe die Pistole aus dem Halfter an meiner Hüfte. Für gewöhnlich nutze ich solche Waffen nur im Notfall. Das hier könnte einer werden.
Schmatzende Geräusche erklingen und ich fluche innerlich. Hier unten lebt eine Kreatur, die vermutlich so alt ist, wie ich. Die Frage ist, ob sie es wagt, mich anzugreifen, oder ...
In dem Moment springt etwas in mein Gesicht und ich fühle Krallen, die sich in meine Haut bohren. Brüllend tobt die Kreatur, als ich sie von mir pflücke und am Kragen gepackt halte.
»Uäh, wieso müsst ihr Schrumpfköpfe so hässlich sein?«, zische ich.
Ein Gnom, etwa so hoch wie mein Unterarm lang, mit riesigem Körper und winzigem Kopf mit leuchtend gelben Augen, starrt mich an.
»Das könnte ich dich auch fragen, elender Gott«, zischt er zurück. »Mein Lager. Such dir ein eigenes.«
»Ich will nichts von deinem Lager«, sage ich finster und funkle ihn an, als er versucht, mit seinen Krallen nach meinem Arm zu schlagen, um sich zu befreien. »Es sei denn, du hast eine Pfeilspitze, die vermutlich aus Ägypten stammt.«
»Habe ich nicht«, faucht der Schrumpfkopf und verschränkt die Arme. »Diese Pfeilspitze ist boshaft und grell. Sie liegt draußen unter einem Stein.«
»Hast du sie dort hin gebracht?«, frage ich.
»Ja, und ich habe heute noch Brandflecken auf meinen Händen«, erklärt er und hebt seine verformten Finger.
Beim besten Willen habe ich keine Ahnung, was daran Brandflecken sein sollen, denn sie sind von Warzen übersät. Und damit hat er in meinem Gesicht rumgekratzt ...
»Führ mich hin und ich bin schneller weg, als du Pfeilspitze sagen kannst.«
»Was springt für mich raus?«, will er wissen.
Ich hebe meinen Mundwinkel. »Ich lasse dir deine Knochen. Ansonsten kannst du ihre Asche beweinen.«
Ich weiß, dass diese Wesen ihre Sammlungen lieben. Keine Ahnung, ob er die Menschen, die hier liegen, getötet hat, oder sie irgendwo gefunden hat. Vermutlich letzteres, aber ich nehme an, dass sich so bald ohnehin kein Mensch hier her wagen wird und er deswegen ungefährlich ist.
Meine Drohung wirkt, der Schrumpfkopf reißt die Augen auf. »Das wagst du nicht!«
»Wetten?«, grinse ich, stecke meine Pistole weg und ziehe ein Feuerzeug aus einer meiner Hosentaschen.
Als es klickt und der Schrumpfkopf die Flamme sieht, die seine Schätze bedrohen, zittert er. »Schon gut! Ich bringe dich hin, hässlicher Gott.«
»Geht doch«, meine ich und stecke das Feuerzeug weg. »Und hör auf, mich hässlich zu nennen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich dir glauben.«
2
Zwei Tage liegt mein Zwischenfall in dem Tempel zurück. Zwei Tage. Und ich rieche immer noch wie Räucherschinken.
Ich gehe durch das Museum, in dem ich arbeite, vergrabe meine Nase gerade in meiner Ellbogenbeuge, als ein Räuspern mich hochschrecken lässt. »Mr. Winter, spät wie immer«, tadelt mich eine samtweiche Frauenstimme. Samtweich und gleichzeitig gefährlich wie Gift selbst.
»Ms. Hart«, lächle ich und drehe mich zu meiner Vorgesetzten um.
Dr. Shenandoah Hart, für ihre Freunde Shenan, für mich Ms. oder Dr. Hart, steht in einer dunkelblauen Jeans und mit einer weißen Bluse mit Schluppenkragen vor mir. Sie trägt wie immer Pumps und einen schwarzen Blazer, den sie jetzt über ihrem Arm hängen hat. Immerhin kann man schon den Sommer fühlen, der hier wohl erst im Juli richtig losgeht. Aber es ist bereits ziemlich warm in der Früh.
Einer von Dr. Harts Vorfahren muss ein Ureinwohner Amerikas gewesen sein. Zumindest habe ich das aus ihrer Akte erfahren. Sie hätte es mir ja nie erzählt, obwohl wir eng zusammen arbeiten. Aber die pechschwarzen Haare, die sie immer aufgesteckt trägt, und der etwas dunklere Teint könnten darauf hindeuten, dass es stimmt. Ich habe auch ihren Namen gegoogelt, weil er eher ungewöhnlich ist.
Auch er entstammt einer Sprache der Ureinwohner und bedeutet »Tochter des Abendsterns«. Als ich sie das erste Mal sah, funkelte sie wirklich wie ein Stern. Dr. Hart ist wunderschön, aber sie kann mich kein Stück leiden.
Was meine Schuld ist. Aber besser für uns beide. Ich hatte sie in einer Bar getroffen, zwei Tage, bevor ich die Stelle mit meiner neuen Identität als Harrison Winter in diesem Museum im Osten der USA antrat. Wir verstanden uns prächtig, haben geknutscht und ich wollte sie eigentlich abschleppen.
Bis mir klar wurde, dass ich mich mehr zu ihr hingezogen fühlte, als gut für mich war. Götter sollten sich nicht verlieben und hätte ich mit ihr geschlafen, hätte ich sie vielleicht wiedersehen wollen. Nein, ich hätte sie bestimmt wiedersehen wollen. Ich kenne mich mit solchen Verbindungen aus.
Manch einer mag sie belächeln, ich weiß, dass es Schicksal gibt, weil ich die Dame ganz gut kenne. Sie heißt Tyche, lenkt das Schicksal. Wir sind irgendwie verwandt und sie verfolgt einen eigenen Plan mit den Fäden, die sie spinnt und legt. Warum sie Dr. Hart und mich füreinander bestimmt hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wie es Menschen ergeht, die eine Beziehung mit Göttern eingehen.
Deswegen habe ich sie stehen lassen und vor ihren Augen angefangen, eine andere zu knutschen. Dass ich eben zwei Tage später als ihr Assistent beginnen sollte, war wirklich Pech. Riesiges Pech. Aber ich hätte wissen müssen, dass Tyche mich nicht so leicht vom Haken lässt.
»Hängen Sie schon wieder Ihren Tagträumen nach?«, schnaubt Dr. Hart und reißt mir ein Exponat aus der Hand, das ich eigentlich längst zurückbringen wollte und gerade aus meiner Tasche gezogen habe, bevor ich meinen Geruch überprüft habe ...
Ich habe das Ding seit einer Woche ständig in meiner Wohnung vergessen. Zum Glück hat Dr. Hart sein Verschwinden bisher wohl nicht bemerkt.
»Was haben Sie damit vor?«
»Ich wollte es nur an seinen Platz bringen«, räuspere ich mich und betrachte die Tonscherbe, die wohl einmal ein Krug war. »Jemand hat es in der Mongolei abgestellt und ich habe es auf meinem Weg zum Büro entdeckt.«
Sie zieht eine Augenbraue hoch und ihre dunklen Augen durchbohren mich. Ich kann ihre Abneigung aufblitzen sehen. Sie sieht nur das, was ich sie sehen lasse. Für Dr. Hart bin ich ein überheblicher Aufreißer, ein Faulpelz und ein Dieb. Mit dem letzteren hat sie tatsächlich recht, obwohl ich mir diese Scherbe wirklich nur ausgeliehen habe, um Hinweise auf die Pfeilspitze zu finden.
Jene Pfeilspitze, die ich vorgestern gefunden und meinem Auftraggeber geschickt habe. Sie ist erstaunlicherweise wirklich ägyptisch aber zum Glück nicht von einem Gott. Sonst hätte ich sie nicht hergeben dürfen. Ich habe nämlich entschieden, nichts Gefährliches auf die Menschenwelt loslassen zu wollen. Vermutlich nehme ich deswegen alle Aufträge an, um sicherzugehen, dass nicht irgendjemand etwas mit Kräften findet, die nicht für Menschen bestimmt sind. Aber da die Pfeilspitze über keinerlei Magie oder Göttlichkeit verfügt, darf sie der alte Mann, der sich davon ewiges Leben verspricht, gerne haben und hoffen, dass sie ihr Geld wert ist.
»Und weswegen sind Sie dann in der römischen Ausstellung?«, zischt sie und schüttelt den Kopf. »Das ist ein Teil eines Krugs aus dem etruskischen Reich.« Sie seufzt und reibt sich die Schläfen. »Wieso merken Sie sich den Unterschied nicht?«
»Ich kann nichts dafür, dass eure Forscher manche Dinge falsch zugeordnet haben und jetzt jeder die Fehler einfach weiterlaufen lässt«, raune ich zu mir selbst.
Dass die Menschen nicht immer recht haben ist nichts Neues für mich. Dr. Hart kann nichts dafür, dass sie ihr Wissen auf falschen Schlussfolgerungen aufbaut. Aber da sie mir nicht glauben wird, muss ich meine Meinung hinunter schlucken und nicken. Was schade ist. Shenan, wie ich sie manchmal in Gedanken nenne, bevor ich mich daran erinnere, dass sie tabu ist, ist klug. Sehr klug sogar. Sie versteht komplexe Zusammenhänge und kann sie jedem mit einer Leichtigkeit erklären, dass auch ein Kind es verständlich findet. Vielleicht fasziniert mich das an ihr. Oder das Lächeln, das sie manchmal auf dem Gesicht hat, wenn sie denkt, ich merke es nicht. In ihr steckt ein bezaubernder Kern, sie verbirgt ihn nur hinter dicken Mauern. Mauern, hinter die ich kurz blicken durfte, an jenem Abend. Aber danach hat sie wohl ein komplettes Abwehrsystem installiert. Ich kann es ihr nicht übel nehmen.
»Verzeihen Sie, Dr. Hart. Ich kann mir das einfach nicht merken«, murmle ich, nachdem ich wohl einen Moment zu lange geschwiegen und sie angestarrt habe. Aber etwas an ihr lässt mich sie einfach nicht vergessen ...
»Immerhin wissen Sie, dass es nicht in die Mongolei gehört«, seufzt sie und ich erahne den Anflug eines Lächelns. Der verschwindet allerdings sofort wieder, als unsere Blicke sich treffen. »Das erklärt aber nicht, wieso Sie schon wieder zu spät sind.«
Ja, warum bin ich noch gleich zu spät. Weil ich erst gestern Nacht aus dem Amazonas zurückgekehrt bin und bis in die frühen Morgenstunden mit meinem Auftraggeber diskutieren musste, ob die Pfeilspitze, für die er angeblich morden würde, wirklich echt ist, oder nicht.
Ein Glück nur, dass ich nicht auf Schlaf angewiesen bin, sonst würde ich wohl jetzt einfach umkippen und schnarchen.
»Harrison!«, zischt sie und ich konzentriere mich wieder auf sie.
Ich räuspere mich und suche nach einer Ausrede. Irgendeiner. Verschlafen. Wasserrohrbruch. Der One-Night-Stand, den ich nicht los wurde. Es ist gleichgültig, ich habe mir nie wirklich Mühe damit gegeben, meinen Ausführungen glaubhaft zu machen. Weil ich will, dass sie mich nicht leiden kann. Denn ... ich empfinde zu viel für sie und das könnte sie ihr Leben kosten.
Gerade setze ich zu einer Antwort an, als sie ihre Hand hebt und den Atem gedehnt ausstößt. »Wissen Sie was, es ist mir eigentlich egal«, meint sie und sieht mich erschöpft an.
Ich weiß, dass sie zu viel arbeitet, gewissenhaft ist. Anders als ich. Ganz anders. Es liegt in meiner Natur, ich nehme die Dinge nicht ernst, versuche überall, etwas Spaß hineinzubringen. Shenan ... sie ist gründlich und sie kämpft für ihren Traum. Dieses Museum zu leiten scheint ihre Erfüllung zu sein, ganz gleich, wie schwer es ist. Ich mache es ihr mit meinem Verhalten wohl auch nicht leicht. Trotzdem ist sie meistens sehr rücksichtsvoll, was ich gar nicht verdient habe, indem sie mir meine spontanen Urlaube genehmigt, wenn ich einen Auftrag annehme.
Aber wenn ich die Schatten unter ihren Augen sehe, fühle ich mich schuldig. Ich sollte sie nicht alleine lassen und vielleicht ... sollte ich ihr zeigen, dass sie sich doch auf mich verlassen kann.
»Ich kann Sie nicht entlassen, weil Sie zu spät kommen«, fährt sie seufzend fort. »Egal, wie oft es passiert. Dazu fehlen mir Alternativen und, wie gesagt, zumindest wissen Sie, dass diese Scherbe nicht in die Mongolei gehört. Das hebt Sie schon von neunzig Prozent der anderen Bewerber für diesen Posten ab.«
»Das klingt fast wie ein Kompliment, Dr. Hart«, grinse ich und versuche, meine Schuldgefühle wegzuschieben. Gelingt mir nicht.
»Wischen Sie sich das dämliche Lächeln aus dem Gesicht, Winter«, schnaubt sie. Heute ist sie wohl noch weniger für meinen Charme empfänglich als sonst, und das heißt etwas. Sie steigt selten auf meine Scherze oder Komplimente ein. Liegt vermutlich an ihrem Abwehrsystem. »Machen Sie sich an die Arbeit. Wir öffnen gleich und heute kommen drei Schulklassen, die sich die Griechenland Ausstellung ansehen wollen.« Sie hebt eine Augenbraue. »Mit der griechischen Mythologie sind sie vertraut?«
Wenn sie nur wüsste ... »Ich habe die Bücher, die Sie mir gegeben haben, studiert. Ich fühle mich bereit, eine Klasse zu übernehmen.«
Sie sieht mich skeptisch an, nickt dann aber. »Gut. Die erste führen wir gemeinsam, die zweite machen Sie alleine. Die dritte überlegen wir uns im Anschluss.«
»Danke«, sage ich und folge ihr zuerst in den Raum für die etruskischen Exponate, wo sie die Scherbe behutsam an ihren Platz legt, bevor wir in ihr Büro gehen.
Wir teilen uns den Raum. Schließlich bin ich ihr Assistent und das ist nicht das ›British Museum‹, sondern ein überschaubares Museum in einer Kleinstadt an der Ostküste der USA. Neben uns beiden gibt es noch drei Angestellte, die hier ›Forschung‹ betreiben. Was so viel bedeutet wie, sie fegen den Staub von Exponaten.
Dr. Hart hingegen schreibt tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten. Sie hat zwar keine Felderfahrung, sprich, sie hat noch nie an Ausgrabungen teilgenommen, aber die Frau ist ein wandelndes Lexikon. Alles, was in den Büchern der Menschen steht, scheint sich auch in ihrem Kopf zu befinden. Ein Jammer, dass sie teilweise falsche Informationen bekommen hat.
Ja, es ist gut, dass ich ihr gezeigt habe, was für ein Arschloch ich bin. Denn der kurze Blick, den sie mir auf ihre wahre Persönlichkeit gegeben hat, hat gereicht, um mein Herz an sie zu binden. Tyche sei Dank.
Wenn das schlechte Gewissen mich überkommt, rede ich mir einfach ein, dass ich auf diese Weise ihr Leben schütze. Dann geht es eigentlich wieder. Denn ... sollte ich meine göttlichen Kräfte zu stark beanspruchen müssen, weil ich bei einem weiteren gefährlichen Auftrag in eine tödliche Falle tappe, würde ich Shenans Lebenskraft anzapfen. Ein altes Gesetz des Olymp. Menschen, die einen Gott lieben, werden als erste ›benutzt‹ um die göttlichen Kräfte zu nähren. Bis zum bitteren Ende.
Nein, so ist es besser. Auch, wenn das bedeutet, ihr nie auf die Art nahe sein zu können, wie ich es mir wünsche.
Natürlich hätte ich meine Identität gleich wieder ändern können, um diesem seltsamen Stich in meinem Herz zu entgehen. Ich muss das ja ohnehin alle paar Jahre, aber etwas an ihr bindet mich. Vielleicht quäle ich mich aber auch einfach nur gerne selbst.
Ihre Nähe ist nämlich reine Tortur. Shenan ist umwerfend. Ihre Ausstrahlung zieht mich an, wie das Licht die Motten. Und genauso würde sie mich verbrennen, wenn ich sie verlieren würde. Eine Sterbliche, die einen Gott liebt, lebt nicht lange. Und eine Sterbliche, die von einem Gott geliebt wird, stirbt noch früher, selbst, wenn er seine göttlichen Kräfte nicht einsetzt.
Ich muss es wissen. Immerhin habe ich eine Gefährtin gehabt, nachdem ich mich entschied, den Olymp zu verlassen und als Mensch zu leben. Sie hieß Luna und ihr gehörte mein Herz. Leider war ich damals noch nicht gut darin, mich vor den anderen Göttern zu verstecken. Sie fanden mich und nutzten Lunas Lebenskraft, um ihre eigene Magie zu stärken, damit sie mich quälen konnten. Natürlich hörten sie nicht auf, als sie im Sterben lag. Ich musste zusehen, wie die Liebe meines Lebens starb, damit Ares und Apollon mit mir ›spielen‹ konnten.
Ich hasse Götter. Ich hasse sie. Und manchmal hasse ich mich selbst.
»Hören Sie mir eigentlich zu?«, fragt Dr. Hart.
Ich räuspere mich. »Götter, Olymp«, brabble ich los, in der Hoffnung, dass sie gerade darüber gesprochen hat.
Sie rollt mit den Augen und atmet langgezogen aus. »Nein. Aristoteles, Pythagoras. Klingelt da etwas?«
Natürlich tut es das. Ich kannte die beiden schließlich. Aber ich zucke nur mit den Schultern. »Mathematik, nehme ich an?«
Sie rollt noch einmal mit den Augen. Alleine dafür ärgere ich sie gerne. Sie ist einfach süß, wenn sie so etwas macht. »Bei Pythagoras, ja. Bei Aristoteles wollte ich eher auf seine Auffassung der Staatsformenlehre hinaus. Immerhin hat er den Grundstein für die Demokratie gelegt.«
Ich grunze und räuspere mich dann noch einmal. Aristoteles hat viel Bedeutendes geschaffen. Aber das mit der Demokratie haben die Menschen der heutigen Zeit dann wohl anders aufgefasst, als er es gemeint hat. Innerlich zucke ich mit den Schultern. Mir kann es gleich sein. Ich habe viele Staatsformen gesehen. Von Stämmen mit Räten, über Monarchien, bis hin zu Republiken und Diktaturen. Jede hat Vor- und Nachteile. Es kommt auf die Menschen an.
»Gut, Ethik und Staatsformen. Ich versuche es mir zu merken.«
Dr. Hart reibt sich die Nasenwurzeln. »Es gibt kein versuchen, Harrison. Machen Sie es oder lassen Sie es bleiben.«
»Star Wars?«, grinse ich.
Dr. Hart hebt den Blick und ein Schmunzeln huscht über ihr Gesicht. Mir stockt der Atem. Sie ist schöner als jede Göttin es je sein könnte und mein Herz schlägt plötzlich viel zu schnell. Wieso kann ich nicht aufhören, mich zu ihr hingezogen zu fühlen? Wieso freue ich mich über Momente wie diesen, wo es sich anfühlt, als könnten wir doch glücklich zusammen sein, wenn ich es nur zulassen würde?
»Sie überraschen mich manchmal doch«, sagt sie und schaltet den Wasserkocher ein. Shenan mag Kaffee nicht, sie trinkt nur Tee. Ihr Blick wird weicher, während sie mich mustert. »Denken Sie, Sie können das wirklich, Harrison? Ich will Sie nicht überfordern.«
Jetzt steigt mein Puls noch mehr an. Sie würde das alleine machen, weil sie nicht möchte, dass ich mich schlecht fühle. Ich bin wirklich so ein Heuchler. »Natürlich, Dr. Hart«, erwidere ich entschlossen. Klar kann ich das. Ich muss mir nur merken, was die Menschen dieser Zeit für die Wahrheit halten. »Würden Sie auch Wasser für mich aufkochen?«
Sie nickt und stellt eine zweite Tasse neben ihre. Ich trinke Tee zwar nicht so gerne, aber ich mag die Sorte, die sie immer aufbrüht. Orange Pekoe. Keine Ahnung, ob das eine Spezialität ist oder ob es daran liegt, dass sie den Tee zubereitet. Aber diese eine Tasse pro Tag genieße ich. Weil ich es mit ihr tue.
Ich schüttele den Kopf. Ich klinge wie ein liebeskranker Teenager. Aber es ist ein Fakt. Ich mag ihre Nähe. Die wenigen Minuten, in denen sie mich nicht anstarrt, als wäre ich der Teufel persönlich - den es übrigens nicht gibt, weil ich auch die Unterwelt recht gut kenne, immerhin habe ich früher Seelen dorthin begleitet - sind die schönsten des Tages. Weil wir uns dann in Ruhe unterhalten und ich immer mehr verstehe, warum Dr. Hart mit Mitte zwanzig bereits ein Museum leiten durfte. Sie ist nicht nur klug, sie hat Weitblick und sie schafft es, die Menschen für sich zu gewinnen.
Kein Wunder, dass ich für sie nur ein überheblicher Aufreißer bin, der etruskische Kunst nicht von römischer unterscheiden kann. Manchmal, wenn ich mich selbst im Spiegel ansehe und meine blonden Haare absichtlich noch mehr verstrubble, als sie schon sind, mir ein selbstgefälliges Grinsen zuwerfe und mich frage, ob meine Augen für die Menschen gräulich oder blau- lila, wie eine Mischung aus Lapis und Amethyst, aussehen, finde ich mich selbst überheblich. Oh, ich sehe vermutlich gut aus. Ich bin immerhin ein Gott. Und ich bin genauso überheblich, wie die meisten anderen Götter. Obwohl ich es längst nicht mehr sein will.
Ich stelle mich neben Dr. Hart und nehme ihr beide Tassen ab, die sie aufgenommen hat, um nach draußen zu gehen. Ein Lächeln huscht über mein Gesicht und sie zieht zumindest einen Mundwinkel nach oben. Dann allerdings hebt sie ihre Nase und atmet ein, als würde sie schnüffeln.
»Riecht es hier verbrannt?«, fragt sie und holt noch einmal Luft.
»Ich rieche nichts, außer dem Tee«, verkünde ich und nehme mir vor, mich die ganze Nacht in die Badewanne zu legen. Lieber rieche ich nach dem Lavendelbadesalz, das ich von den Kollegen zum ›Geburtstag‹ bekommen habe, als nach Räucherfleisch. Und das heißt etwas. Ich hasse Lavendel. Aber das Zeug muss weg und der Geruch auch.
»Ich sehe lieber trotzdem kurz nach. Wir treffen uns auf dem Balkon und gehen den Tag noch einmal durch«, murmelt Dr. Hart und ist auch schon aus dem Büro verschwunden.
Ich seufze und schnüffle an der Tasse. Der Tee ist ihr wieder wunderbar gelungen. Mein Blick fällt auf ihren ordentlichen Schreibtisch. Sie arbeitet viel und schafft es trotzdem, Ordnung zu halten. Ich bewundere sie, weil sie strukturiert ist. Und bin froh, dass sie ein zurückhaltender Mensch ist, sich kein Privatleben gönnt und vermutlich für viele ziemlich zugeknöpft wirkt. Denn bei der Vorstellung, dass sie einem anderen Mann nahe kommen könnte, zieht sich mein Magen schmerzhaft zusammen. Wenn das passiert, muss ich das Weite suchen. Sonst käme zu Diebstahl vermutlich auch Mord auf die lange Liste meiner Verfehlungen.
3
Ich folge Shenan wie ein Geist, während sie die erste Gruppe Junior Highschool Schüler durch den Saal mit den Altertumsausstellungen führt.