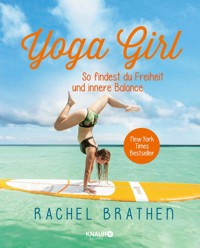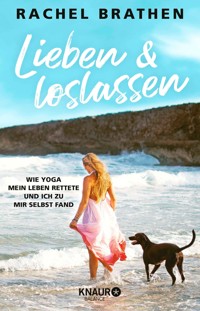
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur Balance eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das persönliche Buch des weltbekannten Yoga-Girls über ihre Sinnsuche. Rachel Brathen erzählt in diesem Buch von ihrer berührenden Reise zu sich selbst. Ihre beste Freundin kommt auf tragische Weise ums Leben. Dies löst tiefe Trauer und eine ganze Reihe von Selbstzweifeln in Rachel aus. Sie kämpft mit ungelösten Traumata und fragt sich, wann sie wirklich glücklich war. Bei ihrer Verlobung mit dem Mann, den sie liebt? Bei ihrer blühenden Karriere als Yoga-Lehrerin, die sie um die ganze Welt führte? Bei jedem Schritt steht die Yoga-Lehrerin immer wieder vor der Wahl: Wird sie alles verlieren, der Trauer erliegen und nach Kontrolle greifen, die außerhalb ihrer Reichweite liegt? Oder kann sie den Verlust überwinden und loslassen? In ihrer persönlichen, spirituellen Verwandlungs-Geschichte und Sinnsuche teilt Rachel ihre tiefsten Erfahrungen über Leben und Tod, Liebe und Angst. Sie erfährt, was es bedeutet, Mutter zu werden, und wie dies einen Prozess der Heilung in ihr anstößt. Am Ende steht die Erkenntnis: Lerne, intensiv zu lieben und loszulassen. "Mein ganzes Herz liegt in diesen Seiten." Rachel Brathen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Rachel Brathen
Lieben und loslassen
Wie Yoga mein Leben rettete und ich zu mir selbst fand
Aus dem amerikanischen Englisch von Sabine Thiele
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Rachel Brathen erzählt in diesem Buch von ihrer berührenden Reise zu sich selbst. Ihre beste Freundin kommt auf tragische Weise ums Leben. Dies löst tiefe Trauer und eine ganze Reihe von Selbstzweifel in Rachel aus. Sie fragt sich, wann sie wirklich glücklich war. Bei ihrer Verlobung mit dem Mann, den sie liebt? Bei ihrer blühenden Karriere als Yogalehrerin, die sie um die ganze Welt führte? In ihrer persönlichen Verwandlungsgeschichte teilt Rachel ihre tiefsten Erfahrungen über Leben und Tod, Liebe und Angst mit. Am Ende steht die Erkenntnis: Lerne, intensiv zu lieben und loszulassen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel eins: Das Ende
Kapitel zwei: Erwachen
Kapitel drei: Üben
Kapitel vier: Vergeben
Kapitel fünf: Aufgeben
Kapitel sechs: Bekommen
Kapitel sieben: Zuhören
Kapitel acht: Erden
Kapitel neun: Bewegen
Kapitel zehn: Verarbeiten
Kapitel elf: Loslassen
Kapitel zwölf: Glauben
Kapitel dreizehn: Akzeptieren
Kapitel vierzehn: Beten
Kapitel fünfzehn: Vertrauen
Kapitel sechzehn: Atmen
Kapitel siebzehn: Fühlen
Kapitel achtzehn: Teilen
Kapitel neunzehn: Schaffen
Kapitel zwanzig: Heilen
Kapitel einundzwanzig: Der Anfang
Epilog
Danksagung
Für meine Mutter, die hier ist
Und meine Großmutter, die nicht mehr hier ist
Und für Lea Luna,
die noch nicht lange bei uns ist und es doch schon immer war
Kapitel eins
Das Ende
Es kam aus dem Nichts. Erst stand ich noch mit Dennis, meinem Freund, und unserem Hund Ringo da und wartete auf den Abflug, dann kniete ich plötzlich auf dem Boden und krümmte mich unter einem Schmerz, der sich anfühlte, als hätte mir jemand ein rot glühendes Messer in den Bauch gestoßen. Ich wurde ohnmächtig und wachte mit dem Kopf in Dennis’ Schoß auf. »Was ist denn los?«, fragte er und sah mich ängstlich an. Ich konnte kaum sprechen. »Mein Bauch«, brachte ich mühsam hervor. Vergeblich versuchte ich, mich aufzusetzen. Mir war schwindelig vor Schmerzen. Jemand rief um Hilfe, und plötzlich standen Sanitäter neben mir. Mein Herz sei in Ordnung, sagten sie. Der Puls normal. Der Blutdruck gut. »Sollen wir ins Krankenhaus fahren?«, fragte Dennis. Ich wollte zustimmen. Der stechende Schmerz in meinem Bauch war mir völlig neu, so etwas hatte ich noch nie erlebt, und mit meinen fünfundzwanzig Jahren hatte ich schon einiges durchgemacht. Ich sollte mitfahren, dachte ich. Irgendetwas stimmt überhaupt nicht. Sie sollten mich wirklich ins Krankenhaus bringen. »Nein«, antwortete ich stattdessen. »Wir dürfen den Flug nicht verpassen. Gehen wir zum Gate.«
Der Flug war kurz, nur dreißig Minuten von Aruba nach Bonaire, wo ich in der kommenden Woche ein Yoga-Retreat leiten sollte. Es war ausverkauft, aus der ganzen Welt kamen die Leute zu uns. Auf gar keinen Fall würde ich sie enttäuschen. Ich musste einfach in dieses Flugzeug steigen. Dennis half mir hoch, doch sobald ich stand, drehte sich das unsichtbare Messer in meinem Bauch, und meine Knie gaben unter mir nach. Ich wusste, was er dachte. Das ist doch verrückt. Wir brauchen einen Arzt. Er flehte mich an, aber ich blieb stur. »Wir müssen nach Bonaire!«, beharrte ich und sah ihn fest an. »Wir werden dort erwartet.«
Ich musste all meine Kraft zusammennehmen, um durch die Passkontrolle zu gehen, und konnte kaum meinen Boardingpass festhalten. Nach außen versuchte ich, tapfer zu wirken, doch innerlich starb ich vor Angst. Was ist denn nur mit mir los? Wir schafften es zum Gate, und ich ließ mich auf den nächsten Wartesitz fallen. Ich war am ganzen Körper schweißnass, in mir pulsierte alles. Mir wurde schlecht, und ich eilte gekrümmt zur nächsten Toilette. Als ich versuchte, die Kabinentür zu öffnen, brach ich zusammen. Eingerollt lag ich auf dem Boden, zu schwach, um aufzustehen. Sterbe ich? Ich tastete in meiner Handtasche nach dem Telefon, um Dennis anzurufen und ihn um Hilfe zu bitten, da hörte ich eine Stimme in mir. »Steh auf. Na los. Hoch mit dir.« Steh auf, wiederholte ich stumm. Hoch vom Boden.
Mir war nicht ganz klar, warum ich so dringend in diesen Flieger musste – ging es wirklich nur darum, niemanden zu enttäuschen, oder versuchte ich zu ignorieren, was mit mir los war? Wie auch immer, ich beschloss, mich weiterzuzwingen. Ich schob das Handy zurück in die Tasche, hielt mich an der Wand fest und zog mich hoch. Beim Blick in den Spiegel starrte mir ein geisterhaft bleiches Gesicht entgegen und flehte mich an, zur Vernunft zu kommen und aufzugeben. Doch ich blieb stur. Los, befahl ich mir. Ein Schritt nach dem anderen.
Ich schaffte es zurück zu Dennis und Ringo, und dann saßen wir eine gefühlte Ewigkeit bis zum Boarden herum. Mein Bauch schien in Flammen zu stehen. Die Uhrzeiger krochen quälend langsam voran. Endlich war es so weit. Als ich mich der Flugbegleiterin mit meinem Boardingpass näherte, verzog sie panisch das Gesicht. »Sie können nicht fliegen!«, sagte sie. »Sie sind krank.« Ich war wachsbleich, auf meiner Stirn stand Schweiß. Ich konnte kaum klar sehen, riss mich aber mit übermenschlicher Kraft zusammen. »Ich werde nach Bonaire fliegen«, erwiderte ich. Die Stewardess sah mich an. »Das Flugzeug mag ja nach Bonaire fliegen. Sie, meine Liebe, hingegen nicht.« Vor Schmerz und Frust knirschte ich mit den Zähnen. Ich wollte doch einfach nur in diese verdammte Maschine und mich auf meinen Platz setzen. »Ich muss aber an Bord«, erwiderte ich nachdrücklich. »Bitte, bitte. Es geht mir gut, ich verspreche es. Es ist nur eine Magenverstimmung. Ich komme schon klar. Ich muss einfach mitfliegen.« Ich weiß nicht, warum sie schließlich nachgab. »Gehen Sie zum Arzt, wenn wir gelandet sind?«, fragte sie nachdrücklich. Ja, das versprach ich ihr. »Na los, dann gehen Sie schon«, meinte sie schließlich und wies mir den Weg. »Schnell, bevor mein Vorgesetzter Sie sieht.«
Ich dachte, die Maschine würde am Gate stehen, doch ein Shuttlebus wartete auf uns. Die Hitze war erdrückend, der Bus voll. Die Vorstellung selbst einer kurzen Fahrt zum Flugzeug war unerträglich. Dennis stieg zuerst mit Ringo und unserem Gepäck ein, bevor er mich in den Bus hob. Ich klammerte mich an einem Haltegriff fest. Meine langen Haare klebten mir am Rücken, der Schweiß tropfte mir vom Gesicht. Warum war es hier drin so warm? Beim Dröhnen des Motors wurde mir wieder schlecht. Nein, ich übergebe mich jetzt nicht. Wenn ich mit etwas nicht klarkomme, dann dem Erbrechen. Ich hatte nicht mehr gekotzt, seit ich als Teenager eine ganze Flasche Wodka vernichtet hatte. Doch in diesem Bus spürte ich, dass ich es nicht würde zurückhalten können. Panisch sah ich mich nach einer Plastiktüte um, einem Mülleimer, irgendwas. Würde es mir gelingen, mich erst zu übergeben, wenn ich wieder im Freien war?
Sobald der verdammte Bus mit quietschenden Bremsen anhielt und die Türen ganz geöffnet waren, drängte ich mich nach draußen. Oben an der Treppe zum Flugzeug stand die Frau, die meinen Boardingpass kontrolliert hatte. Wie war sie so schnell hierhergekommen? Sie musterte mich streng. Wenn ich jetzt kotze, dachte ich, wird sie mich nicht an Bord lassen. Völlig verzweifelt wankte ich hinter den Bus, beugte mich vor und erbrach mein Inneres auf die Rollbahn. Ich wischte mir den Mund an meinem Ärmel ab, ging die Treppe hinauf ins Flugzeug und sank auf meinem Platz zusammen. Dann weiß ich erst wieder, wie ich in einem Taxi mit Dennis und Ringo aufwachte, das mit uns in die Notaufnahme raste. Bonaire ist eine winzige Karibikinsel mit weniger als neunzehntausend Einwohnern. Das Krankenhaus ist so klein, dass sich die Entbindungsstation unmittelbar neben dem Hospiz befindet. Man stirbt, wo man auf die Welt kommt. Zwei Ärzte behandelten mich, beide groß und wohl niederländischer Herkunft. Sie drückten auf meinem Bauch herum und diagnostizierten eine mögliche akute Blinddarmentzündung, wenn nicht sogar einen Durchbruch. Um sicherzugehen, müssten sie allerdings einen Ultraschall machen, doch auf der ganzen Insel gab es nur einen Ultraschallspezialisten, und bis der hier wäre, würde es dauern. Bis dahin würde man mir Morphium geben, sagten die Ärzte, bevor sie wieder gingen.
Die Schmerzen waren unerträglich. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Wo war das Morphium? Stunden waren mittlerweile vergangen. Kapierte denn hier niemand, dass ich vor Schmerzen umkam? Meine Qualen waren mittlerweile so groß, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Endlich kam eine Schwester mit einer Nadel. Man legte mir einen Zugang, und ich seufzte erwartungsvoll, als die ersten Tropfen Morphium durch den Schlauch in meinen Arm liefen. »Schön weiteratmen, Liebes«, sagte die Schwester. »Gleich wird es besser.«
Ich hatte noch nie Morphium bekommen, doch von dem, was ich gehört und in Filmen gesehen hatte, erwartete ich, sehr schnell eine Wirkung zu spüren. Ich krümmte mich vor Schmerzen, wartete auf die Erlösung, doch nichts passierte. Fünfzehn Minuten später lag ich immer noch mit angezogenen Beinen auf der Seite und schrie vor Qualen. Die Ärzte erhöhten die Dosis. Keine Wirkung. Ich war schon fast ohnmächtig vor Schmerz, als der Ultraschallspezialist endlich eintraf. Sieben Stunden waren seit meinem ersten Zusammenbruch am Flughafen vergangen. »Wie ich höre, haben Sie eine akute Blinddarmentzündung«, sagte er. »Ich muss den Ultraschall sofort durchführen, damit man Sie nicht unnötig operiert.«
Dennis hielt meine Hand, während der Mann ein kaltes Gel auf meinem Bauch verteilte. Ich hatte ein seltsames Gefühl von Déjà-vu. Mir wurde bewusst, dass ich diese Szene schon mal gesehen hatte: Dennis hielt meine Hand, wir beide schauten auf einen winzigen Monitor, während das Gel auf meinen Bauch aufgetragen wurde … Ein vertrautes Gefühl. Bestimmt hatte ich es geträumt. Vom ersten Moment unseres Kennenlernens an wusste ich, dass Dennis und ich eines Tages ein Kind bekommen würden. Ich wünschte, ich könnte uns in die Zukunft katapultieren, an einen anderen Zeitpunkt als den jetzigen. An dem wir glücklich darauf warteten, den Herzschlag unseres ungeborenen Kindes zu hören. Ich würde alles dafür geben, nicht gerade hier zu sein, voller Panik und auf der Suche nach dem Grund für diese Schmerzen, die mich ganz sicher umbringen würden. Dennis drückte fest meine Hand. Der Spezialist fuhr mit dem Schallkopf über meinen Bauch. Nach ein paar Minuten schien er verwirrt. »Was ist los?«, fragte Dennis. So hatte er mich noch nie erlebt. Ich bin ein belastbarer Mensch und halte Schmerzen aus. Man sah ihm an, dass er völlig verängstigt war. »Ist es noch schlimmer als vermutet?« Der Mann schüttelte den Kopf. »Nein«, antwortete er. »Ich kann … nichts finden. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Blinddarm entzündet, kurz vorm Durchbruch oder auch nur geschwollen ist. Der Scan sagt, Ihnen fehlt überhaupt nichts.« Ich war sprachlos. »Aber die Schmerzen …«, entgegnete ich. »Ich weiß, dass irgendetwas überhaupt nicht stimmt. Ich habe das Gefühl zu sterben!«
Die Ärzte verstanden es auch nicht – was war die Ursache für die Schmerzen? Warum konnte man auf dem Ultraschall nichts Ungewöhnliches erkennen? Und warum wirkte das Morphium nicht? Bald war ich im Delirium und halluzinierte. Der Schmerz kam in Wellen wie rot glühende Lava und fraß mich auf. Der größere der beiden Ärzte teilte uns sichtlich besorgt mit: »Normalerweise machen wir niemanden auf, wenn wir nicht wissen, wonach wir eigentlich suchen, aber die Stärke der Schmerzen lässt uns keine Wahl. Wir operieren gleich morgen früh. Doch bis dahin müssen wir etwas tun; sie ist dehydriert, und die Medikamente wirken nicht. Ich würde ihr gern eine so große Dosis Morphium geben, dass sie einschläft.«
Ich hörte ihn, nahm seine Worte aber nicht auf. Meine Welt bestand nur noch aus dem Feuer in mir. Ich stellte mir vor, wie die Unterseite meiner Haut schmolz und dunkler Rauch aus meinem Bauch aufstieg. So ähnlich war es mir vor Jahren bei einer Ayahuasca-Zeremonie ergangen, als ich schreckliche Dinge halluziniert hatte. Ich erinnerte mich, dass ich mich damals der Angst vor meinem eigenen Tod ergeben hatte und so dem Albtraum entkommen war. Ob ich jetzt gerade starb, wusste ich nicht, aber es fühlte sich definitiv so an. Auf keinen Fall würde ich noch mehr Schmerzen ertragen können. Dennis schüttelte mich sanft an den Schultern, um mich zurückzuholen. »Schatz«, sagte er. »Sie geben dir gleich etwas, damit du einschläfst. Okay? Ganz viel Morphium, damit die Schmerzen endlich aufhören. Aber du wirst dabei schlafen. Möchtest du das?« »Ja«, erwiderte ich undeutlich. »Sie sollen einfach machen. Ich gehe ins Feuer.«
Ein paar Minuten später kam der Arzt zurück und injizierte mir die Dosis in den Oberschenkel. »Entspannen Sie sich«, sagte er. »Schlafen Sie.« Ich schloss die Augen. Die Flammen veränderten ihre Farbe von tiefrot und orange zu hellgelb und schließlich blau. Plötzlich holte mein Körper tief Atem. Ich spürte, wie die Luft Raum in mir einnahm und das Feuer vertrieb, das mich innerlich aufgefressen hatte. Als ich ausatmete, war der Schmerz weg. Einfach weg. Das Gefühl war unbeschreiblich. Ich trieb in völliger Stille in einem kühlen, ruhigen Ozean.
Gerade glitt ich in den Schlaf, als ich ein Telefon klingeln hörte. Wer ruft da an? Ich klammerte mich an mein Bewusstsein und lauschte, während Dennis in meiner Handtasche nach dem Handy suchte. Luigi war der Anrufer, einer meiner besten Freunde aus Costa Rica. Er muss gehört haben, dass ich im Krankenhaus bin, dachte ich. Ich sage ihm schnell, dass es mir gut geht. Dennis hielt mir das Telefon ans Ohr. »Es geht mir gut«, erklärte ich. »Ich bin im Krankenhaus, aber es geht mir gut. Es tut nicht mehr weh.« »Krankenhaus?«, fragte Luigi verwirrt am anderen Ende. Seine Stimme hatte einen Unterton, den ich nicht deuten konnte. »Warum bist du im Krankenhaus?« »Ich weiß es nicht«, erwiderte ich verwaschen. »Aber jetzt ist alles okay. Alles in Ordnung.« Luigi schwieg lange. Als er wieder sprach, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Ich versuchte, wach zu bleiben und ihm zuzuhören. »Amor. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Fue un accidente. Con Andrea. Andrea tuvo un accidente.« Ich verstand ihn nicht. Warum sprach er von Andrea? Andrea war meine beste Freundin. Wir hatten das letzte Mal vor ein paar Tagen miteinander gesprochen, sie war mit ihrem Freund bei einem Konzert. Was sagte er? Andrea hatte einen Unfall?
Unbestimmte, kaum greifbare Angst überkam mich. Es fühlte sich unwirklich an, wie etwas sehr weit Entferntes. Andrea und ich waren Seelenverwandte. Manchmal war es, als wären wir eine Seele in zwei Körpern. Ich wusste nicht, wo ich anfing und sie aufhörte. Wir spürten die Schmerzen der jeweils anderen, lasen gegenseitig unsere Gedanken. Ich zwang mich zu sprechen. »Was ist passiert? Kann ich mit ihr reden?«, fragte ich. »Nein«, antwortete Luigi. Er schluckte angestrengt. »Luigi. Was ist los, sag es mir«, drängte ich ihn. Meine Knöchel waren weiß, so fest umklammerte ich das Telefon. Er holte tief Luft und sprach endlich. »Falleció.« Mein Herz erstarrte zu Eis. Der Raum begann sich zu drehen. Ich ließ das Handy aufs Bett fallen. »Kannst du mit Luigi sprechen?«, bat ich Dennis. »Ich bin zu müde.« Ich drehte mich auf die Seite und kniff die Augen zusammen. Ein Wort hallte in meinem Kopf wider. Falleció. Ich spreche fließend Spanisch, doch dieses Wort hatte ich noch nie benutzt. Natürlich kannte ich die Bedeutung, aber jetzt, hier, in einem Krankenhausbett auf einer fremden Insel, verstand ich sie nicht. Ich sah die einzelnen Buchstaben vor mir. F-A-L-L-E-C-I-Ó. Etwas Schreckliches verbarg sich dahinter, ich wusste nur nicht genau, was. Ich beschloss, dafür nicht bereit zu sein und zu einem anderen Zeitpunkt darüber nachzudenken. Das Meer zog mich mit sich, und ich wehrte mich nicht.
Irgendwann in der Nacht wachte ich auf. Dennis saß neben mir, den Kopf in die Hände gestützt, und weinte. Dennis weint nie. Da war das Gefühl wieder. Namenlose Angst. Wie eine Wolke, aber weit entfernt. Wieder hörte ich Luigis Stimme in meinem Kopf. Falleció. Die Angst umklammerte mein Herz. Ich will nicht hier sein, dachte ich und schloss die Augen. Die Ozeanwellen rollten wieder heran. Lockten mich. Ich sprang hinein.
Plötzlich bin ich an einem anderen Ort. Einem Krankenhaus, aber nicht auf Bonaire. Ich stehe in einem Flur. Alles ist blendend weiß. Ich trage ein Krankenhaushemd und pinkfarbene Spitzenunterwäsche. Eine junge Frau steht am anderen Ende des Korridors und zwirbelt ihr dunkles Haar zwischen den Fingern. Sie dreht sich zu mir, und ich lächele. Andrea! Ich gehe auf sie zu. Sie umarmt mich, und lange stehen wir einfach nur da und halten einander.
»Ich glaube, es ist etwas passiert«, sage ich. »Ich glaube, ich bin im Krankenhaus.«
»Das sind wir«, antwortet Andrea.
Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe Angst. Als Andrea lächelt, werde ich wieder ruhig.
»Kannst du bei mir bleiben?«, frage ich sie. »Ich will nicht allein aufwachen.«
»Nein«, erwidert sie. »Ich kann nicht bleiben. Ich muss gehen.«
Es scheint so lächerlich, dass wir zusammen in diesem Krankenhaus sind, aber offensichtlich in verschiedenen Zimmern liegen. Wir sollten unsere Betten zusammenschieben, und ich lese ihr vor, wie früher, als wir in Dominical gewohnt haben.
»Bitte geh nicht«, sage ich. Andreas Gesicht leuchtet. Sie ist so wunderschön. Ich will sie berühren.
»Ich bin hier. Ich bin immer hier«, sagt sie, weicht jedoch zurück.
Ich versuche, ihre Hand zu nehmen, kann sie aber nicht erreichen. Der Flur ist lang, und sie ist so weit weg, dass ich sie kaum mehr sehen kann. Das Licht blendet. Ich muss die Augen schließen. Als ich sie wieder öffne, ist Andrea verschwunden.
Sonnenlicht strömte durch das Fenster in mein Zimmer. Ein Plastikarmband mit meinem Namen war an meinem Handgelenk befestigt. Stimmt ja, dachte ich. Ich bin im Krankenhaus. Auf Bonaire. Ich ließ den Blick durch den Raum schweifen und sah Dennis. Seine Augen waren gerötet. Er nahm meine Hand, und er schien etwas sagen zu wollen, hielt sich jedoch zurück. Schließlich brachte er heraus: »Erinnerst du dich noch an gestern Abend?«
»Was meinst du? Die Ärzte?«
»Nein … Egal.«
Ich wollte ihn fragen, was er hatte sagen wollen, doch etwas hielt mich zurück.
»Sie holen dich gleich zur OP ab«, sagte er.
»Okay.«
»Wir müssen dich ausziehen. Und die Armbänder abmachen.«
Mein Handgelenk war voll davon. Manche hatte ich auf meinen Reisen gekauft, andere waren Geschenke. Eines war ein Freundschaftsarmband; Andrea trug dasselbe. Die meisten ließen sich nicht abnehmen.
»Die Ärzte sagen, wir müssen sie abschneiden«, erklärte Dennis.
Er beugte sich mit einer Schere zu mir. »Nein!«, schrie ich. »Ich brauche sie! Du darfst sie nicht abschneiden! Sag ihnen, dass ich mich nicht operieren lasse, wenn ich sie abnehmen muss.«
»Okay«, meinte er nur.
Dennis ging nach draußen und kam mit einer Rolle Verbandsmull zurück. »Wir können dein Handgelenk damit umwickeln«, sagte er. »Du musst sie nicht abschneiden.«
»Gut.«
Die Zeit verging. Ich nickte wieder ein und wachte davon auf, dass man mich zur OP abholte.
Dennis beugte sich über mich und gab mir einen Kuss. »Ich bin hier, wenn du zurückkommst, okay?« Ich hatte Angst. Warum musste ich operiert werden? Ich konnte mich nicht erinnern. »Ich will das nicht mehr«, wehrte ich mich panisch. »Bitte sag ihnen, dass sie mich hierlassen sollen.«
Tränen stiegen Dennis in die Augen. »Alles ist gut«, antwortete er. »Du wirst einfach ein bisschen schlafen, und dann wachst du auf, und ich bin hier.«
»Ich glaube, etwas ist passiert«, sagte ich.
Dennis sah mich an. »Wir müssen jetzt nicht darüber sprechen. Ich liebe dich.«
Ich schloss die Augen. Als ich sie wieder öffnete, befand ich mich in einem sterilen Raum, in dem ein helles Licht brannte. Ärzte beugten sich über mich. Jemand nahm mir das Krankenhaushemd ab und hielt plötzlich inne. »Hat man Ihnen nicht gesagt, dass Sie Ihre Unterwäsche ausziehen müssen?«
Ich sah an mir herab. Ich war nackt, bis auf pinkfarbene Spitzenunterwäsche.
Die in einer solch sterilen Umgebung beinahe anzüglich wirkte.
»Wir müssen sie aufschneiden.«
»Okay.«
Die Schwester setzte mir eine Maske auf. »Zehn, neun, acht …« Der Ozean nahm mich wieder mit sich.
Als ich aufwachte, war das Licht anders. Dennis saß neben mir, wie versprochen. Ich legte eine Hand auf den Bauch. Drei Mullballen waren mit irgendeinem Kunststoff auf der Haut befestigt. Die Stelle fühlte sich empfindlich und wund an. Dennis hielt meine Hand. Ich sah ihn an. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Falleció. Das Wort stand in dicken, schwarzen Buchstaben vor meinem inneren Auge, erzählte mir, was ich noch nicht an mich heranlassen konnte. Wenn ich die Frage nicht stelle, muss ich auch die Antwort nicht hören, dachte ich. Stattdessen fragte ich Dennis, was mit mir los gewesen war.
»Dein Blinddarm war entzündet. Sie haben ihn entfernt«, erklärte er.
»Oh.«
Er öffnete den Mund, um weiterzusprechen, blieb jedoch stumm. Seine Augen waren voller Schmerz. Die Stille im Raum war ohrenbetäubend. Wir schwiegen lange.
»Wo ist Andrea?«, fragte ich schließlich.
Tränen liefen ihm über die Wangen. »Sie hatte einen Autounfall«, sagte er.
»Geht es ihr gut?«
Ich wusste die Antwort bereits.
Dennis schüttelte den Kopf.
Falleció. Das Wort wird vom intransitiven Verb fallecer abgeleitet. Fallecer. Verscheiden. Sterben.
Alles wurde schwarz.
Man sagte mir später, ich hätte geschrien. Nachdem die Ärzte mit mir über die Operation gesprochen hatten, ging Dennis nach draußen zur Toilette. Ich griff nach meinem Handy und wählte Andreas Nummer. Der Anruf wurde sofort auf die Mailbox weitergeleitet. Seltsam, dachte ich. Ich versuche es später noch einmal. Es waren nur noch drei Monate bis zu meiner Hochzeit, und sie hatte ihr Brautjungfernkleid noch nicht gesehen. Es hing bei meinem Vater in Schweden und wartete auf unser aller Ankunft. Taubenblau. Meine Brautjungfern und ich hatten eine Chatgruppe: Olivia, Rose, Jessica, Mathias (mein Brautjunge!) und Andrea. Wir schrieben jeden Tag in der Gruppe und planten die Hochzeit. Wir hatten uns ewig nicht zwischen Taubenblau und Meerschaum entscheiden können. Andrea wollte Taubenblau. Wieder wählte ich ihre Nummer. Wieder keine Antwort.
Ich rufe Luigi an. »Wo ist Andrea?«, frage ich. Er weint. »Sie war auf dem Heimweg vom Strand«, erzählt er. Dabei geriet sie mit ihrem Wagen auf die falsche Straßenseite. Ein Lastwagen fuhr frontal in sie hinein. Ihr Sterben dauerte den ganzen Tag. Zweimal brachte man sie ins falsche Krankenhaus. Alles ging schief. Während er spricht, treibe ich davon. Ist das eine außerkörperliche Erfahrung? Ich höre seine Worte, verstehe sie aber nicht. Alles ist unwirklich. Nichts davon passiert gerade. Ich versuche, ihm zuzuhören, doch worin liegt der Sinn, Worte in einem Traum aufzunehmen, aus dem man doch sowieso gleich wieder erwacht? Luigi redet weiter. Ich merke, wie wichtig es ihm ist, dass er mir das alles erzählt; dass er seine Worte sorgfältig wählt. Er sagt etwas von einer Operation und Krankenhaus und dass sie acht Stunden um ihr Leben gekämpft hat. Irgendetwas an diesem Satz reißt mich in die Realität zurück. Acht Stunden? Ich rechne im Kopf nach, und die Erkenntnis ist so herzzerreißend, dass es mir den Atem raubt. All die Stunden, während der ich mich vor Schmerzen gekrümmt habe, lag Andrea im Sterben. Als ich am Flughafen zusammenbrach, stieß sie mit dem Lastwagen zusammen. Das glühend heiße Messer in meinem Bauch war auch ihr Schmerz. Sie haben sie operiert, um die inneren Blutungen zu stoppen. Unser Schmerz hatte denselben Ursprung. Ihr Herz blieb zweimal stehen. Sie haben versucht, sie wiederzubeleben. Es war nicht mein Schmerz, sondern unserer. Ihrer.
Als ich plötzlich nichts mehr spürte und tief Luft holte – machte Andrea ihren letzten Atemzug.
Kapitel zwei
Erwachen
Den Tod kannte ich, seit ich ein kleines Mädchen war – meine Mutter hatte uns vorgestellt. Am Tag der Feier zu meinem fünften Geburtstag hat sie versucht, sich umzubringen. Nachdem wir mit der Familie und Luftballons und Kuchen und Geschenken gefeiert hatten, sagte sie, sie wäre müde, und bat meinen Vater, meinen Bruder und mich über Nacht zu sich zu nehmen. Wir waren schon auf halbem Weg bei meinem Vater, als er bemerkte, dass er etwas vergessen hatte (oder vielleicht hatte er auch eine Vorahnung), und wir drehten um. Meine Mutter war kaum mehr am Leben, als wir ankamen. Sie hatte zwei Packungen Schlaftabletten mit Wodka geschluckt. Jahre später stieß ich in einer Kommode im Wohnzimmer auf eine Schachtel, in der ich die Abschiedsbriefe fand: einen für Familie und Freunde, einen für meinen Bruder, einen für mich. Ich liebe dich so sehr, und es tut mir so leid … In der Schachtel lagen Bilder von mir als Baby, alte Postkarten sowie einige Zeichnungen. Und zwischen den ganzen normalen Erinnerungsstücken ein Umschlag mit der Aufschrift »Rachel«. Meine Hände zitterten, als ich ihn öffnete. Ich war damals zwölf, und als ich auf dem Boden saß und die Abschiedsworte meiner Mutter las, dachte ich: Wahrscheinlich wird es wieder passieren.
Meine Eltern waren noch sehr jung, als sie sich kennenlernten. Mom war neunzehn und hielt sich mit Kellnern über Wasser. Dad war vier Jahre älter und betrieb bereits einige Casinos und Nachtclubs in der Stadt. Ich weiß noch, wie ich meine Mutter fragte, ob sie meinen Vater je geliebt hatte. »Ich weiß es nicht«, sagte sie. »Er hat mir Sicherheit gegeben. Und Geborgenheit. Er trug diese seltsamen Anzüge. Wir haben nie gestritten, aber er arbeitete die ganze Zeit. Ich war immer allein.«
Ich war Moms Wunderbaby, sagte sie, weil sie damals eine schwere Zeit durchmachte und meine Geburt ihr Leben rettete. Als Kind habe ich den Satz öfter gehört, als ich zählen konnte: Du hast mein Leben gerettet. Mein Wunder. Mitt mirakel. Bald wurde sie ein zweites Mal schwanger. Als ich zwei war, kam mein Bruder Ludvig zur Welt. Kurz darauf trennten sich meine Eltern. Schweden ist kein großes Land, doch als Mom beschloss, dass sie von Uppsala weggehen und sich zur Fluglotsin ausbilden lassen wollte, musste ich den Großteil der Woche bei meinem Vater verbringen. Sie erzählte mir, dass er einmal während ihrer Abwesenheit versucht hatte, mich und meinen Bruder auf ein Internat in den Vereinigten Staaten zu schicken. Denn wenn er die Familie nicht zusammenhalten konnte, sagte sie, sollte sie uns auch nicht haben dürfen. Zum Glück rief die Babysitterin sie in Panik an, und sie kam so schnell wie möglich nach Hause, bevor er uns zum Flughafen bringen konnte. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt – wenn ich auf mein Leben zurückblicke, wird mir klar, dass ich so vieles nicht weiß. Die Version meiner Mutter war immer das genaue Gegenteil dessen, was mein Vater erzählte.
Mom hatte fast ein Jahr ihrer Ausbildung hinter sich gebracht, als sie sich wieder verliebte, in einen Kampfpiloten namens Stefan, den sie auf der Militärbasis kennengelernt hatte, auf der sie arbeitete. Wir Kinder zogen von unserem Vater zu unserer Mutter und Stefan, kamen in eine neue Schule, und meine Großmutter lebte von da an immer wieder für längere Zeit bei uns. Ich glaube, mein Vater wurde wahnsinnig vor Eifersucht. Erst hatte meine Mutter ihn verlassen, dann jemand anderen kennengelernt, seine Kinder zu sich und dem neuen Mann geholt … Das war zu viel für ihn. Mir gegenüber beschrieb er es einmal als »Kidnapping«. Er sagte, er hätte uns abholen wollen, und wir wären einfach weg gewesen, und er hatte keine Ahnung, wo wir waren. Er hätte überall nach uns gesucht; er wollte ja seine Kinder zurückhaben. Als er uns schließlich gefunden hatte, machte er uns das Leben zur Hölle. Einmal drohte er, Stefan zu töten, weshalb dieser von da an mit seiner Dienstwaffe auf dem Nachttisch schlief (in Schweden ist das extrem ungewöhnlich, Waffen gehören nicht zu unserem Alltag). Dads Drohungen wurden so schlimm, dass meine Mutter ihre Telefongespräche aufzeichnete, falls sie ihn vor Gericht bringen müsste. Am Ende bekam sie das alleinige Sorgerecht für uns, und eine Zeit lang hatten wir keinen Kontakt mehr zu meinem Vater.
Mom, Stefan und ich saßen gerade auf der Couch und schauten einen Film, als ich meinen ersten Asthmaanfall hatte. Stefan brachte mich ins Krankenhaus und hielt die Atemmaske über mein Gesicht, während ich nach Luft rang. Erst als Erwachsene erfuhr ich, dass Asthma – das grundsätzlich eine körperliche und oft chronische Erkrankung ist – emotional mit unterdrückter Wut und Angst zusammenhängt. Es war also kein Wunder, dass ich körperliche Beschwerden entwickelte, während an der Oberfläche alles gut schien. Meine Eltern hatten sich auf traumatische Weise getrennt. Meine Familie lag in Trümmern. Und ich wusste nicht mehr, wo mein Vater war. Am besten ist mir in Erinnerung, dass Mom glücklich war, weshalb alles andere nicht so wichtig war. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich sie so: aufrichtig glücklich. Völlig entspannt. Wenn es ihr gut ging, konnte ich ja auch keine Probleme haben, dachte ich mir. Stefan war für mich wie ein echter Superheld aus Fleisch und Blut. Er steuerte Flugzeuge, kletterte auf Berge und fuhr schneller Ski als alle, die ich kannte. Und er lächelte immer. Daran erinnere ich mich am deutlichsten: sein Lächeln. Und wie er meine Mutter zum Lächeln brachte. Eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen ist, wie ich beim Après-Ski in Nordschweden auf Stefans Schultern saß. Wir waren den ganzen Tag auf den Pisten gewesen, und Stefan hatte uns mit seinem Ski eine kleine Kuhle in den Schnee gegraben, in der wir in der Sonne auf Decken saßen und heiße Schokolade tranken. Ich weiß noch, wie glücklich Mom in seinen Armen war und das Gesicht in die Sonne hielt.
Später im Hotel spielte eine Band, und wir tanzten; ich saß wieder auf seinen Schultern, und Stefan hielt mich an den Händen, damit ich nicht hinunterfiel. Ich war erst vier Jahre alt, aber dieser Moment ist mir deutlich im Gedächtnis geblieben; als läge mir die ganze Welt zu Füßen. Ein paar solcher Momentaufnahmen habe ich mir bewahrt; sie sind alle wunderschön, warm und glücklich, aber ich kann sie nicht zusammensetzen. Ich weiß noch, dass er immer gelächelt hat. Doch nur ein paar Monate nach diesem Skiurlaub sollte sich unser Leben für immer ändern.
Mom und Stefan wollten heiraten und hatten gerade ein Haus zusammen gekauft. Ein paar Tage bevor sie alle Papiere unterschreiben sollten, badete Mom gerade meinen Bruder, als es an der Tür klingelte. Ich öffnete, Stefans bester Freund und Flugpartner stand zusammen mit dem Captain der Luftwaffe, einem Psychologen und einem Priester vor dem Haus. Ich wurde in ein anderes Zimmer geschickt, um zu spielen, während die Männer Mom davon in Kenntnis setzten, dass Stefan am Morgen mit seiner Draken (»Drache« auf Schwedisch), einem Kampfjet, bei einem Übungsflug ins Meer gestürzt war. Man hatte ihn tot außerhalb der Maschine gefunden.
Ich erinnere mich nicht, dass ich die Tür geöffnet habe. Ich weiß nicht, dass man mir sagte, ich solle in einem anderen Zimmer spielen. Ich weiß nicht, was mit meinem Bruder war – er war in der Badewanne, ja. Aber wer kümmerte sich um ihn? Wer kümmerte sich um mich? Mom brach bei dieser Nachricht zusammen. Man hat mir diese Geschichte so oft erzählt, aber ich selbst erinnere mich nur an vereinzelte Momente. So funktioniert Trauma – unser Geist verschließt sich, um uns zu schützen, wenn zu viel auf einmal auf uns einstürzt. Ich weiß noch, wie meine Großmutter mich und meinen Bruder bei der Beerdigung nach draußen brachte, uns aus der Kirche führte und uns die Ohren zuhielt, damit wir das Schmerzgeheul unserer Mutter nicht hören konnten. Ich erinnere mich an die kleinen Kärtchen, die man uns gab, in der Handschrift unserer Mutter, doch unterschrieben mit Stefan. Es waren die schlimmsten Stunden ihres Lebens, aber sie schaffte es trotzdem, meinem Bruder und mir Trost in Form dieser Briefchen zu spenden, in denen er erklärte, wie sehr er uns liebte und dass er immer in unseren Herzen weiterleben würde. Viele Verwandte waren da, alle mit düsteren, traurigen Gesichtern. Ich hatte so viele Fragen, war selbst so verstört und traurig, doch ich konnte mich damit nicht an meine Mutter wenden, denn sie war untröstlich. Gar nicht da. Ich wollte ihren Schmerz nicht noch verstärken, indem ich ihr sagte, wie verloren ich mich fühlte. Niemand hatte sich die Zeit genommen, um mir zu erklären, wo Stefan eigentlich war. Irgendjemand hatte gesagt, er sei »jetzt im Himmel«, aber das wusste ich schon; schließlich flog er mit seinem Flugzeug ständig in den Himmel. Ich war fast fünf, ein Alter, in dem man schon einiges versteht, aber eben noch nicht alles. Ich fragte eine Verwandte, was mit Stefan passiert war. Sie antwortete: »Oh, mein Schatz, er hat dich so sehr geliebt. Er wollte ganz schnell heim zu dir, aber dabei ist er mit seinem Flugzeug zu schnell geflogen, und es ist ins Meer gestürzt.« Sie meinte es gut, aber bei mir kam an, dass Stefans Tod meine Schuld war. Wenn er mich ein bisschen weniger lieb gehabt hätte, dachte ich, dann hätte er sich nicht so beeilt, um zu mir zurückzukommen, und dann wäre er noch am Leben und meine Mutter immer noch glücklich. Stattdessen war alles dunkel und schrecklich. Ich hatte meinen Stiefvater verloren, und meine Mutter wurde von ihrer Trauer so überwältigt, dass ich kaum mehr an sie herankam.
Danach zogen wir in unsere Heimatstadt Uppsala zurück, und ich sah meinen Vater wieder. Ich rannte auf ihn zu, und er hob mich hoch. In seinen Armen fühlte ich mich sicher, und ich erlaubte mir zu weinen, was ich bisher bei meiner Mutter nicht getan hatte, weil es sie noch trauriger gemacht hätte. »Weißt du, dass Stefan gestorben ist?«, fragte ich. »Ja, das weiß ich«, antwortete mein Vater. »Und es ist gut, dass er tot ist.« Bei diesen Worten erstarrte ich. Mein Vater behauptet bis heute, dass er das nie gesagt hat, aber ich erinnere mich deutlich daran. Er war verletzt und eifersüchtig, hatte über ein Jahr einen anderen Mann beschuldigt, ihm seine Kinder weggenommen zu haben. In diesem Moment war mir klar: Ich konnte mit niemandem darüber sprechen, konnte niemandem vertrauen. Ich hatte Stefan geliebt, aber niemand würde mir erlauben zu trauern. Mein Vater nicht und ganz sicher nicht meine Mutter, deren eigene Trauer sie von Tag zu Tag psychisch instabiler werden ließ.
Die Besuche von Verwandten wurden immer seltener, und schließlich waren wir drei wieder allein. Um meine Mutter musste ich mich kümmern. Morgens vor der Schule weckte ich meinen Bruder, bevor ich Mom ihr Lieblingsfrühstück ans Bett brachte – Kaffee mit Milch, Orangensaft und Brot mit Käse. Ich lernte gerade erst lesen, konnte aber schon die Kaffeemaschine bedienen. Meine Mutter war nur noch ein Schatten ihrer selbst, zu fast nichts mehr fähig. Ich musste ihre Rolle einnehmen, Ludvigs Hand halten, wenn wir die Straße überquerten, und abends die Kerzen ausblasen, die sie angezündet hatte und brennen ließ, wenn sie ins Bett ging.
Ihr gebrochenes Herz lähmte sie völlig. Lange Zeit lag ich im Bett auf dem Bauch, wenn ich nicht schlafen konnte, legte mir das Kissen auf den Kopf und schrie in die Matratze, denn das tat meine Mutter. Ich dachte, damit könne sie besser schlafen. Ich verstand nicht, dass sie ihre unaussprechliche Trauer herausschrie. Die restliche Familie wusste sicher nicht, wie schlimm die Lage war, bis sie am Tag meiner Geburtstagsfeier versuchte, sich umzubringen. Sie überlebte knapp und wurde dann für ein paar Wochen in die Psychiatrie eingewiesen.
Als sie endlich wieder zu Hause war, versuchte sie ihr Bestes, um weiterzuleben. Sie hatte ihren Seelenverwandten verloren, ihren besten Freund und ihr Zuhause – alles auf einmal. Sie musste allein ein völlig neues Leben beginnen. Ich gab mir alle Mühe, sie aufzuheitern, und nach einer Weile beschloss ich, dass ich alles tun musste, damit sie wieder glücklich wurde. Ich glaubte wirklich, ihr helfen zu können, wenn ich mich nur genug anstrengte. Das bedeutete, gut in der Schule zu sein, mich nicht schmutzig zu machen, nicht unordentlich zu sein und kein Aufhebens um irgendwas zu machen. Ich tat alles, um ein braves Mädchen zu sein.
Mit der Zeit ging es ihr gut genug, dass sie eine Stelle bei einer Beratungsgesellschaft in Stockholm annehmen konnte, eine Stunde von unserem Haus in Uppsala entfernt. Sie war alleinerziehende Mutter, pendelte jeden Tag stundenlang und arbeitete hart, um über die Runden zu kommen. Mein Bruder und ich waren immer die letzten Kinder, die vom fritids abgeholt wurden, dem Kinderhort nach der Schule. Die Betreuer blieben oft länger bei uns, bis unsere Mutter endlich kam. Ich liebte es, als Letzte dort zu sein, den Erziehern zu helfen, die Lichter auszuschalten und alles aufzuräumen.
Mein Vater baute sich währenddessen ein Leben an der Ostsee auf, in Riga, Lettland, eine Flugstunde von uns entfernt. Nach seinem Wegzug sahen wir ihn kaum noch. Ich war acht, als er uns aus heiterem Himmel anrief und erzählte, dass er mit einer Ukrainerin namens Natascha ein Kind bekam, doch noch bevor das Baby auf der Welt war, verließ er Natascha für eine noch jüngere Frau namens Inga. Dad sah sein Kind nicht oft, aber wenn ich bei ihm war, besuchte ich es immer. Sie hieß Katja und war wunderschön. Ich freute mich so sehr, eine Halbschwester zu haben. Da fühlte ich mich weniger allein.
Während Dad damit beschäftigt war, mit seiner sehr viel jüngeren Freundin Schritt zu halten, lernte Mom Calle kennen, einen gut aussehenden, bärtigen Seemann aus Stockholm. Sie verliebten sich ineinander, oder zumindest glaube ich das. Ich weiß nicht, was für eine Art Liebe noch möglich ist, wenn man seinen Seelengefährten verloren hat. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Aber ich weiß noch, dass ich Calle mochte und mich freute, wenn er bei uns war. Nach einer Weile wurde Mom schwanger, und wir zogen mit Calle und seiner Tochter aus einer früheren Ehe zusammen, die jede zweite Woche bei uns wohnte. In Stockholm zu leben war anders. Ich war so nervös vor dem ersten Schultag, dass ich die Woche davor kaum schlafen konnte. Was, wenn mich niemand mochte? Was, wenn ich nicht dazupasste? Am Tag davor fiel ich auf ein Geländer und brach mir einen Knochen in meiner Hand. Ich musste mit einem Gips zur Schule gehen, und allein schon bei der Vorstellung starb ich vor Scham. Ich wollte nicht auffallen, und jetzt musste ich mit dem Arm in einer Schlinge dort auftauchen! Doch dann war der gebrochene Knochen ein Segen. Schon am ersten Tag fand ich Freunde – jeder wollte wissen, warum ich einen Gips hatte.
Mom brachte meine kleine Schwester Hedda auf die Welt, als Katja ein Jahr alt war. Jetzt hatte ich zwei Halbschwestern. Ich liebte Hedda über alles – sie war so klein und zerbrechlich, und sie brauchte mich. Ich kümmerte mich so viel wie möglich um sie. Ich lernte, ihre Windeln zu wechseln und wie ich mit ihr in der Küche herumtanzen musste, wenn sie weinte und nicht schlafen wollte. Auch wenn ich erst zehn war, hatte ich manchmal das Gefühl, als wäre ich Heddas Mutter.
Eine Weile war das Leben ziemlich ruhig. Unsere neue Familie hatte sich eingerichtet, und Dad besuchte mich sogar ab und zu und ging mit mir zum Essen oder kaufte mir eine neue Winterjacke oder nahm mich auf ein Skiwochenende mit. Mom und Calle wirkten recht glücklich, aber offensichtlich waren sie es doch nicht, denn als Hedda gerade mal sieben Monate alt war, verließ Mom ihn für einen Kollegen, der zufällig auch Stefan hieß. Und wieder wurde unser Leben auf den Kopf gestellt.
Mom zog mit uns und Stefan in eine neue Wohnung in einem schönen Teil von Stockholm. Sie war riesig, mit fünf Schlafzimmern, groß genug für uns drei Kinder und seine Zwillinge aus einer früheren Ehe. Bald heirateten sie, aber ich erinnere mich kaum an die Hochzeit, außer dass sie bei den Gelübden nicht dem Priester nachsprachen und sagten »Ich verspreche, dich zu lieben und zu ehren, solange ich lebe«. Meine Mutter antwortete stattdessen: »Ich will dich lieben und ehren, solange ich lebe.« Wenn ich jetzt daran zurückdenke, weiß ich, dass sie es wirklich versprechen wollte, aber nicht konnte. Mit Stefans Tod hatte sie etwas verloren, und sie wusste sicher nicht, wie sie es zurückerlangen sollte. Im selben Jahr heiratete mein Vater Inga in einer sehr viel prächtigeren Zeremonie. Vor zweihundertfünfundsiebzig Menschen hielt ich eine Rede und sagte: »Im Jahr 2000 heirateten meine Eltern endlich. Allerdings nicht einander.« Die Gäste lachten.
Innerhalb weniger Monate erwarteten beide Elternpaare ein Kind. Meine neuen kleinen Schwestern kamen im Abstand von drei Monaten auf die Welt: Dad und Inga bekamen im Mai 2001 Emelie und Mom und Stefan im August Maia. Die sich überschlagenden Ereignisse brachten meinen Stammbaum abrupt durcheinander. Jetzt hatte ich eine Ex-Stiefschwester, die ich nicht mehr sah, zwei neue Stiefgeschwister, vier Halbschwestern und natürlich meinen Bruder. Und als ob das nicht schon gereicht hätte, mich aus dem Gleichgewicht zu bringen, zogen Mom und Stefan mit uns aus der Stadt in ein großes weißes Haus auf Lidingö, einer Insel am Rand von Stockholm.
Ich wollte das nicht. Ich wurde älter und hatte erst kürzlich erkannt, dass es im Leben mehr gab als eine verrückte Familie, die sich ständig veränderte. Zwar war ich erst ein Teenager, aber ich hatte heimlich angefangen zu rauchen und mich mit Leuten angefreundet, die mir zeigten, wie man unbemerkt Alkohol aus der Hausbar klaute. Meine Freundin Stephanie brachte mir bei, wie man sich schminkte, und ich trug bauchfreie Oberteile und große Silberohrringe. Ich stopfte meinen BH aus, damit es so aussah, als hätte ich Brüste, dabei hatte ich noch nicht einmal meine Periode. Ich sah eher wie sechzehn als wie zwölf aus. Und ich war wütend. Ich rebellierte gegen die Regeln meiner Mutter und alles, was von mir erwartet wurde. In großen Kaufhäusern stahl ich zum Spaß Make-up und Klamotten, Unterwäsche, Stofftiere und Schlüsselanhänger. Dinge, die ich nicht brauchte. Ich suchte den Kick und wurde nie erwischt – einmal musste ich allerdings vor einem Wachmann davonrennen. Das war das Sahnehäubchen. Meine Freunde waren meine Komplizen. Sie waren zögerlich und nervös; ich dagegen war draufgängerisch und großspurig, wollte immer größere, teurere Sachen nehmen oder was am nächsten bei der Kasse lag. Kurz gesagt, ich hatte mich von einer ruhigen, ordentlichen Einserschülerin in eine Rebellin verwandelt, die immer das Drama suchte.
Sosehr ich mich auch dagegen sperrte, ich musste mit nach Lidingö ziehen. Das bedeutete natürlich auch eine neue Schule. Ich hätte es nie zugegeben, aber ich wollte so unbedingt dazugehören und Freunde finden, weshalb ich meinen Vater dazu brachte, mir ein neues Paar Diesel-Jeans zu kaufen. In Lidingö drehte sich alles um Designermarken, schicke Handtaschen und Geld, und ich hatte keine Ahnung, wie ich an diesem Ort überleben sollte. Ich kannte nur das Stadtleben – ich hörte Hip-Hop, rauchte und sprach Vorstadtslang.
Der erste Schultag war schrecklich. Ich trug meine neue Jeans und eine Truckercap, die ich tief ins Gesicht gezogen hatte, und versuchte, nicht aufzufallen. Im Flur brüllte mir ein älterer Schüler nach: »Hey, lesbisch sein ist voll okay!« Ich dachte, ich würde im Boden versinken und sterben. Ich sah wie eine Lesbe aus? War das schlecht? Wahrscheinlich ja. Lag es an den Diesel-Jeans? Der Kappe? Ich hatte gedacht, sie wäre cool; das trugen meine Freunde in der Innenstadt. Ich nahm sie ab und stopfte sie in meine Tasche. An dem Tag sprach ich mit niemandem mehr, und als ich nach Hause kam, sagte ich aufgebracht zu meiner Mutter: »Es ist furchtbar. Ich überlebe das keine Woche!« »Keine Angst«, antwortete sie. »Du wirst schon Freunde finden.« Ich schnaubte und rannte türenschlagend in mein Zimmer.
Einen Tag später kam ich mit neuen Freundinnen nach Hause. Ein Mädchen aus meiner Klasse und ich hatten uns gleich gut verstanden, weil sie auch Raucherin war (Zigaretten sind genauso gute Eisbrecher wie gebrochene Knochen), und sie hatte mich ihrer Clique vorgestellt. Meine neuen Freundinnen waren anders als die aus der Innenstadt. Alle hatten Geld – und es stellte sich heraus, dass ich auch nicht arm war! Mein Vater versorgte mich zuverlässig mit modischen Klamotten, einem nagelneuen Roller (damit ich damit zur Schule fahren konnte und nicht den Bus nehmen musste) und Urlauben mit Freunden in den Französischen Alpen oder Südspanien. Bisher war mir Geld nie wichtig gewesen – es war mir sogar immer peinlich gewesen, dass mein Vater nicht arm war –, doch jetzt, als wir in einem der wohlhabendsten Viertel Stockholms lebten, war es plötzlich ein großer Vorteil.
Eine dieser Reisen führte nach Åre, einem Skigebiet in Nordschweden. Einige Kids mieteten ihre eigenen Hütten, und ich war überrascht, dass sie das mit fünfzehn Jahren durften. Mein Vater hatte ein Ferienhaus in Åre, ich wohnte also bei ihm. Jeden Abend betrank ich mich mit dem Bier, das uns die Barkeeper zuschoben, bevor ich um ein Uhr nachts daheim sein musste.
An einem dieser Abende lernte ich Jonathan kennen. Er war groß und sah gut aus, und vom ersten Moment an hatte ich Schmetterlinge im Bauch. Er wirkte ein bisschen gefährlich, und das gefiel mir. Außerdem war er viereinhalb Jahre älter und küsste gut. Als ich nach einer Woche nach Hause fahren musste, schrieb er mir eine Nachricht. Wollen wir uns auch in Stockholm treffen? So begann meine erste große Liebe.
Wenn Jonathan und ich zusammen waren, passierte etwas. Es war, als wäre unsere Beziehung vorherbestimmt. Als hätten sich alle Sterne des Universums so positioniert, dass wir uns fanden. Wenn ich bei ihm war, fühlte ich mich nicht mehr unsicher, sondern geborgen, zu Hause. Wir verbrachten jede freie Sekunde miteinander und verschmolzen geradezu.
Jonathan war ein lieber Junge mit großen Problemen. Sein Geld verdiente er hauptsächlich auf wenig legale Weise, seine Familie hatte ihn in die Kriminalität mit hineingezogen. Er erzählte mir, dass er Jura studieren wollte, der Sprung vom leicht verdienten illegalen Geld zu einem ordentlichen Job jedoch zu schwer war. Er war auch Street-Art-Künstler, und an den meisten Wochenenden fuhren wir durch die Stadt und suchten nach seiner nächsten Leinwand. Ich stand Schmiere und hielt nach der Polizei Ausschau, während er und seine Freunde U-Bahn-Stationen und Tunnels mit riesigen Bildern besprühten. Ich liebte es – der Kitzel, etwas Gefährliches zu tun, belebte mich. Jonathan war unglaublich eifersüchtig, und mit der Zeit wurde ich es auch. Wir liebten uns erst leidenschaftlich und schrien uns gleich danach an und bewarfen uns mit Dingen. Wenn er wütend war, wurden seine Augen ganz schwarz. Nach einem Streit versöhnten wir uns tränenreich und klammerten uns fester aneinander als je zuvor. Mehr als einmal geriet er in eine Barschlägerei, weil mich irgendein Typ angeschaut hatte. Ich mochte es, einen Mann zu haben, der für mich kämpfte, aber selbst in diesem jungen Alter fragte ich mich manchmal: Muss es wirklich immer so schwierig sein? Mit der Zeit gewöhnte ich mich an seine Wut, und als er mich eines Abends nach einem Riesenstreit die Treppe zu unserem Haus hinaufjagte und mein Zimmerfenster mit der Faust durchschlug, um mich an den Haaren zu packen, fand ich immer noch nicht, dass er zu weit gegangen war. Oder einmal waren wir auf einer Dinnerparty, und ich saß neben einem Freund von ihm. Er wurde wieder eifersüchtig, und ich beschuldigte ihn danach, sich Dinge einzubilden. Unter einer Straßenlaterne verpasste er mir eine Ohrfeige und zerfetzte mein Kleid. An einem anderen Abend sprühte er mir Pfefferspray ins Gesicht, und ich dachte, ich müsste ersticken. Ich glaubte, es wäre Liebe. Auf eine verdrehte Weise war es das auch.
Während des Abschlussjahres schwänzte ich so oft wie möglich die Schule, um bei Jonathan zu sein. An meinem achtzehnten Geburtstag schenkte er mir einen Ring, und ich sagte Ja. Irgendwann verließen wir seine Wohnung gar nicht mehr und schliefen bis spät in den Nachmittag. Abends tranken wir. Mein Leben stank nach Bacardi Razz und billigem Wodka. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen wollte, und auch wenn ich glaubte, meinen Seelenverwandten gefunden zu haben, fühlte ich mich allmählich sehr verloren.
Zu der Zeit steckte Mom mitten in der Scheidung von Stefan Nummer zwei und hatte gerade eine Woche in einem Meditationszentrum verbracht, in dem sie Antworten gesucht und offensichtlich auch gefunden hatte. Sie empfahl auch mir, dorthin zu gehen. Ich hatte so große Angst, dass ich dachte, ich würde sterben, doch ich fuhr in das Zentrum. Ich erwartete, die Gründe für meine Traurigkeit zu finden, vielleicht ein paar Probleme mit meinem Vater aufzuarbeiten, doch stattdessen fand ich Stille. Die Tage waren eine Mischung aus aktiver Meditation, Gruppensitzungen, Übungen zu einem gesunden Lebensstil, und dazwischen herrschte absolute Stille. In diesen Momenten erkannte ich etwas Wichtiges: Ich hatte keine Ahnung, wer ich war.
Solange ich mich erinnern konnte, hatte ich nur die Stimme in meinem Kopf gehört, die mein Leben diktierte. Die Stimme, die sagte, ich sei nicht gut genug, nicht hübsch genug, nicht dünn genug, nicht schlau genug. Die Stimme, die sagte, dass ich keine Liebe verdiente, dass mir stattdessen schlimme Dinge zustoßen sollten; dass das Leben nicht gut und schön sein durfte, sondern es rein ums Überleben ging. Als diese Stimme allmählich verstummte, wurden mir grundlegende Dinge über meine Vergangenheit klar. Die vielen traumatischen Ereignisse aus meiner Kindheit, die ich nie verarbeitet hatte, kamen an die Oberfläche. Alles von den Umständen meiner Geburt über die Trennung meiner Eltern, dem Tod meines Stiefvaters, den ständigen Umzügen, dem Selbstmordversuch meiner Mutter, der Abwesenheit meines Vaters bis zu den vielen neuen Familienkonstellationen und den unweigerlich folgenden Scheidungen … Ich erkannte, dass mein Leben eine Abfolge von Trennungen und Verlusten war. Wie sollte ich auch irgendwem oder irgendwas trauen, wenn ich immer nur darauf wartete, dass mich jemand verließ? Ich war achtzehn und kratzte vorerst nur an der Oberfläche, aber es war ein Anfang.
Am letzten Tag nach der Meditation dämmerte mir, dass ich die meiste Zeit meines Lebens Entscheidungen danach getroffen hatte, ob ich damit andere Menschen glücklich machte. Ich war so verwirrt gewesen, nur darauf bedacht, es allen recht zu machen außer mir selbst, und hatte mich zerrissen, um das Chaos in den Griff zu bekommen. Als ich auf dem Meditationskissen saß, wurde mir klar: Ich will nicht nach Hause fahren. Sofort bekam ich Schuldgefühle – was würde meine Mutter sagen, wenn ich nicht heimkäme? Es würde sie sicher verletzen. Sie wäre aufgebracht. Nachdem ich mein ganzes Leben versucht hatte, sie nicht aufzuregen, erschien mir eine objektiv einfache Entscheidung unüberwindlich. Aber … Was empfand ich eigentlich? Was war mit mir? Ich nahm das Notizbuch, in das ich die ganze Woche geschrieben hatte. »Was wäre die liebevollste Entscheidung?«, hatte ich in großen Buchstaben über eine Seite geschrieben. Wir hatten viel über Selbstliebe meditiert und gesprochen und darüber, dass manchmal der liebevollste Schritt nicht unbedingt der einfachste ist. In diesem Moment wurde mir alles klar. Es war nicht liebevoll, die Gefühle meiner Mutter zu schonen, indem ich so tat, als sei alles in Ordnung, wenn es das nicht war. Ich durfte auch nicht meine eigenen Bedürfnisse ignorieren, um Konfrontationen aus dem Weg zu gehen, oder das Glück eines anderen vor mein eigenes stellen. »Ich werde auf mich achten«, schrieb ich. »Das Liebevollste, was ich tun kann, ist, mich für mich zu entscheiden.«
Ich verließ das Zentrum nach einer Woche mit Erkenntnissen, mit denen ich nichts anfangen konnte, und mir war bewusst geworden, wie wütend ich auf meine Mutter war. Es war ein seltsames Gefühl. Ich war noch nie wütend auf sie gewesen. Mein Ziel war immer nur gewesen, sie glücklich zu machen und aufzuheitern, aber ich erkannte, dass sie eine ganz schön schwere Last war. Ich wusste, dass ich ihr mit diesen Gefühlen nicht gegenübertreten konnte, und blieb erst einmal bei Jonathan. Ich betrachtete ihn immer noch als die einzige Konstante in meinem Leben, doch als wir uns wiedersahen, war ich nicht so glücklich, wie ich erwartet hatte. An diesem ersten Abend liebten wir uns, und ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal, seit wir uns kennengelernt hatten, dachte: Nein, das ist es nicht. In dem Meditationszentrum hatte ich so grundlegende Freude und Befreiung gespürt – warum ging es mir nicht auch so, wenn ich mit ihm zusammen war?
Danach begann ich, mein Leben zu verändern. Ich hörte zu rauchen auf, einfach so. Ich trank weniger Alkohol. Es gab Besseres als Schminke und Jungs und Saufen. Vor allem aber ging ich weiter den Fragen nach, die während der Woche in dem Zentrum an die Oberfläche gekommen waren. Zum ersten Mal in meinem jungen Leben fragte ich mich: Macht mich das glücklich? Könnte ich nicht auch etwas anderes tun? Das Leben zog mich in zwei Richtungen. Ein Teil von mir wollte zurück zu meinem alten, blinden Selbst, ein anderer wollte das neue Leben erforschen, von dem ich gerade gekostet hatte.
Nach ein paar Monaten des Grübelns kehrte ich für eine weitere Woche der Selbsterkenntnis in das Zentrum zurück. Es war noch intensiver als beim ersten Mal, weil der Schwerpunkt auf der Kindheit lag. Eine Woche in meine Vergangenheit einzutauchen war sehr anstrengend, und es kamen so viele Emotionen hoch, dass ich kaum wusste, wie ich damit umgehen sollte. Eines Morgens ging ich etwas widerwillig in den Meditationsraum; eine weitere Dynamische Meditation stand auf dem Plan. Dabei spielt das Ausleben von Gefühlen eine wichtige Rolle, der Körper ist der Zugang zum Herzen. Indem wir uns aktiv bewegten, konnten wir den Geist zur Ruhe bringen und absolute Stille erfahren. Es war so herausfordernd wie überwältigend. Als ich den Raum betrat, sah ich eine Frau auf einer Yoga-Matte, die einige Übungen machte. Ich blieb stehen und sah ihr zu. Wie konnte etwas so wichtig sein und sich so gut anfühlen, dass sie vor den anderen dafür aufstand? Es wirkte so heilig. Noch nie hatte ich bei etwas so empfunden. Genau das will ich, dachte ich.