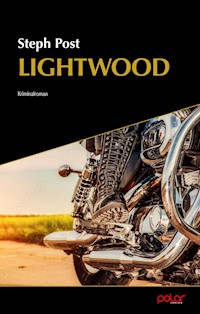
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Judah Cannon ist der mittlere Sohn des berüchtigten Cannon-Clans, der von Sherwood, seinem unerschrockenen und kompromisslosen Patriarchen, angeführt wird. Als Judah nach einem Gefängnisaufenthalt in seine ländliche Heimatstadt Silas, Florida, zurückkehrt, ist er entschlossen, in seinem Leben voranzukommen und mit seinem besten Freund aus Kindertagen und seiner neu entdeckten Liebe Ramey Barrow ein sauberes Leben zu führen. Alles gerät jedoch bald außer Kontrolle, als ein Anruf von Sherwood Judah und Ramey in ein kompliziertes Netz aus Diebstahl, Brutalität und Verrat verstrickt. Unter dem Druck der unerbittlichen Blutsbande überfällt Judah die Scorpions, eine Gruppe methkochender Biker. Ohne Wissen der Cannons gehört die Hälfte des gestohlenen Bargelds jedoch Schwester Tulah, einer größenwahnsinnigen Pfingstpredigerin. Als Schwester Tulah von dem Raub erfährt, schwört sie, sowohl die Cannons als auch die Skorpions dafür bezahlen zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DARK PLACES
Steph Post
Lightwood
Aus dem Englischen von Kathrin BielfeldtHerausgegeben von Jürgen Ruckh
Originaltitel: LightwoodCopyright: © 2017 by Steph Post
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2022Aus dem Englischen von Kathrin BielfeldtMit einem Nachwort von Carsten Germis
© 2022 Polar Verlag e. K., Stuttgartwww.polar-verlag.de
Redaktion: Eva Weigl
Korrektorat: Andreas März
Umschlaggestaltung: Britta Kuhlmann
Coverfoto: © Andrey Armyagov / Adobe Stock
Autorenfoto: © Ryan Holt
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign
Druck und Bindung: Nørhaven, Agerlandsvej 3, 8800 Viborg, DK
Printed in Denmark 2022
ISBN: 978-3-948392-44-4eISBN 978-3-948392-45-1
Für Lucy,in den Sternen
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Danksagungen
Familienbande
Kapitel 1
Als Judah Cannon aus dem Florida State Prison nordwestlich von Starke entlassen wurde, war niemand da, um ihn zu empfangen. Also lief er einfach los. Der Himmel war grau, die Luft stand, und obwohl erst Anfang Mai, war die Hitze Floridas bereits erdrückend. Als er über den Parkplatz ging, rief ein anderer, auch gerade entlassener Häftling Judah etwas zu.
»Hey, Mann, latschst du, oder was? Du weißt, die haben hier ’n Bus, der einen abholt, oder?«
Judah ignorierte ihn.
»Sollen wir dich irgendwohin mitnehmen, Kumpel? Meine Alte hat die Karre voller Kids, aber wir können dich vielleicht noch mit reinquetschen.«
Judah hob anerkennend die Hand, schüttelte aber den Kopf. Er schaute weiter geradeaus auf die Straße und atmete erleichtert auf, als seine Stiefelabsätze auf den Asphalt des Seitenstreifens der State Road 16 schlugen. Nach drei Jahren war er wieder ein freier Mann, und wenn er vorhatte, bis zur Grenze von Badford County zu laufen, dann würde er das auch tun. Er blickte nicht zurück und er achtete nicht auf den entgegenkommenden Verkehr. Er überquerte die Straße, hinüber auf die rechte Seite und dann Richtung Süden.
Judah wartete, bis gut ein Kilometer zwischen ihm und dem Staatsgefängnis lag, bevor er sich die erste Zigarette ansteckte. Starke war sein erster Knastaufenthalt gewesen und ihn triezte die romantische Vorstellung, dass seine erste Zigarette danach, als freier Mann, irgendwie bemerkenswert sein würde. Er wusste nicht, warum. Während eines der wenigen Telefonate mit seinem älteren Bruder war Judah versichert worden, dass die Entlassung aus dem Gefängnis ähnlich erhaben war wie einzufahren. Doch da hatte Judah seine Zweifel. Er hatte sich nicht so im Gefängnis eingewöhnt wie Levi. Er hatte sich nicht brechen lassen, war aber auch nicht in den gleichen Rhythmus verfallen. Er hatte den Kopf eingezogen, aber stets die Fäuste geballt.
Ein Sattelzug dröhnte an Judah vorbei, als er versuchte, das Feuerzeug anzuschnipsen, und er brauchte ein paar Anläufe, bis die Zigarette brannte. Judah inhalierte tief, legte den Kopf zurück und schaute zum Himmel auf. Er hatte die Farbe von brüniertem Stahl. Die Stimmung hielt die Luft an, genau wie Judah. Ein Falke zog über ihm seine Kreise und in der Ferne brummte ein tief fliegendes Flugzeug. Judah behielt den Rauch in der Lunge und wartete.
Nichts. Es brannte nicht. Die Welt erschien nicht klarer und ergab nicht mehr Sinn. Ein Pick-up mit der Ladefläche voller Teenager kreischte an ihm vorbei. Eine leere Coors-Dose landete anderthalb Meter von ihm entfernt auf dem Randstreifen, begleitet von einer Beleidigung seiner Mutter. Judah atmete aus. Die Zigarette schmeckte genauso wie die letzte, die er gerade noch im Gefängnishof geraucht hatte. Und die letzte, die er geraucht hatte, bevor er zur Urteilsverkündung ins Gerichtsgebäude gegangen war. Und die letzte, die er geraucht hatte, nachdem seine Tochter geboren wurde. Nachdem er sein erstes mitternächtliches Dragsterrennen gewonnen hatte. Seine Unschuld verloren hatte. Ein Mädchen geküsst hatte. Sein erstes Päckchen Zigaretten geklaut hatte. Es war dasselbe. Sein Bruder hatte nicht recht gehabt. Aus dem Gefängnis entlassen zu werden war nur ein weiterer Tag, an dem man mit seinem Leben weitermachte.
Judah stopfte das Feuerzeug zurück in die Tasche und zog eine zerknitterte Seite aus einem Notizblock hervor. Sie war so viele Male zusammen- und wieder aufgefaltet worden, dass sie an dem Falz schon ganz weich und abgenutzt war. Er hatte sie mitgenommen und sich eingeredet, dass es ihm egal sei, doch dem war nicht so, das wusste er. Er klemmte die Zigarette zwischen die Lippen und öffnete den Brief. Er war fast auf den Tag genau vor einem Jahr datiert. Er blinzelte auf die gekringelte, mädchenhafte Handschrift, doch blieb mit seinem Blick nicht an den Worten hängen. Er kannte sie alle auswendig. Lieber Judah. Und dann ein bisschen Gezicke darüber, dass der K-Mart oben in Colston schloss. Und noch weiteres Gezicke, weil ihre Mutter wieder angefangen hatte, in der Elks Lodge Bingo zu spielen und jetzt nicht mehr babysitten konnte. Keine Nachfrage, wie es Judah ginge. Und dann die Krönung. Sie hatte genug. Und diesmal wirklich endgültig. Und das meinte sie so. Da gäbe es einen anderen Typen, einen Manager bei Denny’s, der sie so behandelte, wie sie es verdiente. Ihr alles gab, was sie sich wünschte. Er hatte Stella sogar neue Kleider für die Vorschule gekauft. Würde darüber nachdenken, irgendwann für Stella Gymnastikunterricht zu bezahlen. Und, ach ja, übrigens war Stella gar nicht von ihm. Und diesmal meinte sie das auch so. Also wäre es besser für alle, wenn er sie einfach vergäße. Und besser für Stella, wenn sie ihn nicht wiedersehen müsste. Sie endete weder mit einer Entschuldigung, noch wünschte sie ihm ein schönes Leben. Die Blechkarre, die er ihr zum Fahren dagelassen hatte, brauchte ein neues Getriebe, also hätte sie entschieden, sie an den Schrotthändler zu verkaufen. Love, Cassie.
Judah war über den Denny’s-Mann nicht überrascht gewesen. Zumindest hatte sie diesmal abgewartet, bis er hinter Gittern saß. Auch der Teil, dass er nicht Stellas Vater sei, verwunderte ihn nicht, obwohl er auch nicht ganz sicher war, dass er es glaubte. Jedes Mal, wenn Cassie damit gedroht hatte, ihn zu verlassen, hatte sie diese Karte gespielt, und jedes Mal, wenn sie Geld brauchte oder wieder mit ihm zusammenkommen wollte, hatte sie Stein und Bein geschworen, dass Stella seine Tochter war. Aber vermutlich spielte das keine Rolle mehr. Er liebte das flachsblonde, kleine Mädchen, doch es erinnerte sich vermutlich nicht mal mehr an ihn. Und das musste es auch nicht.
Er hatte eine Vereinbarung mit sich selbst getroffen. Wenn Cassie dort auf dem Parkplatz auf ihn gewartet hätte, und dort an dem kaputten Oldsmobile gelehnt hätte, vielleicht noch in dem kurzen blauen Kleid, das er so mochte, und diesen weißen, hochhackigen Sandalen, hätte er alles verziehen und wäre mit ihr nach Colston zurückgekehrt. Während er auf seiner klumpigen Matratze lag und an die Betondecke starrte, hatte er sich die Szene immer und immer wieder in Gedanken ausgemalt. Aber wenn sie nicht auf ihn wartete, nun denn.
Judah hob den Brief, bis eine Ecke davon seine Zigarette berührte. Er inhalierte, die Glut leuchtete auf und das Papier begann zu qualmen. Er ließ den Brief in seiner Hand verglimmen und als er begann, seine Finger zu schwärzen, ließ er ihn neben sich auf den Asphalt fallen. Judah ging weiter. Er schaute nicht mehr zurück.
»Nee, Mann. So was wie Wale auf dem Mond gibt’s nicht. Warst du nie in der Schule, oder was?«
»Ist ja auch nicht wie unser Mond, Blödian. Hast du dir die Show überhaupt angeguckt? Der Typ hat gesagt, Europa. Das ist in der Nähe vom Jupiter. Das ist einer von den Jupitermonden.«
»Und das macht ’n Unterschied, oder wie? Die haben Wale auf dem Jupiter oder so was?«
Judah zog sein Portemonnaie, das BIC-Feuerzeug und eine gequetschte Packung Marlboro aus der Tasche und warf sie auf den Tresen, bevor er sich setzte. Die Metallbeine des Barhockers kratzten über den Betonboden und als er sich niederließ, blickten die beiden Streithähne am anderen Ende des Tresens auf.
»Hey, du. Was meinst du denn?«
Judah rieb sich das Gesicht und sah sich nach dem Barkeeper um.
»Wozu?«
Der Mann hinter der Bar, dessen rosa-wächserne Haut von tiefen Aknenarben zerfurcht war, nickte Judah zu, machte aber keine Anstalten, der verlotterten Blondine, mit der er sich drei Hocker weiter unterhielt, auch nur einen Schritt von der Seite zu weichen.
»Glaubst du, die haben Wale auf Europa?«
Judah beachtete sie nicht. Schließlich löste sich der Barkeeper von der Blondine und ihrer tränenreichen Story und fragte Judah, was er haben wolle.
»Nur ein Bier. Irgendwas vom Fass.«
Der Barkeeper knurrte und klopfte mit seinen haarigen Fingerknöcheln auf den Metalldeckel der Eistruhe.
»Wir haben normales Bier, Light-Bier, Weichei-geht-noch-Sport-machen-Light-Bier und Weichei-Bier-mit-Obstscheibe-am-Glasrand.«
»Wie wär’s mit einem Bier?«
Der Mann grunzte wieder und füllte ein beschlagenes Pint-Glas mit Budweiser. Er stellte es auf dem zerkratzten Holz vor Judah ab und kehrte zu der Blondine zurück. Judah beäugte die bernsteinfarbene Flüssigkeit. Obwohl er im Knast seinen Teil an selbst gebrauten Rachenputzern probiert hatte, war das hier sein erstes richtiges Bier seit drei Jahren. Nachdem er sechs Stunden lang entweder gelaufen oder getrampt war, hatte Judah den Glauben daran verloren, dass nun, wo er wieder draußen war, alles irgendwie besonders sein würde, war aber dennoch zufrieden, mit einem kalten Bier in einer dunklen Bar zu hocken. Er nahm einen Schluck. Das Budweiser schmeckte genauso fade, wie er es in Erinnerung hatte. Aber damit konnte Judah leben.
Er trank die Hälfte des Biers in großen Schlucken und versuchte, sich zu entspannen. Dann legte er die Hände vor sich auf den Tresen und lehnte sich auf dem Barhocker mit seinem rissigen Leder zurück. Es war jetzt mindestens fünf Jahre her, seit Judah, in kitschiges Neonlicht getaucht, im The Ace in the Hole gesessen hatte, doch die Einrichtung der Bar hatte sich kaum verändert. Der »Hooters Girl« war von 2011, doch der Kalender hing noch an derselben Stelle neben dem Pappschild »Tipping is NOT a City in China«. Der dazugehörige Messingeimer für das Trinkgeld hing immer noch in den Pfoten eines ausgestopften Bibers, den der Eigentümer eigenhändig geschossen hatte, obwohl eines seiner Glasaugen inzwischen herausgefallen war und nun danebenlag, angelehnt an den platten Biberschwanz. Der verschmierte und oxidierte Barspiegel, die halb leeren Kühlboxen für Flaschenbier, der säuerliche Geruch der Barmatte, der pinkfarbene Schimmer des übergroßen Michelob-Schildes: all das war gleich. Sogar der Barkeeper. Der Mann selbst war neu, aber seine Attitüde war die gleiche. Judah war sich unsicher gewesen, ob er nach Silas zurückkehren sollte, doch jetzt fühlte er sich bestätigt. Er nahm einen weiteren Schluck Bier und zündete sich eine Zigarette an.
»Also, hey, du hast uns gar nicht geantwortet.«
Judah griff nach dem Plastikaschenbecher und legte seine Zigarette zwischen die kalte Asche. Er drehte sich auf seinem Barhocker um und sah die beiden Männer zu seiner Rechten an. Irgendwie kamen sie ihm bekannt vor. Sie schienen Anfang dreißig zu sein, also schätzte Judah, dass er vermutlich mit ihnen auf der Highschool gewesen war. Der Mann, der Judah am nächsten saß, hatte ein wanderndes Auge und Judah meinte, sie hätten zusammen Baseball gespielt. Judah legte den Kopf leicht schief.
»Wie bitte?«
Der Mann mit dem schielenden Auge zeigte hoch auf den eingestaubten Fernseher, der in der Ecke über der Bar hing. Bunte Planeten wirbelten über eingeblendeten Untertiteln herum. Judah sah kurz zum Fernseher auf und dann wieder zurück zu den Männern an der Bar. Er hob die Augenbrauen und tippte die Asche von seiner Zigarette. Der zweite Mann, dessen dunkles, gelocktes Haar unter seiner Kappe hervorquoll, schlug genervt mit der flachen Hand auf den Tresen und beugte sich vor.
»Mein idiotischer Cousin Pellman hier denkt, es könnte Wale auf dem Mond geben. Tust du mir einen Gefallen und sagst ihm, dass das Schwachsinn ist, damit er endlich die Klappe hält? Darum habe ich kein Kabelfernsehen bei mir zu Hause. Das sind doch alles Durchgeknallte, die mit offenem Mund über Zeitreisen staunen, und dass eigentlich Aliens die Pyramiden gebaut haben sollen und so Scheiß. Was für ein Stuss.«
Pellman schüttelte den Kopf und wedelte mit der Hand in Richtung seines Cousins, als wolle er eine Fliege verscheuchen. Es sah Judah von der Seite an.
»Du siehst nicht aus, als wärst du von hier. Was meinst du denn dazu?«
Judah sah wieder zum Fernseher auf. Es lief eine Werbung für Blutzuckerteststreifen. Eine alte Schwarze hielt ihre Finger hoch, um zu zeigen, dass sie die ständige Pikserei leid war.
»Eigentlich komme ich hier aus der Gegend.«
Judah fuhr mehrfach mit der Hand über sein kondensiertes Bierglas.
»Echt? Ich hab dich hier noch nie gesehen.«
Pellman sah Judah mit seinem zusammengekniffenen guten Auge an.
»Na ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Egal, hör zu. Da ist dieser Typ in dieser Wissenschaftssendung und der sagt, es gäbe Wasser auf diesem Mond, der um den Jupiter fliegt.«
Judah unterbrach ihn.
»Warum guckt ihr in einer Bar eine Wissenschaftssendung?«
Pellmans Cousin schlug wieder mit der flachen Hand auf den Tresen.
»Genau! Das ist genau das, was ich auch wissen will. Weißt du, darum hab ich nämlich bei mir zu Hause kein Kabelfernsehen.«
Pellman wandte sich an seinen Cousin.
»Wenn du das hättest, Erwin, dann würde deiner Frau vielleicht endlich ein Licht aufgehen, und sie würde dich Vollpfosten verlassen.«
Pellman und Erwin. Jetzt war Judah sicher, dass er mit ihnen zusammen auf der Highschool gewesen war. Erwin war ein Outfielder bei den Tigers und Pellman, wegen seines Auges und der absoluten Unfähigkeit, ein sich bewegendes Objekt zu fangen, der Getränkejunge des Teams. Nachdem er einen Stoß gegen die Schulter bekommen und dabei sein Bier verschüttet hatte, drehte sich Pellman wieder zu Judah um.
»Also, hör zu. Da ist dieser Wissenschaftstyp, und der sagt, es gäbe vielleicht Wasser auf dem Mond, der um Jupiter kreist.«
Judah nickte.
»Ah-ha.«
»Und dann sagt der Typ, dass mit der Hitze und allem, und wie die Sonne auf den Mond reflektiert oder so was, und den Nährstoffen in den Steinen, von denen sie denken, dass sie da oben sind, und noch anderes Zeugs, also, er sagt, dass, wenn wir ein Raumschiff zu diesem Mond nehmen und dann unter das Eis gehen oder so was, und, also, warte mal kurz.«
Pellman machte eine kurze Pause, um den Diskussionsfaden im Kopf durchzugehen. Erwin kicherte boshaft, doch Judah zog nur an seiner Zigarette und wartete.
»Jetzt weiß ich’s wieder. Er sagte, dass, wenn wir unter das Eis gingen und dort Wasser finden würden, dann könnte in dem Wasser Leben sein.«
Judah trank sein Bier aus und sah sich nach dem Barkeeper um.
»Okay.«
»Also habe ich gesagt, wenn da Leben im Wasser ist, dann könnte da mehr sein als nur so ’n paar kleine Insekten oder Kriechtiere. Da könnte es auch Größeres geben. Weil, weißt du, der Jupiter ist ein großer Planet, und dann muss der Mond auch groß sein, was bedeutet, dass in dem Wasser dicke Viecher sind.«
Erwin schüttelte den Kopf und lachte in sich hinein. Der Barkeeper eiste sich von der Blondine los und schenkte Judah noch ein Bier ein. Als er es absetzte, schwappte es über und Judah griff nach ein paar Cocktailservietten. Pellman quasselte immer noch.
»Also, die größten Tiere, die mir einfallen, die im Wasser leben, sind Wale.«
Erwin unterbrach ihn.
»Was ist mit Haien?«
»Kannst du nicht mal für fünf Minuten den Mund halten? Die Sache mit den Haien haben wir doch schon durch. Wie oft soll ich’s dir denn noch sagen? Wale sind größer als Haie.«
Erwin schnaubte.
»Ja, aber nicht fieser.«
Judah zielte und warf die biergetränkten Servietten in den Mülleimer hinter der Bar. Er musste das fragen. »Wie lange sitzt ihr Jungs schon hier und streitet darüber?«
Pellman blickte hoch zum Fernseher.
»Also, die Show jetzt is’ nich’ über Monde. Ich glaub’, die ist über Galaxien oder so was. Die Show über Monde war die davor, glaub’ ich. Oder war das die über Asteroiden? Ich weiß nich’ mehr.«
Judah blickte von einem Cousin zum anderen. Sie tranken offensichtlich schon eine ganze Weile. Pellman leerte seine Flasche PBR und knallte sie auf den Tresen.
»Du hast recht. Wir reden schon viel zu lange darüber. Also, dann lass uns das jetzt beenden. Was glaubst du, Neuer? Glaubst du, es gibt Wale auf Europa?«
Judah drückte seine Zigarette aus und legte die Unterarme auf die Kante des Tresens.
»Ich bin kein Neuer. Ich heiße Judah Cannon und bin erst seit heute Morgen aus dem Gefängnis raus. Zum Teufel mit Walen auf dem Mond. Lasst uns ein paar Shots trinken.«
Schwester Tulah Atwell sah hinauf in den Himmel über Kentsville und konnte spüren, wie sein schreckliches Gewicht sie niederdrückte. Es war, als hätte jemand einen mit Diamanten bestreuten schwarzen Samtmantel in die Atmosphäre geworfen, der nun mit der Absicht, sie zu ersticken, auf die Erde zurückfiel. Sie wandte sich von der schweren Dunkelheit ab und musterte den Parkplatz, der vor ihr lag und vor staubigen Pick-ups, Minivans und Wagen, die ein paar Tausend Kilometer zu viel auf dem Tacho hatten, überquoll. Viele Autos parkten gefährlich nahe an dem durchweichten Abflussgraben und würden es schwer haben, mit durchdrehenden Reifen dort wieder wegzufahren, wenn der Gottesdienst irgendwann in den feuchten, frühen Morgenstunden zu Ende war. Schwester Tulah stemmte die Hände in ihre ausladenden Hüften und betrachtete ausdruckslos den Platz. Hinter ihr und den dünnen Wänden der Last Step of Deliverance Church of God wurde unablässig weitergesungen.
»This little light of mine … I’m gonna let it shine, this little light of mine … I’m gonna let it shine …«
Die Sänger waren gefangen in dem Moment, wiederholten die Strophen wieder und wieder, begleitet von Klavier, Tamburin und endlosem Klatschen. Die Erweckung hatte noch nicht offiziell angefangen, doch die Gemeinde hatte sich bereits hineingesteigert. Sie hatten jetzt schon eine Dreiviertelstunde Hymnen gesungen und Schwester Tulah hatte ihre Stimmen geeicht. Es würde eine lange Nacht werden, ein langes Wochenende, und sie wollte eine Vorstellung davon bekommen, wie es laufen würde. Sie schnaubte und spuckte in den Sand zu ihren Füßen.
Die rückwärtige Tür der Kirche öffnete sich hinter ihr und ein schmaler Lichtstreifen durchbohrte die Finsternis. Die Stimme eines Mannes, hoch, keuchend und ein wenig unsicher, kam um die Ecke.
»Ist es schon so weit?«
Schwester Tulah warf einen letzten Blick auf die schwarze, klaffende Weite über sich und entschied, dass, wenn sie so weit war, Gott es auch sein müsste. Sie rückte den Spitzenkragen ihres langen Blumenkleides zurecht, glättete ihr Haar, einst Straßenköterblond, jetzt stahlgrau, und stellte sicher, dass alle Haarnadeln saßen. Sie rieb sich die fleischigen, altersgefleckten Hände und leckte sich über die Lippen, bevor sie sie fest aufeinanderpresste. Ohne über die Schulter auf den wartenden Streifen Licht zu schauen, antwortete Schwester Tulah.
»Es ist so weit.«
Als Judah das Gefängnis verließ und sich auf den Weg nach Silas machte, hatte er nicht mehr als zwanzig Dollar in der Tasche. Doch sobald Erwin und Pellman klar wurde, wer Judah war, verkündeten sie, ihn einzuladen. Judah stellte seinen zweiten Shot Whiskey ab und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Die beiden Cousins und Judah waren damals, als Judah noch in der Stadt lebte, keine engen Freunde oder so gewesen, doch je mehr er trank, desto mehr genoss er ihre Gesellschaft.
»Scheiße, Mann. Kann echt nicht glauben, dass du von Starke hierher zu Fuß gelaufen bist. Das sind doch locker dreißig Kilometer oder so?«
Judah zog seine letzte Zigarette aus der Packung und tippte sie auf die Bar.
»So ungefähr. Davon bin ich aber wahrscheinlich nur zehn oder so gelaufen. Dann hat mich diese verrückte Lady in dem Minivan mitgenommen, von der ich euch erzählt habe.«
»Oh ja, die, die dich am Walmart in Kentsville rausgelassen hat, dir dann gefolgt ist und versucht hat, dir ein paar Klamotten zu kaufen?«
Judah fuhr sich mit der Hand durchs Haar und hustete. Die Frau in dem beigefarbenen Taunus, die wieder und wieder insistierte, dass Judah sie Trish nannte, war sehr nett gewesen, und Judah mochte sich nicht über sie lustig machen, doch als sie Judah durch den Laden gefolgt war und ihn dann an der Kasse mit dem Angebot überrascht hatte, ihm das Paar Wrangler und das karierte Hemd zu kaufen, war ihm das auf den Keks gegangen.
»Jo.«
Pellman schüttelte den Kopf.
»Mann, ich sollte auch mal für ’ne Weile in den Knast. Vielleicht bietet mir dann auch eine Braut an, mir neue Klamotten zu kaufen, wenn ich rauskomm.«
Judah zündete sich die Zigarette an.
»Ist nicht so großartig, wie’s sich anhört.«
Es war Freitag und im Verlauf des Abends füllte sich das Ace. Judah erkannte langsam immer mehr Stammkunden wieder, als sie mit Schwung durch die Kneipentür kamen. Die schwere Metalltür schlug hinter jeder Person wieder zu und bei jedem Schlag schaute Judah automatisch hoch in den Spiegel hinter der Bar. Er begegnete den Blicken von Leuten, die er kannte, doch niemand schien ihn zu bemerken. Judah wandte sich an Pellman.
»Findest du, ich sehe anders aus?«
Pellman erzählte gerade ausschweifend von der letzten Lady, für die er einen Haufen Geld ausgegeben hatte, und die sich damit bedankte, dass sie mit Erwins Daddy schlief, als Judah ihn unterbrach.
»Hä?«
»Findest du, ich sehe anders aus? Als beim letzten Mal, wo du mich gesehen hast?«
Der Alkohol stieg Judah zu Kopf. Nüchtern hätte er eine solche Frage nie gestellt. Doch er begann, sich irgendwie beklommen zu fühlen, fehl am Platz. Er war nach Silas zurückgekehrt, weil er nicht wusste, wohin er sonst gehen sollte. Ihm war klar, dass er nicht mehr weiterwusste, obwohl er das nie zugeben würde, und er wusste, dass Silas nicht die Schwalbe war, die ihn zum Ufer leiten würde. Wenn überhaupt, würde die Stadt ihn ertränken, ihre Tentakel um sein Herz schlingen und ihn in den Abgrund ziehen. Judah hätte alles dafür gegeben, wenn die Anonymität, die ihn gerade schützte, für immer währen würde. Pellman legte den Kopf auf die Seite und dachte kurz über Judah nach.
»Zum Teufel, Mann. Ich weiß nicht. Als du ganz am Anfang reingekommen bist und dich hingesetzt hast, hab ich dich nicht erkannt. Aber ich denk, du siehst nicht anders aus oder so. Man ist nur so an dieselben Leute gewöhnt, die hier immer sind, da denkt man nicht über Leute nach, die weggehen und wiederkommen. Also, ich weiß nicht.«
Judah starrte in den milchigen Barspiegel. Im verzerrten Spiegelbild hätte er der Sohn von jedem in Silas sein können. Aber das war nur Wunschdenken.
»Ich weiß auch nicht.«
Judah stand auf und bahnte sich seinen Weg durch verschwitzte Leute und eine Wolke von abgestandenem Qualm zur Toilette hinter der Bar. Es war abgeschlossen, und hinter der Sperrholztür konnte er Gekicher hören. Er entschied, nicht zu warten, verließ das Ace und trat hinaus in die warme Nacht. Als Judah um die Ecke kam, warf ihm ein Mann in seinem Alter, der an der Wand des Betonziegelgebäudes lehnte, einen bösen Blick zu. Das stämmige Teenager-Mädchen, das barfuß war und nur ein heißes, bauchfreies pinkfarbenes T-Shirt trug, verdrehte die Augen und zog das Gesicht des Mannes zurück an sein eigenes. Judah wich dem Blick des Typen aus und ging an ihnen vorbei zum Schotterparkplatz hinter der Bar. Er suchte sich seinen Weg über Steinbrocken und abgestorbene Grasbüschel, bis er den letzten Pick-up am Ende der verbeulten Reihe erreicht hatte, wo er den Reißverschluss seines Hosenstalls öffnete. Irgendwie hoffte er, dass er gegen das Vorderrad des Pick-ups pinkelte, der dem Mann gehörte, der es mit der Minderjährigen trieb, aber vermutlich gehörte der weiße Dodge eher einem Jugendtrainer oder einem Kriegsveteranen. Bestimmt hatte er genau diese Art von Glück. Aber das hielt Judah nicht ab. Er erleichterte sich im schwachen blau-weißen Licht einer Insektenlampe, die am Ast einer Eiche hing, und musterte sein Spiegelbild im Fahrerfenster.
Judah hatte im Gefängnis nicht viel Zeit damit verbracht, in den Spiegel zu gucken. Und vorher auch nicht. Er kam aus einer langen Reihe von Männern, die auf den Dreck unter ihren Fingernägeln genauso stolz waren wie andere Männer auf ihre Armbanduhr. Männer, die ihr Unterhemd erst dann wechselten, wenn es Matsch- oder Blutflecken hatte, oder Schlimmeres, und nicht einfach nur, weil ein neuer Tag war. Männer, die nur in den Spiegel schauten, wenn sie sich rasierten, und die sich nur rasierten, wenn sie jemandem an die Wäsche wollten. Eitelkeiten spielten keine Rolle.
Doch für einen kurzen Augenblick betrachtete sich Judah im wässrigen Glanz des fingerverschmierten Fensters eingehender. Er brauchte einen Haarschnitt, doch er hatte immer noch dasselbe dunkle, fast schwarze Haar, das widerspenstig in alle Richtungen abstand, wenn er es nicht mit einer Kappe bändigen konnte. Sein Bruder Levi, der noch keine vierzig war, hatte an der rechten Seite inzwischen eine graue Strähne, doch als Judah seinen Kopf drehte, fiel ihm dort nichts auf. In der Dunkelheit war es schwer zu sagen, doch er nahm an, dass seine Augen immer noch hellgrau waren, umgeben von drei Reihen Fältchen, weil er, seit er krabbeln konnte, fast jeden Tag draußen verbracht hatte. Cassie hatte ihm oft gesagt, dass er mit blauen Augen so viel besser aussehen würde, doch das war ihr Ding. Jedes Mal, wenn sie wieder Schluss gemacht hatten, krallte sie sich jemanden mit blondem Haar, blauen Augen und einer Goldkette. Sie hatte immer versucht, ihm Schmuck zu kaufen und wurde wütend, wenn er ihn nicht trug. Er fragte sich, was für eine Halskette der neue Denny’s-Freund wohl hatte.
Judah schüttelte ab und zog den Reißverschluss hoch. Soweit er sagen konnte, sah er genauso aus wie das letzte Mal, als er in Silas gewesen war, also war er nicht sicher, warum ihn niemand wiedererkannte. Vielleicht hatte Pellman recht; die Leute waren es gewöhnt, immer dieselben Gesichter zu sehen, Männer in den gleichen Arbeitshemden, die die gleichen Pick-ups fuhren, das gleiche Bier tranken, die gleichen Frauen anbaggerten oder verprügelten, in denselben Bars, wo vor ihnen schon ihre Väter und deren Väter genau das Gleiche getan hatten. Judah ging um das Gebäude herum zurück und entschied, noch ein wenig die Anonymität zu genießen, solange er konnte. Er befürchtete, dass es nicht lange anhalten würde, sowie die Leute herausfanden, dass ein weiterer Cannon-Junge wieder in der Stadt war. Er drückte die schwere Stahltür auf und schob sich durch die inzwischen noch lautere Menge zurück an die Theke. Pellman war nirgends zu sehen, und auf seinem Platz saß jetzt die Person, die Judah am wenigsten erwartet hatte, und die einzige Person in der Bar, die zählte.
Als sie spürte, wie seine Hand die Lehne ihres Barhockers ergriff, drehte sie sich um, und ihr breites Lächeln traf ihn an einer Stelle, die er ganz vergessen hatte. Sie fuhr sich mit einer Hand durch ihr langes, zerzaustes Haar, stützte einen Ellbogen auf die Theke und betrachtete ihn.
»Hast ja lange genug gebraucht, zurück in die Stadt zu kommen.«
Judah atmete tief ein und merkte, dass er keine Ahnung hatte, was er sagen sollte.
»Hi, Ramey.«
Kapitel 2
Der Barkeeper, der sich irgendwann während der letzten vier Bier und zwei Shots schließlich vorgestellt und geknurrt hatte, sein Name sei Grady, räumte die Reste von Pellmans achtstündigem Saufgelage ab und wischte den Platz vor Judah ab.
»Wieder das Gleiche?«
Judah nickte und ließ sich auf dem Hocker neben Ramey nieder. Es fiel ihm schwer, sie anzusehen, also konzentrierte er sich auf den Barkeeper.
»Wo sind die Jungs, die hier saßen?«
Grady deckte den Plastikaschenbecher zu und klopfte dann die Asche in den Müll.
»Erwins Frau ist schließlich aufgetaucht. Gut, dass sie dich nicht hier hat sitzen sehen, als sie reinkam. Hat Zeter und Mordio geschrien, um seinen Arsch ins Auto zu bewegen. Hat Pellman gleich mitgenommen. Aber sie sagten beide, ich soll deinen Deckel offenlassen, sie bezahlen ihn dann beim nächsten Mal.«
Grady stellte das Bier vor Judah ab und verschränkte die Arme über seiner breiten Brust.
»Wer bist du überhaupt? Kommst du gerade zurück vom Militär, oder was?«
Neben Judah zündete Ramey sich eine Zigarette an und lachte. Judah richtete seinen Blick auf das Bier.
»Also, Grady. Ich habe dich ja immer für einen ganz besonderen Idioten gehalten, aber willst du wirklich behaupten, du weißt nicht, wer das hier ist?«
Judah sah Grady an und kannte dessen Gesichtsausdruck schon vorher. Ramey hatte so eine Art, genau das zu sagen, was ihr in den Sinn kam, und schaffte es dabei gleichzeitig, dass derjenige, den sie da gerade beleidigte, sich in sie verliebte. Grady grinste und zuckte mit den Achseln. Also konnte er doch lächeln.
»Da bin ich überfragt.«
Judah betrachtete die Bläschen, die an einer Seite seines Pint-Glases aufstiegen. Aus dem Augenwinkel konnte er sehen, wie Rameys Zigarette auf ihn zeigte.
»Er ist einer der Cannon-Jungs. Ich weiß, dass du noch nicht allzu lange in Silas bist, aber solche Sachen musst du wissen.«
Judah versuchte, ein unbeteiligtes Gesicht zu machen, doch das fiel ihm schwer. Der Barkeeper schüttelte den Kopf.
»Und da gibt’s noch einen?«
Ramey blies eine Rauchfahne aus dem Mundwinkel und nickte, bevor sie ihre Zigarette in den Aschenbecher legte. Judah spürte ihre Hand auf der Schulter.
»Den gibt’s. Also, warum schenkst du uns nicht noch zwei Shots Jack ein?«
Unverzüglich tauchte ein zerkratztes Schnapsglas mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit darin vor Judah auf. Als er draußen herumlief, hatte er erwogen, wieder nüchtern zu werden, doch offensichtlich lief der Abend auf etwas anderes hinaus. Er merkte, wie Ramey neben ihm wartete.
»Nimm deinen Shot, Judah Cannon.«
Judah nahm das Glas zwischen zwei Finger. Er holte tief Luft und hob gleichzeitig den Shot und seinen Kopf. Schließlich überwand er sich und sah ihr in die Augen. Sie waren ernst. Mitfühlend, aber wild entschlossen. Wie oft hatte er schon diesen Blick in ihren Augen gesehen? Er hielt das Schnapsglas hoch, neben ihres, und Ramey nickte.
»Also, sind wir jetzt durch mit dem Scheiß?«
»Vermutlich schon.«
Sie verengte die Augen.
»Ich hab dich fast sieben Jahre lang nicht gesehen. Da brauch ich schon eine bessere Antwort als das.«
Judah stieß mit dem Rand seines Glases gegen ihres und beiden kleckerte Whiskey auf die Hände. Sie schaute ihn unbeirrt an. Judah wusste, dass er betrunken war, doch er wusste auch, dass er meinte, was er sagte. Und er wusste, dass es bei ihr genauso war.
»Ramey Barrow, durch diese Tür zu kommen und dich hier sitzen zu sehen, war das Beste, was mir in den letzten sieben Jahren passiert ist. Wie wär’s damit?«
Sie hob das Glas an die Lippen.
»Das reicht.«
Sie knallten die Schnapsgläser auf den Tresen und Judah wusste, dass es eine wilde Nacht werden würde.
»Ich habe dir einen Brief geschrieben. Als du im Gefängnis warst. Genau genommen habe ich mehrere geschrieben.«
Ramey leerte den Rest Bier ihrer Dose und warf sie dann nach hinten über das Dach ihres silbernen Cutlass. Sie prallte auf dem eh schon zerbeulten Dach ab und rollte dann in das lange, feuchte Gras. Judah blickte unverwandt in die funkelnden Sterne über ihm.
»Ich weiß.«
»Du hast nie zurückgeschrieben.«
Die Sterne schienen in der Dunkelheit zu brennen.
»Nein.«
Ramey griff nach der Supermarkttüte zwischen ihnen, um sich noch ein Bier zu nehmen. Sie klopfte mit einem kaputten Fingernagel oben auf die Dose, aber öffnete sie nicht. Judahs Blick war immer noch auf den Himmel gerichtet.
»Magst du mir erzählen, wieso?«
Ramey sah, wie Judahs Zähne im Mondlicht aufblitzten, als er sich auf die Unterlippe biss. Er senkte den Blick und seine Augen betrachteten nun nicht mehr die Sterne, sondern blickten sinnierend auf die Falten in seinen schwieligen Handflächen. Schließlich drehte er sich zu Ramey um und atmete aus.
»Puh, Ramey. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erklären. Oder wie. Oder was. Oder nichts.«
Sie nickte. Von dort, wo sie saßen, beleuchteten die Scheinwerfer des Wagens die andere Seite des Feldes und in dem gespenstischen Licht wirkte ihr rotbraunes Haar schwarz.
»Willst du darüber reden?«
Judah folgte mit seinem Blick der Silhouette ihrer Kieferpartie.
»Über das Gefängnis?«
Ramey nickte wieder. Jede Bewegung, die sie machte, war so vertraut und doch so fremd. So tröstlich und doch so nervenaufreibend. Hatte er nicht schon mal so nah, nur Zentimeter entfernt, neben ihr gesessen? Genau in diesem Feld? Es war damals nur kälter gewesen, ein Abend Ende Oktober. Und das Fahrzeug war der Pick-up seines älteren Bruders gewesen, ausgeliehen, ohne zu fragen. Das Licht war an jenem Abend schwächer gewesen, nur eine schmale Mondsichel, die sich durch die Wolken kämpfte, und er hatte versucht, nicht auf die einzelne Träne zu blicken, die an ihrer sommersprossigen Nase hing, als sie gequält gestand, dass Keith Wilder sie nicht gefragt hatte, ob sie mit ihm zum Homecoming-Ball gehen würde, und dass das ein hundertprozentiges Zeichen dafür war, dass niemand sie jemals lieben würde.
»Ja.«
Er hätte damals sein Mighty-Tigers-Sweatshirt ausziehen und es um ihre dünnen, fünfzehn Jahre alten Schultern wickeln können. Er hätte ihr sagen können, dass sie wunderschön war, dass sie etwas Besonderes war und jedem Typen an der Bradford Central High das Herz brach, wenn sie ihn nur anlächelte, und dass Keith Wilder ein Weichei war, der keinen hochbekam, außer bei einer Ziege. Er hätte seinen Arm um sie legen können, seine beste Freundin in der ganzen, weiten Welt, und hätte ihr all das erzählen können, und vielleicht hätte sie dann geschnieft und ihre Schulter zurückgeworfen und ihn dann mit diesem schiefen Lächeln angesehen, das er so liebte. Stattdessen hatte er ihr den verhunzten Joint gereicht, den er versucht hatte zu drehen, und sie gebeten, es für ihn zu tun. Sie hatte kleinere Finger und war schneller.
»Eigentlich nicht, nein.«
Sie hatte das verdrehte Papier aus seiner Hand geschnappt, es zwischen den Handflächen verrieben und ihm die Reste des trockenen Grases ins Gesicht geworfen. Sie hatte ihn ein Arschloch genannt; und er sie eine Zicke. Am nächsten Tag hatte er ihr als Friedensangebot ein Dr. Peppers gebracht, das er bei Buddy’s geklaut hatte, und sie hatte ihm in die Schulter geboxt. Fest. Alle ihre Freunde auf dem Schotterparkplatz hinter dem verlassenen Spirituosenladen hatten gelacht. Alle wussten, dass es zwischen den beiden immer so lief.
Ramey klopfte wieder oben auf ihre Bierdose. Judah schaute auf ihren Mund, während ihre Blicke die Dunkelheit vor ihnen absuchten. Ihre Unterlippe war immer noch so voll, fast schon ein Schmollmund, doch in den Mundwinkeln lag eine Traurigkeit, an die er sich nicht erinnerte. Es gab so viel, was er wusste, aber nicht offiziell. Worüber er gehört hatte, aber nicht dort gewesen war. Wovon er gern ein Teil gewesen wäre, aber sich nicht getraut hatte. Ramey streckte die Hand aus und schob sie unter seine.
»Also dann, in Ordnung.«
Die Fliegengittertür von Rameys Apartment wurde ratternd geöffnet und dann hörte sie das Klopfen. Es kam von einer Faust, die zu groß und zu schwer war, als dass sie zu Ginny gehören könnte, dem Mädchen nebenan, das keine Vorstellung davon hatte, dass acht Uhr an einem Sonntagmorgen zu früh für den Versuch war, sich Cash für den nächsten Schuss zu leihen. Das Klopfen war auch nicht hektisch genug, um von Ginny zu kommen. Wer auch immer da an die Tür hämmerte, machte es langsam, gezielt und ohne die Absicht, wieder zu gehen. Ramey schob sich das Haar aus den Augen, rollte sich rüber und schlüpfte in einer gleitenden Bewegung aus dem Bett. Sie kickte sich ihren Weg durch die Kleidung, die verstreut auf ihrem dünnen, braunen Teppich lag, bis sie ihre Jeans gefunden hatte. Es klopfte erneut. Sie zog sich während des Gehens die Jeans hoch, stolperte, als sie ihre Fersen unten durch die engen Hosenbeinöffnungen zwängte, und schloss dann leise die Schlafzimmertür hinter sich. Als sie das Wohnzimmer durchquerte, nahm sie ein dreckiges T-Shirt von dem orangefarbenen Zweiersofa und zog es sich über den Kopf. Während sie ging und gleichzeitig versuchte, sich anzuziehen, stieß sie sich das Schienbein an der scharfen Ecke des Couchtisches und gab die Bemühungen auf, leise zu sein.
»Verdammt!«
Judah war vermutlich sowieso schon wach.
»Gib mir einfach eine Minute, bevor du meine Scheißtür einschlägst!«
Ramey stützte sich mit einer Hand an der holzvertäfelten Wand ab und vergewisserte sich, dass ihr T-Shirt ganz heruntergezogen war, bevor sie die Tür öffnete. Sie fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, um sich einen Zopf zu machen, stellte fest, dass sie kein Haargummi hatte, und ließ es wieder fallen. Als sie durch den Spion guckte, war sie überrascht, eine verzerrte Gestalt zu sehen, die irgendwie dem Mann ähnelte, der in ihrem Bett lag. Ramey verdrehte die Augen und schob die Kette zurück, bevor sie den Riegel drehte und die Tür öffnete.
Levi hatte gerade seine Faust gehoben, um ein weiteres Mal zu klopfen, und verpasste Ramey beinahe einen Schlag auf die Nase. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und verengte die Augen. Levi stützte sich mit einem Arm am Türrahmen ab und versuchte, sich ins Apartment zu lehnen. Er würdigte Ramey kaum eines Blickes.
»Ist er hier?«
Er versuchte, sich an ihr vorbeizuschieben, doch Ramey wich nicht aus.
»Wer?«
Levi trat einen Schritt zurück und sah Ramey an, als würde ihm schließlich einfallen, dass es ihre Haustür war, in die er fast ein Loch geschlagen hatte.
»Du weißt wer. Judah.«
Ramey zuckte mit den Achseln.
»Hab ihn nicht gesehen.«
»Bullshit.«
Levi versuchte, über Rameys Schulter hinweg ins Apartment zu gucken, doch Ramey verlagerte das Gewicht und blockierte wieder seine Sicht.
»Ich dachte, Judah ist im Gefängnis.«
Levi starrte Ramey böse an. Er war größer als sie, größer als Judah, obwohl sie das gleiche eckige Kinn und die gleichen zusammengekniffenen Augen hatten. Levi war wuchtig und hatte ein breites Kreuz, war schwerfällig auf den Füßen, aber schnell mit seinen dicken, fleischigen Pranken. Er wurde auch schnell wütend, aber nur, wenn er persönlich von jemandem beleidigt wurde. Er ignorierte versteckte Anspielungen, war jedoch in seinem Leben noch nie einem direkten Streit aus dem Weg gegangen. Levi war jemand, den man gern in einem Gewinnerteam hatte, aber ein gefährlicher Gegner, wenn sich das Blatt in die falsche Richtung wendete. Ramey kannte Levi bereits ihr ganzes Leben und war schon seit Ewigkeiten nicht mehr sonderlich beeindruckt. Levi schnaubte.
»Er wurde entlassen.«
»Also kommst du jetzt zu mir, um ihn zu jagen? Ich habe Judah seit Jahren nicht mehr gesehen.«
Levi sah sie stirnrunzelnd an. Er war zwar stur, aber nicht blöd. Dann trat er näher und sah auf sie herunter.
»Wenn du ihn siehst, sag ihm, dass Sherwood mit ihm reden muss. Jetzt.«
Ramey hielt seinem Blick stand.
»Wenn ich ihn sehe.«
»Mädel, du hörst mir besser gut zu.«
Ramey zuckte mit keiner Wimper.
»Ich sagte doch, wenn ich ihn sehe.«
Sie schloss die Tür und schob den Riegel vor. Dann fuhr sie sich mit der Hand durchs Haar und blieb mit den Fingern hängen. Als sie die Schlafzimmertür öffnete, nahm sie an, dass Judah schon aufgestanden sei, und war nicht überrascht, ihn an seinen Hemdenknöpfen herumfummeln zu sehen. Sie stand mit verkrampftem Unterkiefer im Türrahmen und sah zu, wie er den Reißverschluss seiner Hose zuzog.
»Hast du’s gehört?«
Judah setzte sich auf die Kante des zerwühlten Betts und schnürte sich die Stiefel zu. Er sah sie nicht an.
»Jepp.«
»Geh nicht.«
Als Judah seinen Fuß wieder auf den Boden gestellt hatte, verharrte er und sah zu Ramey hoch. Der Klang ihrer Stimme sagte ihm, dass sie wusste, dass er gehen würde, egal was sie sagte, doch unter dieser Resignation verbarg sich ein verstecktes Flehen. Er stand auf und strich seine Jeans glatt.
»Ich muss das hinter mich bringen.«
Sie rammte ihre Hände in die Gesäßtaschen ihrer Jeans und wippte auf den Fersen ihrer nackten Füße.
»Du bist noch keinen ganzen Tag zu Hause.«
Judah tastete in seinen Taschen nach dem Portemonnaie und griff sich seine Zigaretten und das Feuerzeug von der Kommode unter dem Fenster. Das harsche Morgenlicht schien durch die milchigen Kunststoffjalousien. Judah rubbelte sich kurz das Gesicht und kümmerte sich nicht weiter um sein Haar. Er drehte sich zu Ramey um und legte ihr die Hände auf die Schultern. Sie hob den Kopf, um ihn anzusehen, und er küsste sie kurz.
»Und in weniger als einem Tag habe ich es von komplett einsam und fast nicht existent dahin geschafft, dass ich meine beste Freundin getroffen haben, die auf mich gewartet hat, bis dahin, dass ich schließlich den Mut hatte, endlich meine Augen zu öffnen und zu erkennen, was meine beste Freundin wirklich war.«
Ramey sah ihn ambivalent an. Sie nahm ihre Hände nicht aus den Gesäßtaschen und schwankte leicht, als er sie an sich zog und ihre Stirn mit seiner berührte.
»Und ist. Ich meinte jedes einzelne Wort, was ich letzte Nacht gesagt habe, Ramey. Jedes Wort. Und ich meine es immer noch. Okay?«
Sie nickte, doch er ließ sie bereits los. Er ging an ihr vorbei und sie wartete auf das Geräusch der Tür, die sich öffnete und wieder schloss. Sie stand unter dem summenden Deckenventilator in dem stetig wärmer werdenden Zimmer und konnte ihn immer noch riechen, konnte immer noch seine Anwesenheit neben sich spüren. Doch sie wusste, sie war allein.
Schwester Tulah schaute von ihrem in Bratensoße getunkten Buttermilchbrötchen auf, um festzustellen, dass ihr Neffe in der offenen Tür stand und sie beobachtete. Darauf wartete, dass sie seine Anwesenheit zur Kenntnis nahm, wäre vermutlich eine genauere Beschreibung gewesen. Niemand beobachtete Schwester Tulah. Man starrte sie zornig an, zog vor ihr den Kopf ein, verdrehte beim schweren Gang ihrer nahenden Schritte die Augen in wilder Angst, doch man beobachtete sie nicht. Sie war die Beobachterin, und die Einwohner von Bradford County warteten still und schweigend auf ihr Urteil.
Schwester Tulah nahm eine dünne Papierserviette und zerrieb sie zwischen ihren fettigen Fingern. Dann nahm sie eine weitere, faltete sie und drückte sie sich langsam an den Mund. Sie tat es wieder und wieder, bis sie überzeugt war, dass Bruder Feltons kaputte Knie langsam schmerzten und seine dicken, teigigen Beine anfingen zu zittern. Tulah nahm das schmuddelige Papier von ihrem Gesicht und gab dünne, rosa Lippen preis, die für ihr breites Gesicht viel zu schmal waren. Sie packte die klebrige Serviette mit beiden Händen und richtete schließlich das Wort an ihn.
»Ja?«
Bruder Felton lehnte am Türrahmen, um sich abzustützen, und beäugte das, was ausgebreitet vor seiner Tante lag. Zwei Take-away-Schachteln von Jimmy Boy’s lagen offen vor ihr auf dem unordentlichen Schreibtisch. Einer enthielt das halb abgenagte Gerippe einer gebratenen Hühnerbrust in einer Pfütze von gedünsteten Okras und Tomaten, dazu einen deformierten Haufen krosser Käsemakkaroni. In der anderen Schachtel befanden sich die Reste von Buttermilchbrötchen, vollgesogen mit dicker, brauner Bratensoße. Er fing dort, wo er stand, beinahe an zu sabbern, aber es war einfacher, das Essen anzusehen als seine Tante. Selbst wenn die Neon-Deckenleuchten in dem winzigen Büro nur schwach waren, und den engen Raum in dasselbe schale, antiseptische Licht hüllten, dem man normalerweise bei Gebrauchtwagenhändlern begegnet, waren Tulahs Augen furchterregend. Farblos, fast durchsichtig, abgesehen von den winzigen Pupillen, die so schwarz und tödlich waren wie die eines Hais, konnten Schwester Tulahs Augen in die Brust eines Mannes greifen und seine Seele zerquetschen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.
Felton sah zu, wie eine fette, schwarze Fliege die Speisen umrundete und dann auf Schwester Tulahs Handrücken landete. Sie rührte sich kein bisschen.
»Also, es ist nur so, dass es jetzt fünf Stunden her ist.«
Schwester Tulah nahm die Plastikgabel, die in der Bratensoße lehnte, und stocherte in dem schwammigen Brötchenmatsch herum, wobei die Fliege noch an ihrer Hand klebte. Sie entdeckte ein Stück, das sie wollte, und begann hineinzugraben.
»Und?«
Bruder Felton zupfte an dem verschwitzten Hosenbund seiner rotbraunen Anzughose. Er wünschte, er könnte den Gürtel noch etwas lockern, doch er war schon im letzten Loch.
»Also, da drinnen ist es so langsam richtig heiß.«
»Wenn der Teufel beginnt, sich seinen Weg aus den Herzen der Menschen zu bahnen, wird man das sicherlich in der Luft merken, die die Menschen umgibt.«
Felton leckte sich die trockenen Lippen und riss ein fleckiges weißes Taschentuch aus seiner Tasche. Er wischte sich die hohe Stirn und tupfte danach die gekräuselten dunkelbraunen Haare hinten auf seinem Schädel platt. Er putzte sich die Nase mit dem Tuch und steckte es wieder in die Tasche.
»Ja, das ist sicher wahr.«
»Warum störst du mich dann?«
Schwester Tulah griff nach ihrem Ein-Liter-Styroporbecher süßen Tee, der am Rand des Schreibtisches stand. Sie schlürfte durch den Strohhalm und fixierte ihn mit ihren bleichen Augen. Er räusperte sich und versuchte es noch mal.
»Sie haben heute Morgen in der Zeitung geschrieben, dass es heute der bisher heißeste Tag des Jahres werden würde.«
»Glaubst du, Gott liest Zeitung?«
Bruder Felton wich ihrem Blick aus und schaute aus dem kleinen quadratischen Fenster hinaus auf den Schotterparkplatz. Die Buicks und Fords schimmerten in der prallen Sonne und er fragte sich, wie viel Grad es im Schatten waren.
»Ich weiß es nicht. Ich werde mich hüten zu mutmaßen, was Gott tut.«
Schweigen füllte den Raum wie heiße Luft, die sich in einem Ballon ausdehnt.
Schwester Tulah hob die Reste der Hühnerbrust an und ließ sie dann angeekelt wieder in die Schachtel fallen. Sie lehnte ihr dickes, breites Kreuz im quietschenden Bürostuhl zurück und ließ ihre Unterarme auf dem Schreibtisch vor sich ruhen.
»Was genau willst du, Bruder Felton?«
Felton hätte einen Schritt nach vorn getan, doch er musste seine Hand am Türrahmen lassen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
»Wie ich schon sagte, sind die Türen inzwischen seit fünf Stunden verschlossen. Zwei der Jungs haben sich in der Ecke erleichtert und Schwester Nessie ist ohnmächtig geworden. Sie ist im achten Monat schwanger, weißt du? Es ist vermutlich nicht gut für sie, dass sie immer noch dort drinnen ist. Ich meine, mit dem Baby, das bald kommt und so.«
Schwester Tulah breitete ihre dicken Finger auf dem herumliegenden Haufen von fettbespritzten Papieren aus.
»Bleichen und ein Nachmittagsschlaf. Was noch?«
Felton schluckte; seine Zunge begann in seinem Mund anzuschwellen.
»Niemand wurde seit halb elf vom heiligen Geist erfüllt. Alle scheinen sich im selben Zustand zu befinden wie zu dem Zeitpunkt, als du gegangen bist. Nur dass ich sie jetzt noch nicht mal dazu bringen kann zu singen. Ich denke, dass der Geist für heute vielleicht weitergezogen ist.«
Bruder Felton wurde langsam schwindlig, also sprach er schneller.
»Es war ein gesegneter Tag, Schwester Tulah. Bruder Mark hat schließlich Buße getan und bereut, seine Frau beim Osterpicknick angegriffen zu haben, und Schwester Sipsy hat Buße getan und bereut, dass sie diese Late-Night-Shows im Fernsehen guckt. Die Kollekte war heute reichlich. Vielleicht ist es Zeit, allen eine Pause zu gönnen.«
Tulah beäugte ihren wehleidigen Neffen, sagte jedoch nichts.
»Oder, wenn du glaubst, dass alle auf einem guten Weg sind, vielleicht könnten wir dann die Ventilatoren herausholen? Vielleicht wird der Heilige Geist die Gemeinde wieder erfüllen, wenn sie sich ein wenig abgekühlt hat.«
Schwester Tulah hob ihren fetten Arm vom Schreibtisch und verscheuchte die Fliege von den faserigen Resten der Okras. In der anderen Schachtel bekam die Bratensoße langsam eine zähe Haut. Tulah blickte auf ihr Essen und runzelte die Stirn.
»Haben alle Buße getan?«
Felton richtete sich auf und keuchte.
»Nicht alle, aber die meisten.«
»Hat Bruder Jacob für die hinterhältigen Lügen gebüßt, die er gewagt hat, über diese Kirche auszusprechen?«
»Noch nicht. Aber vielleicht, wenn man ihm noch eine weitere Woche gibt, um über seine Sünden nachzudenken. Eine weitere Woche, um zur Besinnung zu kommen und im gesegneten Licht des Herrn und dem Geschenk der Vergebung zu schwelgen. Er könnte eventuell sogar davon überzeugt werden, eine höhere Wiedergutmachung an die Kirche zu zahlen.«
Schwester Tulah schien einen Moment darüber nachzudenken, während sie die Styroporschachteln zuklappte und verschloss, doch dann schüttelte sie den Kopf.
»Nein.«
»Nein?«
Bruder Felton lief ein Rinnsal Schweiß das Gesicht herunter, doch er gab sich nicht damit ab, sein Taschentuch erneut herauszuholen.
»Nein. Heute ist der Tag der Erlösung. Wenn es heute nicht passiert, passiert es nie. Bruder Jacob muss seine Schuld eingestehen. Wenn er bereit ist, das zu tun, komm und hole mich, damit ich ihn in der Entscheidung leite, wie viel seine Sünde ihn kosten wird. Er muss der Kirche demonstrieren, dass Gott so gnädig ist, alle Schuld zu vergeben, solange sie aufrichtig sind.«
Schwester Tulah entließ ihn mit einem Handwedeln.
»Bis dahin bleiben die Ventilatoren im Lagerraum und die Türen verschlossen. Du weißt, was zu tun ist, Bruder Felton. Also tu’s.«
Felton trat rückwärts aus dem Raum und verschwand den Flur hinunter. Schwester Tulah grunzte und zog neben sich die Metallschublade ihres Schreibtisches auf. Sie holte eine Tüte Käsebällchen heraus und riss sie auf. Wenn es sein musste, würde sie den ganzen Tag warten.
Kapitel 3
Judah nahm nicht an, dass sich Silas groß verändert hatte, seit er das letzte Mal seine Familie besucht hatte, und dem war so. Es hatte sich nicht verändert, seit er das letzte Mal hier gelebt hatte, seit der Highschool, seit dem Kindergarten, seit er geboren wurde. Die gesprayten Graffitis an den Gebäuden waren inzwischen ausgefeilter und die träge, sich hinziehende Central Street wurde jetzt von fünf Ampeln durchschnitten, statt nur von zwei. Doch wie viele andere kleine, planlose Städte auf dem Land, hatte auch Silas in den späten 1960er Jahren aufgehört, sich zu entwickeln. Statt sich zu entfalten, hatte es sich in ein Schneckenhaus zurückgezogen und zugelassen, dass das Moos wuchs und sich Risse bildeten. Silas war die Art von Stadt, die nützlich war, wenn ein Zombie-Angriff drohte und die Überlebenden einen Save-A-Lot Supermarkt brauchten, den sie plündern konnten, oder leere Ladenfronten, um sich zu verstecken. Und natürlich einen Mr. Omelet.
Judah drückte die gläserne Eingangstür auf und war erleichtert, dass der Diner fast leer war. Ab zehn Uhr würde man nur noch einen Stehplatz vorne im Restaurant bekommen und in den Sitzecken würden sie zu sechst sitzen. Momentan jedoch langweilte sich das sommersprossige Teenagermädel und machte sich nicht die Mühe, von seinem pinkfarbenen, Strass verzierten Handy aufzusehen.
»Wie viele?«
Judah ignorierte sie und sah sich in dem schmalen Restaurant um. Die Bar vor der offenen Küche war leer, abgesehen von einer alten Frau, die vorsichtig mit einem zitternden Löffel Maisgrütze ihren Mund ansteuerte. Ein junges Paar mit einem teilnahmslosen Baby in einem Hochstuhl saß an einem der eckigen Tische, die entlang des Raums standen. Die Gäste, die im Halbdunkel im hinteren Teil des Diners in den Kunstleder-Sitzecken saßen, konnte er nicht erkennen, doch aus einer sah er eine Rauchfahne aufsteigen. In den Restaurants von Florida war das Rauchen inzwischen verboten. Judah nahm an, dass er es sein musste.
»Ich treffe mich hier mit jemandem und gehe nur kurz nach hinten.«
Das Mädchen zuckte mit den Achseln und legte ihr Handy lange genug weg, um ihm eine klebrige, laminierte Speisekarte und ein eingerolltes Besteck zu geben. Judah ging langsam in den hinteren Teil des Restaurants und setzte sich seinem Vater gegenüber in die Sitzecke.
»Du wolltest mich sehen?«
Sherwood grinste.
»Du kommst früher, als ich dachte. Erzähl mir nicht, dass dieses Barrow-Mädel dich schon wieder rausgeworfen hat.«
Judah ließ die Speisekarte und das Besteck auf den Tisch fallen und fuhr sich mit den Händen durchs Haar. Er beäugte den weißen Kaffeebecher aus Keramik, der auf dem Tisch stand.
»Na ja, ich wollte das hier so schnell wie möglich hinter mich bringen.«
Sherwood drückte seine Zigarette im gelben Glibber eines Tellers mit beidseitig gebratenem Spiegelei aus.
»Das ist nicht sehr höflich.«
Judah stützte sich mit den Unterarmen auf der harten Tischkante ab und beugte sich vor.
»Was willst du, Sherwood?«
»Willkommen zu Hause, Sohn.«
Sherwood lachte und Judah wusste, dass es eine Weile andauern würde. Er beugte sich hinaus in den Gang und winkte eine ältere Kellnerin herbei, die mit einer Kaffeekanne durch die Gegend mäanderte. Zufrieden, dass endlich eine Form von Erleichterung im Anmarsch war, drehte Judah sich zurück zu seinem Vater.
Sherwood Cannon war in jeder Beziehung ein großer Mann. Er war knapp zehn Zentimeter größer als Judah und wog fast fünfzig Kilo mehr als er. Seine Hände waren breit, die Unterarme dick und der Oberkörper massig unter dem zusätzlichen Polster, das ihn einhüllte, seit er in die Jahre gekommen war. Sein Haar war grau und schlaff, doch er trug es immer noch lang, zurückgebunden zu einem dünnen, strähnigen Zopf, der zwischen seinen Schulterblättern herunterhing. Ein passender, zotteliger Bart verbarg die gelben, kaputten Zähne, doch seine Augen waren die beste Ablenkung von diesem Mangel an Mundpflege. Sie waren stechend blau und saßen für ein so großes Gesicht eigenartig tief. Rote, geplatzte Äderchen häuften sich auf Sherwoods Knollennase und den sonnenverbrannten Wangen, und obwohl Judah es von seinem Winkel aus nicht sehen konnte, wusste er, dass an Sherwoods linkem Ohr eine dünne Narbe verlief, vom Rand seines Unterkiefers bis hoch zu seinem inzwischen zurückgehenden Haaransatz.
Die Kellnerin stellte kleckernd eine Tasse mit öligem Kaffee vor Judah hin und wartete nicht ab, ob er etwas bestellen wollte. Judah fiel wieder ein, dass es zwei Sorten Mensch in Silas gab: Solche, in deren Läden Mitglieder der Familie Cannon erwünscht waren, und solche, bei denen das nicht so war. Diese Kellnerin gehörte offensichtlich zur letzteren Kategorie. Judah hoffte, dass eine andere Bedienung vorbeikommen würde, bei der das nicht so war. Er spürte bereits, wie sein Magen an sich selbst zu nagen begann, und sehnte sich nach ein paar Toasts mit Eiern.





























