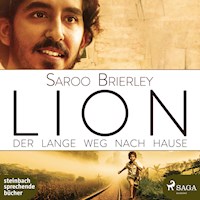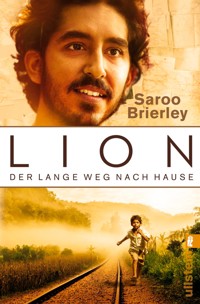
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es ist ein Tag wie jeder andere im Leben des fünfjährigen Saroo: Auf dem Bahnhof einer indischen Kleinstadt sucht er nach Münzen und Essensresten. Schließlich schläft er vor Erschöpfung in einem wartenden Zug ein. Der fährt den kleinen Jungen ans andere Ende von Indien, nach Kalkutta. Völlig alleine an einem der gefährlichsten Orte der Welt schlägt er sich wochenlang auf der Straße durch, landet im Waisenhaus und gelangt so zu den Brierleys, die Saroo ein neues Zuhause in Australien schenken. Fünfundzwanzig Jahre später macht sich Saroo mit Hilfe von Google Earth auf die Suche nach seiner leiblichen Familie. Am Bildschirm fährt er Nacht für Nacht das Zugnetz von Indien ab. Das Unglaubliche passiert: Er findet ein Dorf, das dem Bild in seiner Erinnerung entspricht – und macht sich auf den Weg ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
»Eine unglaubliche Geschichte!« BBC
Es ist ein Tag wie jeder andere im Leben des fünfjährigen Saroo: Auf dem Bahnhof einer indischen Kleinstadt sucht er nach Münzen und Essensresten. Schließlich schläft er vor Erschöpfung in einem wartenden Zug ein. Der fährt den kleinen Jungen ans andere Ende von Indien, nach Kalkutta. Saroo kann weder lesen noch schreiben, er kennt den Namen seiner Heimatstadt nicht, nicht einmal seinen eigenen Nachnamen. Ganz allein überlebt er wochenlang auf der Straße, bevor er in einem Waisenhaus landet und so schließlich zu den Brierleys gelangt, die Saroo ein neues Zuhause in Australien schenken.
Fünfundzwanzig Jahre später macht sich Saroo mit Hilfe von Google Earth auf die Suche nach seiner leiblichen Familie. Am Bildschirm fährt er Nacht für Nacht das Zugnetz von Indien ab und findet wie durch ein Wunder die Nadel im Heuhaufen, die einmal sein Zuhause war.
Mein langer Weg nach Hause ist die wahre und ergreifende Geschichte eines Jungen, der allen Widrigkeiten zum Trotz überlebte und als erwachsener Mann wieder nach Hause fand.
Der Autor
Saroo Brierley wurde in Khandwa, Madhya Pradesh, Indien, geboren. Er lebt heute in Hobart, Australien, und fährt regelmäßig nach Indien, um seine leibliche Familie zu besuchen.
Saroo Brierley und Larry Buttrose
Mein langer Weg nach Hause
Wie ich als Fünfjähriger verlorenging und fünfundzwanzig Jahre später meine Familie wiederfand
Übersetzt von Michael Windgassen
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
ISBN 978-3-8437-0970-5
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014© 2013 Saroo Brierley / Penguin Group AustraliaTitel der Originalausgabe: A Long Way Home (Penguin Group Australia)Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: © John Canty, Penguin Group Australia; © Keren Su / Getty Images (Gleisstrecke, Wüste); © FinePic® (Ornamente, Stadt)Karte: © Peter PalmDie Bilder im Innenteil wurden, wenn nicht anders gekennzeichnet, freundlicherweise von Saroo Brierley und Larry Buttrose zur Verfügung gestellt.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik
Für Guddu
Inhaltsverzeichnis
Über das Buch und den Autor
Titelseite
Impressum
Widmung
Prolog
1 Erinnerungen
2 Aus den Augen verloren
3 Überleben
4 Rettung
5 Ein neues Leben
6 Mums Reise
Bildteil
7 Jugendjahre
8 Die Suche
9 Gefunden
10 Wiedersehen mit der Mutter
11 Wiederanschluss
12 Pläne
13 Zurück nach Kalkutta
Epilog
Danksagung
Feedback an den Verlag
Empfehlungen
Prolog
Sie sind fort.
Fünfundzwanzig Jahre lang habe ich mir diesen Tag in Gedanken ausgemalt. Eine halbe Welt entfernt von hier aufgewachsen, mit neuem Namen und in einer neuen Familie, fragte ich mich immer wieder, ob ich meine Mutter, meine Brüder und Schwestern jemals wiedersehen würde. Nun bin ich hier, stehe in einem ärmlichen Viertel einer kleinen, staubigen Stadt in Zentralindien vor einem heruntergekommenen Haus, in dem ich meine ersten Jahre verbrachte – und es wohnt niemand mehr darin. Es ist leer.
Als ich das letzte Mal an dieser Stelle stand, war ich fünf Jahre alt.
Die aus den Angeln gelöste Tür ist viel kleiner als in meiner Erinnerung. Um hindurchzugehen, müsste ich jetzt den Kopf einziehen. Es hat keinen Sinn anzuklopfen. Durch das Fenster und durch die Lücken in der baufälligen Ziegelmauer kann ich in den winzigen Raum blicken, den sich meine Familie geteilt hat. Träte ich ein, würde ich mich darin gerade eben aufrichten können.
Meine schlimmste Befürchtung, sosehr ich sie auch zu verdrängen versucht hatte, scheint sich zu bewahrheiten: Ich finde nach Jahren der Suche endlich nach Hause zurück, und meine Familie ist ausgezogen.
Nicht zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich hoffnungslos verloren und weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin jetzt dreißig, habe Geld und ein Rückflugticket in der Tasche, komme mir aber vor wie damals als Kind auf dem Bahnsteig. Mir stockt der Atem, mir schwirrt der Kopf, und ich wünschte, ich könnte das Geschehene rückgängig machen.
Nebenan öffnet sich plötzlich eine Tür. Eine rotgewandete junge Frau mit einem Säugling im Arm tritt aus der sehr viel besser erhaltenen Nachbarwohnung auf die Straße. Ihre Neugier ist verständlich. Ich sehe zwar aus wie ein Inder, aber meine westliche Kleidung wirkt vermutlich ein bisschen zu neuwertig, und meine Haare sind modisch gestylt. Kein Wunder, dass ich als Außenseiter, als Fremder auffalle. Schlimmer noch, ich verstehe die Sprache der Frau nicht und kann nur ahnen, dass sie mich fragt, was ich hier zu suchen habe. Mein Hindi ist nur bruchstückhaft, und die wenigen Wörter, die mir einfallen, weiß ich nicht auszusprechen. Ich sage: »Ich spreche kein Hindi, nur Englisch«, worauf sie zu meiner Überraschung entgegnet: »Ich spreche Englisch, ein bisschen.« Ich zeige auf die verlassene Wohnung und nenne die Namen derer, die darin gelebt haben – »Kamla, Guddu, Kallu, Shekila« –, dann zeige ich auf mich und sage: »Saroo.«
Die Frau wird still. Meine australische Mum hat mich auf eine solche Situation vorbereitet und mir etwas mitgegeben. Ich krame in meiner Reisetasche und hole ein Blatt Papier daraus hervor. Darauf kleben Farbfotos, die mich als Kind zeigen. Wieder deute ich auf mich, dann auf die Fotos und sage: »Klein. Saroo.«
Ich versuche mich daran zu erinnern, wer damals, als ich hier lebte, nebenan wohnte. Gab es ein kleines Mädchen, aus dem diese Frau geworden sein könnte?
Sie starrt auf die Fotos, dann auf mich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mich verstanden hat, aber dann fängt sie an, stockend auf Englisch zu reden.
»Leute … nicht mehr leben … heute hier«, sagt sie.
Obwohl sie nicht direkt bestätigt, was ich befürchtet habe, treffen mich ihre Worte schwer. Mir wird schwindlig. Ich stehe vor ihr und kann mich kaum rühren.
Es war mir im Grunde klar, dass, wenn ich es eines Tages hierher zurückschaffen sollte, meine Familie nicht mehr da sein würde. Selbst als ich noch zu ihr gehörte, waren wir von einem anderen Ort in diese Wohnung gezogen – arme Leute können sich häufig nicht aussuchen, wo sie wohnen, und meine Mutter musste immer dorthin, wo ihr gerade Arbeit angeboten wurde.
Diese und ähnliche Gedanken tauchen unwillkürlich aus meinem Unterbewusstsein auf, in das ich sie verbannt hatte. Die andere Möglichkeit, dass meine Mutter tot ist, schiebe ich sofort beiseite.
Ein Mann, der uns beobachtet hat, nähert sich. Auch ihm zähle ich die Namen meiner Mutter Kamla, meiner Brüder Guddu und Kallu, meiner Schwester Shekila und meinen eigenen Namen – Saroo – auf. Er will gerade etwas sagen, als sich ein weiterer Mann zu uns gesellt und in klarem Englisch fragt: »Ja? Kann ich irgendwie helfen?«
Seit meiner Ankunft in Indien ist er der erste Mensch, mit dem ich mich mühelos unterhalten kann. Ich erzähle ihm meine Geschichte in wenigen Worten: dass ich als kleiner Junge hier gewohnt habe, eines Tages einem meiner Brüder verlorengegangen und in einem anderen Land aufgewachsen bin; dass ich mich an den Namen dieses Ortes hier, an Ganesh Talai, nicht hatte erinnern können, aber nun trotzdem zurückgefunden habe und versuche, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwester ausfindig zu machen. Kamla, Guddu, Kallu, Shekila.
Meine Geschichte scheint ihn zu überraschen. Ich zähle die Namen meiner Angehörigen noch einmal auf.
Nach einer Weile sagt er: »Warten Sie einen Moment. Ich bin in zwei Minuten wieder da.«
Was hat er vor? Verschiedene Möglichkeiten geistern mir durch den Kopf. Ruft er jemanden, der weiß, was geschehen ist? Lässt er sich vielleicht sogar eine Adresse nennen? Aber hat er überhaupt verstanden, wer ich bin? Zum Glück lässt er mich nicht lange warten – und spricht die Worte, die ich nie vergessen werde: »Folgen Sie mir. Ich führe Sie zu Ihrer Mutter.«
1
Erinnerungen
In Hobart, wo ich aufgewachsen bin, hing eine Indienkarte an der Wand meines Zimmers. Dafür hatte meine Mum – meine Adoptivmutter – gesorgt, damit ich mich in meinem neuen Zuhause wohler fühlte. Ich war sechs Jahre alt, als ich dort eintraf, und noch so ungebildet, dass ich nicht einmal wusste, was eine Landkarte ist. Sie musste mir erklären, was es damit auf sich hatte und was sie darstellte.
Mum hatte das Haus mit indischen Gegenständen geschmückt. Es gab Hindu-Figuren, Ornamente und Glöckchen aus Messing und viele kleine Elefanten. Dass dies für einen australischen Haushalt keine gewöhnlichen Gegenstände waren, wusste ich natürlich auch nicht. Auf der Kommode in meinem Schlafzimmer lag außerdem ein mit indischen Motiven bedrucktes Tuch; darauf hockte eine mit bunten Kleidern ausstaffierte, aus Holz geschnitzte Puppe. All dies war mir irgendwie vertraut, auch wenn ich derartige Dinge zuvor nie zu Gesicht bekommen hatte. Andere Adoptiveltern wären vielleicht der Meinung gewesen, dass es mir bessergetan hätte, bei null anzufangen, ohne jeden Bezug zum Land meiner Geburt. Aber meine Hautfarbe verriet ohnehin meine exotische Herkunft, und meine Adoptiveltern hatten sich bewusst entschieden, ein Kind aus Indien anzunehmen.
In meiner Kindheit purzelten mir die zahllosen Ortsnamen auf der Karte im Kopf durcheinander. Lange bevor ich lesen konnte, wusste ich immerhin, dass das riesige V des indischen Subkontinents voller Städte und Ortschaften, Wüsten und Berge, Flüsse und Wälder ist. Dies alles – der Ganges, der Himalaja, Tiger, Götter! – faszinierte mich zunehmend. Beim Anblick der Karte verlor ich mich in Gedanken darüber, dass sich dort irgendwo der Ort versteckte, an dem ich zur Welt gekommen war. Ich wusste, dass er »Ginestlay« hieß, nicht aber, ob es sich um eine Stadt, ein Dorf oder vielleicht auch nur um ein Wohnviertel handelte. Auf der Karte war er jedenfalls nicht zu finden.
Ich kannte nicht einmal mein genaues Alter. In den offiziellen Dokumenten standen nur ein von den indischen Behörden geschätztes Geburtsdatum sowie der Tag meiner Ankunft im Waisenhaus, das mich zur Adoption freigab. Als verwirrtes kleines Kind hatte ich nicht viel zur Aufklärung meiner Identität oder meiner Herkunft beitragen können.
Darum wussten auch meine Adoptiveltern anfangs nicht, wie und warum ich verlorengegangen war. Sie wussten nur, dass man mich auf den Straßen Kalkuttas aufgelesen und mich, weil meine Familie nicht ausfindig zu machen war, in das Waisenhaus gegeben hatte. Zum Glück für uns alle wurde ich schließlich von den Brierleys adoptiert. Sie zeigten mir Kalkutta auf der Karte und sagten, dass ich von dort käme. Dabei hörte ich den Namen dieser Stadt aus ihrem Mund zum ersten Mal. Erst ein Jahr nach meiner Adoption und als ich einigermaßen Englisch gelernt hatte, konnte ich meinen Stiefeltern beibringen, dass ich in Wirklichkeit nicht aus Kalkutta stammte und dass es mich nur dorthin verschlagen hatte, nachdem ich in einem Bahnhof in der Nähe von »Ginestlay« in einen Zug gestiegen war. Der Bahnhof habe »Bramapour«, »Berampur« oder ähnlich geheißen; er müsse sehr weit entfernt von Kalkutta liegen, doch wo genau, habe mir damals niemand sagen können.
Nach meiner Ankunft in meinem neuen Zuhause war die Zukunft erst einmal wichtiger als die Vergangenheit. In einer Welt, die völlig anders war als die Umgebung meiner ersten fünf Jahre, sollte für mich ein neues Leben beginnen, und meine Stiefeltern halfen mir nach Kräften über die größten Schwierigkeiten hinweg. Für meine Mum war offenbar klar, dass ich die sprachliche Hürde in kürzester Zeit von selbst überwinden würde, denn sie drängte mich nicht, Englisch zu lernen, und hielt es stattdessen für wichtiger, dass ich mich wohl fühlte und Vertrauen fasste. Dafür braucht man keine Worte. Sie kannte ein indisches Paar in der Nachbarschaft, Saleen und Jacob. Wir besuchten die beiden häufig und aßen mit ihnen zusammen indisch. Sie sprachen mit mir in meiner Muttersprache, stellten einfache Fragen und übersetzten, was mich meine Eltern über unser neues Zusammenleben wissen lassen wollten. Ich kam aus sehr einfachen Verhältnissen und sprach nur ein paar Brocken Hindi, doch verstanden zu werden half mir sehr, mich in der fremden Umgebung zurechtzufinden. Wenn Gesten und Handzeichen zur Verständigung mit meinen Stiefeltern nicht ausreichten, konnten wir uns immer an Saleen und Jacob wenden, so dass die Kommunikation eigentlich nie ins Stocken geriet.
Wie Kindern überhaupt, fiel es auch mir recht leicht, die neue Sprache zu erlernen. Anfangs kam ich allerdings nur selten auf meine Vergangenheit in Indien zu sprechen. Meine Eltern wollten mich nicht bedrängen und warteten geduldig ab, bis ich dazu bereit war, und anscheinend machte ich mir auch nicht allzu viele Gedanken darum. Doch Mum erinnert sich, dass ich einmal – ich war sieben Jahre alt – scheinbar unvermittelt in Aufregung geriet und ausrief: »Me begot!« Ich hatte sagen wollen, dass ich etwas vergessen hatte – I forgot –, aber herausgekommen war fälschlicherweise »Mich begattete«. Meine Mum konnte sich schließlich dennoch einen Reim auf meinen Ausbruch machen: Ich hatte in meiner Vorstellung den Weg zur Schule nahe meinem indischen Zuhause nicht mehr nachvollziehen können, den ich oft mitgegangen war, um die Schüler zu beobachten. Das hatte mich verstört. Wir einigten uns darauf, dass die Sache nicht so tragisch sei. Aber tief im Innern war sie mir offenbar wichtig. Von der Vergangenheit waren mir schließlich nur die Erinnerungen geblieben, und im Stillen führte ich sie mir immer wieder vor Augen, um sicherzugehen, dass sie nicht verblassten.
Im Grunde ging mir die Vergangenheit ständig durch den Kopf. Besonders nachts wurde sie wach; es fiel mir dann schwer, mich zu beruhigen, um schlafen zu können. Tagsüber war ich von den vielen Dingen, die ich zu tun hatte, meist abgelenkt. Aber selbst dann wanderten meine Gedanken immer wieder in die frühen Jahre zurück. Darum und weil ich entschlossen war, nicht zu vergessen, blieben mir meine Kindheitserfahrungen in Indien deutlich vor Augen. Sie ergaben ein fast vollständiges, detailliertes Bild – von meiner Familie, meinem Zuhause und den traumatischen Umständen der Trennung. Manche dieser Erinnerungen waren schön, andere schlimm, doch ich konnte die einen ohne die anderen nicht halten und hielt darum an allen fest.
Mein Wechsel in ein anderes Land und eine andere Kultur war weniger schwierig, als man annehmen würde, denn verglichen mit den Verhältnissen meiner frühen Kindheit in Indien hatte ich es in Australien sehr viel besser. Natürlich wollte ich meine leibliche Mutter wiedersehen, aber als mir klarwurde, dass diese Hoffnung aussichtslos war, beschloss ich, mich an jeden Strohhalm zu klammern, der mich überleben ließ. Mum und Dad waren sehr liebevoll, von Anfang an, zärtlich und immer darauf bedacht, dass ich mich sicher, geliebt und vor allem erwünscht fühlte. Für ein Kind, das sein Zuhause verloren und erfahren hat, dass sich kaum jemand darum kümmert, bedeutet dies unendlich viel. Ich vertraute mich ihnen vollkommen an. Schon im Alter von sechs Jahren (wenn ich davon ausgehe, dass ich zu diesem Zeitpunkt wirklich sechs Jahre alt war) begriff ich, dass mir eine zweite Chance gewährt worden war, was im Leben selten genug der Fall ist. In kürzester Zeit wurde aus mir Saroo Brierley.
In meinem neuen Zuhause in Hobart fühlte ich mich geborgen, und ich dachte, dass es vielleicht falsch sei, immer wieder zurückzublicken, und dass mein neues Leben von mir verlange, mit der Vergangenheit abzuschließen. Darum behielt ich meine nächtlichen Gedanken für mich. Mir fehlten auch die sprachlichen Mittel, sie zu formulieren. Und außerdem hatte ich keine Vorstellung davon, wie ungewöhnlich meine Geschichte war. Sie hatte mir zwar schrecklich zugesetzt, aber ich dachte, dass so etwas eben passiert. Erst sehr viel später, als ich mich auch anderen Leuten anvertraute, entnahm ich ihren Reaktionen, dass das, was mir widerfahren war, alles andere als gewöhnlich ist.
Manchmal setzten sich meine nächtlichen Gedanken bei Tage fort. Ich erinnere mich, mit Mum und Dad einmal im Kino den Film Salaam Bombay! gesehen zu haben. Er handelt von einem kleinen Jungen, der in einer indischen Großstadt zu überleben versucht, in der Hoffnung, zu seiner Mutter zurückkehren zu können. Die Bilder rührten quälende Erinnerungen in mir auf und brachten mich zum Weinen, was sich meine Eltern, die mir mit dem Film eine Freude machen wollten, nicht erklären konnten.
Zu ähnlichen emotionalen Turbulenzen führte bei mir auch traurige Musik, insbesondere Klassik. Kleine Kinder weinen zu sehen und zu hören wirkte ebenso stark auf mich, doch was mich am meisten aufwühlte, war der Anblick anderer kinderreicher Familien, wohl weil sie mich trotz meines günstigen Schicksals daran erinnerten, was ich verloren hatte.
Mit der Zeit legte sich meine Scheu davor, über meine Vergangenheit zu sprechen. Schon etwa ein, zwei Monate nach meiner Ankunft erzählte ich Saleen in wenigen Worten von meiner indischen Familie – Mutter, Schwester, zwei Brüder – und davon, dass ich von meinem Bruder getrennt worden und verlorengegangen war. Viel mehr konnte ich damals nicht erklären, und Saleen hörte mir freundlicherweise einfach nur zu, ohne mich mit Nachfragen zu verwirren. Als ich mich auf Englisch besser ausdrücken konnte, teilte ich Mum und Dad sporadisch weitere Einzelheiten mit, etwa, dass mein Vater die Familie verlassen hatte, als ich noch sehr klein gewesen war. Die meiste Zeit aber konzentrierte ich mich auf die Gegenwart. Ich ging zur Schule, schloss Freundschaften und entdeckte meine Liebe zum Sport.
Dann, an einem verregneten Wochenende ungefähr ein Jahr nach meiner Ankunft in Hobart, überraschte ich Mum – und mich selbst – damit, dass ich aus freien Stücken ausführlich auf mein Leben in Indien zu sprechen kam. Wahrscheinlich fühlte ich mich inzwischen sicher genug, nicht zuletzt sprachlich, so dass ich meine Erfahrungen in Worte fassen konnte. Ich erzählte ihr mehr als je zuvor: davon, dass wir in unserer Armut oft hungern mussten und dass mich meine Mutter manchmal mit einem leeren Topf losgeschickt hatte, um in der Nachbarschaft Essensreste zu erbetteln. Es war ein sehr bewegendes Gespräch, während dessen mich Mum eng an sich gedrückt hatte. Sie schlug mir vor, eine Skizze von dem Ort meiner Geburt zu zeichnen und die Wege einzutragen, die ich gegangen war, zum Fluss, wo ich mit anderen Kindern gespielt hatte, und zum Bahnhof, wohin eine Straße führte, über die sich eine Brücke spannte. Mit den Fingern fuhren wir die Strecken nach und machten uns dann gemeinsam daran, den Grundriss meines Zuhauses im Detail zu rekonstruieren. Wir markierten die Stellen, an denen die einzelnen Familienmitglieder geschlafen hatten, und notierten sogar die Reihenfolge, wann wer zu Bett gegangen war. Je besser mein Englisch wurde, desto vollständiger wurde diese Skizze. Sie half auch meinen Erinnerungen wieder auf die Sprünge, so dass ich Mum halbwegs die Umstände erklären konnte, die dazu geführt hatten, dass ich verlorengegangen war. Sie machte sich Notizen, malte eine geschwungene Linie auf die Indienkarte in Richtung Kalkutta und schrieb dazu: »eine sehr weite Reise«.
Ein paar Monate später fuhren wir nach Melbourne, wo wir andere Kinder trafen, die aus demselben Waisenhaus in Kalkutta adoptiert worden waren wie ich. Mich mit ihnen auf Hindi austauschen zu können brachte längst verschüttete Erinnerungen ans Licht. Zum ersten Mal konnte ich meiner Mum berichten, dass mein Heimatort Ginestlay hieß, und als sie mich fragte, wo der denn liege, antwortete ich zuversichtlich, wenn auch ein wenig unlogisch: »Du könntest mit mir dorthin fahren, dann zeige ich ihn dir. Ich kenne den Weg.«
Den Namen meines Herkunftsortes zum ersten Mal seit meiner Ankunft in Australien laut ausgesprochen zu haben war, als hätte sich ein Ventil geöffnet. Wenig später offenbarte ich einer Lehrerin, die ich sehr mochte, eine noch vollständigere Version der Ereignisse, die zur Trennung von meiner Familie geführt hatten. Sie reagierte genauso erstaunt wie Mum, machte sich aber ebenfalls Notizen, über anderthalb Stunden lang. Mir mochte Australien noch fremd sein, aber meiner Mum und meiner Lehrerin musste das, was ich zu berichten hatte, so seltsam vorgekommen sein, als hätte es sich auf einem anderen Planeten abgespielt.
Die Geschichte, die ich ihnen erzählte, handelte von Menschen und Orten, die mir seitdem immer und immer wieder durch den Kopf gingen und an die ich auch in den folgenden Jahren ständig denken musste. In meinen Erinnerungen ist bis heute natürlich die eine oder andere Lücke. Manchmal bin ich mir nicht sicher, in welcher Reihenfolge sich einzelne Vorfälle abspielten oder wie groß die zeitlichen Abstände sind, die zwischen ihnen lagen. Es fällt mir auch mitunter schwer zu unterscheiden, was ich damals als Kind in Indien beziehungsweise als Heranwachsender in Australien gedacht und empfunden habe. Es mag sein, dass meine wiederholten Reisen und Versuche, Hinweise aus der Vergangenheit zu bergen, die Faktenlage ein wenig durcheinandergebracht haben, doch der überwiegende Teil meiner Kindheitserfahrungen bleibt in meiner Erinnerung lebendig und klar.
Es hat mich damals sehr erleichtert, meine Geschichte zu erzählen. Heute, nachdem die Ereignisse vor zwei Jahren mein Leben so verändert haben, bin ich überglücklich, meine Erfahrungen teilen und damit anderen vielleicht sogar Hoffnung machen zu können.
2
Aus den Augen verloren
Meine frühesten Erinnerungen reichen zurück in die Zeit, als ich auf meine kleine Schwester Shekila aufpassen musste; wenn wir Verstecken spielten, lachte sie über das ganze Gesicht, das meist recht schmutzig war. Und ich erinnere mich an lange, warme Nächte während der heißen Monate, wenn wir uns mit den anderen Bewohnern des Hauses draußen im Hof trafen, jemand Harmonium spielte und andere dazu sangen. Ich gehörte ohne jeden Zweifel dazu und fühlte mich wohl in solchen Nächten. Die Frauen holten Bettzeug und Decken nach draußen. Wir mummelten uns darin ein und schauten zu den Sternen auf, bis uns die Augen zufielen.
So war es in unserem ersten Heim, in dem ich zur Welt gekommen bin; wir teilten es uns mit einer anderen Hindu-Familie. Sie belegte eine, wir die andere Hälfte eines großen zentralen Raums, der mit Ziegeln ummauert und mit einem Estrich aus Kuhdung, Stroh und Lehm ausgelegt war. Unsere Unterkunft war sehr einfach, aber gewiss nicht einer jener Verschläge in den Slums, chawl genannt, in denen die Ärmsten der Armen solcher Riesenstädte wie Mumbai und Delhi hausen müssen. Trotz der beengten Verhältnisse kamen wir alle in der gemeinsamen Wohnung gut zurecht. Meine Erinnerungen an diese Zeit zählen zu den glücklichsten.
Meine Mutter war eine Hindu, mein Vater Muslim – ihre Ehe war eine ungewöhnliche Verbindung zur damaligen Zeit, und sie hielt auch nicht lange. Mein Vater verbrachte nur wenig Zeit mit uns – später erfuhr ich, dass er sich eine zweite Frau genommen hatte; Mutter musste uns mehr oder weniger allein aufziehen. Obwohl wir selbst keine Muslime waren, zog sie mit uns in den muslimischen Teil der Stadt, wo ich meine Kindheit verbrachte. Meine Mutter war sehr schön und schlank und hatte lange, glänzende Haare. Ich erinnere mich an sie als die hübscheste Frau der Welt. Neben meiner Mutter und meiner kleinen Schwester gab es noch meine älteren Brüder Guddu und Kallu, zu denen ich voller Liebe und Verehrung aufblickte.
In unserem zweiten Zuhause waren wir für uns allein, hatten aber noch weniger Platz. Die Wohnung war eine von dreien im Erdgeschoss eines roten Ziegelhauses. Auch hier bestand der Boden aus gestampftem Kuhdung und Lehm. Uns stand bloß ein Raum zur Verfügung. In der einen Ecke befand sich eine kleine Feuerstelle, gegenüber ein Lehmtrog mit Trinkwasser, mit dem wir uns auch wuschen. Es gab nur eine einzige Ablage, auf der wir tagsüber unsere Schlafdecken aufbewahrten. Das Haus war baufällig; überall bröckelte es. Meine Brüder und ich zogen manchmal einen Ziegelstein aus der Mauer und lugten aus Spaß durch das Loch nach draußen, um es gleich darauf wieder zu verschließen.
In unserer Stadt war es, von der Regenzeit abgesehen, heiß und trocken. Den Bergen in der Ferne entsprang ein Fluss, der an der alten Stadtmauer entlangströmte. Im Sommer ließ der Monsun ihn über die Ufer treten, so dass die Felder ringsum überschwemmt wurden. Die kleinen Fische, auf die wir sonst Jagd machten, konnten wir erst dann wieder zu fangen versuchen, wenn der Regen nachließ und der Fluss abschwoll. Auch der Fußgängertunnel unter der Eisenbahn, die den Fluss überquerte, lief während der Regenzeit immer voll Wasser. Trotz des Staubs und der Steinchen, die herabfielen, wenn ein Zug vorbeifuhr, war dieser Tunnel sonst der Ort, an dem wir am liebsten spielten.
In unserem Viertel gab es nur sehr arme Leute, von denen viele für die Eisenbahn arbeiteten. Für die wohlhabenderen Bürger jenseits der Bahntrasse lebten wir buchstäblich auf der falschen Seite. Die Häuser waren durchweg alt, manche drohten einzustürzen. Wer nicht in einer Sozialwohnung unterkam, musste – wie wir – mit einer winzigen Hütte vorliebnehmen, bestehend aus einem, höchstens zwei Räumen. Alle waren ähnlich ausgestattet: mit Regal, niedrigem Holzbett und einem Wasserhahn über einem Ausguss.
Die ungepflasterten Straßen waren, von uns Kindern abgesehen, voller Kühe, selbst im Stadtzentrum, wo sie oft inmitten des hektischen Verkehrs auf dem Boden lagen und vor sich hin dösten. Schweine trieben sich in Rotten herum; nachts schliefen sie dicht an dicht an irgendeiner Straßenecke, bei Tag streiften sie frei umher auf der Suche nach etwas Fressbarem. Wem sie gehörten, schien nicht so recht klar zu sein – sie waren einfach da. Viele muslimische Familien hielten sich Ziegen, und natürlich gab es überall Hühner, die im Staub pickten. Vor den vielen Hunden hatte ich Angst, auch vor denen, die freundlicher zu sein schienen. Sie waren mir nicht geheuer, seit mich einmal einer mit seinem Knurren und Bellen in die Flucht geschlagen hatte. Ich war davongelaufen, gestolpert und mit dem Kopf auf eine Fliesenscherbe gefallen, die im Boden steckte. Es fehlte nicht viel, und ich hätte ein Auge verloren. Über die Schnittwunde entlang der Braue wickelte ein Nachbar einen Verband. Als ich schließlich meinen Weg nach Hause fortsetzte, begegnete mir Baba, der Heilige unseres Ortes, und sagte, ich dürfe keine Angst vor Hunden haben, sie würden nur beißen, wenn sie spürten, dass man ängstlich sei. Ich versuchte, seinen Rat zu beherzigen, wurde aber trotzdem immer nervös, wenn ich Hunde auf der Straße sah. Von meiner Mutter wusste ich, dass manche Tiere eine tödliche Krankheit hatten, die sie übertragen konnten, selbst dann, wenn sie nur nach einem schnappten. Nach wie vor mag ich keine Hunde, und die Narbe über dem Auge ist immer noch zu erkennen.
Nachdem mein Vater uns verlassen hatte, musste Mutter für unseren Lebensunterhalt allein aufkommen. Kurz nach Shekilas Geburt arbeitete sie auf Baustellen und schleppte unter der brennenden Sonne schwere Steine auf dem Kopf, sechs Tage die Woche, von Sonnenaufgang bis zur Dunkelheit. Wir Kinder hatten nicht viel von ihr. Manchmal, wenn sie weiter entfernt arbeiten musste, blieb sie tagelang fort. Trotzdem verdiente sie so wenig, dass es für uns alle nicht reichte. Um über die Runden zu kommen, nahm Guddu im Alter von zehn Jahren einen Job als Tellerwäscher in einem Restaurant an. Hunger hatten wir meist dennoch. Wir lebten von der Hand in den Mund. Es kam nicht selten vor, dass wir bei Nachbarn, auf dem Markt oder am Bahnhof Lebensmittel oder Geld erbetteln mussten, aber irgendwie schafften wir es von Tag zu Tag. Schon frühmorgens zog jeder von uns los, um aufzutreiben, was sich fand; abends kam dann das Mitgebrachte auf den Tisch und wurde geteilt. Ich erinnere mich, fast immer hungrig gewesen zu sein, was mir aber eigentümlicherweise nicht viel ausgemacht hat. Ich fand es normal. Wir Kinder waren nur Haut und Knochen und hatten vor Unterernährung geblähte Bäuche. Aber so erging es vielen Kindern in Indien; es war nicht ungewöhnlich.
Wie viele Gleichaltrige in unserer Nachbarschaft waren meine Brüder und ich sehr erfinderisch, wenn es darum ging, etwas zum Essen zu besorgen. Manchmal versuchten wir, Mangofrüchte von einem Baum zu holen, indem wir Steine danach warfen. Aber es konnte auch abenteuerlicher zugehen. Eines Tages beschlossen wir, auf einem Umweg über die Felder nach Hause zurückzukehren, und kamen an einem Hühnerstall vorbei, der ungefähr fünfzig Meter lang war und von bewaffneten Männern bewacht wurde. Guddu ließ sich davon nicht abschrecken und meinte, dass es uns gelingen könnte, ein paar Eier zu stehlen. Also legten wir uns einen Plan zurecht. Wir wollten warten, bis die Wachen eine Pause machten, um Tee zu trinken. Ich als der Kleinste und Unauffälligste sollte als Erster in den Stall schleichen, gefolgt von Guddu und Kallu. Guddu hatte die Idee, die erbeuteten Eier – möglichst viele – hinter den gerafften Säumen unserer T-Shirts in Sicherheit zu bringen. Dann würde es heißen, nichts wie weg.
Von unserem Versteck aus beobachteten wir die Wachen, die nach einer Weile tatsächlich loszogen, um mit den Stallknechten Rotis zu essen und Chai zu trinken. Jetzt durften wir keine Zeit verlieren. Ich huschte in den Stall und fing gleich damit an, Eier einzusammeln. Bald waren auch Guddu und Kallu zur Stelle. Die aufgeschreckten Hühner fingen an zu schreien und alarmierten die Wachen. Wir hasteten nach draußen, als die Männer herbeirannten und bis auf zwanzig Meter an uns herankamen. Guddu rief: »Schnell, schnell!« Wir stoben davon, jeder in eine andere Richtung, schneller als die Wachen. Zum Glück schossen sie nicht auf uns. Erst als ich sie weit genug hinter mir zurückgelassen hatte, wagte ich zu verschnaufen.
Dummerweise hatten die Eier bei der Flucht gelitten. Von den neun, die ich erbeutet hatte, waren nur zwei heil geblieben; die anderen, zerschlagen, troffen mir vom Hemd. Meine Brüder waren vor mir zu Hause angekommen, und meine Mutter hatte schon eine Bratpfanne aufs Feuer gestellt, als ich eintraf. Zehn Eier waren übrig geblieben, genug für uns alle. Ich hatte einen Bärenhunger und sah meiner Mutter zu, wie sie zuerst Shekila zu essen gab. Weil ich mich nicht länger beherrschen konnte, schnappte ich ihr das Spiegelei vom Teller, rannte damit zur Tür hinaus und ignorierte die wütenden Proteste.