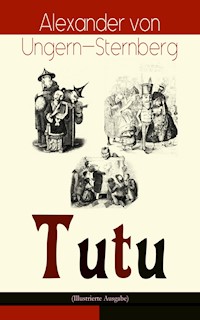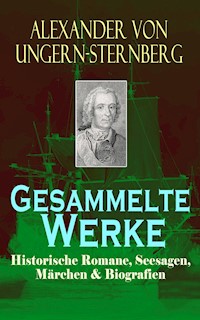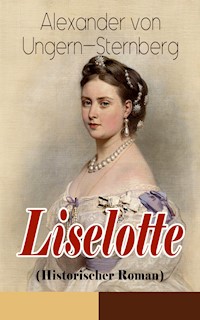
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Liselotte (Historischer Roman)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Die Grundsätze, die sich in der aufkeimenden Jungfrau entwickelten, ihr fester, unbeugsamer Sinn, ihre Offenheit und Wahrheitsliebe wurden bald ihrer Umgebung bekannt, die sie schätzte und liebte oder, wie es der Charakter der Beobachtenden mit sich brachte, tadelte und floh. Immer hatte sie aber ihre Tante, die Kurfürstin, zur Freundin. Die junge Prinzessin aus Celle, wie sie sich denn bei allen einzuschmeicheln suchte, gab auch unserer Charlotte die freundlichsten Zeichen ihres Wohlwollens. Charlotte betrachtete sie mit mißtrauischen Blicken: sie traute ihr nicht. Des Kurprinzen stille und feste Gradheit, sein an harten Stolz grenzender Charakter machten auf Charlotte einen günstigen Eindruck. Den Stolz hielt sie für männlich, die Schweigsamkeit für Charakter, und so war Vetter Georg ihr lieb und teuer. Sie begleitete ihn auf der Jagd, sie machte kleine Reisen in seiner Gesellschaft, und der finster blickende Jüngling hatte für sie immer ein gefälliges Wort, eine freundliche Haltung. Einstmals fragte sie ihn: "Liebst du deine Cousine, Georg?" Der Prinz, so rasch und so bestimmt gefragt, erwiderte einlenkend: "Würdest du denn Sophie Dorothea nicht lieben, wenn sie deine Frau wäre?"..." Alexander von Ungern-Sternberg (1806-1868), war ein deutscher Erzähler, Dichter und Maler. Er war Verfasser historischer und biographischer Romane, Novellen und ironischer Märchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 683
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liselotte (Historischer Roman)
Inhaltsverzeichnis
1. Die Jugend der Prinzessin
Der Sommer des Jahres 1655 war ein besonders heißer; es standen bald nacheinander zwei Kometen am Himmel, die die Astronomen wie die Astrologen stark beschäftigten und aus denen die letzten allerlei prophezeiten, was auf die folgenden Jahre Bezug hatte. Dann herrschte im südlichen Deutschland eine Teuerung, die sich in der Gegend von Schwaben und Franken zu einer Hungersnot steigerte und in ihrem Gefolge Seuchen und Krankheiten brachte.
Um Heidelberg herum war die Atmosphäre rein und erquickend; sei es nun, daß das Neckartal diese Eigenschaft besonders an sich hatte, oder daß es eine besondere Gunst klimatischer Einflüsse war, die Milde und Klarheit der Luft, die Gesichertheit der Sonnenwärme, unangetastet von den mephitischen Dünsten, die sich überall anderswo entwickelten, herrschten hier ungestört und machten, daß die Reisenden besonders diese Gegend aufsuchten und, einmal hier angelangt, auch gern verweilten. Wir sehen zwei Wanderer besonderer Art vor uns, die die Straße des Neckartals hinaufwanderten und sich der Heidelberger Brücke näherten. Die Sonne hatte sich von dem Gipfelpunkt ihrer Macht bereits gesenkt, und die Schatten verlängerten sich; ein warmes Lüftchen bewegte die Baumgruppen und führte den Reisenden die Gerüche frisch duftender Blumen zu, die in der Umfriedung der Gärten standen, die zu beiden Seiten des Weges ihren Reichtum entwickelten. Diese Blumenwelt, im Verein mit den Bäumen der schönen Straße, die ebenfalls unter einer kostbaren Fülle reicher Blüten standen, bildeten eine entzückende und anmutige Umgebung, doppelt erquicklich für die Wanderer, da diese offenbar zum erstenmal diese Gegend betraten und ihren wundersamen Flor anstaunten. Es waren zwei Männer in reicher Kleidung; der eine, der ältere, war vom Kopf bis zu den Füßen in Schwarz gehüllt, mit einer schweren, goldenen Kette um den Hals. Er hielt den kleinen, mit Federn gezierten Hut in der Hand, wodurch das ausdrucksvolle Gesicht mit einem vollen, schwarzen Bart, mit kurzem Haar und schwarzen Augen ungehindert und keck aus den Spitzen der Halskrause hervorleuchtete. Der zweite war ein junger Mann von noch nicht vollen zwanzig Jahren, dessen Kleidung ebenfalls höhere Abkunft zeigte, dessen Manieren aber nicht die Eleganz und die vornehme Leichtigkeit seines Gefährten hatten.
Als sie die Brücke überschritten hatten, näherten sie sich einem kleinen Grasplatze, der innerhalb der Festungsmauern angelegt war und dazu bestimmt schien, für die Bewohner der Burg eine willkommene Stelle abzugeben, wo sie sich, unbelauscht und unangefochten von der übrigen Bewohnerschaft der Umgegend, ergehen konnten. Man sah von dieser kleinen, mit Laub und Blumen geschmückten Ebene, wenn das Tor der Brücke offen stand, auf das nahe Ufer und auf das, was daselbst sich ereignete, ohne doch wiedergesehen zu werden. Als die Fremden die wenigen Stufen hinaufstiegen, die sich hier, um in das Innere der Burg zu gelangen, zeigten, gewahrten sie, an das Gitter gelehnt, das hier den kleinen Garten umzäunte, ein Kind stehen und aufmerksam eine Gruppe spielender Kleinen betrachten, die sich am Ufer des Flusses tummelten. Der Ausdruck des Kindes, seine gespannte Aufmerksamkeit auf seine kleinen Gefährten dort unten, hatte so etwas Eigentümliches, daß die beiden Wanderer nicht umhin konnten stehenzubleiben, um die Kleine zu betrachten. Es war ein gesundes, frisches Mädchen von nicht voll vier Jahren, in einem Röckchen von rotem Stoffe, auf dem blonden Kinderkopfe eine hohe, mißgestaltete Mütze, von der ein schwarzer, kleiner Florschleier herabfiel. Die Kleine wandte, als sie merkte, daß sie Gegenstand der Neugierde war, ihre hellen, kleinen Augen mit dem Ausdruck besonderen Mutwillens zu den Fremden und tat ihr Verlangen kund, über die Umzäunung des Gärtchens gehoben zu werden.
»Willst du hinüber zu deiner Freundin, Kleine?« fragte der ältere der Herren das Mädchen, indem er an den Gartenzaun herantrat.
Das Mädchen sah den Mann fragend an; offenbar hatte sie die Sprache des Herrn nicht verstanden; erst als der zweite auf deutsch hinzusetzte: »Sollen wir dich hinüberheben?« nickte sie mit dem Kopfe, indem sie den Fuß auf eine der Sprossen der Umzäunung setzte.
Sie wurde hinübergehoben, und hier, nachdem sie einen flüchtigen Blick umhergeworfen und sich unbeobachtet sah, war sie mit wenigen Sprüngen hinunter an das Ufer und stand jetzt unter den Kindern, die sich neugierig um sie scharten. Sie ließ sich von vorn und vom Rücken betrachten, dann ergriff sie eines der Mädchen an den Händen und fing an sich mit ihm herumzuschwingen, so daß der schwarze Schleier an ihrer Mütze im Winde flog. Dann rief sie aus: »Nun singt euer Lied nochmals! Ich kenne es und will das Spiel mit euch spielen.«
Alsobald ordnete sich ein kleiner Zug; das kleine Mädchen ging voran, und die andern sangen. »Du bist der Sommer!« sagte ein hübscher Bube, indem er vor der fremden Kleinen einen Kratzfuß machte; »oder willst du lieber die Fürstin sein?«
»Ich bin die Fürstin!« erwiderte das Mädchen stolz.
Und der ganze Kreis sang:
»Nun sind wir in den Fasten, da leeren die Bauern die Kasten. Wenn die Bauern die Kasten leeren, wolle uns Gott ein gut Jahr bescheren. Strü, strü, stra! Der Sommer der ist da!«
Und sich zu ihrer Umgebung umwendend, wiederholte die Kleine: »Strü, strü, stra! Der Sommer der ist da!« –
Es war ein liebliches Bild, am Ufer des Stroms die lustige Kinderwelt spielen zu sehn. Die beiden Fremden ergötzten sich daran, und der ältere sagte, indem er auf das Mädchen wies: »Die kleine Dicke möcht' ich mit mir nehmen, sie wäre ein guter Spielkamerad für meinen trübseligen Philipp!« –
»Ach!« rief der andere, »was fällt Ihnen ein, bester Oheim! Gibt es denn im schönen Frankreich nicht der lustigen Kinder genug; müssen wir nach Deutschland gehen, um da zu plündern?«
»Ich liebe dieses Land, das eigentlich uns gehört und das uns auch noch einmal zufallen wird!« rief der ernste Mann mit einem lächelnden Ausdruck, indem er über die Schulter herüber seinen jungen Gefährten anblickte. »Gefallen dir denn diese schönen Ufer nicht, Gaston? Das ganze ist ein Garten, und dazu das schöne Schloß dort oben. Wie prachtvoll muß es sich hier leben lassen!«
Der junge Mann schien von dem Enthusiasmus seines Gefährten nichts zu begreifen. Er neigte bejahend das Haupt, war aber mit seinen Gedanken bei der Kleinen unten am Flusse.
Plötzlich ließ sich ein ängstlicher Schrei hören. Die beiden sahen sich um und bemerkten jetzt eine ältliche Frau, die ängstlich im Gärtchen hin und her irrte und jemand zu suchen schien. Es zeigte sich alsbald, daß sie das Kind vermißte, das sie hier spielend verlassen hatte.
»Madame suchen die Kleine!« hob der ältere Herr an, »sie ist dort unten.«
»Ich danke Ihnen, mein Herr,« erwiderte die Frau französisch, »aber wie ist sie dort hingekommen?«
»Ich habe sie herübergehoben,« erwiderte die ruhige und feste Stimme des Mannes.
Die Frau blickte erstaunt den kühnen Befreier ihres Schützlings an und sagte dann: »So eilen Sie, sie wiederzuschaffen. Es ist die Tochter des Kurfürsten. Es ist uns nicht erlaubt, diesen Garten zu verlassen.«
»Beruhigen Sie sich, Madame!« hub der jüngere an. »Sogleich soll sie wieder da sein!«
Er eilte die Stufen hinab und kam mit dem Kinde auf dem Arme bald wieder. Er hob es von neuem über den Zaun und legte es in den Arm der Frau, die es mit sanften Worten schalt.
»Nicht böse sein, Mutter Joli!« rief die Kleine. »Sie spielten unten und sangen das bekannte Liedchen; da mußte ich dabei sein! Du siehst ein, es ging nicht anders, ich mußte dabei sein.«
»Das war durchaus nicht nötig!« rief die Frau. »Ich sehe, ich kann dich nicht eine Minute allein lassen. Papa hat recht, wenn er sagte: ›Es ist uns eine ungehorsame Tochter geboren worden.‹«
»Schon wieder sagst du das!« rief das Kind, halb weinend und mit dem Fuße stampfend, »der Vater sagt das nicht; er kann es nicht sagen, aber du, du sagst es, nur um mich zu ärgern, böse Mutter Joli!«
Die Alte sah mit einem Ausdruck von Zufriedenheit in das blühende, erhitzte Gesicht der Kleinen, dann sagte sie zu beiden Männern: »Meine Herren, darf ich um Ihre Namen bitten, damit mir wissen, mit wem wir die Ehre haben.« –
»Nennt mich, liebe Dame, General Duprez, und dieser hier ist mein Neffe, der Marquis von Rohan.«
»Ah!« rief die Frau respektvoll, und die beiden Herren der Kleinen vorstellend, sagte sie: »Hier, Madame, ist der Herr General und der Herr Neffe des Generals, die das Vergnügen haben, Euch vorgestellt zu werden. Nehmen Sie Ihre Mütze ab und grüßen Sie.«
Das Mädchen tat, wie ihr geheißen, mit einem feinen und zierlichen Anstande, dann wieder die Kopfbedeckung mit dem Schleier aufsetzend, rief sie mit kindlicher Freude, halb zu ihrer Erzieherin gewendet: »Was sagst du, Mutter, wenn ich die Herren oben in die Burg führe? Ihnen zeige, was sie sehen wollen? Der Vater ist nicht zu Hause, und die Mutter hat sich eingeschlossen. Niemand wird uns stören.«
Auf eine Kopfneigung der Mademoiselle Joli erfaßte die Prinzessin die Hand des Generals und führte ihn den Gang hinauf. Der junge Mann und die Gouvernante folgten.
Oben angelangt, waren die Fremden erstaunt über die reiche Aussicht, die sich von dem Plateau des Burghofes ringsumher dem Auge bot. Das ganze, schöne Neckartal, mit seinen Hügeln und Tälern lag vor ihnen, und durch die Ebene schlängelte sich der Fluß, dessen Ufer alte Burgen und neue Anpflanzungen zierten. Rundum schmückten Statuen den innern Burghof und gaben mit ihrer majestätischen Ruhe dem Ganzen den Charakter einer wahren Königsburg, die stolz und sicher die Gegend beherrschte.
»Das sind sämtlich meine Väter,« sagte die Kleine, auf eine Treppenstufe sich stellend und auf die steinernen Gestalten zeigend. »Dies hier ist der Georg, dies der Wilhelm, jener der Heinrich! Sie haben alle gelebt, Gott weiß, wann, aber sie sind alle Herren des Landes gewesen, und ich – ich stamme von ihnen!«
Der Ausdruck des Stolzes, des Selbstbewußtseins, mit dem die Kleine diese Worte sprach, hatte so etwas Eigentümliches und Komisches, daß die beiden Herren lachten und der ältere auf das Kind zulief, es in seine Arme schloß und einen Kuß auf seine Wangen drückte, indem er dazu rief: »O du niedliche Kleine! Sage mir, freust du dich auch, so große Herren zu deinen Vorfahren zu haben?«
Das Mädchen sah ihre Erzieherin an, und dann antwortete sie langsam: »Ich darf es eigentlich nicht sagen, man hat es mir verboten, aber ich sage es doch: Wir sind viel reicher als der Kaiser in Wien, denn meine Papas sind älter als er und seine Papas. Mein Großvater war König. Und wenn ich einmal heirate, werde ich auch nichts anders als einen König nehmen.«
Madame Joli mischte sich hier ins Gespräch, indem sie rief: »Lassen Sie sie, meine Herren, Sie hören, sie spricht töricht. Man muß auf Kindesworte nicht achten.«
»Ich spreche nicht töricht, ich rede die Wahrheit!« rief das Kind entrüstet. »Wenn die Herren mich hören wollen, so laß sie doch! Mußt du denn immer dazwischenfahren?« –
Die Herren und die Gouvernante lachten über das zornrote Kind, das beschämt darüber sich in den schwarzen Schleier wickelte und hinter der alten Dame sich versteckte. Indem kamen noch ein paar Herren hinauf, die die ersteren zu suchen schienen. Sobald sie sie entdeckten, entblößten sie ihre Häupter und blieben ehrfurchtsvoll stehen.
»Sind die Wagen in Bereitschaft?« fragte der ältliche Herr.
»Sie sind's, gnädiger Herr!« erwiderte einer der Männer.
»So laßt uns gehn.« Er wandte sich an die Erzieherin. »Haben Sie Dank, meine Dame,« sagte er, »für Ihre Güte, mit der Sie uns hier aufgenommen. Melden Sie Ihrem Herrn, daß wir als Reisende unsere Straße ziehen, sonst würden wir uns die Ehre geben, ihm auszuwarten. Und Sie, mein Prinzeßchen, geben Sie uns die Hand zum Abschiede.«
Das Kind war durchaus nicht erstaunt, als sie erfuhr, mit wem sie sprach. Sie hielt ein kleines, goldenes Bildchen in ihren Händen, das der junge Mann an einer Kette trug. »Wen stellt das vor?« fragte sie den Prinzen.
»Einen Heiligen, wie Sie hier mehrere sehen!« erwiderte der junge Mann.
»Gebt es mir!« rief die Kleine; »ich liebe Bilder, ich möchte es haben.«
Ohne ein Wort zu erwidern nestelte der junge Mann das Bild los und gab es der Prinzessin. »Dafür sollst du einen Kuß haben,« sagte das mutwillige Mädchen. »Da du ein Marquis bist, kann ich dich küssen.«
Der Kuß wurde gegeben, unter herzlichem Gelächter der beiden Herrn, und die Gesellschaft trennte sich. Der Graf und der Marquis gingen voran, die Herren aus ihrem Gefolge begleiteten sie. Madame Joli stand noch lange mit der Kleinen auf dem Arme und sah die fremden Herren über die Brücke gehen und drüben sich auf der Landstraße verlieren.
2. Der Schlag ins Gesicht
Der Pfalzgraf Karl Ludwig empfing bei seiner Zurückkunft die Nachricht von den zwei Fremden; er tadelte seine Tochter über das erbetene Geschenk und befahl der Gouvernante, daß sie künftig dergleichen nicht dulden solle; denn er, wie sein Haus, begehre von niemand etwas.
Die Stimmung des Herrn war schwer und bedrückt. Er setzte sich an einen Tisch in der Halle und stützte das Haupt in die Hand. Wenn man das Antlitz ansah, wie es sich jetzt, halb beschattet von der Hand, zeigte, so war es das eines noch schönen Mannes, obgleich die Jahre merklich darüber hingezogen waren. Das Auge war groß und dunkel, aber zugleich geheimnisvoll und düster; die Brauen hingen tief hinein, und sie sowohl als die Barthaare hatten einen Anflug von Grau, obgleich der Herr noch nicht volle vierzig Jahre zählte. Seine Gestalt war voll und stark; der einfache Jagdrock zeigte die Schönheit und das Ebenmaß der Glieder. In der Jugend war Karl Ludwig schwächlich gewesen, und der mindest schöne von den schönen Kindern des unglücklichen Böhmenkönigs und der lieblichen Prinzessin von England; später aber hatten Kriegsübungen seinen Körper gestählt, und die trüben Erfahrungen seiner Jugend waren ihm Lehren der Weisheit und Vorsicht geworden.
Das Kind, das noch immer mit seinem goldenen Bildchen spielte, drückte sich zwischen die Knie des Vaters, und indem es die klaren Augen nicht von der kummergedrückten Miene desselben wegwandte, liebkoste es schüchtern den trauernden Mann, indem es mit seinen Händchen über die breite und nervige Hand des Vaters fuhr. Madame Joli hatte sich entfernt.
»Was haben dir die Herren gesagt?« fragte der Vater seine Tochter, indem er sie mit mißtrauischen Blicken ansah.
»Nichts, Papa, gar nichts. Die waren ja selbst fremd!« erwiderte das Mädchen.
»Vielleicht waren es Späher,« murmelte der Fürst vor sich hin. »Ich habe überall Feinde.«
»Die hatten so offene, gute Gesichter,« sagte die Kleine. »Wenn sie alle in Frankreich so aussehn, möchte ich wohl hin.«
»So?« sagte Karl Ludwig, und seine Miene verzog sich etwas zum Lächeln. »In zehn Jahren wollen wir weiter davon sprechen. Ich werde dich aus dem Hause geben, Mädchen!«
Das Kind sah den Vater an. »Fortgeben willst du mich?« fragte es unwillig und überrascht. »Wohin denn? Gehör' ich nicht hierher? Bin ich nicht dein Kind?«
»Du sollst zu deiner Tante, der guten Kurfürstin von Hannover.«
»Zu der? Zu der Tante, die mir zu Weihnachten die schöne Puppe geschickt hat? Ja, zu der will ich.«
Die Kleine sah zufrieden und stolz ans, indem sie dies sagte. Der Vater fragte: »Also du gehst gern?«
»O – Vater!« rief sie und hing sich an seinen Hals, »wie kannst du nur so sprechen! Ich denke, du kommst mit!« sagte das Mädchen.
»Wie kann ich?« rief der Vater finster. »Weißt du denn nicht, daß ich hierbleiben muß?«
»Wegen Fräulein Luise?« fragte das Kind.
»Still!« rief der erschreckte Mann und hielt die Hand dem Kinde vor den Mund. »Du darfst nicht von ihr sprechen. Hörst du? Nie ihren Namen nennen. Die Arme hat es so schon schwer genug hier im Hause!« –
»Die liebe Tante Sophie!« rief das Kind, plötzlich wieder heiter. »Wird sie mich aber auch wollen, wenn ich ohne dich komme?« –
»Mama Joli wird dich hinbringen; dort wirst du eine andere Gouvernante erhalten, die dir die Tante ausgesucht hat.«
»Wo bleibt Joli?« fragte die Kleine.
»Sie geht nach Frankreich zurück, wo sie ihre Verwandten hat,« entgegnete der Vater und strich mit der Hand über das Lockenhaupt des Kindes. Er hielt plötzlich inne und lauschte nach einer Seite hin. »War es nicht, als ginge die Türe an der Kammer der Mutter?« fragte er, sich umsehend.
»Nein, nein!« entgegnete die Kleine, »hier ist alles still und tot. Es ist wie im Grabe. Seitdem die Mutter böse ist, hört man keinen Laut hier. Zum Essen kommt aber Vetter Ernst; er hat es sagen lassen.«
»Hat man es der Mutter gemeldet?«
»Mama Joli ist drin gewesen,« erwiderte das Kind, »sie hat mit dem Kopf genickt, gesagt hat sie nichts.«
Der Fürst war in Nachdenken versunken. Er sah auf das Antlitz seines Kindes, und ihm die Haare aus dem Gesicht streichend, versenkte er sich tief und forschend in die hellen Augen. »Wirst du auch einmal die Qual und die Marter eines Mannes werden?« flüsterte er. »Ruht auch in dir der giftige Lindwurm, der unsere Tage verzehrt und uns vor der Zeit reif zum Grabe macht? Es wäre besser, du wärest nie geboren! Hier, mit dieser Hand könnte ich dich erwürgen! Dich von der Erde hinwegreißen, giftiges, kleines Unglücksgeschöpf!«
Seine Augen nahmen den Charakter einer ungezähmten Wildheit an, und das Kind, das sonst nicht furchtsam war, senkte seinen Blick und suchte zwischen den Knien des Vaters zu entschlüpfen. Er hielt sie aber nur fester.
»Bleib!« rief er drohend, »und höre, was ich dir sage. Du weißt, wo ich gestern abend war, zwischen zehn und elf Uhr?«
Das Kind neigte das Haupt bejahend.
»Dein Tod ist's, wenn du es der Mutter wiedererzählst!« sagte der Vater mit leiser und einschüchternder Stimme. »Hörst du – dein Tod!«
»Ich werde niemand etwas sagen!« versicherte das Mädchen.
»Darum mußt du fort!« sagte der Zürnende, halb vor sich hin. »Vor Teufeln kann ich mich wehren, aber nicht vor Engeln, die die Rolle der Teufel spielen. Jetzt geh und sieh, ob der Tisch gedeckt ist. Ich komme gleich hinab, sage das der Mutter, und sei freundlich und froh.«
Die kleine Elisabeth Charlotte, schon jetzt eingeweiht in die geheime Geschichte ihres Hauses, war die Vertraute des Vaters und des Fräuleins Luise von Degenfeld, während sie gegen die Kurfürstin, ihre Mutter, geheimnisvoll und verschlossen blieb. Diese Rolle, die das Kind spielen mußte, drückte ihre Spuren in seinen offenen und freien Charakter. Sie verstand, so jung sie auch war, schon zu heucheln und sich zu verstellen. Dies machte den Kummer und die Sorge der kleinen, unschuldigen Seele aus, die gern die ganze Welt zu Freunden haben wollte. Im Vorzimmer wartete die Joli auf sie, nahm sie auf den Arm und brachte sie ins Ankleidezimmer, wo der schöne, rote Festtagsrock lag, den sie heute anlegte.
Der Haushalt der Pfalzgrafen und Kurfürsten damaliger Zeit hatte etwas Einfaches, beinahe Bürgerliches. Frühmorgens stand der Herr auf, frühstückte allein, trank dazu eine Kanne Biersuppe, dann ging er auf dem Altan seines Schlosses, wo er seine Vertrauten hinbestellt hatte, auf und ab, und sich der herrlichen Fernsicht erfreuend, an schönen Morgen ungestört und unbelauscht, besprach er mit dem Kanzler Wellenritt die Angelegenheiten seines Hauses und seines kleinen Reiches. Wellenritt war ein ältlicher Mann, dessen Jugend in Kriegslagern dahingegangen war, im Dienste des Böhmenkönigs Karl Ludwig Viktor. Dann ging der Kanzler seinen Geschäften nach, und der Kurfürst begab sich in die untern Räume, wo gewöhnlich einige Herren von der Regierung sich einfanden, die Befehle erhielten und die Landeswünsche vortrugen. Alsdann wollte es die Pflicht, daß der Kurfürst in den Gemächern seiner Gemahlin sich einige Augenblicke aufhielt, von wo dann zur Tafel gegangen wurde. Diese, wenn keine Gäste da waren, wurde in althergebrachter Weise zusammen mit den Kindern, den zwei Edelfräulein der Kurfürstin, und den Ammen und Wärterinnen der Kinder zugebracht. Waren Gäste zugegen, so wurden nur die beiden Fräulein an die Tafel gezogen, die übrige kleine Welt tafelte für sich, doch immer in demselben Zimmer. Den Nachmittag ging der Kurfürst aus und blieb oft bis zum Abend fort, wo dann ein ebenso häuslicher Nachtimbiß die kleine Burggesellschaft versammelte. Gab es feierliche Gelegenheiten zu begehen, so war der Kurfürst durchaus kein Feind von Gelagen und späten Nachtessen. Alsdann erstrahlte die alte, pfalzgräfliche Burg zu Heidelberg im Glanze der Lichter bis spät in die Nacht, und unten die getreuen Städter erfreuten sich am Schall der musikalischen Instrumente, die bis tief zur Morgenröte hineintönten.
Ein solches Fest wurde gefeiert, als das junge Fräulein von Degenfeld an den Hof kam, um die Stelle einer Dame der Kurfürstin anzutreten. Damals war alles Freude und Glanz. Die Kurfürstin hatte die Mutter des jungen Fräuleins geliebt, sie hatte ihr auf ihrem Totenbette versprechen müssen, für das Mädchen zu sorgen, und als sie nun herangewachsen sich ihr vorstellte, glaubte die Beschützerin in ihr alle Eigenschaften zu entdecken, die wert waren, das Glück zu gründen, das durch den neuen Ankömmling heraufbeschworen war. Luise von Degenfeld war ebenso schön, wie sie sanft und liebenswürdig war. Dem kurfürstlichen Hause war in ihr ein neuer Stern aufgegangen, der seine friedebringenden Strahlen weit über alle Verhältnisse des Hauses warf. Alle Mißhelligkeiten wurden versöhnt, Widerwärtigkeiten geschlichtet, neue freudige Annäherungen geschlossen, bis plötzlich, in einer unglücklichen Stunde der Genius der Zwietracht erwachte und der böse Engel der Eifersucht sich des Herzens der Kurfürstin bemächtigte.
Die Gelegenheit war auf einem Balle. Schon war Luise drei Jahre Hausgenossin gewesen, und der Kurfürst, seiner Gemahlin treu, hatte ihr nicht die mindeste Annäherung gezeigt. Während die tanzenden Paare im Saale sich bewegten, vermißte man Luisen. Sie wurde gesucht und nicht gefunden. Die Kurfürstin flüsterte ihrem Gemahl zu, daß sie bemerkt habe, wie der Truchseß von Leuberg, der schon lange für das schöne Fräulein brannte, in eines der Nebengemächer mit ihr verschwunden sei. Diese Nachricht schmerzte den Herrn; er hatte bis jetzt den Ruf des Fräuleins für unverletzbar gehalten, und jetzt mußte er vernehmen, daß sie im Einverständnis mit einem Manne sich heimlich von der Gesellschaft entfernt habe. Er beschloß sogleich, sie selbst zu suchen, und fände er sie mit dem Truchseß zusammen, vor aller Welt die Verbindung zu verkündigen; denn er wollte durchaus nichts Heimliches in seinem Hause dulden. Er ging die große Stiege hinab, er durchsuchte die Gemächer, die abseits vom Tanzsaal lagen; er öffnete die Kabinette, die von der höheren Dienerschaft bewohnt wurden, nirgends entdeckte er etwas. Endlich näherte er sich dem Zimmer des Fräuleins. Leise schluchzende Worte drangen an sein Ohr; er glaubte die Stimme des frechen Ehrenräubers zu erkennen. Einem Tritt des Fußes wich die Tür. Was erblickte er? Auf dem Boden hingestreckt, lag eine alte Frau, in elende Lumpen gekleidet, und über sie gebeugt, mit einem Tuche in der Hand, kniete Luise. Beim Eintritt des Herrn sprang sie auf und nahte sich, schüchtern und um Verzeihung bittend, dem finster Forschenden.
»Wie? Sie hier, mein Fräulein, und in dieser Tracht einer Krankenwärterin?« rief der Kurfürst, angenehm überrascht, seine Vermutung nicht bestätigt zu finden.
»Gnädiger Herr,« erwiderte das Fräulein, »diese Frau begegnete mir auf der Treppe, als ich im Begriff stand, in den Ballsaal zu gehen. Sie war hinfällig und krank, unfähig, den Gang zu vollenden, den sie sich vorgenommen, und der sie mit einer Bitte zu Euer kurfürstlichen Gnaden führen sollte; was sollte ich tun? Sie ihrem Schicksal im Gewirr überlassen? Ich führte sie mit Hilfe eines Dieners hierher, und hier beschäftige ich mich mit ihrer Pflege.«
Der Fürst sah die alte Frau genau an und fragte: »Woher bist du?«
»Aus Hechingen, gnädiger Herr!« erwiderte sie, sich mühsam aufrichtend. »Mein Sohn hat die Ehre, in kurfürstlichen Diensten zu stehen. Man sagte mir, er sei in Ungnade gefallen und sollte aus dem Dienst entlassen werden. Da machte ich mich auf, für ihn Fürbitte einzulegen.«
Während die Alte sprach, hatte der Kurfürst seinen Blick auf die jungfräuliche Gestalt der helfenden jungen Dame gerichtet. Mochte es nun das Ungewohnte der Situation, mochte es die ungewöhnliche Färbung sein, die ihr Gesicht durch das Niederbeugen rötete, er fand sie schön und sagte ihr dies mit leisem Flüstern, indem er, sich umwendend, bemerkte, daß ein Diener ihm gefolgt war. Er gab ihr den Arm, überließ dem Diener die Alte und führte sie in den Tanzsaal, worauf er daselbst laut vor der Kurfürstin und den Gästen die schöne Tat des Fräuleins lobpreisend erzählte.
Von dieser Zeit an entspann sich ein Verhältnis zwischen dem Kurfürsten und dem Fräulein.
Das war nun bereits zwei Jahre her. Die Kurfürstin kämpfte dagegen mit allen Waffen, die Eifersucht und beleidigte Eitelkeit ihr eingaben; aber vergebens. Sie bewirkte nur, daß die Flamme, die ihr Gemahl für das schöne, tugendsame Fräulein hegte, an Lebhaftigkeit zunahm und an Dauer wuchs.
An dem Abend, von dem hier die Rede ist, sollte der eifersüchtige Kampf zu einer Entscheidung gedeihen. Es war nur ungünstig, daß ein dritter, und zumal der Prinz von Baden, dabei zugegen war.
Als man sich bei Tische versammelte, bemerkte der Kurfürst eine Wolke auf der Stirn seiner Gemahlin. Sie saß schweigend und still da, währender Prinz und der Kurfürst eine gezwungene Unterredung führten. Fräulein von Degenfeld hielt ein Unwohlsein an ihr Zimmer gefesselt. Die kurfürstlichen Kinder mit ihren Bonnen und Gouvernanten saßen an einem Tischchen in der Ecke des Gemaches.
Der Unwille des Fürsten stieg von Minute zu Minute. Er mutmaßte, seine Gemahlin habe sich bei dem Gaste über ihn beschwert, und er drang jetzt darauf, ein freundliches Gesicht von ihr zu sehen.
»Warum so übler Laune, Madame?« fragte er gespannt und die Augen nur halb öffnend, wie er es zu tun pflegte beim Heranrücken eines Sturmes.
»Sie fragen mich, mein Herr?« bemerkte die Kurfürstin in einem gleichgültigen Tone.
»Wen sonst?« entgegnete er. »Was ist Ihnen geschehen, was Ihre Laune dermaßen verschlimmert hat, daß Sie ganz zu vergessen scheinen, daß wir einen Gast haben?«
»Die Frau Cousine«, bemerkte der Prinz von Baden, »war noch vor einer Stunde die Fröhlichkeit und Liebenswürdigkeit selbst.«
»So! Also meine Gegenwart ist's alsdann, die so übel wirkt,« sagte der erzürnte Fürst. »Ist's so, Madame?«
Keine Antwort. Nur ein stilles, verdrießliches Vorsichhinsehen.
»Ich will Antwort!« rief der Fürst jetzt im vollen Zornes. »Man spreche es laut aus, was mißfällt und was man anders wünscht.«
»O, sehr vieles!« sagte jetzt die Kurfürstin in einem schnellen und leidenschaftlichen Tone. »Wenn das Aussprechen nur hülfe. Kann man einen Hof sehen, an welchem es übler zugeht als hier!«
»Wer beträgt sich hier schlecht?« rief der Fürst wahnsinnig laut.
Die Kurfürstin blieb still und verwundert sitzen.
»So sei dies die Antwort!« schrie der Fürst, indem er seiner Gemahlin einen Schlag ins Gesicht gab, so daß die Tischgäste entsetzt aufsprangen. Die Kurfürstin warf ihrem Gemahl einen Blick zu, in dem sich Zorn und Verachtung aussprachen, und verließ den Saal. »Ich will Ruhe haben!« tobte der Zornige weiter, »und kann ich sie nicht auf anderen Wegen erreichen, so auf diesem. Sie ist die Tückische, die mich immerdar zum Zorne reizt. Es muß anders werden. Ich schwöre es bei dem Andenken meines Vaters.«
Die Kinder hatten sich erhoben. Der Knabe lief der Mutter nach, das kleine Mädchen aber kam zum Vater, klammerte sich an dessen Knie und bat: »Schlage mich, Vater, wenn du jemand schlagen willst, nur nicht die Mutter.«
Der Zorn des Fürsten war verzogen. Er hob das Kind auf, küßte es und rief unter vorquellenden Tränen: »Es ist gut, Kleine; es wird alles gut werden! O, was das Dasein für eine Qual ist!«
3. Das Fensterkreuz
Es wird nötig sein, etwas vom Charakter Luisens von Hessen zu sagen.
Der Kurfürst, als er sich am Hofe des Landgrafen befand, war gerade damals auf dem Gipfelpunkt seines Mißgeschicks. Die Fürsten, die kaum sich beruhigt hatten, den Vater des jungen Prinzen von seinem usurpierten Throne gestoßen zu haben, beratschlagten darüber, welche Strafe sie über die Söhne verhängen sollten. Es hieß, daß keiner derselben das Recht auf den pfälzischen Thron erreichen solle. Da gelang es Julianen, der Witwe eines der, Vettern des Kurfürsten, am Hofe des Kaisers eine günstige Stimmung für das ausgeschlossene Haus zu erwecken. Man beschloß, einen Versuch zu machen, ob einer der unglücklichen Prinzen befähigt sei, die Erblande des Verstorbenen zu regieren. Man wählte den Ältesten, der provisorisch eingesetzt wurde mit der Aussicht, den Thron sofort wieder einzubüßen, wenn die Stände des Reiches eine Klage gegen ihn vorbrächten. So betrat Karl Ludwig das Erbe seiner Väter. Die Zeitumstände besserten sich wider Erwarten; jene Formel wurde beseitigt, und hinfort war nicht weiter die Rede von einer anderweitigen Besetzung des Thrones. Als der Prinz noch zweifelhaft war, ob ihn das Glück begünstigen werde, oder ob es ihn fallen lassen würde bis tief in das Bodenlose eines verzweifelten Mißgeschicks, befand er sich gerade in der freundschaftlichen Nähe des Vaters Luisens, der auch stets der warme Anhänger des unglücklichen Böhmenkönigs war.
Das Mißgeschick fesselte die Herzen und machte den, der davon betroffen, anziehend und wünschenswert. Dies empfand Luise. Eine geheime Liebe jedoch machte sie abgeneigt, auf neue Anerbietungen einzugehen, die ihr gemacht wurden. Der Landgraf ließ nicht undeutlich sein Verlangen merken, die Prinzessin dem Sohne seines ehemaligen Freundes zu geben. Luise schwankte. Sie erkannte das Zartgefühl in dem fürstlichen Jüngling, mit keinem offen hingestellten Verlangen hervorzutreten. Was konnte er ihr bieten? Sollte sie, die Besitzende, die Sicherberechtigte, sich dem Wellenschläge eines ungewissen Geschicks hingeben? Mit dem, den sie wählte, Flucht und Verbannung teilen? Nimmermehr. Karl Ludwig verschloß tief im Busen seine Wünsche, seine Hoffnungen. Da zerriß der Tod das Band der frühern Liebschaft: Luise war frei, und das Resultat ihrer Freiheit war ihre Entscheidung für Karl Ludwig. Die Eltern der Prinzessin priesen das Glück des jungen Paares, besonders da nun die günstige Entscheidung seiner äußeren Verhältnisse hinzukam, der Weg zum Throne ihm gebahnt war. Die in Haag lebende Mutter des Prinzen, die mit ihren Kindern dorthin geflüchtet war, und die nebst ihrem eigenen trüben Lose das Geschick ihres Bruders, jenes unglücklichen Karl I. von England, zu beweinen hatte, erfuhr diese freudige Nachricht mit hoher Befriedigung. Sie machte sich mit ihren Töchtern auf den Weg und traf in Kassel ein, um die Hochzeit ihres ältesten Sohnes mitzufeiern.
Luise zog mit ihrem Gemahl in Heidelberg ein. Die reizende Umgebung, die herrliche Lage des Ortes trugen das ihrige dazu bei, das Glück des jungen Paares zu erhöhen. Bald nacheinander genas die Pfalzgräfin zweier Kinder, eines Sohnes und einer Tochter, die im Laufe von fünf Jahren das Licht der Welt erblickten. Die Tochter war jene Elisabeth Charlotte, das lebendige, aufgeregte Kind, das wir vor uns gesehen haben. Karl Ludwigs Charakter neigte nichtsdestoweniger zur Schwermut; je mehr er seine äußere Existenz sich befestigen sah, je deutlicher das Glück sich für ihn aussprach, um so düsterer umzog sich sein innerer Himmel. Er erlebte Tage, wo ihm alles, was er errungen hatte, zweifelhaft schien, wo er von neuem den Sturm des Schicksals sich gegen ihn entfesseln sah, und wo nichts ihn zu retten versprach als eine Entfernung vom Schauplatz der Tätigkeit in eine einsame Klause der Weltentfremdung. Solche Augenblicke benutzte seine Gemahlin, um sich ihm im Gefolge der einschmeichelnden Kunst zu nahen, deren Meisterin sie war. Sie spielte die Theorbe, sie sang, sie trug die Märchen und Sagen ihres Vaterlandes in einfacher, schlichter Weise vor, und immer gelang es ihr, den kranken Mann aus seiner Erstarrung zu reißen und ihn dem Leben und dem Hoffen neu wiederzugeben.
Dieses schöne Verhältnis hatte zehn Jahre gedauert, als jenes Ereignis, von dem wir Kunde gegeben, dazwischentrat. Die Kurfürstin sah sich zurückgesetzt, einem jüngeren, lieblicheren Wesen, das sie neben sich aufgezogen hatte, hingeopfert. Der Schmerz, den diese Entdeckung ihr verursachte, war peinvoll. Sie machte Versuche, ihr früheres Ansehen wieder zu erreichen, aber umsonst. In jenem Augenblick des Trübsinns, der jetzt öfter sich einstellte, war ihre liebevolle Nähe ihrem Gemahl nicht genügend; sein Sinn strebte nach etwas, was ihm fehlte, und hätte auch nichts die Gemütsverfassung des Fürsten verraten, die plötzliche Erscheinung des jungen Fräuleins von Degenfeld hätte es tun müssen, die, wenn sie erschien, plötzlich das finstere Gewölk zerriß und einen himmlischen Strahl der Freude und der Befriedigung emporrief. Die Kunst der Kurfürstin besaß das Fräulein nicht; sie sang, aber ihre Stimme war nicht so edel gebildet und klangvoll wie die ihrer Meisterin; dennoch brachte sie größere Wirkung hervor. Der Kurfürst hörte so gern diese Stimme. Er sah so gern die Züge dieses Antlitzes, das sanfte Schönheit mit dem Stempel ihrer eigentümlichsten Reize versehen hatte.
»Ach!« rief einst der Kurfürst im halben Traume, indem er die Arme in die Luft nach einem Gegenstand ausbreitete, der flüchtig nach oben zu verschwinden schien: »Warum sendet mir der Himmel diesen Engel, dessen Leitung ich nicht folgen darf?«
Die Kurfürstin saß am Lager und hörte diese Worte. Sie drangen tief in ihr Inneres. Sie wußte es nun, sie war ihrem Gemahl nicht mehr das, was sie ihm gewesen, was sie ihm bis an den Tod zu sein hoffte. Sie antwortete nichts; leise schlich sie sich aus dem Zimmer; und in dem ihrigen angelangt, fühlte sie brennende Tränen ihr Auge netzen und ein herbes Weh ihr Inneres zerreißen. Hin war ihr Glück! Hin ihre Zufriedenheit und Ruhe!
Ein verzeihliches Gefühl des beleidigten, weiblichen Stolzes trieb sie an, diejenige zu quälen, von der ihre eigene Qual ihren Anfang nahm. Sie behandelte das Fräulein mit rücksichtsloser Strenge, sie neckte sie mit kaltem Hohn, sie ließ sie auf alle Weise ihre Überlegenheit fühlen. Luise von Degenfeld, weit entfernt, hierüber beim Kurfürsten Klage zu führen, verdoppelte ihren Eifer, der Gebieterin zu dienen, ohne doch jemals hoffen zu können, es ihr zu Willen zu machen. Dieser schlecht versteckte Zwist konnte nicht verfehlen, auf beiden Seiten Parteigänger zu schaffen. Auf die Seite der Kurfürstin trat ihre Mutter, eine eitle, ränkevolle Frau, die ihre Zeit damit hinbrachte, am Hofe ihrer Tochter Mißvergnügen und Streitigkeiten zu veranlassen, indem sie behauptete, Friede und Eintracht unter die Vermählten zu bringen. Auf des armen Hoffräuleins Seite trat die Fürstin von Wied, die das Degenfeldsche Haus kannte, und deren Alter geeignet war, die Versuche zur Sühne, die sie anstellte, zu entschuldigen, indem Frau von Degenfeld, Luisens Mutter, die Jugendfreundin der Fürstin gewesen war. Sie erschien am Hofe zu Heidelberg mit der ausgesprochenen Absicht, Luise von dort zu entfernen, um sie mit sich zu nehmen, wo sie mit einer ihrer Töchter zusammen die Stütze und Freude ihres Alters ausmachen sollte. Diesem Plane widersetzte sich jetzt der Kurfürst, der Luise nicht aus seiner Nähe verlieren wollte.
So standen die Angelegenheiten, als der Zeitpunkt erschien, von dem soeben die Rede gewesen.
Die Fürstin Sophie von Hessen befand sich, als der unselige Streit durch die Gewalttätigkeit des Kurfürsten zu einer nicht wieder zu beseitigenden Aufregung angewachsen war, gerade in Wien, wo sie die Geschäfte des Landgrafen von Hessen bei den Ministern leitete. Die Fürstin von Wied lag krank in Heidelberg, und zu ihr brachte Karl Ludwig seine Geliebte, als er sie im eigenen Hause nicht mehr sicher wähnte.
Die Kurfürstin hatte sich nämlich durch ihren jähzornigen Charakter zu einer auffallenden Tat verleiten lassen. Nachdem sie ein paar Tage in finsterm Groll sich in ihre Gemächer eingeschlossen, wartete sie nur die Entfernung ihres Gemahls ab, um mit ihrem Plane hervorzutreten. Mit einer Pistole bewaffnet, nachdem sie ihre Umgebung unter irgendeinem Vorwande entfernt hatte, legte sie sich in der Fensterecke ihres Gemachs auf die Lauer, um das gegenüberliegende Fenster, wo sie wußte, daß Luise von Degenfeld ihren Platz zu nehmen gewohnt war, im Auge zu behalten. Lange lauerte sie, wie die blutdürstige Tigerkatze, ehe es ihr gelang, ihr Opfer sicher zu fassen. Kaum hatte das bleiche Antlitz ihrer Feindin von der gegenüberliegenden Treppenstufe sich ihr gezeigt, als sie die Pistole abschoß und in demselben Augenblick einen durchdringenden Schrei vernahm, der durch die weiten Hallen des Palastes bis zu ihr drang.
Einen Moment später, und sie warf schaudernd die Todeswaffe von sich.
Mit verhülltem Gesicht stand sie in der Mitte ihres Zimmers, und die Schande der Tat, die sie soeben vollbracht, legte sich wie dunkles Gewölk um ihre Seele.
»Mörderin!« hauchte sie vor sich hin. »Was hast du getan? Wohin riß dich die verzweifelte Wut! O, wäre ich doch nie geboren worden!«
Sie tat einen Schritt vorwärts, sie blieb stehen – sie lauschte.
Ein dumpfer Lärm tönte von unten herauf. Sie vernahm Männerstimmen, unter diesen die des Kurfürsten.
Es war unmöglich, sich zu verbergen; auch dachte die Fürstin nicht daran. Sie blieb stehen, mehr einer Bildsäule gleich als einem lebenden Wesen, als sie ihren Gemahl bei sich eintreten sah.
Er blickte sie an, er sah das abgebrannte Pistol zu ihren Füßen; er sagte nichts, aber seine Blicke sprachen.
»Dies für den Schlag!« sagte sie mit lautloser Stimme.
»Elende!« rief der Kurfürst. »Wir können nicht mehr unter einem Dache wohnen. Morgen verläßt du dieses Haus. Danke es dem gütigen Geschick, das deinen Mordpfeil am Fensterkreuze zersplitterte, sonst solltest du ihren Tod mit deinem Leben bezahlen!«
»Tue, wie du willst und wie du kannst!« sagte leise die beleidigte Frau. »Meine Tat und mein Leben stehen beide vor Gott. Nur unendlicher Jammer hat mich handeln lassen, wie ich gehandelt habe.«
Sie glitt in das Nebengemach, das sie hinter sich abschloß.
Das ganze Schloß war von Leuten angefüllt. Man mußte Wachen ausstellen, um ferneren Andrang zu hindern. Die arme Luise lag noch immer in Ohnmacht. Die auf sie gerichtete Kugel hatte das starke, steinerne Kreuz, das das Fenster einschloß, so hart getroffen, daß es abbröckelte und eine tiefe Spur hinterließ.
Als Luise von Degenfeld wieder zu sich kam, befand sie sich in der Stadt, in der Wohnung der Fürstin von Wied. Der Kurfürst sah seine Gemahlin nicht wieder. Die Mutter kam aus Wien und nahm sie mit sich nach Kassel. Als sie fort war, nahm Fräulein von Degenfeld mit dem Kurfürsten das Schloß in Besitz. Er erhob sie zur Raugräfin und lebte mit ihr, wie man sagt, heimlich vermählt.
4. Das siebzehnjährige Mädchen
Wir übergehen in unserer Erzählung den Zeitraum von dreizehn Jahren, in denen nichts für uns Wichtiges vorfiel und haben jetzt unsere junge Prinzessin vor uns, am Hofe Ernst Augusts, des Herzogs und spätern Kurfürsten von Hannover.
Die Zeugnisse der Geschichte geben der Tante Elisabeth Charlottes, der Kurfürstin Sophie, einen bedeutenden Rang. Sie war ebenso vorzüglich, was den Geist betrifft, wie vorsorgend und zärtlich, was ihre Pflichten als Gattin und Mutter angeht. Ernst August war einer der Fürsten, die höher zu stehen verdienten, als das Schicksal sie gestellt. Anfangs Bischof von Osnabrück, gelangte er später zur Herzogswürde in Hannover, und alsdann war die Klugheit seiner Gemahlin, noch mehr als seine eigene, Ursache seines Emporsteigens zum Besitze des Kurhutes, der ihm vom Hofe zu Wien verliehen wurde, nicht ohne Widerstreit der anderen Kurfürsten, in deren Reihe er bald trat. Er war klug, vorsichtig, zurückhaltend und hörte auf guten Rat. Sein älterer Bruder, der in Celle regierte, hatte diese Eigenschaften nicht, oder nur in geringem Grade, und deshalb war er zurückgeblieben, während Ernst August vorwärtsschritt.
Drei Söhne hatte er, von denen Georg, der älteste, später König von England, der Gegenstand der besonderen Liebe der Mutter, einen finsteren und kalten Charakter zeigte. Ein Plan des Vaters, durch welchen er danach trachtete, die beiden Häuser Celle und Hannover zu vereinigen, war es, der die Heirat des Kurprinzen mit seiner Cousine, der Tochter des Herzogs von Celle, zuwege brachte. Diese Prinzessin, damals noch sehr jung, war, was ihre Geburt betrifft, nicht ebenbürtig, sie war es nur geworden, indem ihre Mutter, eine Französin von geringer Herkunft, in den Fürstenstand erhoben worden war. Sophie Dorothee zeigte sich durch die Einredungen ihrer Eltern zu dieser Ehe willig und erschien mit diesen, als Georgs zukünftige Gemahlin, am Hofe zu Hannover gerade zu der Zeit, wo unsere pfälzische Prinzessin ihr siebzehntes Jahr erreicht hatte. Man kann sich denken, welch ein Gegenstand der Neugierde und des weiblichen Interesses sie dem jungen Mädchen wurde, das damit ein neues Mitglied ihrem weitläufigen Verwandtenzirkel beigezählt erhielt.
Der Hof zu Hannover war ein lebhafter, anziehender und vielfach beschäftigter. Die geistvolle Kurfürstin, der edle Fürst, der seiner jungen Angehörigen mit Vertrauen und väterlicher Würde entgegentrat, der Kurprinz, der sie auf jede Weise auszeichnete und sie seiner zukünftigen Gemahlin als Umgang empfahl, die übrigen Mitglieder des Hauses sowie dessen entferntere und nähere Umgebung, alles beeiferte sich, das kluge, gescheite und regsame Mädchen mit Ehren und Freuden unter sich aufzunehmen. Dies zeigte sich besonders, als sie das obenbezeichnete Jahr erreichte, wo man darauf sann, sie eine passende Ehe schließen zu lassen. Das kleine »Rauschen-Platten-Knechtchen«, wie man sie, besonders ihrer Wildheit wegen, in früheren Jahren genannt, war jetzt zu einer folgsamen, liebenswürdigen Jungfrau herangereift, die, nicht hübsch, doch durch einen Zug frischer Jugend und frohen Lebensmutes unwillkürlich für sich einnahm. Alle Gegenstände dienten ihrem muntern Geist zum Scherze, und ihr gerader Sinn, der, abhold jeder Intrige, stets die Wahrheit liebte und sagte, machte sie zu einer Feindin jedes im Dunkel schleichenden Heuchel- und Schmeichelgeistes. Ihr Körper hatte sich zu der ihm bestimmten Vollendung entwickelt; er war kräftig, fest und sicher gebaut. Ihre Taille war nicht schlank, nicht biegsam, aber sie zeugte von Ausdauer und Widerstandskraft gegen die Übel, die die Mode damals über die junge Damenwelt brachte und die darin bestanden, daß sie durch heftiges Einschnüren die inneren Organe leidend machten. Charlotte besaß eine so feste, starke Natur, daß ihr kein Schnürleib etwas anhaben konnte. Ihr schönes, volles, halbblondes Haar lag in Locken über der Stirn gescheitelt den Nacken herab und war nur durch künstliche Mittel zu der Höhe emporzutreiben, die ebenfalls die damalige Mode den jungen Damen vorschrieb. Ihre Arme waren voll und weiß, sehr selten mit Ringen und Geschmeide besetzt. In ihrem Antlitz vermißte man, wenn sie ernsthaft war, die Regelmäßigkeit der Züge, wenn sie aber scherzte und lachte, so machte der mutwillige Ausdruck der Augen aus dem nichts weniger als schönen Gesicht eine anziehende Erscheinung. Ein Mund mit schönen Zähnen, ein kleiner Fuß und eine niedliche Hand waren gewiß keine geringzuschätzenden Reize, doch war sie ein so sonderbares Mädchen, daß sie auf jeden, der sie zum ersten Male sah, fast den Eindruck machte, als stände ein verkleideter Knabe vor ihm. Dies war auch Charlottes geheimer Wunsch: sie wollte diesen Eindruck hervorrufen. Sie hatte sich von frühester Jugend gewöhnt an ein mehr knabenhaftes als mädchenhaftes Wesen. Sie ritt vortrefflich, sie ging mit dem Onkel auf die Jagd, sie machte lange und ermüdende Spaziergänge, und mit nichts konnte die Erzieherin, eine Frau von Hörling, die an Madame Jolis Stelle getreten war, sie mehr aufheitern und belohnen, als indem sie ihr sagte, sie habe dies oder jenes wie ein Knabe getan oder gesprochen. Die Kurfürstin zähmte diese Lust ein wenig, indem sie das aufwachsende Mädchen öfters bei sich in ihrem Zimmer hielt, sie hier weibliche Arbeiten machen und auf weibliche Weise sich beschäftigen ließ. Dabei aber war die männliche Richtung, die der Geist zusamt dem Körper nahm, der ernsten, geistvollen Frau doch so willkommen, daß nichts sie bewegen konnte, dem Mädchen auch hierin Zwang und Fesseln anzulegen. Oft ließ sie sich von ihr Bücher vorlesen, die ein philosophisches Wissen enthielten, und da freute sie sich, wenn sie die liebe Pflegetochter nach Dingen forschen hörte, die über die Grenzen der gewöhnlichen weiblichen Kenntnisse weit hinausgingen. Sie durfte dabei sein, wenn Leibniz erschien, und die Betrachtungen über Gegenstände der Natur, die der berühmte Forscher anstellte, fanden an dem jungen Pagen, wie sie selbst sich nannte, einen aufmerksamen Zuhörer und einen unermüdlich tätigen Hilfeleistenden, wenn es etwas anzuordnen oder zu schaffen gab.
Von Liebe, von Zärtlichkeit, von all den Empfindungen, die eine weibliche Brust berühren, wenn sie zu gewissen Jahren gelangt ist, wußte und empfand sie nichts. Eine empfindsame oder galante Regung begeisterte sie meist zu einer possenhaften oder komischen Parodie, die sie stets mit großem Mutwillen ausführte. Die Kurfürstin erlaubte ihr dergleichen selten und nie in Gegenwart vieler Personen, indem sie ihr vorhielt, daß nichts die Menschen mehr erbittere, als sich in ihren Gefühlen, mochten diese nun echt oder erlogen sein, lächerlich gemacht zu sehen. Charlotte hatte hierauf immer nur eine Antwort: »Mein Gott!« sagte sie, »ich will sie ja gar nicht lächerlich machen, nur das, was sie tun und sagen, erscheint mir so, wie ich's darstelle. Kann ich dafür, wenn es lächerlich wirkt?« – Doch nur eine einzige Rüge der von ihr verehrten und geliebten Tante genügte, sie zurückzuhalten und ihr Gelüst zu dämpfen.
Das Schicksal ihres Hauses war der Gegenstand der Gespräche der Kurfürstin, wenn sie mit dem Kinde allein war. Alsdann wurden die Geschichten herangezogen, die irgendein beklagenswertes und trauriges Gefühl in dem Busen der würdigen Mutter erregten: das Unglück ihres Vaters, sein Fall und der Hohn und der Spott derer, die ihn selbst verleitet hatten, jene unglückliche Würde anzunehmen. Es war ein ganzer Himmel voll Trauer und Düsterheit, der sich auf die Seele Sophies legte, wenn sie den Namen des Königs Friedrich nannte; noch mehr klagte sie, wenn das Andenken der edlen englischen Fürstentochter, die sie als Mutter liebte und verehrte, in ihre Erzählungen sich einmischte. Der Tod des ersten Karl zeigte sich ihrem Geiste als furchtbares Zeichen des schnellen Hinschwindens alles dessen, was menschliche Größe und menschliche Höhe bezeichnet. Sie weinte bittere Tränen, als sie die Flucht schilderte, die sie damals mit ihrer armen Mutter, heimatlos und geächtet, bis nach Holland gemacht; sie schilderte das Leben der Fürstin, wie sie mit jeder Not kämpfend, kaum so viel besaß, um ihren dürftigen Haushalt zu unterhalten, ihre liebsten Schätze, ihre Kinder, vor Mangel und Erniedrigung zu schützen. In jener Schule hatte die edle Seele der Fürstin sich frühzeitig bilden gelernt und jene Festigkeit, jenen ernsten, männlichen, energischen Geist erreicht, der jetzt ihre vorzügliche Zierde war.
»Aber, teure Tante,« hub das junge Mädchen an, indem sie sich die Tränen aus den Augen trocknete, »was tat der Großvater, was die Großmutter, um so viel Unglück zu verschulden? Welch ein tyrannisches Mißgeschick liegt darin, diejenigen leiden zu lassen, die an dem Mißlingen der Pläne der Ehrgeizigen die geringste Schuld haben? O, welche Welt ist dies, meine Tante! Welch ein Gewühl von Ungerechtigkeit und blinder Willkür.«
»Versündige dich nicht, mein Kind,« entgegnete Sophie. »Wir verehren die Allmacht und Allwissenheit Gottes auch dort, wo wir ihren Weg nicht mit unseren sterblichen Augen messen und beurteilen können. Du sprichst von Ungerechtigkeit. Wie aber, wenn in dieser scheinbaren Ungerechtigkeit der Himmel einen der schönsten Keime von Belehrung verborgen hätte? Wenn der jetzige Inhaber des englischen Thrones stirbt, wenn die nächsten Thronerben ebenfalls dahingerafft werden, alsdann treten ich und mein Sohn in unser Recht, und die drei Kronen Englands sind eine Vergütigung für jenes Elend, das unsere Vorfahren erlitten.«
»Möchte es dem Himmel gefallen, diesen Weg einzuschlagen!« rief Charlotte mit Wärme, »er wäre der einzige und richtige, um die Seele, die über das Unerforschliche brütet, mit den Geschicken der Welt zu versöhnen.«
»Er wird es zum Besten lenken,« rief Sophie, »darum laß uns getrost sein. Wir können nichts weiter tun als nach unserer Einsicht und nach bestem Rat die Dinge ordnen, wie sie aber alsdann vom Geschick zusammengestellt werden, das ist nicht unsere Sache. Es komme, was da will, haben wir das unsrige getan, können wir in Ruhe und Ergebung uns fügen.«
Solche Gespräche führte die verständige Tante oft mit ihrer jungen Nichte, in deren feuriger und tätiger Seele sie frühzeitig Züge entdeckte, die mit ihrem eigenen Charakter harmonierten. Sie sprach auch von ihren Brüdern, den Oheimen der jungen Prinzessin, und da war einer darunter, den frühzeitig der Tod hinweggerafft hatte, der in Sophiens Herzen jedoch den obersten Platz eingenommen.
»Als das Unglück uns erreichte,« hub sie an, »war Karl nicht viel über fünf Jahre alt, und seine Erziehung fiel besonders mir anheim, da ich zehn Jahre älter war und die Mutter das Vertrauen in mich setzte, daß ich ganz nach ihrem Sinn den Knaben leiten würde. Er war schüchtern und verlegen; seine Charaktereigenschaften hatten, da sie sich in der Zeit unseres Unglücks entwickelten, etwas Furchtsames, Ängstliches angenommen, und weit entfernt, den tätigen, feurigen Geist der übrigen Söhne zu hegen, wünschte und hoffte er nichts, als daß es gelingen möchte, völlig unsere Ansprüche aufzugeben und im Privatleben zu verschwinden. Wenigstens wollte er so handeln. Ich suchte seine Seele zu beleben, zeigte ihm die großen Tugenden unserer Vorfahren und suchte seine Tatkraft anzufrischen, ihnen nachzustreben. Umsonst! Er knüpfte deshalb, ohne Wissen seiner Mutter, als er in die mannbaren Jahre getreten war, ein Verhältnis mit einem Mädchen an, das edel und tugendhaft, aber nichts weniger als ihm ebenbürtig war. Wie oft habe ich ihn damals gewarnt, ihn mit Tränen gebeten, seiner Abkunft zu gedenken, des Glückes, das uns noch teilhaftig werden könnte, es half nichts. Er trat mit seiner Erwählten heimlich vor den Altar, und eine kleine Kirche in Gent war der Ort, wo ein katholischer Priester die Ehe einsegnete, die weiter niemand als nur mir bekannt wurde. Ich sorgte für die Neuvermählten, und als das Geschick den Bruder mir nahm, erstreckte ich meine Sorge auch auf die junge Witwe, die mit einem Knaben niedergekommen war. Es huben damals die unseligen Unruhen in den vereinigten Provinzen zu wüten an, die die Länder verwüsteten und die Hälfte der Einwohner zwangen auszuwandern, um in den Nachbarstaaten vor des Krieges Flamme Schutz zu suchen. Die arme Mechthild Sparre, dies war der Name der Witwe meines Bruders, kam zu mir und kündigte mir an, daß sie in Geleitschaft eines Verwandten mütterlicherseits, nach Frankreich auszuwandern beabsichtige. Sie nahm dorthin ihren Knaben mit. Ich konnte nichts tun; es wäre töricht gewesen, mich ihrem Glück zu widersetzen, ich gab ihr also meine besten Wünsche, das Wenige, was ich an Kostbarkeiten besaß, mit, und so sind sie und ihr Kind meinen Blicken entschwunden. Als ich später mein glückliches Ehebündnis schloß, unterließ ich nicht, mich nach Mechthild zu erkundigen, doch stets ohne den geringsten Erfolg. Sie war und blieb verschwunden. Meinem Bruder in der Pfalz, deinem Vater, habe ich die Geschichte mitgeteilt, und sollte es ihm gelingen, des Knaben Aufenthalt zu erkundschaften, so wird er an ihm handeln, wie es einem Oheim gegen seines Bruders Kind geziemt.«
5. Liselotte sieht sich in der Welt um
Die Grundsätze, die sich in der aufkeimenden Jungfrau entwickelten, ihr fester, unbeugsamer Sinn, ihre Offenheit und Wahrheitsliebe wurden bald ihrer Umgebung bekannt, die sie schätzte und liebte oder, wie es der Charakter der Beobachtenden mit sich brachte, tadelte und floh. Immer hatte sie aber ihre Tante, die Kurfürstin, zur Freundin.
Die junge Prinzessin aus Celle, wie sie sich denn bei allen einzuschmeicheln suchte, gab auch unserer Charlotte die freundlichsten Zeichen ihres Wohlwollens. Charlotte betrachtete sie mit mißtrauischen Blicken: sie traute ihr nicht. Des Kurprinzen stille und feste Gradheit, sein an harten Stolz grenzender Charakter machten auf Charlotte einen günstigen Eindruck. Den Stolz hielt sie für männlich, die Schweigsamkeit für Charakter, und so war Vetter Georg ihr lieb und teuer. Sie begleitete ihn auf der Jagd, sie machte kleine Reisen in seiner Gesellschaft, und der finster blickende Jüngling hatte für sie immer ein gefälliges Wort, eine freundliche Haltung. Einstmals fragte sie ihn: »Liebst du deine Cousine, Georg?«
Der Prinz, so rasch und so bestimmt gefragt, erwiderte einlenkend: »Würdest du denn Sophie Dorothea nicht lieben, wenn sie deine Frau wäre?«
»Das ist unmöglich,« rief Charlotte kurz. »Wenn ich ein Mann wäre, könnte ich nie der Tochter einer Putzmacherin meine Hand reichen.«
»Aber, Charlotte – ist denn Sophie Dorothea die Tochter einer Putzmacherin?«
»Versteht sich. Ob die französische Mamsell später Herzogin wurde, tut nichts zur Sache, sie bleibt, was sie war. Aber artig und gefällig ist sie, das gebe ich zu.«
»Ich hoffe,« sagte der Prinz nach einer Pause, »daß, wenn ich sie einst heirate, du sie als die Mutter meiner Kinder achten und schätzen lernen wirst.«
»Das ist wohl möglich!« erwiderte das junge Mädchen mit Stolz; »indessen das beweist nichts.« Hiermit war das Gespräch abgebrochen.
Es kostete wenig Mühe für das lebhafte und aufmerksame Auge der Prinzessin, zu erforschen, daß der Kurfürst, ihr Onkel, eine Geliebte hatte, die von der Kurfürstin geduldet wurde. Gegen diese war sie artig, freundlich, zuvorkommend, so daß das stolze Gemüt der Gräfin Platen dadurch für sie eingenommen wurde. Eine Geliebte durfte ein König, ein Prinz haben; dies war keine Gemahlin, dadurch wurden die Rechte der Kinder nicht beeinträchtigt, kein falsches und unechtes Blut in die Reihenfolge der Nachkommen gebracht.
Mit ihren jüngeren Vettern stand sie auf gutem, kameradschaftlichem Fuße. Sie ritt umher mit dem einen, sie exerzierte die Soldaten in Männerkleidung mit dem anderen, ja sie führte manchen Spaß aus in einem Kostüm, das nicht das ihrige war. Ein junges Mädchen in einer Mühle, wohin sie öfters mit dem Prinzen Max ritt, fand den jungen Leutnant im Gefolge des Prinzen ganz nach ihrem Geschmack. Sie machte ihm in bester Form eine Liebeserklärung, und der junge Leutnant erwiderte diese mit den üblichen Geschenken und kleinen Gunstbezeigungen. Der kleine Handel ging ein paar Sommermonate hindurch seinen Gang, bis des Mädchens Neigung so heftig wurde, daß Charlotte, in die Enge gebracht, sich ihr entdeckte. Die beiden Mädchen wurden nun Freundinnen. Charlotte brachte ihre ehemalige Liebschaft an den Hof, und sie wußte sich so wohl zu betragen, daß der Kurfürst und die Kurfürstin sie beschenkten und ihr Gunst bewiesen. Sie hieß immer des Leutnants Geliebte.
Auch nach Celle ging sie hinüber, um den dortigen Onkel, den sie so nannte, weil es ihre Tante verlangte, zu begrüßen; aber ein Zusammentreffen mit der Gemahlin desselben hatte eine kalte, förmliche Begrüßung zur Folge, kein »freundliches Kompliment«, wie die hannoveranischen Herrschaften gewünscht hatten. Nach Hause gekommen, erging sich Charlotte in den tollsten Späßen über die französische Mamsell, wie sie die Herzogin nannte. Dies mußte heimlich geschehen, um die Tochter nicht zu beleidigen. »Du bist und bleibst doch das ungezogene Rauschenplattenknechtchen!« rief Sophie; »es ist nicht anders, und niemand wird es anders machen.«
»Ja, ja, ma tante!« rief Charlotte, indem sie die Hände der verehrten Frau küßte; »ich bin nur glücklich, wenn du das arme Rauschenplattenknechtchen nicht von dir jagst! Was die übrige Welt tut, kümmert mich nicht.«
Mit der Frau von Hörling setzte sie sich bald auf den besten Fuß. Sie war ihr liebes Mütterchen, und sie nannte sie stets nach dem früheren Namen derselben, Frau Uffeln. Frau Uffeln konnte ihr ungescheut manchen Eigensinn, manche ungerechte Ansicht und Meinung aus dem Sinn reden.
Auch nach Berlin reiste Charlotte, begleitet von einem ihrer Vettern, um Sophiens Tochter, die Kurfürstin, die Gemahlin Friedrichs, des nachmaligen ersten Königs von Preußen, zu begrüßen. Der Hof von Berlin war voll Glanz und Etikette. Friedrich liebte beides und wußte sich in seiner Stellung als Kurfürst ganz gut zu benehmen. Diese Reise machte Leibniz mit, der der Kurfürstin gelehrte Mitteilungen und Aufträge von der Mutter brachte, beide eigens bestimmt für die Tochter, die gleiches Interesse und gleiche Studien mit der Mutter hatte. Einen Abend in Charlottenburg brachte die junge Prinzessin mit ihrer Cousine und inmitten der gelehrten Freunde zu, den sie später ihrer Tante auf höchst ergötzliche Weise schilderte. Sie ahmte die Berliner Akademiker nach, die nicht wüßten, ob sie sich setzen dürften, und wenn sie säßen, ob und wie lange sie ihren Platz behaupten sollten. Dann das Zuwinken und Zuflüstern der gelehrten Herren untereinander und zuletzt ihr lautes Reden und Absprechen, als sie einige Gläser Glühwein getrunken hatten. Oft erschien es ihr, als habe die Kurfürstin ihre ganze gelehrte Umgebung zum besten, so laut scherzte sie mit ihnen, erwiderte ihre Einfälle lachend, die oft nur die Unverschämtheit, nicht den Witz und die Feinheit für sich hatten. Als die Gesellschaft in den Garten hinaustrat, um sich spazierengehend zu erfreuen, gab der Zufall Charlotte einen alten Pedanten zum Begleiter, der sich bemühte, ihr philosophisch zu erklären, auf welche Weise man ein Garnknäuel zustande brächte, wobei er sehr sinnreich die verschieden laufenden Fäden des Knäuels mit den disharmonierenden philosophischen Schulen und Lehren verglich, und wie dann doch am Ende aus einem so verworrenen Gewebe ein geordnetes, festes Ganzes herauskäme. Dies belustigte die Zuhörerin dermaßen, daß sie versprach, bei dem nächsten Knäuel, den sie machen würde, des Herrn Akademikers zu gedenken und sich dabei in der Erinnerung seiner Belehrung zu erfreuen. Der gelehrte Mann dankte ihr freundlich und bat sich zur Anerkennung seiner Bemühung dieses Knäuel als Geschenk aus. Charlotte lachte herzlich, fertigte während ihrer Anwesenheit in Berlin das Knäuel und verehrte es ihrem neugewonnenen Freunde.
Mit dem Prinzen von Schwedt und ihrem Vetter machte sie in Berlin auch eine Jagd mit, bei der sie das Mißgeschick hatte, da sie ein wildes Pferd ritt, von diesem herabgeworfen zu werden und sich den Arm zu verstauchen. Der Kurfürst und die Kurfürstin waren ihretwegen in nicht geringer Besorgnis; allein Charlotte kümmerte sich wenig um den Unfall; am nämlichen Abend zeigte sie sich dem versammelten Hofe bei einem Ball mit dem Arm in der Binde. Ja sie wagte es sogar, zum Schrecken der Oberhofmeisterin, die diesen Verstoß gegen die Etikette auffällig fand, mit dem Arm in der Binde zu tanzen. Zur Bewunderung der jungen Herren des Hofes führte sie den Tanz zum Entzücken gut aus und kehrte freudeglühend und stolz in die Arme ihrer Cousine zurück, die sie schalt und tadelte, aber in der freundlichsten Manier. Die junge, pfälzische Amazone wurde das Tagesgespräch, und lange nachdem das kecke, fast wilde und eigentümliche Fürstentöchterchen fort war, hieß es noch immer in dem Kreise der Höflinge: Das tat sie, das sagte sie, so benahm sie sich! Und wie kleidete sie das alles so vortrefflich!
Sophie Charlotte schrieb ihrer Mutter, der Kurfürstin von Hannover:
»Wir senden Ihnen, gnädigste Frau und geliebte Mutter, Ihren wilden Vogel wieder zurück, der hier den ganzen Hof toll gemacht hat, so daß wir in dem Zeitraume, den sie hier zubrachte, in der Tat nicht wußten, wo uns der Kopf stand. Alle Tage neue Possen, neue Seltsamkeiten. Möchte es Euer Liebden gelingen, aus diesem völlig wilden, knabenhaften Mädchen eine anstandsvolle Prinzessin zu bilden, die das tut, was die übrigen ihres Standes tun, und zwar mit den besten Manieren und den gehorsamsten Ansichten.«