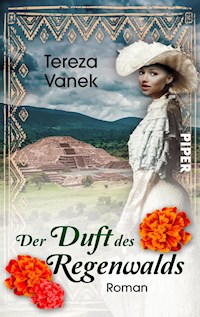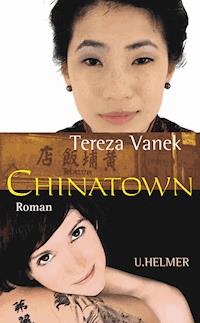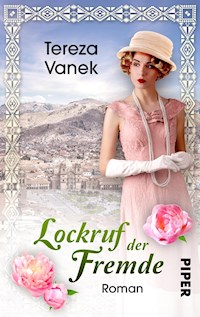
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Maya-Saga
- Sprache: Deutsch
Zwischen dem schillernden Berlin und dem mystischen Peru in den 1920er Jahren: Ein packender historischer Roman um eine junge Frau auf der Suche nach der Liebe. Für alle LeserInnen von Lydia Conradi und Laila El Omari Alice Wegener ist längst nicht mehr so unerfahren wie vor ein paar Jahren. Als bekannte Künstlerin kehrt sie nun mit ihrem Sohn Paul nach Berlin zurück. Die schillernde Großstadt ist genau der richtige Ort, um ihre Bilder auszustellen. Auch Paul findet schnell Anschluss – und seine große Liebe: Friderike von Greifen. Doch das junge Glück wird überschattet, denn Friderikes Bruder hat sich den Nazis angeschlossen und versucht die Beziehung zu zerstören. Paul und Friderike geben nicht auf. Selbst dann nicht, als Paul Deutschland verlässt, um an einer archäologischen Expedition in Peru teilzunehmen. Friderike zieht los, um ihren Geliebten dort zu finden. Sie gerät in eine faszinierende, archaische aber auch gefährliche Welt, in der sie bald um ihr Leben kämpfen muss ... Bei diesem Roman handelt es sich um die Fortsetzung von "Der Duft des Regenwaldes". Die Bände sind unabhängig voneinander lesbar und nur lose miteinander verbunden. »Ich konnte mir die Farbenvielfalt Perus, die Gerüche und die Hitze vorstellen, als wäre ich selbst dort. Ein Buch welches man kaum aus der Hand legen konnte.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Tereza Vanek hat ihren Roman wieder brillant und spannend geschrieben. Sie lässt die politischen Wirren aller drei Länder gut einfließen. Sie schafft es den Leser mit auf Reisen zu nehmen. Wunderbar unterhaltend.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Man wird unweigerlich auf eine kunterbunte Reise mitgenommen. Ich habe das Buch verschlungen. Einfach wunderbar geschrieben.« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Lockruf der Fremde« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© 2020 Piper Verlag GmbH, München
Die Karte stammt aus Waisbard, Simone »Machu Picchu – Die heilige Stadt der Inka« aus dem Pawlak Verlag, Herrsching (1992)
Covergestaltung: Favoritbüro München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Inhalt
Cover & Impressum
Karte
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Anmerkungen zum historischen Hintergrund
Kapitel 1
Berlin, Februar 1931
Leonora versuchte, so tief wie möglich in den Wollstoff ihres Mantels zu kriechen. Leider hatte der Wind in Deutschland Messer, die durch jede Ritze stachen und so ungehindert in ihren Körper eindringen konnten. Sie hätte niemals gedacht, dass Kälte schmerzen konnte, doch nun, eine Woche nach ihrer Ankunft in der Heimat ihrer Mutter, hatte sie es endgültig begriffen.
Sie sah sich nach ihrer Mutter um, die auch bei diesen frostigen Temperaturen einen sehr eleganten Eindruck machte. Der dunkelblaue Mantel passte zu dem in Locken gelegten Blondhaar, auf dem ein farblich abgestimmtes Barett saß. Bei milderen Temperaturen hätte Leonora darunter gelitten, dass ihr eigenes Kleid weitaus zerknitterter war und ständig verrutschte. Der deutsche Winter hatte auch Vorteile, überlegte sie. Man konnte sich in einen weiten Mantel hüllen wie eine Nonne in ihren formlosen Habit, der alle Eitelkeit überflüssig machte.
Leonoras Mutter wippte ungeduldig mit dem Fuß, während sie ihren Blick über den Bahnsteig schweifen ließ. »Wo bleibt er denn nur? Hierzulande ist man pünktlich«, murmelte sie verärgert.
»Vielleicht hat dein Galerist begriffen, dass du die chaotischen Verhältnisse in Mexiko lieber magst, und will dir einen Gefallen tun«, murmelte Leonora.
Die Mutter drehte sich zu ihr um und warf ihr einen Blick zu, der einen Hauch von Unmut ausdrückte. Leonora senkte beschämt den Kopf. Sie hatte scherzen wollen, aber im Umgang mit ihrer Mutter bekam jedes ihrer Worte ein zusätzliches Gewicht, das es schwer und sperrig machte.
»Ich meinte nur, dass …«, begann sie, aber bevor sie ihre Erklärung hatte vollenden können, erschien Paul auch schon, gefolgt von einem Trolley, den ein uniformierter Mann schob.
»Es ging ganz schnell!«, rief er. »Das ist das Schöne an Deutschland. In Mexiko hätten wir wahrscheinlich zwei Stunden gewartet und dann mindestens einen falschen Koffer bekommen.«
Er lachte. Die Mutter stimmte ein.
»Dann hätten wir Wetten abschließen können, was vielleicht in dem falschen Koffer steckt«, meinte sie. »Das Leben in Mexiko kann sehr spannend sein.«
Sie umarmte ihren Sohn. Leonora wurde noch ein wenig kälter, da ein heftiger Wind über den Bahnsteig fegte. Ihre Zähne schlugen klappernd aufeinander, und sie stieß einen kläglichen Laut aus.
Die Mutter merkte es nicht, doch Paul drehte sich zu ihr um und legte seinen Arm um Leonoras Schultern. »Kopf hoch! Als ich zum Studium hierher kam, hatte ich Angst, den ersten Winter nicht zu überleben. Aber zwei Jahre später mochte ich den Schnee sogar.«
Leonora fror schlagartig weniger, als könnte die Gegenwart ihres Bruders sogar dem Wind seine Schärfe nehmen.
»Da! Da kommt er!«, rief ihre Mutter nun und begann zu winken.
Ein hochgewachsener Mann schritt durch die tanzenden Schneeflocken auf sie zu. Auch er wirkte tadellos elegant auf die klassisch-schlichte Weise der Deutschen, bewegte sich zielgerichtet und diszipliniert. Leonora spürte, wie sie instinktiv ihre Schultern straffte, um keinen schlechten Eindruck auf den Galeristen ihrer Mutter zu machen. Immerhin war es auch ihm zu verdanken, dass es ihnen trotz der politischen Unruhen in ihrer Heimat niemals wirklich schlecht gegangen war.
Als Tobias Winter vor ihnen stand, staunte Leonora vor allem über seine Größe. Er überragte sie um mindestens zwei Köpfe, wirkte mit den grau melierten Schläfen und dem schmalen Gesicht distinguiert und dadurch auch anziehend.
Sie sah das strahlende Lächeln ihrer Mutter, und ihr Magen verkrampfte sich in einer bösen Vorahnung.
Alice Wegener del Rio verstand, mit Männern umzugehen, rief sie sich in Erinnerung. Ein weiterer Grund, warum es ihnen niemals so schlecht gegangen war wie einigen anderen Familien in Mexiko zur Zeit der Revolution. Während der Vater sich für Reformen engagiert hatte und stets mit einem Fuß im Gefängnis gestanden war, hatte seine Frau unbeirrt ihre Bilder gemalt und gelernt, sie gewinnbringend zu verkaufen. Sie hatte jeden porträtiert, der dafür gezahlt hatte, ganz egal zu welchem politischen Lager er gehörte. Insgesamt hatte sie sich aus den Konflikten herausgehalten, indem sie sich stets darauf berufen hatte, Ausländerin zu sein. Dass sie eine überzeugte Anhängerin der Liberalen war und den starken Einfluss der Kirche in der Gesellschaft nicht guthieß, wussten nur ihre Familie und ihre engen Freunde.
Leonora hatte immer gedacht, der Zweck all dieses taktischen Vorgehens seitens ihrer Mutter hätte darin bestanden, den Vater bei seinem Kampf um ein freies, gerechtes Mexiko zu unterstützen. Doch jetzt war das Land endlich zur Ruhe gekommen, der Vater hatte ein Amt in der Regierung inne, seiner Familie gehörte ein schönes Haus, und ihre Mutter hätte das entspannte Leben einer Frau der gehobenen Mittelschicht führen können.
Stattdessen war sie überstürzt mit zweien ihrer Kinder nach Deutschland aufgebrochen.
»Es ist mit eine Ehre, Sie in Ihrer Heimat zu begrüßen, Frau del Rio«, sagte Tobias Winter mit einem höflichen Nicken. »Ihr letzter Aufenthalt liegt nun schon viele Jahre zurück.«
Ihre Mutter war in Deutschland gewesen, als Leonoras ältester Bruder Patricio 1904 auf die Welt gekommen war. Er hatte seine ersten zwei Lebensjahre hier verbracht, dann war Alice mit ihm nach Mexiko zu seinem Vater zurückgekehrt.
Den Grundstein für ihre Laufbahn als erfolgreiche Künstlerin hatte sie damals schon gelegt. Ihre Bilder wurden nach Deutschland verschifft, nachdem sie in Mexiko oder den USA ausgestellt worden waren. Doch diesmal hatte sie es sich in den Kopf gesetzt, persönlich bei ihrer Vernissage anwesend zu sein, von der sie sich viel erhoffte. Leonora konnte die unangenehme Ahnung, dass sich diesmal mehr dahinter verbarg als der übliche Ehrgeiz von Alice del Rio, nicht abschütteln.
Nun ergriff der Galerist Tobias Winter den Arm ihrer Mutter und führte sie plaudernd zu dem Taxi, das auf sie alle wartete. Paul hatte er mit einem höflichen, aber desinteressierten Lächeln bedacht. Leonora hatte nicht mehr Aufmerksamkeit von ihm bekommen als ein Dienstmädchen, doch genau dafür war sie in ihrer Heimat auch manchmal gehalten worden.
Sobald sie in dem warmen Fahrzeug saß, wurde Leonora langsam neugierig auf Berlin, das ebenso groß und laut schien wie Mexiko-Stadt. Es mangelte an Farben, dafür schlug der Puls dieser Stadt schneller und verlässlicher. Alle Menschen schienen zu wissen, wohin sie wollten, und liefen auf dieses Ziel entschlossen zu. Sie hatten daher weniger Zeit, miteinander zu reden oder einfach nur entspannt irgendwo zu sitzen, denn ein innerer Drang trieb sie vorwärts.
Leonora musste zugeben, dass es ihr gefiel. Sie mochte Ordnung und bewunderte Menschen, die wussten, wo ihr Platz im Leben war. Doch ganz erfüllte die Heimatstadt ihrer Mutter ihre Erwartungen nicht.
»Ich habe mir Deutschland sauberer vorgestellt«, flüsterte Leonora ihrem Bruder zu, als sie schon eine Weile durch die Straßen der Stadt gefahren waren. Sie hatte mehr Bettler entdeckt als erwartet und fragte sich, wie diese Leute mit der Kälte zurechtkamen. Wer hier kein Dach über dem Kopf hatte, musste im Schlaf erfrieren. An manchen Ecken stapelte sich Müll, der an diese eine Stelle verbannt zu sein schien, anstatt sich wie in Mexiko-Stadt überall breitzumachen.
»Wenn du Ruhe und Sauberkeit willst, musst du aufs Land fahren«, erwiderte Paul. »Berlin ist zu wild. Aber genau das liebe ich an der Stadt. Man kann hier wirklich frei sein. Warte ab, es wird dir auch gefallen.«
Im Moment vermochte Leonora sich das nicht vorzustellen. Dieses fremde Land schien geschaffen für hochgewachsene, elegante Gestalten wie ihre Mutter und ihren Bruder. Sie selbst hatte Angst, diese zwei ihr vertrauten Menschen hier für immer zu verlieren.
Alice genoss den Anblick bekannter Gebäude und versank in Erinnerungen, während die Stimme ihres Galeristen in ihren Ohren summte. Sie staunte, dass die grauen Fassaden und farblosen Kleider der Frauen sie nicht störten, sondern angenehm beruhigend wirkten. Auch gegen die Kälte fühlte sie sich erstaunlich gut gewappnet. In Mexiko war sie auf Schritt und Tritt angestarrt worden, was manchmal schmeichelhaft, oft aber lästig gewesen war. Hier versank sie einfach in der Menge, eine Blondine, die allmählich ergraute, blass und mit wasserblauen Augen. Wenn sie sich unauffällig kleidete, wäre sie nichts weiter als eine Frau von etwa fünfzig Jahren, daher für die meisten Männer nicht mehr von Interesse.
Die Vorstellung gefiel ihr. Sie sehnte sich nach Ruhe, um zu überlegen, wie es mit ihr weitergehen sollte.
»Morgen werden einige Journalisten und Kunstkritiker erscheinen«, erzählte Tobias Winter indessen. »Man ist sehr gespannt auf Ihre Bilder und auch auf Sie, Frau del Rio. Diese Kombination aus Exotik und deutscher Sachlichkeit macht aus Ihrem Werk etwas Besonderes – und Ihre ungewöhnliche Biografie noch dazu, das weckt Interesse.«
Er warf ihr einen erwartungsvollen Blick zu, als erwarte er Lob, sie in ein so vorteilhaftes Licht gerückt zu haben.
Alice unterdrückte einen Seufzer. Manchmal wünschte sie sich, wieder ein fast unbekanntes junges Mädchen zu sein, von dem niemand sich besonders viel erhoffte. »Ich werde mein Bestes geben, einen guten Eindruck auf diese Leute zu machen«, versprach sie Tobias Winter.
Als unbekanntes junges Mädchen hätte sie sich niemals ein Hotel wie das Eden leisten können, wo sich laut ihrem Galeristen die erfolgreichen Künstler der Stadt trafen.
Als das Taxi vor dem eleganten Bau zum Stillstand kam, verspürte Alice freudige Aufregung. Sie liebte Jazz und Tanzhallen. Hier würde sie sich wenigstens amüsieren können, ohne dass jemand ihr unpassendes Benehmen vorwarf.
Sie stiegen aus dem Taxi und ließen die Koffer vom Poitier abholen. Alice zog eine Zigarette aus ihrer Handtasche, und Tobias Winter ließ sogleich sein Feuerzeug aufblitzen. Der Blick ihrer Tochter Leonora kam ihr missbilligend vor, sie straffte die Schultern und fragte sich, warum dieses Mädchen sich so oft gebärdete wie eine jener Gouvernanten, unter denen Alice als Kind gelitten hatte.
In Mexiko hätte keine Frau, die etwas auf sich hielt, auf offener Straße geraucht. So benahmen sich nur Arbeiterinnen und Prostituierte. Aber das hier war Berlin, modern und rebellisch, so wie auch einige Kreise in Mexiko-Stadt, wo Leonora sich aber nicht hingewagt hatte. Was hatte sie nur falsch gemacht, dass ausgerechnet ihre Tochter so schrecklich brav und langweilig geworden war?
Gleich darauf wurde Alice von brüllenden Männerstimmen aus diesen Gedanken gerissen. Hinter ihnen zog eine uniformierte Truppe die Budapester Straße entlang, schwang rote Fahnen mit dem Hakenkreuz und ließ die deutsche Sprache sehr grob und hässlich klingen. Alice wandte den Blick ab.
»Das sind also die Anhänger von Adolf Hitler«, sagte sie zu Tobias Winter, der nur mit den Schultern zuckte.
»Dumme Jungs, nichts weiter«, meinte er. »Machen Sie sich keine Sorgen. Unser Land ist jetzt modern und demokratisch.«
Alice beschloss, ihm zu glauben, und ging auf den Hoteleingang zu.
»Mama, wir müssen auf Leonora warten!«, rief Paul in ihrem Rücken. Alice drehte sich erstaunt um, denn für gewöhnlich war ihre Tochter sehr zuverlässig.
Nun sah sie Leonora auf die marschierenden Männer starren, eine kleine junge Frau, die in der Fremde fröstelte und versuchte, die ihr unbekannte Welt zu begreifen.
»Komm, lass uns jetzt reingehen!«, rief Alice ihr auf Spanisch zu, doch entweder hörte Leonora sie nicht, oder aber sie weigerte sich zu gehorchen. Sie machte sogar ein paar Schritte auf die Marschierenden zu.
Dann ging alles sehr schnell. Leonora strauchelte, rutschte auf dem glatt gefrorenen Straßenpflaster aus und fiel hin. Alice schrie auf und hastete zu ihrer Tochter, gefolgt von Paul. Gemeinsam halfen sie Leonora wieder auf die Beine. Sie schien nicht ernsthaft verletzt, nur verstört. Missgeschicke wie diese waren ihr immer unnötig peinlich.
»Jemand hat mich geschubst«, murrte sie. »Keiner dieser Männer, sondern einer von den Zuschauern.«
»Sicher ein Versehen«, meinte Paul. »Es sind so viele Leute unterwegs.«
Leonora nickte kurz und ließ die Schultern sinken. Unglücklich schien sie immer noch.
Alice erinnerte sich daran, dass sich hinter der sittenstrengen Fassade ihrer Tochter ein verletzliches Wesen verbarg, das ständig Angst hatte, sich lächerlich zu machen. Tröstend strich sie ihr über den Arm. »Du musst aufpassen, wenn Schnee und Eis auf den Straßen liegen«, riet sie. »Aber auch die Einheimischen rutschen oft genug aus, also brauchst du dich nicht zu schämen.«
Leonora blickte kurz auf. »Ich glaube, man hat mich eine Zigeunerin genannt, bevor ich gestoßen wurde«, flüsterte sie. »Aber mein Deutsch ist nicht gut. Sicher habe ich es falsch verstanden.« Sie lächelte bemüht.
Alice ergriff die Hand ihrer Tochter. »Es ist nicht wichtig. Denke nicht mehr daran!«, sagte sie aufmunternd und zog Leonora zum Hotel.
Erst allmählich wurde ihr bewusst, dass die dunkle Haut und das pechschwarze Haar ihrer Tochter der Grund für diese Anfeindung gewesen waren. In Mexiko war sie es, die auffiel, während Leonora in der Masse unsichtbar wurde. Alice hatte sie manchmal darum beneidet. Nur war sie in Mexiko bewundert worden, wenn mitunter auch auf aufdringliche Weise. Die Ahnung, dass ihre Tochter in Berlin nun Beleidigungen zu hören bekäme, verursachte ihr Magenschmerzen. Hätte sie Leonora besser bei ihrem Vater lassen sollen? Sie hatte gedacht, ein Aufenthalt in Deutschland könnte für das Mädchen eine bereichernde Erfahrung sein.
»Ich hoffe, der jungen Dame geht es gut«, mischte Tobias Winter sich nun ein. »Wenn sie einen Arzt braucht, dann …«
»Sie braucht keinen!«, unterbrach Alice barscher als beabsichtigt. Auf einmal fand sie die Bemühungen des Galeristen lästig. »Wir möchten nur so bald wie möglich auf unsere Zimmer. Die Reise war anstrengend, und wir müssen uns ausruhen«, fügte sie sanfter hinzu.
Tobias Winter regelte alles mit deutscher Gründlichkeit. Sie erhielten ihre Zimmerschlüssel, die Koffer wurden zum Aufzug getragen, und man teilte ihnen mit, wann sie zum Abendessen erscheinen konnten.
Manche Leute sahen Leonora interessiert an, aber niemand verhielt sich feindselig. Paul erhielt ebenfalls zahlreiche Blicke von anwesenden Frauen, doch er war auch in Mexiko angeschmachtet worden.
Alices Freude, wieder in der Heimat angekommen zu sein, kehrte allmählich zurück.
»Alice del Rio, ein weiblicher Paul Gauguin«, las Friderike ihren Freundinnen aus der Zeitung vor. »Die abenteuerlustige Berlinerin heiratete einen Mexikaner und ließ sich von der Farbenpracht des Landes inspirieren. Nun endlich können ihre Landsleute nicht nur die Werke der in Amerika bereits bekannten Künstlerin bestaunen, sondern auch die weit gereiste Frau kennenlernen, die die Bilder erschaffen hat. Galerie Winter, Kurfürstendamm, Vernissage am Samstag um 15 Uhr mit anschließender Feier im Hotel Eden.« Sie warf einen erwartungsvollen Blick in die Runde. Klara und Marie blätterten weiter in ihren Zeitschriften. Sie unterdrückte einen Seufzer. »Also ich würde gern hingehen. Was meint ihr?«
»Mein Vater wird es niemals erlauben«, murmelte Klara ohne besonderes Interesse. »Die Frau klingt irgendwie … unseriös.«
»Sie ist Künstlerin«, erwiderte Friderike. »Natürlich benimmt sie sich nicht wie eine Anstandsdame.«
Marie hatte nachdenklich die Stirn gerunzelt. »Also schlecht finde ich deinen Vorschlag nicht«, gab sie zu. »Meine Cousine geht manchmal ins Hotel Eden feiern, aber sie gilt als Schande der Familie. Ich weiß nicht, wie wir unsere Eltern davon überzeugen sollen, uns dorthin zu lassen.«
Dieses Problem hatte Friderike vorausgesehen. »Wir sagen, dass wir gemeinsam ins Museum gehen«, meinte sie. »Klassische Bildung. Das erwartet ein angesehener Mann von seiner zukünftigen Braut. Daher werden unsere Eltern die Idee gutheißen. Und wirklich gelogen ist es nicht einmal, denn wir sehen uns Kunst an!«
Sie hatte darüber nachgedacht, seit sie die Anzeige gestern in der Zeitung entdeckt hatte. Schon der Name Alice del Rio versprach Aufregung und Abenteuer, eine Abwechslung in ihrem Dasein, das aus gelegentlichen Besuchen bei anderen adeligen Familien bestand, die allesamt über den Verlust der ihnen vertrauten Lebensart klagten. In der neuen Welt, die nach dem großen Krieg angebrochen war, gab es für Leute wie ihre Eltern keinen Platz mehr, dachte Friderike manchmal. Aber sie selbst glaubte an Auswege. Ihre Ländereien hatten sie verkaufen müssen, nachdem der Vater Schulden gemacht hatte. Ihr Bruder hatte keine Aussichten auf eine Stellung bei Hof, weil es keinen Hof mehr gab. Doch in dieser Gesellschaft, die auf den Kopf gestellt und kräftig durchgeschüttelt worden war, konnten Frauen plötzlich selbst Geld verdienen, indem sie einfach taten, was sie gut konnten.
Diese Alice del Rio musste eine davon sein.
»Also, wir treffen uns morgen so gegen zwei in der Konditorei Schilling und gehen dann auf diese Vernissage«, beschloss Friderike. »Wir müssen ja nicht mit zu der Feier im Hotel Eden.«
In diesem Fall würden sie sicher zu spät nach Hause kommen. Das eigentliche Problem aber bestand darin, dass sie sich keinen einzigen Drink im Eden würden leisten können. Den Familien von Klara und Marie ging es nicht besser als ihrer eigenen. Sie waren alle drei dazu erzogen worden, die Ehefrau eines Mannes von Stand zu werden, doch nun hatten diese Männer oft kein Auskommen mehr, das die Gründung einer Familie ermöglicht hätte.
Klara und Marie schienen willens, ihr Leben dennoch auf einem Sofa zu verbringen, ohne darauf zu achten, dass die Polster unter ihnen zerschlissen waren. Friderike hingegen spürte den Drang, in die Welt hinauszustürmen, um dort ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Eine Begegnung mit dieser Alice del Rio würde ihr vielleicht zeigen, wie Frauen außerhalb der ihr bekannten, von Pflichten und Traditionen eng umrissenen Welt lebten.
Der Familienaufsicht für eine Weile zu entkommen, erwies sich als einfacher denn befürchtet. Ihr Bruder Theodor war mit Freunden unterwegs, die Eltern waren nach dem Verlust des Vermögens häufig zu erschöpft, um ihre Tochter ständig zu kontrollieren. Dass die Familie sich kaum noch Personal leisten konnte, war ein zusätzlicher Vorteil, da niemand mitbekam, was Friderike tat.
Sie kramte das Geld, das sie sich mit Klavierunterricht verdient hatte, aus ihrer Schublade und zog ihr bestes Kleid aus dem Schrank. Es entsprach nicht der aktuellen Mode, die wieder tailliert zugeschnitten wurde, sondern fiel locker um ihren schmalen Körper, was Friderike mochte. Sie hatte mehr Bewegungsfreiheit, und niemand merkte gleich auf den ersten Blick, wie mager sie war. Einen passenden Hut und Handschuhe besaß sie zum Glück, der Mantel war an den Ärmeln zerschlissen, doch sie würde ihn sicher an irgendeiner Garderobe abgeben können, bevor sie den Raum der Vernissage betrat.
Eilig hastete sie zur Straßenbahn. Dass sie ihr Haus auf dem Land hatten verkaufen müssen, um in eine Wohnung in Neukölln zu ziehen, gehörte zu den Folgen ihrer Verarmung, die Friderike heimlich als Vorteil betrachtete. Sie brauchte weder eine Kutsche noch ein Automobil, um an die Orte zu gelangen, die sie sehen wollte.
Klara erschien nicht zu der Verabredung, weil sie sich um ihre kranken Geschwister kümmern musste. Marie aber wartete bereits mit einer Tasse Kaffee.
»Willst du da wirklich hingehen? Wir könnten auch ein bisschen herumbummeln«, meinte sie zaghaft, ließ sich aber von Friderike mitziehen, da Marie meistens tat, was ihr gesagt wurde.
Die Galerie Winter befand sich in einem eleganten Bau gegenüber einem kürzlich eröffneten ungarischen Restaurant. Friderike opferte ihre Ersparnisse, um Eintrittskarten für Marie und sie selbst zu erwerben, und betrat dann neugierig einen großen, hellen Raum.
Sie verstand nicht besonders viel von Kunst. Ihr Zeichenlehrer war entlassen worden, als es um die Finanzen der Familie schlecht zu stehen begann, und von moderner Malerei hatte sie nicht viel mitbekommen, da ihre Familie diese schon immer abgelehnt hatte. Auf den Bildern von Alice del Rio war immerhin zu erkennen, was die Künstlerin darstellen wollte. Frauen in bunten Kleidern, Hütten, viel Grün und farbenfrohe Vögel. Alles war aufeinander abgestimmt, vermittelte den Eindruck eines warmen, lebensfrohen Landes. Um Friderike herum schubsten sich Leute, die in Notizbücher kritzelten und selbst Skizzen entwarfen. Im hinteren Ende des Raumes hatte sich ein hochgewachsener grauhaariger Mann aufgebaut, der eine Frau nach vorn schob.
»Meine Damen und Herren, dies ist Alice del Rio. Kaum eine deutsche Frau dürfte so viele Abenteuer erlebt haben wie sie. Sie durchquerte einst den mexikanischen Dschungel und besuchte uralte Ruinen, um uns den Eindruck dieser fremden Welt überbringen zu können.«
Alice del Rio sah nicht begeistert aus, auf diese Weise angepriesen zu werden, doch sie fing sich schnell und lächelte. »Mexiko ist nicht einmal so fremd, wie es den Anschein haben mag«, erzählte sie nun. »Auch dort kämpfen die Armen ums Überleben und die Reichen darum, ihre Vorrechte nicht zu verlieren. Leider läuft so ein Kampf nicht selten blutig ab.«
Der Galerist verzog kurz das Gesicht, denn der Bezug zu politischen Fragen gefiel ihm wohl nicht. Aber er präsentierte seine Künstlerin immer noch hoffnungsvoll. Dazu hatte er gute Gründe, befand Friderike. Selbst wenn die Worte der Künstlerin nicht allen Leuten zusagen mochten, ihre Erscheinung war schlichtweg umwerfend.
Das graue Kleid war akkurat geschnitten, betonte den schmalen Körper und machte ihn alterslos. Ein silberblonder Pagenkopf umrahmte das wie aus Marmor gehauene Gesicht. Diese Frau musste schon bewundernde Blicke auf sich ziehen, wenn sie morgens verschlafen aus dem Bett kroch. Nun schüttelte sie Hände, lächelte weiter und redete ununterbrochen.
»Brauchen wir wirklich Bilder von Wilden?«, hörte Friderike einen Mann in ihrem Rücken murmeln, ärgerte sich, aber ging nicht darauf ein. Die Menschenmenge schob sie vorwärts, Marie klagte, dass es ihr zu eng wurde, und flüchtete wieder an den Ausgang. Friderike versuchte weiterhin, der faszinierenden Alice del Rio näher zu kommen, aber Journalisten und andere wichtig aussehende Leute versperrten ihr den Weg.
Schließlich gab sie es auf, denn ihre gute Erziehung verbot ihr, rücksichtslos ihre Ellbogen einzusetzen. Sie gesellte sich zu Marie und trank gemeinsam mit ihr das Glas Schampus, das jedem Gast serviert worden war. Danach verspürte sie den Drang, die Toilette aufzusuchen, und ließ Marie allein.
Es ging in einen Kellerraum, wo sich glücklicherweise noch keine Schlange gebildet hatte. Vor den Waschbecken entdeckte Friderike eine junge Frau, die auf dem Boden kniete und sich angestrengt umsah.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie höflich.
Die Frau blickte auf. Ihr Gesicht war dunkel wie auf den Bildern von Alice del Rio, sie hatte schmale Augen und sehr breite Wangenknochen. Aus der Hochsteckfrisur hatten sich ein paar pechschwarze Strähnen gelöst.
Sie sah nicht deutsch aus. Nicht einmal europäisch.
»Lo siento«, stammelte sie. »Ich habe meinen Ring verloren. Aus Gold.«
Friderike ging nun ebenfalls in die Hocke, um bei der Suche zu helfen. Ihre scharfen Augen und ihre Aufmerksamkeit für Details waren von der Mutter manchmal gelobt worden, daher hoffte sie, sich nützlich machen zu können. Unter dem rechten Waschbecken ganz hinten in der Ecke sah sie auch schon etwas Goldgelbes leuchten und streckte erwartungsvoll die Hand aus. Gleich darauf konnte sie der Fremden ihren Fund entgegenhalten. Der Ring war schmal, aber wirklich aus Gold, und er hatte einen blauen Stein.
»Muchas gracias!«, murmelte die Dunkelhaarige. »Wenn ich den verloren hätte …«
Sie stieß einen Seufzer aus und richtete sich auf. Ihr Körper war klein, wies aber jene Rundungen auf, die Friderike an ihrem eigenen vermisste. Das dunkelblaue Kleid schien sie einzuzwängen wie ein Korsett, die Füße in den Lackschuhen wirkten aufgequollen. Ein wenig erinnerte sie an eine Bäuerin, die sich für die Stadt herausgeputzt hatte. Friderike überlegte, ob sie eine Bedienstete der Malerin sein konnte.
»Sie kommen aus Mexiko?«, fragte sie.
Die junge Frau nickte.
»Wie gefällt es Ihnen in Berlin?«, wollte Friderike wissen. Sie war stets neugierig, was Menschen aus der Fremde von ihrer Heimat hielten.
»Muy bien … ich meine, sehr gut«, erwiderte die Mexikanerin schnell, lachte dann, um ihre eigene Verlegenheit zu überspielen. »Aber kalt. Sehr kalt.«
»Im Sommer wird es besser«, sagte Friderike und überlegte, ob jemand vor ihr schon jemals eine überflüssigere Aussage gemacht hatte.
»Si, si. Mi madre, also meine Mutter, sagt das auch.« Das Mädchen hatte sich den Goldring an den Finger gesteckt.
»Ihre Mutter lebt in Deutschland?«, bohrte Friderike weiter nach. Vielleicht arbeiteten beide für die Künstlerin.
»Meine Mutter ist Deutsche«, erwiderte das Mädchen. »Sie wurde hier geboren. Jetzt stellt sie hier ihre Bilder vor.«
Kurz blieb Friderike die Luft weg. Sie starrte in das breite kaffeebraune Gesicht und suchte vergeblich nach Ähnlichkeiten zu der blonden Frau aus der Galerie. Vielleicht würden sie auffallen, wenn man beide aus der Nähe betrachtete.
Friderike wurde bewusst, dass dieses Starren unhöflich war. »Es tut mir sehr leid, ich wusste nicht, dass …«, begann sie verlegen.
Die junge Mexikanerin lachte. »Sie sind nicht die Erste. Zu Hause hielt man mich auch für das Dienstmädchen.«
Eine sehr angenehme Erfahrung konnte das nicht gewesen sein, dachte Friderike. »Sie sehen aus wie die Frauen, die Ihre Mutter malt«, sagte sie daher. »Dort oben bestaunt sie nun jeder.«
Die Mexikanerin schien einen Moment lang nachzudenken.
»Man bewundert diese Frauen nur, weil eine Frau wie meine Mutter sie gemalt hat«, wandte sie ein.
Friderike wagte nicht zu widersprechen, denn das Mädchen würde sich damit wohl besser auskennen.
»Ich bin Leonora del Rio«, sagte die Mexikanerin nun und hielt ihr die Hand hin. »Es war nett, dass Sie mir helfen wollten, obwohl Sie dachten, ich sei das Dienstmädchen.«
Friderike brach der Schweiß aus, als sie sich wieder ihrer Unhöflichkeit bewusst wurde, doch Leonora sah weiterhin freundlich drein.
»Möchten Sie meine Mutter treffen? Jetzt sagen Sie nicht Nein. Deshalb sind alle Leute heute hier.« Sie grinste und winkte Friderike zu. »Ven, ven! Ich stelle Sie vor.«
Friderike trottete ihr hinterher wie ein folgsamer Hund, ohne wirklich an ihr Glück glauben zu können. Dort oben war ein Saal voller Menschen, die alle Alice del Rio kennenlernen wollten, doch ausgerechnet ihr sollte es vergönnt sein? Sie fuhr sich nervös mit den Fingern durchs Haar und hoffte, so ihre farblosen Strähnen in eine bessere Form zu bringen. Ihr Kleid war hoffnungslos altmodisch, was sie für gewöhnlich nicht störte, aber neben Alice del Rio fürchtete sie, wie eine Lumpensammlerin auszusehen.
Das Gedränge um die Künstlerin hatte zugenommen. Leonora drängelte sich entschlossen vorwärts, gefolgt von Friderike. Schließlich gelangten sie ins Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit.
Die Künstlerin lehnte mit einem Glas Champagner in der Hand an einem Stehpult und beantwortete Fragen, lachte immer wieder und zog manchmal Grimassen. Beim Anblick ihrer Tochter sah sie kurz überrascht aus. Leonora redete auf sie ein und winkte Friderike herbei.
»Sie haben meiner Tochter geholfen!«, sagte Alice del Rio und lächelte Friderike an. Aus der Nähe konnte man zarte Falten in ihrem Gesicht erkennen. Das Haar war von grauen Strähnen durchzogen, doch all dies änderte nichts an der Anmut ihrer Erscheinung.
»Ich half ihr nur, einen Ring zu finden«, erwiderte Friderike und war stolz auf sich, weil sie dieser Frau ins Gesicht sehen konnte. »Das war nicht besonders schwer.«
»Aber sehr nett. Leonora will trotz ihrer schlechten Augen leider nicht immer ihre Brille tragen«, erwiderte Alice del Rio und streckte Friderike die Hand hin.
»Es freut mich, Sie kennenzulernen, Fräulein …«
»… von Greifen«, erwiderte Friderike. Sie überlegte, dass Alice del Rio vielleicht nichts von Adelstiteln hielt. Aber so war nun einmal ihr Name und sie hasste es zu lügen.
»Nun, Fräulein von Greifen, falls Sie uns später noch zu der Feier im Hotel Eden begleiten wollen, sind Sie herzlich eingeladen«, sagte die Künstlerin und wandte sich dann wieder dem Galeristen zu, der ihr etwas zugerufen hatte.
Friderike dachte kurz nach, was genau damit gemeint gewesen war. Wahrscheinlich hatte nicht jeder Zutritt zu dieser Feier. Etliche Leute in dieser Galerie mochten sie um die Einladung beneiden, doch änderte sich dadurch nichts an dem Umstand, dass sie sich keinen Drink würde leisten können.
»Hier ist noch mein Bruder«, rief Leonora ihr zu und zog Friderike aus der dichten Menschentraube heraus.
In der hinteren Ecke befand sich ein weiteres Stehpult, an dem ein junger Mann in einem hellbraunen Anzug lehnte, ebenfalls mit Champagnerglas in der Hand. Leonora zupfte ihn am Ärmel. Spanische Worte flogen hin und her. Das Verhältnis zwischen beiden schien deutlich entspannter als das Friderikes zu ihrem Bruder Theodor. Dann sah der Sohn der Künstlerin sie an, und ihre Welt fuhr kurz Karussell, sodass sie sich an dem Stehpult festhalten musste.
Der Mann hatte ein ebenso klassisch geschnittenes Gesicht wie seine Mutter, doch die dunkelbraunen Locken und der Schwung seiner Augenbrauen ließen ihn trotzdem männlich wirken. Um solche Schönlinge prügelten Mädchen sich für gewöhnlich, aber Friderike war stets stolz auf sich gewesen, weil sie sich nicht so leicht durch äußeren Schein blenden ließ. Nun wurde sie eines Besseren belehrt. Vielleicht lag es an der Freundlichkeit, mit der dieser Mann seine im Vergleich zu ihm so unscheinbare Schwester behandelte. Nichts an seinem Auftreten drückte irgendein Gefühl der Überlegenheit aus, er schien lediglich erschöpft von den vielen Menschen, die seine Mutter belagerten. Friderike ahnte, dass es ihr selbst in einer solchen Lage ähnlich gehen würde.
»Endlich eine Deutsche, mit der meine Schwester befreundet sein möchte!«, sagte der junge Mann in tadellosem Deutsch und lächelte sie an. »Sie schickt der Himmel, Fräulein …«
»… von Greifen«, wiederholte Friderike.
»Paul del Rio. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Möchten Sie auch ein Glas Champagner?«
Sie nickte, ohne weiter nachzudenken. Auf einmal stand sie mit beiden Kindern von Alice del Rio da und wurde in ein Gespräch gezogen, das ganz selbstverständlich dahinfloss, ohne dass Verlegenheit und Unbehagen aufgekommen wären. Sie konnte sich nicht vorstellen, mit Theodor so zu reden, wie Leonora es mit ihrem Bruder tat. Sie schubsten einander scherzhaft an, unterbrachen sich beim Reden und plapperten durcheinander, um Friderike das Leben in Mexiko zu beschreiben. Sie erfuhr, dass es eine Revolution gegeben hatte, an der Alice del Rios nicht anwesender Ehemann aktiv beteiligt gewesen war. Nun hatte er ein Amt in der neuen Regierung inne, ebenso wie der älteste Bruder der beiden, Patricio.
»Und wir treiben uns mit unserer Mutter in Deutschland herum«, meinte Paul schließlich. »Die weniger praktisch veranlagten Mitglieder der Familie sind entbehrlich.«
Für einen Moment schien Leonora das Gesicht zu verziehen, aber sie sagte nichts.
»Also, kommen Sie mit ins Hotel Eden?«, wollte Paul am Ende wissen. Friderike stimmte zu, obwohl sie wusste, dass sie ein großes Wagnis einging. Ihre einzige Erfahrung mit Treffpunkten von Künstlern beschränkte sich auf einen Besuch des Romanischen Cafés am Breitscheidplatz. Dort war sie nicht in den Nebenraum vorgelassen worden, wo die wirklich renommierten Leute gesessen hatten. Im Hauptsaal hatte sie allein einen Kaffee trinken wollen, doch zwei betrunkene Männer hatten darauf bestanden, ihr Gesellschaft zu leisten. Als sie aus Höflichkeit nicht geschafft hatte, die unerwünschten Verehrer abzuwimmeln, war sie von drei stark geschminkten Damen am Nebentisch als Landpomeranze auf der Suche nach Abenteuern verspottet worden. Nach dieser Erfahrung hatte sie Theodors Abneigung gegen solche vermeintlichen Horte der Dekadenz für einen Moment geteilt.
Aber nun erwachte die Neugier von Neuem. Vielleicht würde man über ihr altmodisches Kleid spotten, das ungeschminkte Gesicht und ihr steifes, unbeholfenes Auftreten unter all den schillernden Gestalten. Aber was machte das schon, wenn sie endlich die Chance hätte, einen anderen Lebensstil kennenzulernen, der die Moderne feierte anstatt über den Verlust alter Privilegien zu klagen?
Marie fiel ihr wieder ein, und sie verspürte einen Stich schlechten Gewissens. »Ich sehe nach meiner Freundin, dann komme ich wieder«, sagte sie schnell und mischte sich wieder unter die anderen Gäste der Galerie.
Marie hatte an der Garderobe bereits ihren Mantel abgeholt, als Friderike ihr entgegeneilte.
»Ich habe gesehen, dass du es bis in den engen Kreis der Auserwählten geschafft hast«, meinte sie, doch klang es nicht vorwurfsvoll. »Kommst du jetzt mit?«
Friderike schüttelte den Kopf. »Ich gehe noch ins Hotel Eden.«
Marie riss staunend die Augen auf. »Dein Bruder wird dich umbringen. Du weißt, was er von solchen Lokalen hält«, sagte sie nur, nahm die Entscheidung aber hin.
Friderike hatte nicht vor, ihrer Familie später zu sagen, wo sie gewesen war. Aber allein ein längeres Fernbleiben könnte sie in Schwierigkeiten bringen. Doch wenn sie sich diese Gelegenheit entgehen ließ, so würde sie für den Rest ihres Lebens darunter leiden.
»Bitte, schau auf dem Heimweg bei meiner Familie vorbei und sag ihnen, dass ich später komme, weil ich eine wichtige Einladung erhalten habe«, bat Friderike zum Abschied. Marie versprach es und entfernte sich mit einem Schulterzucken.
Sie würde nicht lange bleiben, überlegte Friderike. Vielleicht bis acht. Dann fuhren noch genug Trambahnen, um sie sicher nach Hause zu bringen. Bis dahin wäre ihr auch irgendeine Ausrede eingefallen, wo sie die ganze Zeit gewesen war.
Kapitel 2
Berlin, Juni 1931
Leonora hatte auf dem Balkon Platz genommen und ihr Buch aufgeschlagen. »Das Gold von Caxamalca«, die Erzählung eines deutschen Schriftstellers, der sich mit dem Niedergang des Reichs der Inka befasst hatte. Es überraschte sie, dass jemand über ein Land schreiben wollte, das er niemals gesehen hatte. Der Autor Jakob Wassermann schien großen Respekt vor dem letzten Herrscher der Inka zu empfinden. Leonora überlegte, dass ihr Vater dies als Idealisierung des edlen Wilden abgetan hätte. Wer nicht zu den Indigenen gehörte, mochte ihren Lebensstil bewundern, aber im Grunde waren sie abergläubische Bauern.
Ob der Vater nun verärgert wäre, weil die große Liebe seines Lebens eben aus dieser Bewunderung für eine exotische, unbekannte Welt in Deutschland Profit schlug? Es schien Leonora unwahrscheinlich. Er hatte seine Alice stets verehrt und ihre Liebe als kostbares Geschenk betrachtet, das ein unerwartet wohlwollendes Schicksal ihm gemacht hatte.
Sie selbst musste ein sehr störrisches, undankbares Wesen sein, weil sie den ganzen Zirkus bei den Ausstellungen ihrer Mutter nicht mochte. Immerhin hatten sie alle ihren Aufenthalt in dieser schönen, geräumigen Wohnung am Ku’damm allein dem Verkaufstalent von Alice del Rio zu verdanken.
Aber ihr Problem bestand nicht darin, dass sie ihre Mutter verurteilte, erkannte Leonora nun. Sie verurteilte sich selbst, weil sie in diesem reichen, ordentlichen Land nichts Rechtes zu tun wusste, während ihre Mutter Bilder verkaufte und Paul sich mit der ersten Frau traf, die es ihm wirklich angetan hatte.
Wenigstens war diese Friderike nett, klug und bescheiden. Leonora konnte sich noch an einige Verehrerinnen ihres Bruders erinnern, die ihr in Mexiko Freundschaft vorgespielt hatten, um Paul vorgestellt zu werden. Friderike hingegen hatte ihr dieses Buch von Jakob Wassermann geschenkt, obwohl Paul sich schon regelmäßig mit ihr traf. Es freute Leonora, dass dieses so ganz und gar deutsche Mädchen sie wirklich zu mögen schien. Aber wenn Paul hier eine Arbeit fand und seine Friderike heiratete, sollte sie dann ihr Leben damit zubringen, ihnen den Haushalt zu führen und mögliche Kinder aufzuziehen, wie es die Aufgabe alter Jungfern war?
Seufzend ließ sie ihr Buch sinken. Sie vermisste ihr Haus in Mexiko-Stadt, wo sie manchmal in der Küche ausgeholfen und den Klatschgeschichten der Bediensteten gelauscht hatte. Hier war sie eine Fremde, die überall angegafft wurde. Man mochte sie interessant finden, gab ihr aber zu verstehen, dass sie nicht hierher gehörte.
Als es an der Tür klingelte, war sie erleichtert, von diesen düsteren Gedanken abgelenkt zu werden. Das Dienstmädchen kam nur zweimal täglich, daher lief Leonora selbst nach unten, um aufzumachen.
Vor ihr stand eine junge Frau in einem hausbackenen Kleid, das um ihre breiten Hüften spannte. Der Hut drückte ihr Haar auf unschöne Weise platt. Leonora verspürte Sympathie, denn in gewisser Weise blickte sie in ihr Spiegelbild. Hier wusste noch jemand sich nicht vorteilhaft zurechtzumachen.
»Ist Friderike von Greifen hier?«, fragte die Fremde, ohne sich vorgestellt zu haben. Ihr blasses Gesicht wies rote Flecken auf.
Leonora verneinte. »Sie macht einen Spaziergang mit meinem Bruder«, erklärte sie. Friderike hatte ihm einen großen Park zeigen wollen.
»Wissen Sie, wann die beiden zurückkommen?«, fragte die junge Frau.
Leonora schüttelte den Kopf. »Möchten Sie hereinkommen und warten?«, bot sie spontan an. Wenigstens hätte sie so für eine Weile Gesellschaft.
»Ich weiß nicht … es ist dringend … aber ja, ich komme herein.« Die Fremde stürmte fast an Leonora vorbei und blieb dann schnaufend im Flur stehen. »Bitte, verzeihen Sie, ich bin gelaufen«, redete sie weiter. »Ich wollte das Geld für die Straßenbahn sparen.«
Die weitverbreitete Armut gehörte zu den Dingen, mit denen Leonora vor ihrer Ankunft in Deutschland nie gerechnet hätte.
»Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Sie müssen mich für furchtbar unhöflich halten«, fuhr die junge Frau fort, während Leonora sie ins Wohnzimmer führte. »Ich bin Marie von Weissenfelde.«
Noch eine Adelige, dachte Leonora. Und diese konnte es sich nicht einmal leisten, mit der Trambahn zu fahren. »Kaffee?«, fragte sie höflich.
Marie nickte und sank auf ein Sofa, nachdem sie dazu aufgefordert worden war. Leonora lief in die Küche. Zwar war noch Kaffee vom Frühstück übrig, aber sie setzte frischen auf. Dann holte sie ein paar eingewickelte Tortillas hervor, die sie gestern gebacken hatte. Wer so schnell gerannt war, brauchte eine Stärkung.
Sie brachte beides zu Marie, die mit großen Augen die Einrichtung des Wohnzimmers musterte. Alice hatte einige Fotografien von Maya-Ruinen aufgehängt und jene alten Götterfiguren, die sie sammelte, im Raum verteilt.
»Das ist alles aus Mexiko, nicht wahr?«, fragte Marie.
Leonora bejahte.
»Ich verstehe, dass diese Dinge Friderike gefallen«, meinte Marie und biss dankbar in eine Tortilla. »Sie war immer neugierig auf die große, weite Welt.«
»Sind Sie es denn nicht?«, wollte Leonora wissen.
»Ach, ich mag mein Zuhause«, erwiderte Marie. »Ich weiß nicht, wie ich woanders zurechtkäme. Und es gibt auch in unserem Land genug zu tun.«
Ebenso hatte Leonora gedacht, als sie noch in Mexiko gewesen war. »Aber warum sind Sie denn nun so weit gelaufen, um Friderike zu suchen?«, bohrte sie weiter nach.
Marie legte seufzend den Rest ihrer Tortilla auf den Teller. »Sie wird in Schwierigkeiten geraten, wenn sie so weitermacht. Ihr Bruder ist heute früher nach Hause gekommen als erwartet. Er wollte wissen, wo sie ist, kam sogar zu uns und wurde wütend, weil sie nicht bei mir war, wie sie es ihm wohl gesagt hatte. Ich habe ihm erzählt, dass sie einen Ausflug mit anderen Freundinnen gemacht hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er mir glaubte. Jedenfalls sollte sie möglichst schnell nach Hause kommen, sonst …« Marie verstummte und ließ den Kopf hängen.
»Sonst was? Was kann geschehen?« Leonora wusste, dass viele mexikanische Männer ihre Töchter oder Schwestern wie einen kostbaren Schatz bewachten, der stets Gefahr lief, gestohlen zu werden. Sie hatte die Deutschen aber für moderner und vernünftiger gehalten.
»Also Theodor von Greifen ist schwierig«, erzählte Marie. »Er hat sich diesen Leuten angeschlossen, die unser Land wieder groß machen wollen, und seitdem hat Friderike Probleme mit ihm. Sie weiß, dass er nicht mit dem einverstanden wäre, was sie tut, und will es geheim halten. Auf Dauer geht das nicht gut. Denn Theodor ist ein echter Hornochse. Meine Familie hätte nichts dagegen, wenn ich mich mit einem Mann treffe, dessen Mutter sich eine solche Wohnung leisten kann.« Wieder warf sie einen bewundernden Blick auf das Mobiliar.
»Also Friderikes Familie weiß nicht, dass sie sich mit meinem Bruder trifft«, stellte Leonora fest.
»Ja, so ist es. Es tut mir leid«, murmelte Marie, als sei sie selbst daran schuld.
Leonora dachte angestrengt nach. Paul hatte niemals erwähnt, dass seine neue Flamme ihn vor der Verwandtschaft verschweigen musste. Wahrscheinlich hatte er keine Ahnung davon. »Ich denke, diese Dinge werden sich regeln lassen«, versicherte sie Marie. »Sie sind Friderike jedenfalls eine gute Freundin. Kennen Sie sie schon lange?«
Sie erfuhr, dass beide Mädchen gemeinsam ein Pensionat besucht hatten.
»Danach hätten wir in die Gesellschaft eingeführt werden sollen, um einen passenden Ehemann zu finden. So war es zur Zeit unserer Mütter«, erzählte Marie freimütig. Sie schien einfach froh zu sein, dass jemand an ihrer Person Interesse zeigte. »Doch nach dem Krieg hat sich alles verändert. Unsere Familien mussten überall sparen, und wir saßen nur noch zu Hause. Friderike suchte schon lange eine Möglichkeit auszubrechen, aber ich habe Angst, dass sie sich in große Schwierigkeiten bringt.«
»Mein Bruder ist ein anständiger Mensch«, versuchte Leonora, sie zu beruhigen. Sie wusste, dass Paul häufig für einen verantwortungslosen Frauenhelden gehalten wurde, aber er hatte auch in Mexiko niemals ein Mädchen ins Unglück gestürzt. »Er ist an Friderike ernsthaft interessiert. Ich habe ihn noch niemals so erlebt. Er schwärmt ständig davon, wie intelligent und unternehmungslustig sie ist.«
Paul mochte Frauen wie seine Mutter. Friderike war keine so strahlende Erscheinung, aber sie verfügte ebenfalls über Verstand und Willenskraft, die zwei Attribute, denen Alice del Rio in erster Linie ihren Erfolg verdankte. Die wohlerzogenen Mädchen der mexikanischen Oberschicht hatten Paul niemals in so helle Begeisterung versetzen können wie diese Deutsche, die offenbar seinetwegen ihre Familie belog.
»Es würde mich sehr für Rike freuen, wenn sie einen solchen Mann bekommt«, meinte Marie mit einem Seufzer. »Theodor wird ihr trotzdem Probleme machen, aber der Rest ihrer Familie ist vielleicht vernünftiger.«
Marie schien einen großen Teil ihres Lebens damit zu verbringen, anderen Menschen die Erfüllung ihrer Träume zu wünschen. Wieder fühlte Leonora sich an sich selbst erinnert.
»Und was ist mit Ihnen? Sie wollen nicht mehr aus Ihrem Leben machen?«
Angesichts dieser Frage wirkte Marie völlig verblüfft. Sie kaute schnell ihre Tortilla zu Ende, dann zuckte sie verlegen mit den Schultern.
»Ich suche mir nützliche Aufgaben«, meinte sie nach einer Weile. »Es gibt ein paar Dinge, die auch eine unverheiratete Frau aus gutem Haus tun darf. Ich helfe in einem Spital für arme Leute aus, dreimal die Woche. Wohltätigkeit ist die allererste Aufgabe einer guten Christin, das sagte schon meine Großmutter. Und ich habe so das Gefühl, nicht völlig nutzlos zu sein.« Sie lächelte Leonora an, bevor sie fortfuhr. »Ehrlich gesagt, also wenn Sie nichts dagegen hätten, diese … mexikanischen Pfannkuchen sind köstlich und unsere Kranken würden sich sehr freuen, einmal so etwas probieren zu können. Also wenn Sie ein paar entbehren könnten …«
»Ich bringe sie gern vorbei!«, rief Leonora. »Sagen Sie mir einfach, wann und wohin.«
Marie unternahm einige gespielte Versuche, das Angebot anzulehnen, doch als Leonora hartnäckig blieb, schrieb sie ihr eine Adresse auf.
»Ich bin immer Montag, Mittwoch und Samstag dort«, erzählte sie. »Aber Sie können natürlich auch jemanden mit den Pfannkuchen schicken. Ihre Mutter braucht Sie sicher oft.«
Das tut sie eben nicht, dachte Leonora, wollte es aber nicht aussprechen. In diesem Moment ging die Tür auf, Paul kam herein, gefolgt von Friderike, die bei Maries Anblick versteinerte.
»Dein Bruder sucht dich«, sagte Marie nur. Dieser eine Satz reichte, um die frische Röte von Friderikes Wangen zu wischen.
»Mein Bruder ist eigenwillig«, sagte sie schnell, an Paul gewandt. Ihr Lächeln wirkte wie aufgeklebt, es passte nicht zu ihrem ernsten Gesicht. »Bitte entschuldige mich, ich muss sofort nach Hause und ihm erklären, wo ich gewesen bin. Zu der nächsten Feier von Alice del Rio am Samstag komme ich natürlich. Wir sehen uns dort!« Sie warf ihm einen flehenden Blick zu, bevor sie zum Ausgang hastete. Marie trottete ihrer Freundin hinterher.
Paul blieb mit einem verstörten Gesicht zurück. »Ich wollte ihr eigentlich noch ein paar Bücher über altamerikanische Ruinen zeigen. Sie schien wirklich interessiert«, sagte er zu seiner Schwester und setzte sich auf das von Marie verlassene Sofa. »Auf einmal lässt sie sich zurückpfeifen wie ein Hund.«
»Es muss an dem Bruder liegen«, erwiderte Leonora. »Der klingt etwas … unangenehm.«
»Aber sie hat ihn nie erwähnt!« Paul hatte die Stirn gerunzelt, als sei seine Welt aus den ihm vertrauten Bahnen geraten.
»Friderike benahm sich immer wie eine selbstbewusste Frau, die sich von niemandem etwas sagen lässt«, redete er weiter. »Und jetzt ist plötzlich von einem Bruder die Rede, der sie offenbar nach Lust und Laune herumkommandieren kann. Ich frage mich, was sie mir noch alles verschwiegen hat.«
In diesem Moment könnten sie Alices Rat brauchen, dachte Leonora, denn ihre Mutter kannte die Verhältnisse in Deutschland besser. Aber da sie ständig beschäftigt war, mussten ihre Kinder allein zurechtkommen. Ein Zustand, den sie bereits aus der Heimat kannten.
»Ich glaube, die Lage ist komplizierter, als du denkst«, sagte Leonora nach kurzem Nachdenken. »Auch hier gibt es Vorschriften, wie eine junge Frau sich zu benehmen hat. Deine Friderike möchte nicht zugeben, dass sie Angst vor ihrem Bruder hat, aber im Grunde ist es so. In Mexiko sind viele junge Frauen in einer ähnlichen Lage. Wenn wir ehrlich sind, ist niemand völlig unabhängig. Nicht einmal unsere Mutter.«
»Friderike hat bisher nie erwähnt, dass ich ihrer Familie vorgestellt werden könnte«, sinnierte Paul laut und zog ein unzufriedenes Gesicht. »Irgendein Problem gibt es also. Das alles gefällt mir nicht.«
In Mexiko waren sie in den letzten Jahren zu angesehenen Leuten geworden, Kinder eines Staatsbeamten und einer erfolgreichen Künstlerin. Leonora spürte an den Blicken, die man ihr hier manchmal auf der Straße zuwarf, dass es in Berlin nicht unbedingt der Fall war. Paul war davon bisher verschont geblieben, weil er wie ein Europäer aussah.
Sie begann, den Tisch abzuräumen. Wenn sie irgendeine Tätigkeit ausführte, arbeitete ihr Verstand immer am geschmeidigsten.
»Hast du denn ernsthafte Absichten mit ihr? Könntest du sie dir als deine Frau vorstellen? Sonst lass das Mädchen besser in Frieden, sie könnte deinetwegen eine Menge Schwierigkeiten bekommen.«
»Ich habe sehr ernsthafte Absichten« erwiderte Paul ohne Zögern. »Sie ist die erste Frau, mit der ich mir ein Leben vorstellen kann.«
»Na dann.«
Kurz wusste Leonora auch nicht weiter. Sie freute sich für Paul, hatte aber Angst, welche Folgen seine Verbindung mit einer Deutschen haben könnte. Ihr Bruder würde vielleicht in Berlin bleiben, weil seine Frau es sich so wünschte. Ihre Mutter hatte es womöglich ebenfalls vor, nur Leonora sah für sich keine Zukunft in diesem Land. Sie wäre lieber mit Paul nach Hause gefahren, doch wollte sie seinem Glück nicht im Weg stehen.
»Versuche, die von Greifens kennenzulernen«, riet sie ihm schließlich. »Deine Friderike ist eine deutsche Adelige, auch wenn sie vielleicht lieber etwas anderes wäre. Du kannst sie nicht einfach so aus ihrem Umfeld reißen.«
»Unser Vater hat es mit unserer Mutter genauso gemacht«, erwiderte Paul, aber er schien nachdenklich. »Ich werde Friderike beim nächsten Treffen darauf ansprechen«, beschloss er schließlich. »Sie kann mich nicht länger vor ihrer Familie verstecken. Außerdem möchte ich gern wissen, welchen Grund sie dafür hat.«
Dann lächelte er endlich wieder und ließ sich von Leonora Kaffee einschenken. Sein Gemüt war so sonnig wie die meisten Tage in seiner Heimat, denn er hatte bisher fast immer bekommen, was er sich gewünscht hatte.
Leonora ging davon aus, dass es so bleiben würde. Wenn deutsche Adelsfamilien an Trambahnfahrkarten sparten, was sprach dann gegen den Sohn einer erfolgreichen Malerin als Ehemann für ihre Tochter?
In Mexiko hätte es eine Menge Dinge gegeben: Herkunft, Lebensstil, politische Ansichten und vieles mehr. Familien, die einst zur Oberschicht gehört hatten, fühlten sich immer noch als Wesen einer edleren, reinen Art, selbst wenn sie Besitz und Privilegien eingebüßt hatten. Aber Leonora hielt Deutsche für einsichtiger und schneller bereit, sich veränderten Umständen anzupassen.
Im Kopf erstellte sie bereits eine Liste all der Zutaten, die sie brauchte, um mexikanisches Essen für das Spital vorzubereiten. Wenigstens einmal würde auch sie in diesem fremden Land einen sinnvollen Beitrag leisten können.
»Ich habe einem Spaziergang gemacht«, erzählte Friderike, als sie das Wohnzimmer betreten hatte. Ihre Familie war bereits versammelt, denn in der engen Wohnung hatten sie wenig Möglichkeiten, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. Der Vater las auf einem Sofa Zeitung, die Mutter stickte. Nur Theodor hielt nichts in der Hand, das ihn irgendwie beschäftigt hätte.
Eben das fehlt ihm, dachte Friderike. In der alten Welt hätte er eine Offizierslaufbahn eingeschlagen, an militärischen Übungen teilgenommen und mit seinen Kameraden das Casino besucht. Doch nach dem großen Krieg waren die Möglichkeiten einer militärischen Laufbahn stark eingeschränkt worden, und Theodor hatte es nicht geschafft, in den Kreis der Auserwählten aufgenommen zu werden.
Als Friderike seine verkrampften Schultern sah, wurde ihr bewusst, dass er bis zum heutigen Tage darunter litt, die Prüfung zum Offiziersanwärter nicht bestanden zu haben. Für ihn war damals ein Traum zerbrochen, doch hatte er deshalb das Recht, auch ihre Träume in Stücke zu hauen?
Sie würde sich wehren. Jetzt, da ihr Leben endlich eine Wendung zu nehmen begann, die ihren Wünschen entsprach, würde der Bruder sie nicht aufhalten.
»Warst du mit deinen Freundinnen unterwegs?«, fragte ihre Mutter nun und lächelte. Augusta von Greifen war stets die Verbündete ihrer Tochter gewesen, teilte ihre Begeisterung für Musik und Literatur. Der Vater konnte damit zwar nicht viel anfangen, duldete es aber als passende Beschäftigung für Frauen von Stand. Früher war Theodor wie sein Vater gewesen, ein Mann, der Pferde und die Jagd geliebt, Friderike aber auch ihre Leidenschaften gegönnt hatte. In letzter Zeit begann er, sich zunehmend zu verändern.
»Sie war nicht bei ihren Freundinnen«, knurrte er, bevor Friderike etwas hatte sagen können. »Sonst hätte Marie von Weissenfelde sie nicht holen müssen. Rike beginnt sich herumzutreiben, wie viele junge Frauen es heutzutage tun.«
Wie selbstgefällig und überheblich seine Miene wirkte! Friderike hatte Theodor niemals für besonders klug gehalten, doch diese Neigung, sich als ihr Herr und Meister aufzuspielen, musste er von seinen Kameraden aus der NSDAP übernommen haben.
»Viele junge Frauen wollen heutzutage etwas von der Welt mitbekommen«, erwiderte sie, zog Hut und Handschuhe aus, die sie auf der Kommode ablegte. Ihre Kehle schmerzte vom schnellen Rennen, doch langsam begann ihr Atem sich zu beruhigen. »Daher bin ich mit neuen Freunden spazieren gegangen. Ich wüsste nicht, was daran schlecht sein sollte.«
Sie setzte sich neben ihre Mutter aufs Sofa. Auf dem kleinen Tischchen stand noch eine Kanne Tee, aus der Friderike sich einschenkte. Sie griff auch nach dem Gebäck, das ihnen ihr Dienstmädchen gebracht hatte. Paul hatte gesagt, dass seine Schwester und sogar die umwerfend elegante Alice del Rio selbst backen konnten. Friderike erwog, es zu lernen, um nicht wie ihre Mutter stets auf die Arbeit anderer Frauen angewiesen zu sein.
»Die Frage ist, wer diese neuen Freunde sind«, redete Theodor indessen weiter. »Menschen aus anständigen Familien müssten uns bekannt sein.«
Friderike hörte ihre Mutter leise seufzen, aber Augusta hatte früh gelernt, dass es unklug war, mit zornigen Männern zu streiten. Leider konnte Friderike diesem Beispiel selbst nicht immer folgen.
»Berlin ist eine riesengroße Stadt. Daher bezweifle ich, dass du alle anständigen Leute hier kennst«, widersprach sie ihrem Bruder. Theodor fuhr wütend auf, doch der Vater mahnte ihn mit einer Handbewegung zur Ruhe.
»Nun geht euch nicht gegenseitig an die Kehle«, sagte der alte Herr. »Rike soll uns sagen, mit wem sie in den letzten Monaten so viel Zeit zubringt. Dann werden wir entscheiden, was von diesen Leuten zu halten ist.«
Friderike kippte schnell den Tee herunter, um die Trockenheit in ihrem Hals zu bekämpfen. Sie hatte auf dem Weg hierher bereits entschieden, dass es an der Zeit war, ihrer Familie reinen Wein einzuschenken. Glücklicherweise teilte der Vater nicht Theodors beunruhigende politische Ansichten.
»Ich hatte die Ehre, eine bekannte Malerin kennenzulernen, die im Februar in der Galerie Winter ausstellte«, begann sie. »Sie ist Deutsche, lebte aber lange im Ausland. In Mexiko.«
Theodor runzelte die Stirn, aber Augusta sah sehr neugierig aus.
»War das diese Frau, von der ich in der Zeitung las? Die Hütten und Indianer malt?«, fragte sie.
Friderike nickte. »Alice del Rio.« Der Name hatte für sie immer wie eine exotische Melodie geklungen, aber plötzlich hatte sie Angst, welche Schwingungen er in ihrer Familie auslösen würde.
Zunächst einmal schwiegen alle.
»Sie hat einen mexikanischen Ehemann, der dort für die Regierung arbeitet«, redete Friderike weiter.
Dieses Detail klang schon einmal gut. Das Gesicht ihres Vaters entspannte sich.
»Ihre zwei Kinder kennen Berlin kaum, daher habe ich sie herumgeführt«, beendete Friderike ihre Erklärung. Das stimmte zwar nicht ganz, aber es war eine für ihre Familie verdauliche Interpretation der wirklichen Ereignisse.
»Das war sehr nett von dir, Kind«, sagte Augusta. »Vielleicht willst du sie ja einmal zu uns einladen.«
Zum ersten Mal seit langer Zeit verspürte Friderike den Wunsch, ihrer Mutter um den Hals zu fallen.
»Wie alt sind diese Kinder denn?«, meldete sich wieder Theodor zu Wort.
Friderike biss sich auf die Lippen. »Die Tochter ist etwa in meinem Alter. Der Sohn hat in Berlin Archäologie studiert. Er ist fünfundzwanzig.«
»Das weißt du ja sehr genau!«, erwiderte Theodor. »Warst du Ehrengast auf seiner Geburtstagsfeier?«
»Kinder, Kinder, nun hört auf damit«, klagte der Vater. »Vielleicht will Rike uns von selbst etwas von diesem jungen Herrn erzählen.«
Der Vater wäre dankbar, mich einem gut situierten Ehemann übergeben zu können, dachte Friderike. So würde die Last auf seinen eigenen Schultern etwas leichter werden. Noch vor Kurzem hätte diese Erkenntnis sie verletzt, aber nun war sie froh darüber.
»Er ist sehr klug und ich bin ihm zugetan«, sagte sie frei heraus. Der Vater seufzte tief, Theodor schnaubte. Doch ihre Mutter sah erfreut aus.
»Es wurde aber auch Zeit, dass unserer Rike ein Mann gefällt. Willst du ihn uns nicht bald vorstellen?«
In der alten Welt wäre dies unmöglich gewesen, dachte Friderike. Ihre Eltern hätten über ihre Heirat bestimmt. Doch nun waren sie in diese enge Wohnung mit schäbigen Möbeln gezwängt, daher gab es keine besondere Auswahl an passenden Schwiegersöhnen. Sie erkannte wieder einmal, dass sich dadurch für sie auch erhebliche Vorteile ergaben. »Ich lade sie alle ein, wenn ihr wollt. Paul del Rio mit seiner Mutter und Schwester«, schlug sie spontan vor. Gleich darauf kamen ihr Bedenken, doch sie konnte schlecht zurücknehmen, was sie selbst angeregt hatte.
Alice del Rio musste diese Wohnung schrecklich finden und würde vielleicht bei ihren Künstlerfreunden Witze darüber reißen, dass der deutsche Adel heutzutage in einem modrigen Trödelladen lebte. Leonora war weniger anspruchsvoll als ihre Mutter, schüchterte Friderike daher nicht derart ein. Paul war bisher immer freundlich gewesen, schien sich nicht darum zu scheren, dass sie nur drei Kleider besaß, die alle schon mehrfach geflickt waren, und behandelte sie mit mehr Aufmerksamkeit, als sie es jemals von einem Mann erlebt hatte. Manchmal hatte sie Angst, wie sie damit zurechtkäme, wenn er sich am Ende doch von ihr abwandte. Eine Begegnung mit ihrer Familie könnte diese Entwicklung beschleunigen, aber all das war nicht zu verhindern, wenn er nicht hinnehmen konnte, aus welchem Umfeld sie kam.
Also hatte sie nur in die Wege geleitet, was unausweichlich war.
Der Vater nickte. Theodor sah zwar schlecht gelaunt aus, widersprach aber nicht.
Nun würde sie die del Rios einladen müssen. Friderike wurde flau im Magen, aber es war niemals ihre Art gewesen, vor Notwendigkeiten einzuknicken.
Leonora hatte es mit Mühe geschafft, den Korb mit ihren Tortillas aus der überfüllten Trambahn zu zwängen, und hastete nun die Straße hinab. Sie hatte nicht erwartet, Berlin an manchen Orten hässlicher zu finden als Mexiko-Stadt, das auch in den armen Gegenden wenigstens bunt und gelassen wirkte. Hier im Wedding hatte das Elend das graue verlebte Gesicht eines Arbeiters, der schon lange begriffen hatte, dass Disziplin und Fleiß ihm nicht helfen würden, der Armut zu entkommen.
Paul hatte erzählt, dass es auch den Deutschen seit dem großen Börsenkrach von 1925 zunehmend schlechter ging. Er musste es von seiner Friderike erfahren haben, denn sie selbst führten ein angenehmes Leben hier, wie üblich dank dem Erfolg ihrer Mutter. Leonora hatte die zahlreichen Obdachlosen und Bettler zwar vorher schon bemerkt, doch hier waren es so viele, dass sie nicht mehr übersehen werden konnten, selbst wenn man es bewusst versuchte.
Da sie es aus Mexiko gewohnt war, hellhäutige Menschen mit sauberer Kleidung und Wohlstand in Verbindung zu bringen, verstörte der Anblick von Lumpen und Ausschlag in den fahlen Gesichtern sie so sehr, dass sie kurz strauchelte. Hinter ihr brüllte ein zorniger Mann, dass nur ein völlig dämliches Weib mitten auf der Straße stehen bleiben konnte. Leonora stolperte tapfer weiter, ohne sich umzusehen. Die Heimat ihrer Mutter, in ihrer Vorstellung stets ein reiches, blitzsauberes Land, hatte ganz offensichtlich ernsthafte Probleme. Aber sie selbst würde die erste ernsthafte Aufgabe, die sie hier zu meistern hatte, erfüllen.
Das kleine Spital befand sich am Ende der Müllerstraße, wo schon Felder und Bäume sichtbar wurden. Berlin war in den letzten Jahren explosionsartig gewachsen, hatte Paul erzählt. In manchen Gegenden konnte man noch deutlich erkennen, dass sie vor nicht allzu langer Zeit ländlich gewesen waren.
Leonora klopfte an, eine mürrisch aussehende, magere Frau öffnete ihr und winkte sie herein.
»Sie sind tatsächlich gekommen!«, rief Marie von Weissenfelde und lief auf sie zu.
»Hier sind meine Tortillas. Wie versprochen.«
Nun, da sie ihre Gaben überreichen konnte, fühlte Leonora sich zuversichtlicher. Sie hastete Marie hinterher, die sie durch einen langen Korridor in ein helles Zimmer führte.
»Hier kümmere ich mich um Leute, die eigentlich schon genesen sind, aber keinen Ort haben, an den sie gehen könnten«, erzählte Marie unterdessen. »Herr Dr. Goldmann ist sehr sozial eingestellt, er wirft niemanden hinaus. Selbst Kranke, die schon entlassen wurden, können hierher kommen, um mit Essen versorgt zu werden.«
Sie winkte Leonora herein. Etwa fünfzehn Menschen saßen an kleinen Tischen und löffelten Suppe. Leonora wurde neugierig, aber nicht feindselig angestarrt. Sie stellte ihre Tortillas auf einem Rollwagen ab, neben der großen Schüssel mit der bereits verteilten Suppe.
»Mein Name ist Leonora del Rio«, sagte sie laut und lächelte.
Die Esser blickten nun alle in ihre Richtung.
»Kommt die aus einem Varieté?«, fragte ein ausgemergelter junger Mann und hustete gleich darauf, wodurch sein Lachen erstickt wurde.
»Nein, ich komme aus Mexiko!«, fuhr Leonora unbeirrt fort. »Ich habe euch allen eine Spezialität aus meiner Heimat mitgebracht!«
Sie entfernte den Deckel von dem Topf mit ihren Tortillas und stellte zwei Dosen mit Soßen auf.
»Verbrennt man sich daran nicht den Mund?«, fragte ein zahnloser Alter, doch seine Tochter, ein mageres Mädchen von etwa fünfzehn Jahren, herrschte ihn an, still zu sein. »Wir essen, was wir kriegen. Es war nett von dieser Frau, uns etwas mitzubringen aus … ach, egal woher.« Sie holte sich als Erste eine Tortilla, tunkte sie auf Leonoras Rat hin in die Salsasoße und biss hinein. »Es ist scharf, aber ich brenne nicht!«, rief sie ihrem Vater zu und winkte ihn herbei, während sie den Rest ihrer Tortilla so schnell verschlang, dass ihr Sabber übers Kinn lief.
Nun folgten auch andere Leute diesem Beispiel und Leonoras mexikanische Gaben verschwanden rasend schnell in deutschen Mündern. Sie hätte mehr mitbringen sollen, konnte das bei Gelegenheit nachholen. Vielleicht wäre es jetzt aber an der Zeit zu gehen, denn diese Menschen mochten zwar ihr Essen, starrten sie aber weiterhin misstrauisch an.
»Ich danke Ihnen für Ihre Großzügigkeit«, verkündete plötzlich eine Männerstimme in ihrem Rücken. Leonora sah sich erstaunt um. Vor ihr stand ein hochgewachsener Mann im Arztkittel, der ihr seine Hand entgegenhielt.
»Das ist Herr Dr. Goldmann«, mischte sich Marie ein. »Ich habe ihm Bescheid gegeben, dass Sie heute kommen.«
Leonora spürte, dass sie rot wurde. Sie war es nicht gewöhnt, für besonders wichtig gehalten zu werden.
»Es freut mich, dass mein Essen hier so gut ankommt«, stammelte sie. In Wahrheit waren diese Menschen wohl dankbar für jede kostenlose Nahrung, doch minderte das nichts an Leonoras Zufriedenheit.
»Sie haben unseren Kranken eine große Freude gemacht«, redete der Arzt weiter. »Spezialitäten aus fernen Ländern könnten sie sich niemals leisten. Würden Sie gern etwas mehr von unserem Spital sehen, Fräulein del Rio?«
Er kannte also ihren Namen, aber das war nicht verwunderlich, denn ganz Berlin musste inzwischen von ihrer Mutter gehört haben.
»Ja, sehr gern, wenn Sie die Zeit haben, mich herumzuführen. Ich möchte Ihnen nicht zur Last fallen«, erwiderte Leonora. Ärzte mussten furchtbar viel zu tun haben, vor allem in einer Gegend wie dieser.
»Sie sollen wissen, wem Ihre Unterstützung zuteilwurde«, sagte der Dr. Goldmann und winkte sie wieder in den Korridor.
Das Spital war klein, doch das hatte Leonora bereits vermutet.
»Wir behandeln hier auch Leute, die sich keinen Arzt leisten können, weil sie keine Krankenversicherung haben«, erzählte Dr. Goldmann, während er sie in die mit Betten vollgestellten Räume führte. Es sah überall sauber aus, und obwohl jedes Zimmer mit bleichen, ausgezehrten Gestalten überfüllt war, verbreiteten Bilder von Wäldern und Blumen eine entspannte Atmosphäre.
Wahrscheinlich wären viele der Leute da draußen gern krank geworden, um hier für ein paar Tage einziehen zu können.
»Gehört das Spital der Kirche? Oder einer anderen karitativen Organisation?«, fragte Leonora, nachdem der Arzt sie in sein Büro geladen hatte.
»Ich bin der alleinige Eigentümer«, erwiderte Dr. Goldmann. Er setzte sich ihr gegenüber hin, nahm seine Brille ab, und Leonora staunte, wie groß seine dunklen Augen plötzlich wurden. Er war ein feingliedriger Mann mit einem schmalen Gesicht, dessen Ausdruck auf Schwermut hinwies. Etwas an ihm erinnerte an einen jungen Hund, der ein Zuhause suchte, doch gleichzeitig schien er unerschütterlich in seiner Gefasstheit, als hätte er früh gelernt, die Widrigkeiten des Lebens hinzunehmen.
»Das heißt, Sie arbeiten hier ohne Gehalt?«, fragte Leonora staunend.