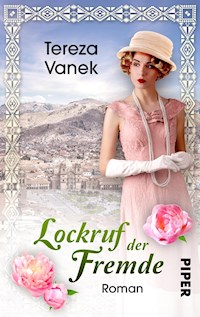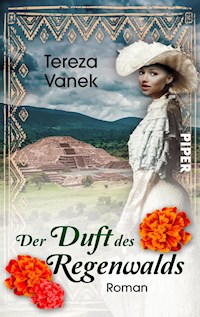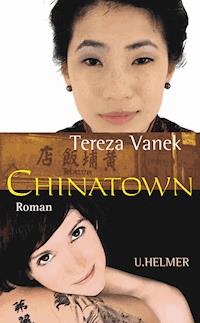14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
London im Jahre 1787: Mit ihrer extravaganten Erscheinung und ihren freien Ansichten gilt die Malerin Natalja Serbinskaja als ein bunter Vogel. Die junge russische Gräfin denkt nicht daran zu heiraten, sehr zum Leidwesen ihrer Amme und stetigen Begleiterin Jelena. Doch dann verliebt sich Natalja – in die Schwarze Sadie. Tereza Vanek erzählt eindrucksvoll die Geschichte einer Frauenliebe zu Zeiten der Sklaverei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Tereza Vanek
Schwarze Seide
Roman
© 2016 eBook nach der Originalausgabe
© 2007 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach/Taunus
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Atelier KatarinaS, NL
ISBN 978-3-89741-980-3
Ulrike Helmer Verlag
Neugartenstr. 36c, 65843 Sulzbach/Taunus
E-Mail: [email protected]
www.ulrike-helmer-verlag.de
Inhalt
18. März 1787
20. März 1787
28. März 1787
30. März 1787
14. April 1787
25. April 1787
15. Mai 1787
3. Juni 1787
15. Juni 1787
20. Juni 1787
23. Juni 1787
26. Juni 1787
London, 16. Oktober 1792
Nachwort
18. März 1787
Wir sitzen etwas abseits der anderen Fahrgäste, deren Gerede ich bereits ganze zwei Stunden während der Kutschfahrt ertragen musste. Obwohl ich, ganz anders als in meiner Kindheit, durchaus an Gesellschaft gewöhnt bin, erschöpfen mich langatmige Konversationen, wenn ich nicht ein Glas Champagner in der Hand halte, der meine Zunge ein wenig löst. Außerdem kann ich hier in unserer Nische ungestörter schreiben.
Seit einer Stunde pausieren wir jetzt in dieser wenig standesgemäßen Herberge. Der Wirt ist überaus mürrisch. Als er uns das Bier auftischte, betrachtete er uns abschätzig. Vor allem auf Jelena ruhten seine Blicke. Sie prangt ganz in Rot, die Lieblingsfarbe russischer und, soweit ich gesehen habe, auch böhmischer Bauersfrauen. Unauffällig bin auch ich selbst wohl für diese ländlichen Verhältnisse nicht. Mein Haar, mein Gewand und gar meine Schuhe zieren Schleifen, Rüschen und Bänder. Silberohrringe mit verschiedenfarbigen Steinen schaukeln in meinen Ohren wie Schiffe, die exotische Fracht transportieren, und an den Fingern meiner Hände blitzt es ebenso farbenfroh. In den letzten Jahren habe ich mich meiner neuen Umgebung schneller angepasst als jemals zuvor. Vielleicht, weil ich mich fühlte wie ein Fisch, der endlich in ein Gewässer gelangt ist, das seinem Naturell entspricht.
Ich nippte an dem Bier, das fade schmeckt, wie es englischem Bier eben eigen ist. Als ich den Krug wieder auf den Tisch stellte, stieß ich gegen mein Tintenfass und verfluchte meine ewige Geistesabwesenheit, die immer wieder zu solchen Missgeschicken führt. Unterdessen breitete sich ein dunkler Fleck auf dem Holztisch aus. Jelena sprang auf, um ihr Kleid vor Verschmutzung zu bewahren, und brachte den Tisch dadurch zum Beben. Bier schwappte aus unseren Krügen, vermischte sich langsam mit der Tinte zu fein geschwungenen Mustern, um schließlich einen neuen Farbton entstehen zu lassen, der leider auch einen Volant meines Ärmels erfasste.
»Gottverdammter Mist«, hörte ich meine eigene Stimme sagen und erkannte, dass ich zu allem Übel auf Englisch geflucht hatte. Auch darin war mein Liebhaber ein guter Lehrmeister. Jelena zauberte ein Taschentuch aus ihrem Beutel, um sogleich für Sauberkeit zu sorgen. Glücklicherweise ist der Fleck auf meinem Ärmel sehr klein und verschwindet fast zwischen den Wellen des Volants. Ein Schatten tauchte hinter Jelenas Schulter auf. Der Wirt brachte einen feuchten Lappen und entfernte mit missmutiger Miene die Folgen unserer Ungeschicklichkeit. Aus lauter schlechtem Gewissen bestellte ich noch ein weiteres Bier, auch wenn ich vielleicht gar nicht die Zeit haben werde, es zu trinken.
Jelena hingegen hatte Brot, englischen Käse und Obst mitgebracht, da sie den Kochkünsten von Herbergsbesitzern, vor allem den ausländischen, generell misstraut. Ich schaute gleich nach dem Wirt und fragte mich, ob er unangenehm reagieren würde, wenn wir sein Essen so deutlich mit Verachtung strafen. Aber er schien beschäftigt. Erst als Jelena ihren Proviant vor aller Augen ausbreitete, beehrte er uns erneut mit seiner Gegenwart.
»Es gibt hier eine Küche«, erklärte er nachdrücklich. Jelena nickte und biss in einen Apfel.
»Wir haben warmes Essen. Fleisch und Kartoffeln. Auch Brot und Würste für eine schnelle Mahlzeit.«
Ich schenkte ihm mein freundlichstes Lächeln und versicherte, nicht hungrig zu sein. Das war zwar eine Lüge, doch ich kann Jelenas Vorräte auch in der Kutsche verzehren, was ohnehin eine bessere Idee gewesen wäre. Jelena kaute indessen unbeirrt an ihrem Käsebrot.
»Wenn die Damen nichts von meinem Essen wollen, dann können sie mit ihrem eigenen auch nach draußen gehen.« Der Wirt wurde lauter und deutlicher. Getuschel und ein paar Lacher drangen an mein Ohr. Einer unserer Mitreisenden, ein junger Anwalt, war aufgestanden und machte Anstalten uns zu Hilfe zu kommen, was ich vermeiden wollte, denn dann würde ich den Rest der Reise sein Gerede ertragen müssen. Daher versetzte ich meiner Zofe einen Tritt unter dem Tisch. Sie wendete langsam ihren Kopf zur Seite, um so endlich zuzugeben, dass sie die Anwesenheit des Wirts bemerkt hatte.
Jelenas Gesicht ist wandlungsfähig. Manchmal kann sie wie ein junges, kokettes Mädchen aussehen, dann wieder gleicht sie einer strengen Erzieherin. Doch jene Miene, die sie nun aufsetzte, ist ihre liebste Waffe gegen alle anstrengenden Zeitgenossen: Mit ihren hohen Wangenknochen und den leicht schrägen Augen verwandelte Jelena sich in den Inbegriff bäuerlicher Beschränktheit, als reiche ihr Verstand gerade noch dazu, Kühe zu melken und die Ernte einzubringen.
»Ich nicht verstehen«, murmelte sie und ich unterdrückte ein Lachen. Glücklicherweise war der Wirt nicht dabei, als sie in London mit dem Kutscher schäkerte, um den Preis für die Fahrt nach Bristol herunterzuhandeln.
»Sie kann leider kaum Englisch«, mischte ich mich nun ein und verfluchte Jelena im Stillen, weil ich ihretwegen immer wieder zur Schauspielerin werden musste, nicht gerade meine größte Begabung. »Sie ist Russin und erst seit kurzem hier. Sie müssen verstehen, Russland ist ein armes Land. Dort gibt es keine Wirtshäuser, wo man Essen bekommt. Sie ist es gewöhnt, ihre eigenen Vorräte mitzubringen. Aber mir können Sie gern Brot und Wurst für die Reise einpacken.« Ich gönnte dem Wirt das süßeste Lächeln, zu dem ich fähig bin. Einiges habe ich doch gelernt von meiner Zofe, die mich prompt zornig anfunkelte, weil ich Lügen über ihre Heimat verbreitete. Außerdem bin ich ja auch schuld daran, dass wir überhaupt hier sind, in der Fremde, und nun auch noch auf dem Land.
Ich habe das Landleben selbst nie besonders geliebt, ganz gleich, in welchem Land ich mich gerade aufhielt. London vermisse ich schon jetzt. Die Stadt ist mir in den letzten drei Jahren ans Herz gewachsen, mehr als jede andere, in welcher ich jemals gelebt habe. Und das waren viele. Ich sehne mich nur selten zurück nach den Orten meiner Geburt und Kindheit, dem kaiserlichen Wien oder der alten, verträumten Stadt Prag. Beide sind für mich Geschichte. Doch das lebendige London fasziniert mich, sein Farbenreichtum entspricht meinem Gemüt. Hier wurde ich zur Künstlerin. Sogar die Neugierde, einmal meine wahre Heimat zu sehen, hat nachgelassen. Aber das ist nicht verwunderlich.
Ich bin Malerin. Ich entwerfe Theaterkulissen und Kostüme. Ich male Bilder und bekomme Geld dafür. All das, wovon ich jahrelang träumte, hat sich erfüllt. Manchmal fürchte ich, eine Schlafende zu sein, der bald schon ein enttäuschendes Erwachen blüht. Doch bisher hat der Traum kein Ende gefunden.
Unsere Mitreisenden schauen die ganze Zeit herüber. Der junge Anwalt verschlingt Jelena und mich mit seinen Blicken und die beiden Witwen fortgeschrittenen Alters zerreißen sich offensichtlich die Mäuler über uns. Seufzend unterdrücke ich den Wunsch, mir eine Zigarre anzuzünden. Vielleicht findet sich später eine Gelegenheit, um kurz im Wald zu verschwinden.
Nachdem der Wirt sich damit abgefunden hatte, eine unzivilisierte Wilde als Gast zu haben, fragte ich Jelena auf Deutsch: »Gefällt dir die Reise nicht? Du bist doch in der Provinz aufgewachsen.« Jelena trank von dem Rest ihres Biers und verzog das Gesicht.
»Deshalb muss ich das Landleben aber nicht mögen. Wie lange dauert es noch, bis wir endlich da sind?«, erwiderte sie auf Russisch, lauter als notwendig. Als ob wir nicht schon genug aufgefallen wären! Ich beschloss, sie ein wenig zu ärgern, und fuhr auf Englisch fort, denn der Wirt schien außer Hörweite.
»Noch ein paar Stunden bis Bristol, denke ich. Es kommt darauf an, wie viele Pausen wir machen. Und dort werden wir abgeholt. Ich weiß leider nicht genau, wie weit Marie Luises Heim von Bristol entfernt ist.«
Sie verzog das Gesicht, um mir klarzumachen, was für eine alberne, vollkommen überflüssige Idee diese Reise in ihren Augen war. So wie die meisten Ideen, welche ich seit dem Tod meines Vater gehabt hatte. Ich ärgere mich ein wenig über ihre Undankbarkeit. Wer weiß, wie ihr weiteres Leben in Russland verlaufen wäre, hätte ich mich damals entschlossen, der Einladung meiner Tante nach Moskau zu folgen. Dann hätte Jelena dort als eine von vielen Leibeigenen im Haushalt arbeiten können, den Launen meiner Tante ausgeliefert und ohne jedes Recht, deshalb auch nur verärgert dreinzublicken.
Aber mir stand der Sinn nicht danach, mit Jelena zu streiten. Sie wird dabei meist sehr laut und sehr russisch. Ein paar der einheimischen Gäste starrten uns außerdem bereits unverhohlen an. In London gingen wir in der Masse von Seeleuten, Händlern und Weltenbummlern, von Durchreisenden und dort ansässigen Fremden unter. Aber hier auf dem Land ist es ganz und gar englisch. Wir passen beide nicht hierher, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
Seit es mir endlich gelungen ist, etwas Geld zu verdienen, und Jelena noch zusätzlich für unsere Nachbarn wäscht, kann sie sich ein wenig Luxus leisten: drei leuchtend rote Kleider, aus Baumwolle und Leinen, ja eines gar aus Seide. Es ist gewiss nicht neu, doch gut erhalten. Sie muss es auf einem jener Märkte erworben haben, die sie mit Vorliebe aufsucht. Rot ist eine gewagte Farbe für eine Frau von über vierzig Jahren, vor allem im puritanischen England. Zudem harmoniert dieser Farbton nicht unbedingt mit dem rötlichen Schimmer ihres kastanienbraunen Haars. Aber das kümmert Jelena nicht. Sie hat ein buntes Tuch um ihre Schultern geworfen, so wie es die einfachen Russinnen tun. Es kann unmöglich noch aus Russland stammen, sie ist seit über zwanzig Jahren nicht in ihrer Heimat gewesen. Die Tücher und Kleider und skurrilen Schätze, die sie zu einer Verkörperung aller Fantasien machen, welche es hierzulande wohl über Russinnen gibt, entdeckt Jelena auf ihren Märkten. Ob diese Fantasien richtig oder falsch sind, scheint dabei völlig unwichtig. In Wien und Prag hat sie sich viel unauffälliger gekleidet. Doch hier, so weit von ihrer Heimat entfernt, wie es der europäische Kontinent nur zulässt, will sie plötzlich ihre Herkunft zur Schau stellen.
An mir ist nichts sonderlich russisch, am allerwenigsten mein Empfinden. Ich war ein kleines Kind, als mein Vater seine Heimat verließ, um niemals wieder zurückzukehren. Das halbherzige Angebot meiner Tante, welches ich nach seinem Tode erhielt, nahm ich aus Stolz nicht an, so dass ich das Land meiner Geburt bis heute nicht bewusst gesehen habe. Auch mein Äußeres ist in keiner Weise markant slawisch. Mein Englisch klingt noch etwas fremd, doch meist werde ich für eine Deutsche gehalten. Das ist nicht erstaunlich. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich deutsch gesprochen.
Aber auch meine Erscheinung erregt hier in der Herberge Aufsehen. Nicht etwa, weil sich die Männer gewöhnlich nach mir umdrehen würden. Jelena ist trotz ihres fortgeschrittenen Alters in dieser Hinsicht weitaus erfolgreicher, und sie strebt derartigen Erfolg auch an. Ich selbst war niemals erpicht darauf, angestarrt zu werden. Aber jetzt geschieht es dennoch. Mein Kleid, das unter den herausgeputzten Schauspielern, Straßenhändlern und vornehmen Herrschaften, welche die Theater von Drury Lane und Covent Garden sowie die Kaffeehäuser oder Tavernen in der Nähe aufsuchen, recht bescheiden wirkt, schreit hier geradezu nach Aufmerksamkeit.
Natürlich könnte ich mich etwas unauffälliger kleiden und dennoch Malerin sein. Dieser Gedanke steht Jelena jedenfalls im Moment geradezu ins Gesicht geschrieben. Ich, das Kind eines Grafen, bräuchte mich nicht bunt herauszuputzen und zu schminken wie ein Theatermädchen. Natürlich bräuchte ich das nicht. Aber ich putze mich gern so heraus! Die schlichten, züchtigen Gewänder meiner Kindheit und frühen Jugend habe ich abgelegt. Sie gehörten zu einem Teil meines Lebens, der endgültig vorüber ist. Zwar hätte ich in ihnen hier in dieser abgelegenen Herberge weitaus weniger befremdlich gewirkt, aber diese Überlegung ist rein spekulativ, denn meine alten Kleider habe ich ein paar Straßenhändlern in Prag geschenkt, bevor ich die Stadt verließ – Menschen, an deren Seite ich viele Monate lang gestanden und nicht selten erbärmlich gefroren hatte, in der verzweifelten Hoffnung auf einen Käufer für meine Bilder.
Es gab da einen älteren Mann unter ihnen, der für vorbeigehende Herrschaften die Arien des Herrn Mozart sang, nicht schlecht übrigens, doch war er für die Oper wohl zu alt. Einer jener vielen Menschen, denen das Schicksal zwar Begabung, aber nicht das Glück geschenkt hatte, von dieser wirklich leben zu können. Wenn er nicht sang, da seine Stimme im Winter oft heiser war, fuhr er mit einem kleinen Karren spazieren und verkaufte Punsch, den er aus einem Fass in nicht unbedingt saubere Becher füllte. Bei klirrender Kälte fanden sich genügend Abnehmer.
Ich erinnere mich an einen Abend in Prag, ich glaube nur wenige Tage, bevor ich Charlie traf, als die Kälte sich wieder derart in meine Knochen gefressen hatte, dass ich mir nicht mehr sicher war, ob ich ohne Hilfe den Weg nach Hause schaffen würde. Mir liefen die Tränen über die Wangen vor Verzweiflung, und ich konnte einen bösen Gedanken in meinem Kopf nicht mehr bändigen: Bereits ein Jahr, nachdem ich stolz meiner Familie den Rücken gekehrt hatte, um von der Malerei zu leben, war ich kaum mehr als eine Bettlerin, die vor Kälte schlotternd ihre Hände nach vorbeiziehenden Besuchern des neu gebauten Prager Theaters ausstreckte, immer in der Hoffnung auf ein Almosen. Ich muss noch erbärmlicher ausgesehen haben als die übrigen Bettlerinnen, denn der alte Mann blieb mit seinem Karren vor mir stehen, füllte einen Becher großzügig mit herrlich heißem Punsch und drückte ihn in meine blaugefrorene Hand. Er sagte nichts und ich dankte schweigend. Keiner von uns wollte ein Wort darüber verlieren, dass die Tochter des Grafen Serbinskij nicht mehr in der Lage war, sich einen Becher Punsch zu kaufen.
Einige Wochen später sah ich den Mann durch Zufall wieder. Ich war bereits Charlies Mädchen und ging an seinem Arm, um die Arien des Herrn Mozart im Opernsaal zu hören. Der alte Mann nickte mir nur unauffällig zu, denn er kannte die Regeln der Welt, zu welcher wir beide gehörten. Diejenigen, denen ein Aufstieg gelungen war, nahmen Zurückgebliebene nur ungern wahr. Ich kam jedoch am nächsten Abend wieder an den Ort zurück und bot ihm all meine alten Besitztümer an, die ich nicht nach London mitnehmen wollte. Er schien sich nicht gekränkt zu fühlen. Menschen in seiner Lage können sich allzu viel Stolz nicht erlauben, auch das hatte ich bereits gelernt. Er suchte sich drei Kleider aus warmem, dunklem Stoff für seine Tochter aus, eines davon mit einem fein verzierten Spitzenkragen, denn die Tochter wollte sich demnächst vermählen. Ich selbst, das wusste der Straßenhändler, würde nun so schnell keinen Ehemann mehr finden, da ich einen anderen Weg eingeschlagen hatte. Charlie würde mich niemals heiraten, ja, in London, seiner Heimat, würde er vermutlich kein Opernhaus mit mir aufsuchen, um nicht von Bekannten seiner Mutter in Begleitung der falschen Frau gesehen zu werden. Das alles war ein Teil des Handels, auf den ich mich eingelassen hatte. Die meisten jungen, einigermaßen ansehnlichen Frauen aus jener Halbwelt der Straßenhändler, Gauner und erfolglosen Künstler verließen irgendwann den Pfad der Tugend. Deshalb wunderte sich eigentlich niemand unter den Anwesenden, als ich meine letzten anständigen Kleider verschenkte, bevor ich in London ein neues Leben begann.
Aber meine Gedanken sind wieder einmal auf Wanderschaft gegangen, eine Neigung, die Jelena in höchstem Maße missfällt. Genau wie der Umstand, dass ich so oft schreibe. Ich habe den Eindruck, dass sie sich dann vernachlässigt fühlt.
»Ich kann es kaum erwarten, Marie Luise zu sehen«, begann ich, um meine einstige Leibeigene etwas freundlicher zu stimmen. Das gelang mir allerdings nicht, schon der Einstieg war falsch.
»Wie lange willst du dort bleiben?«, murmelte sie missmutig und kaute weiter an ihrem Brot.
»Ich weiß es nicht. So lange, wie sie meine Gesellschaft haben möchte und wie ich von London fortbleiben kann, ohne dass meine Auftraggeber mich vergessen.«
»Das könnte schneller geschehen, als du denkst.«
Es überrascht mich ein wenig, Jelena wegen meiner Aufträge besorgt zu sehen. Meinem Wunsch, von der Malerei zu leben, schenkte sie lange Zeit ungefähr so viel Beachtung wie den Träumen eines zwölfjährigen Bauernmädchens, eines Tages einen Prinzen zu heiraten. Nein, ich glaube, Letzteres hätte sie sogar ernster genommen. Doch muss ihr wohl aufgefallen sein, dass unsere Lage sich allmählich gebessert hat, obwohl ich nicht willens war, von meinem Liebhaber mehr als nur ein kleines Haus als Geschenk anzunehmen. Es liegt in der Nähe der Theatergebäude, denn in das bunte Treiben rund um den Markt von Covent Garden verliebte ich mich auf den ersten Blick. Wir haben letzten Winter nicht mehr gefroren, da genug Brennholz für den Kamin zur Verfügung stand. In ein paar Monaten können wir vielleicht wieder regelmäßig Fleisch essen, so wie damals, als mein Vater noch lebte. Meine Kleider und die wenigen Möbelstücke erwerbe ich mit Geld, das ich als Künstlerin und nicht als Mätresse verdiene, und dieser Umstand erfüllt mich mit Stolz.
»Und außerdem, was ist, wenn Sir Charles zu lange auf dich warten muss? Er wird womöglich sehr schnell Ablenkung finden.«
Mit diesem Satz zerstörte Jelena die Illusion, ich sei in ihren Augen nun in erster Linie Malerin. Für sie bin ich weiterhin ein junges Mädchen, das auf den Schutz eines wohlhabenden Mannes angewiesen ist. Bedauerlicherweise hat sie damit nicht ganz Unrecht.
Ohne Charlies Hilfe hätte ich kaum meine ersten Aufträge bekommen, und ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt schon ein weises Vorhaben wäre, auf seine Unterstützung zu verzichten. Dieser Gedanke trübt meine Stimmung ein wenig.
»Charlie findet stets Ablenkung, wenn er sie sucht«, erwiderte ich trotzig wie ein Kind. »Aber das ändert nichts an seinem Verhältnis zu mir.«
Jelena zuckte mit den Schultern. Ihre Miene verriet, dass sie meine Aussage für albern und unsinnig hielt, es aber mit den Jahren aufgegeben hatte, mir meine verrückten Ideen ausreden zu wollen. Ich bin das einzige Kind, das ihr geblieben ist, auch wenn sie mich nicht selbst auf die Welt gebracht hat. Sie liebt mich, so wie sie wohl auch ihren Sohn in Sankt Petersburg lieben würde, wenn er dies nur zuließe. Aber ihr Sohn ist dank der Hilfe meines Vaters Anwalt geworden und schämt sich nun für seine bäuerliche, ungebildete Mutter. Mir scheint, dass Jelena ihn verstehen kann, ganz gleich wie sehr sie auch unter dieser Zurückweisung leidet. Mich jedoch, die sich ihr gegenüber keiner Zurückweisung schuldig macht und schon seit Jahren darauf verzichtet, sie wie eine leibeigene Bedienstete zu behandeln, mich versteht sie nicht. Auch wenn sie mich liebt, ebenso wie ihren Sohn, ja vielleicht sogar noch mehr. Tief in ihrem Inneren hat Jelena sich immer eine Tochter gewünscht, glaube ich. Ein Mädchen, dem sie all ihre Lebensweisheit über die geheimnisvollen Künste und Listen des Frauseins beibringen konnte. Nur, dass ihre Ratschläge bei mir nicht auf fruchtbaren Boden fielen.
Weit geeigneter wäre Marie Luise als Ziehtochter gewesen, auch wenn Jelena stets etwas abfällig über meine Freundin sprach. »Du bist nicht weniger hübsch als diese kleine Österreicherin«, murmelte sie früher, während sie mein Haar frisierte und Zierkämme hineinsteckte. »Du weißt dich einfach nicht richtig zu benehmen, das ist alles. Du bist zu schüchtern und zu ungelenk, sonst würdest du einen größeren Eindruck machen, glaube mir. Ein so hübsches Mädchen wie du und kein einziger Verehrer, da soll einer die Welt verstehen …«
Damals, als ich jung und überaus belesen, aber ahnungslos diesen Worten lauschte, verwirrten sie mich nur. Marie Luise war meine Freundin, die einzige, welche ich mit Fug und Recht so nennen konnte, denn mein Vater lebte sehr zurückgezogen und schätzte mit zunehmendem Alter die Gesellschaft von Büchern mehr als die anderer Menschen. Ohne Marie Luise hätte ich niemals Eingang gefunden in die Welt der Bälle und gegenseitigen Visiten unter Leuten der besseren Gesellschaft, wo junge Mädchen nach zukünftigen Ehemännern Ausschau halten konnten.
Ich saß dort, wo andere sich so gern vergnügten, fühlte mich verloren und wusste nicht, wie ich mich an Gesprächen beteiligen sollte, die mir völlig sinnentleert schienen. Mein Vater hatte mir beigebracht, mit ihm über Philosophie und Literatur zu diskutieren. In dieser Art von Konversation hatte ich einiges Talent entwickelt, doch nützte mir mein klares Denkvermögen, welches meinen Vater mit Stolz erfüllte, im Ballsaal wenig. Ganz gleich, wie sehr Jelena auch an meinen Haaren herumzupfen mochte oder wie häufig sie meinen Vater bedrängte, mir ein paar schöne Kleider zu kaufen statt immer neue Bücher: Die jungen Herren verlangte es nicht nach meiner Gesellschaft. Sie ertrugen mich nur, um in Marie Luises Nähe sein zu dürfen. Sie lachte und kicherte bereitwillig über jene Scherze, die mir so hoffnungslos albern erschienen, stellte ihre Grübchen zur Schau und flirtete geradezu hemmungslos. Nie wich sie von meiner Seite, als wisse sie nur zu gut, wie elend mir dann erst zumute sein würde. Mir wäre es nie in den Sinn gekommen, Marie Luise als eine Konkurrentin zu betrachten, die es zu übertrumpfen galt. Doch Jelena sah die Dinge so. Marie Luise aber erkannte den wahren Grund für meine Erfolglosigkeit oder wagte es, ihn auszusprechen.
»Du siehst so schrecklich ernst und klug aus. Das macht den Leuten Angst, vor allem, wenn sie dich nicht näher kennen. Und die meisten Männer mögen so etwas nicht bei einer Frau.« Sie hatte Recht. Sie war gar nicht so dumm, meine Marie Luise.
Nun, nach vielen Jahren, muss sie durch Zufall herausgefunden haben, dass wir uns wieder im selben Land aufhalten. Ich hatte sie noch irgendwo in den englischen Kolonien vermutet, wo der Mann ihrer Träume Zuckerplantagen besitzt, soweit ich mich erinnern kann. Und sie dachte wohl, ich wäre noch in Prag oder in Russland bei meiner Tante und vielleicht auch verheiratet, wer weiß. Als es mir wirklich schlecht gegangen war, hatte ich aufgehört, ihr zu schreiben, da ich mich für meinen Misserfolg schämte. Und je näher wir nun ihrem Hause kommen, desto mehr wächst meine Verunsicherung angesichts unseres bevorstehenden Wiedersehens.
Jelena macht mich darauf aufmerksam, dass die Kutsche weiterfahren wird. In ihren Augen steht ein stummer Vorwurf, weil ich so lange Zeit schweigend vor ihr saß und ins Schreiben vertieft war. Ich sollte versuchen, sie den Rest der Reise ein bisschen zu unterhalten, damit sie nicht auf die Idee kommt, wieder umzukehren. Ohne Jelena an meiner Seite würde ich mich schrecklich verloren fühlen, sie ist die einzige Konstante in meinem Leben.
Heute kommt sie, die Abenteurerin. Lady Cavender blickt schon seit dem Frühstück sehr missmutig drein, und Master Anthony hat mit seiner Frau heute noch kaum ein Wort gewechselt. Die Hartnäckigkeit, mit welcher sie auf eine Einladung dieser eigenartigen Person bestanden hat, ist auch sehr ungewöhnlich gewesen. Ansonsten versucht die junge Lady Marylouise, ihrem Mann alles recht zu machen, auch wenn ihr dieses Kunststück selten gelingt. Darin ergeht es ihr wie allen anderen.
Manchmal würde ich es der Lady Marylouise gern ins Ohr flüstern, damit sie weniger traurig dreinblickt, wenn ihr Mann wieder einmal unfreundlich zu ihr ist. Sie hat mein Mitgefühl, von Anfang an, schon als der junge Herr sie auf die Plantage mitgebracht hat, damals in Jamaika. Sie sah eigentlich nicht viel besser aus als die meisten der neu eingetroffenen Sklaven: ängstlich, verwirrt und geschwächt. Die lange Seereise schien ihr nicht gut bekommen zu sein, sie war in einer fremden Umgebung, und erstaunlicherweise sprach dieses weiße Mädchen nicht besonders gut englisch. Damals wusste ich noch nicht, dass die Weißen in verschiedene Völker zerfallen und daher verschiedene Sprachen haben, genauso wie mein Vater es mir über die Afrikaner erzählt hat. Ich wusste überhaupt sehr wenig über die Weißen. Das hat sich geändert, seit wir in England sind.
Für meinen Vater waren die Weißen nicht wirklich Menschen, sondern seltsame Dämonen in menschenähnlicher Gestalt. Er beharrte stets darauf, dass von ihnen ein unangenehmer Geruch ausgehe und ihre Behaarung sie den Tieren besonders ähnlich mache, was ja sicher seine Gründe hätte. Gefühle traute er ihnen nicht zu, denn er hielt sie für vollkommen bösartig. Meine Mutter verdrehte stets die Augen, wenn er so redete, und meinte, er sei ein Dickkopf, der sich selbst noch in große Schwierigkeiten bringen würde, aber sie widersprach ihm nicht, jedenfalls nicht, solange er kein Mitglied der Familie Cavender angriff, vor allem nicht die alte Lady Cavender, deren Zofe meine Mutter fast ihr ganzes Leben lang gewesen ist.
Meine Mutter gehörte zu den privilegierten Sklaven, welche im Haus arbeiten. Sie trug saubere Kleidung, durfte sich meist satt essen und hatte gute Aussichten, länger als nur ein paar Jahre zu leben, da keine übermäßige körperliche Anstrengung von ihr verlangt wurde. Sie verdankte dieses Privileg ihrer hellbraunen Haut und den grünlichen Augen. Der Vater meiner Mutter, mein Großvater also, muss ein Weißer gewesen sein. Dies gehört zu den Dingen, welche eigentlich alle in meiner Familie wissen, die aber niemals ausgesprochen werden, als könne allein ihre Erwähnung einen bösen Geist zum Leben erwecken, der uns alle verschlingt. Meine Mutter wusste um ihr Glück und verhielt sich stets vernünftig, denn ihr war klar, dass jemand in ihrer Lage sich Unvernunft nicht erlauben kann.
Der alte Lord Cavender war unvernünftig, heißt es, er trank zu viel und spielte und verlor eine Menge Geld, worunter die Familie später leiden musste. Aber sie litt nicht in dem Maß, wie meine Leute leiden, wenn sie unvernünftig gewesen sind, denn immerhin sind alle Cavenders noch am Leben, und das fehlende Geld hat der junge Master Cavender durch seine günstige Heirat mit der Lady Marylouise wieder ins Haus gebracht. Reiche, weiße Familien können die Folgen von ein wenig Unvernunft hier und da recht gut überstehen.
Es gab eigentlich nur einen Moment im Leben meiner Mutter, da ihr Handeln nicht von der Vernunft gelenkt war, die sie am Leben hielt, nämlich den Augenblick, da sie beschloss, meinen Vater zum Mann zu nehmen. Sie erzählte mir einmal davon, als sie zu ahnen begann, dass die Dinge zwischen meinem Vater und mir nicht zum Besten standen, als wollte sie mir klar machen, wie wichtig dieser Mann in ihrem Leben war. Das erste Mal sah sie den tiefschwarzen, großen Afrikaner nur aus der Ferne, aber sie fand sofort Gefallen an ihm, vielleicht, weil er all das zeigte, was sie sich aus Gründen der Vernunft verbot: Stolz, Aufsässigkeit und den Mut zum Widerstand. Trotz seiner Körperkraft hätte mein Vater als Feldsklave wohl nicht lange überlebt, da er zu oft den Zorn von Aufsehern auf sich lenkte. Meine Mutter bescherte ihm ein angenehmeres Leben als Hausdiener, lehrte ihn, seinen Zorn zu bändigen, indem sie ihm Dinge schenkte, für die es sich in dieser neuen Welt zu überleben lohnte. Gleichzeitig zerstörte sie seine Freundschaften mit Gleichgesinnten, denn wir Haussklaven waren unter den Feldarbeitern nicht gerade beliebt, da wir ein komfortableres Leben führen durften. Mein Vater galt nun als Verräter. Seinen Traum, eines Tages zu fliehen und sich den Rebellen in den Bergen anzuschließen, von denen er so oft sprach, begrub er oder gab ihn vielmehr an meine Schwester weiter, da ich, sein Sohn, zu der Verwirklichung dieses Traums so wenig geeignet bin. Ich denke, mein Vater hat viel zu Sadies Problemen beigetragen, indem er ihr, einem Mädchen und noch dazu einer Sklavin, beibrachte zu denken wie ein Krieger.
Aber ich schweife ab. Ich habe Gefallen am Schreiben gefunden und kann nun einfach nicht mehr aufhören. So muss es bei dem alten Lord Cavender mit dem Trinken und dem Glücksspiel gewesen sein. Dabei waren noch bis vor gar nicht langer Zeit die Bücher der Weißen unlösbare Rätsel für mich. Ich staubte sie täglich ab mit der Gründlichkeit, die meine Mutter mich gelehrt hatte, und fragte mich, welche Geheimnisse sie den Cavenders wohl verrieten, wenn sie von ihnen in die Hand genommen wurden. Die alte Lady Cavender liest nur selten und wenn, dann die Bibel, aus welcher sie uns gelegentlich auch vorgetragen hat, in der Überzeugung, so zur Rettung unserer Seelen beizutragen.
Der junge Master Cavender erhält Zeitungen, mit denen er sich vormittags in sein Arbeitszimmer zurückzieht, und gelegentlich Bücher über die Jagd. Ich denke, diese Dinge hätten auch meinen Vater interessiert, ganz gleich wie oft er behauptete, die Gedanken und Schriften der Weißen könnten nur verachtenswert sein. Mit der Lady Marylouise hielt allerdings noch eine neue Art von Buch Einzug in den Haushalt der Cavenders.
»Romane«, murmelte die alte Lady missbilligend, als seien die Seiten dieser Bände mit Gift beträufelt, oder als könne man bei ihrem Anblick erblinden.
»Liebesgeschichten«, erklärte die junge Lady damals. Anfangs lächelte sie noch versöhnlich, wenn sie gerügt wurde. Das änderte sich aber schnell.
Ich träumte davon, all diese Texte einmal zu entziffern, denn sie schienen mir wie die Tür zu einer besseren Welt, ja vielleicht stand in ihnen gar erklärt, wie man jene Art von Überlegenheit erreicht, welche die Cavenders zu Herrschaften macht, die sich unsereins als Diener halten. Doch fehlte mir der Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Ich wusste nicht, wie all jene seltsamen Zeichen sich vor den Augen des Betrachters in Dinge und Bedeutungen verwandeln.
Erst als wir in England ankamen, änderte sich das. Die Weißen sind hier in der Mehrzahl, ganz anders als in Jamaika. Viele von ihnen laufen ebenso elend und zerlumpt herum wie die Sklaven auf der Plantage der Cavenders. Seltsamerweise sind die meisten Weißen hier netter zu uns als in Jamaika, vielleicht, weil sie hier zu Hause sind und es so viele von ihnen gibt. In Jamaika bekamen wir außer den Cavenders nur weiße Aufseher zu Gesicht, und natürlich den Verwalter Malraux, dem die meisten von uns gern aus dem Weg gingen.
In England ist eigentlich jeder weiß, vom Bettler bis zum feinen Herren in der Kutsche. Anfangs wurden wir daher auch manchmal angestarrt, aber weniger mit Verachtung wie von den Aufsehern in Jamaika denn mit Neugierde, Staunen und auch Furcht, da man uns offenbar für gefährlich hielt und meinte, wir verfügten über Zauberkräfte. Ein paar zerlumpte Jungs auf der Straße in Bristol fragten mich einmal, ob ich ein Menschenfresser sei. Das wirklich Lustige daran war, dass man in Afrika angeblich ähnliche Dinge über die Weißen denkt. Man glaubt, sie verschleppen die Leute, um sie aufzuessen. Und ausgerechnet hier, in dem Land der Weißen, fand sich ein Mann, der mich die Schrift der Weißen lehrte.
Er ist Schneider in Bristol und fertigt die Anzüge des jungen Master Cavender an. Der Herr hat einen sehr eigenen Geschmack, wie ich weiß. Er schätzt teure, edle Stoffe wie Samt und Damast, doch verabscheut er jenen überflüssigen Zierrat, die Schleifen, Rüschen und gepuderten Perücken, welche bei Hof angeblich Mode sind. So habe ich ihn öfter reden hören, vor allem, wenn er das Aussehen seiner Frau, der Lady Marylouise, bemängelt. Dieser Schneider in Bristol versteht es, die Vorstellungen des Master Cavender genau zu erfüllen, weshalb er regelmäßig Aufträge von ihm erhält. Nun, dieser Schneider ist ein so genannter Quäker und damit auch ein Gegner der Sklaverei. Das alles erfuhr ich erst viel später, nachdem ich Freundschaft mit seinem Sohn geschlossen hatte, dessen Gesicht durch eine Hasenscharte entstellt ist und der stottert. Nur aus diesem Grund wagte ich, den weißen Jungen anzusprechen, nämlich weil wir etwas gemeinsam haben. Man findet uns beide hässlich. Davids Vater schien erstaunlicherweise erfreut, dass jemand bereit war, sich mit seinem Sohn abzugeben. In Bristol wurde David von Altersgenossen meist gehänselt und gelegentlich auch verprügelt, so wie es mir auf der Plantage in Jamaika ergangen war. Hierzulande macht die Farbe meiner Haut mich zum Außenseiter. Dass ich außerdem einen verkrüppelten Fuß habe, fällt deshalb nicht so auf.
Ich wurde an einem Sonntag bei Davids Familie eingeladen, und da der junge Herr seinen besten Schneider nicht verärgern wollte, durfte ich die Einladung annehmen. So schloss ich erstmals in meinem Leben Freundschaft mit einer weißen Familie, was mein Vater in Jamaika niemals gebilligt hätte. Aber mit wem soll ich denn sonst Freundschaft schließen, wenn alle um mich herum weiß sind? Ich habe allmählich begriffen, dass es sich weitaus besser lebt, wenn man anderen Menschen die Gelegenheit gibt, manchmal nett zu einem zu sein.
David ist nun mein erster und einziger Freund. Gemeinsam mit ihm lernte ich lesen und schreiben, was ich sicherheitshalber aber nur meiner Schwester Sadie anvertraute. Sie selbst interessiert sich dafür nicht, da unser Vater das nicht gewollt hätte. Er hat ihr ein paar arabische Schriftzeichen beigebracht, als er noch bei uns war, und sie davon überzeugt, dass diese Schrift ebenso gut ist wie die der Weißen. Das mag ja stimmen. Aber was nützt es mir, eine Schrift lesen zu können, in der kein einziges Buch in meiner Umgebung geschrieben ist? Wie kann ich durch diese Schrift jemals etwas lernen? Sadie macht es wütend, wenn ich so etwas sage.
Gelesen habe ich bisher einige Texte aus der Bibel, dem einzigen Buch im Haus von Davids Vater, doch das war kein so großer Gewinn, denn aus der Bibel hat uns ja bereits die alte Lady Cavender manchmal etwas vorgetragen. Gelegentlich wage ich es auch, aus der Bibliothek ein Buch zu entwenden. Die Cavenders gehen selten in ihre Bibliothek, so dass es ihnen nicht auffällt. Ich zünde nachts eine Kerze an und kämpfe mich durch den Text, obwohl mir die Augen brennen und anfangs auch mein Kopf vor Anstrengung schmerzte, so sehr hatte ich mit unbekannten Wörtern und verworrenen Sätzen zu kämpfen. Doch in letzter Zeit ist es leichter geworden.
Ich folgte der Laufbahn eines armen Mädchens, das sich weigert, die Geliebte eines reichen Mannes zu werden und schließlich von diesem geheiratet wird. Das schien mir unglaubwürdig, denn gewöhnlich verfahren reiche Männer anders mit armen, widerspenstigen Frauen. Dann folgten noch einige Beschreibungen über angemessenes Benehmen eines Gentleman, was mir klarmachte, dass auch unser Master Cavender nicht als solcher auf die Welt gekommen war, sondern Richtlinien braucht. Am schwierigsten, aber auch faszinierendsten war bisher der Text eines gewissen Milton, der in Versen geschrieben ist und vom Sündenfall erzählt, wobei es dort etwas anders zugeht als in der Bibel. Satan könnte einem fast sympathisch sein, er ist stark und lässt sich nicht unterkriegen. Es gelingt mir immer noch nicht, alles zu verstehen, aber die Schönheit der Sprache ist berauschender als ein paar Gläser Rum. Leider besitzen die Cavenders nicht viele solcher Bücher. Und jene, die sie haben, lesen sie nicht. David hat mir von einem Theaterstück erzählt, das er einmal in London gesehen hat, heimlich mit seiner Tante, denn Davids Vater hält das Theater für Teufelswerk. In diesem Stück ging es um einen schwarzen Mann, jedenfalls hatte man dem Schauspieler viel schwarze Farbe ins Gesicht geschmiert. Allerdings hat David das Stück nicht ganz begriffen, weil er damals noch sehr jung war. Nur, dass am Ende der schwarze Mann und seine Frau tot waren, daran erinnert er sich. Seine Tante weinte deshalb und erklärte, es sei immer gefährlich, einen Fremden zu heiraten. Irgendwann bekomme ich vielleicht heraus, wie dieses Stück heißt. Ich würde gern wissen, was diesen Shakespeare dazu gebracht hat, sich eine Geschichte über einen Schwarzen auszudenken.
Ich lernte auch zu schreiben und erhielt Blätter, um es zu üben. Mein heimliches Vergnügen ist es inzwischen geworden, ebenso wie das Lesen, eine Art Laster, das ich vor dem Rest der Welt geheim halten muss. So wie eben der alte Lord Cavender lange seine Schuldscheine und unbezahlten Rechnungen verbarg, habe ich Blätter unter meiner Matratze versteckt. Der Stapel wächst. Vorige Woche habe ich ein wenig Papier aus dem Arbeitszimmer des Master Cavender gestohlen. Ich darf aber nicht zu leichtsinnig werden, denn wenn mein Geheimnis entdeckt wird, würde ich in große Schwierigkeiten geraten. Die Cavenders wollen bestimmt nicht, dass ich lesen kann! Ihre Bücher würden sie mir nie freiwillig ausleihen. Und meine Mutter wäre entsetzt. »Man sollte die Herrschaften niemals unnötig verärgern«, erklärte sie meiner Schwester und mir von klein auf, nur, wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt, eben wenn eine Sache sehr, sehr wichtig ist. Und das Niederschreiben eigener Gedanken wäre sicher keine wichtige Sache in ihren Augen.
Aber ich wollte davon berichten, dass diese Abenteurerin kommt. Setzt man sich einmal hin, um in Ruhe über eine einzige Sache zu schreiben, kommen die Gedanken aus allen Richtungen herbei, so wie die Leute auf den Marktplatz rennen, wenn neue Ware eingetroffen ist.
Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist, eine Abenteurerin. Von Abenteurern habe ich gelegentlich gehört. Der junge Master Cavender unterhält sich mit seinen männlichen Gästen manchmal über Forscher und Entdecker, die in fremde Länder aufbrachen, um herauszufinden, was es dort für England zu holen gäbe. Afrika ist eines dieser Länder. Weiße, die in das Land der Schwarzen kamen, waren Abenteurer. Wir hingegen kommen in ihr Land als Sklaven. Aber wie soll eine Abenteurerin aussehen? Eine sonnengebräunte Frau in Hosen? Mit einem Gewehr in der Hand? So eine Frau würde der junge Herr doch nicht über seine Türschwelle lassen.
Es begann vor ungefähr zwei Wochen. Der junge Herr hatte Besuch von einem anderen Herrn aus angesehener Familie. Eine Weile saßen sie mit den Damen des Hauses am Tisch, dann zogen sie sich zurück, um irischen Whiskey zu trinken und Zigarren zu rauchen, was Damen üblicherweise nicht tun. Ich folgte ihnen als ihr Diener, wodurch ich etwas von dem Gespräch mitbekam. Die Herrschaften übersehen unsereins vollkommen, wenn sie sich unterhalten. Ich glaube, sie vergessen sogar, dass wir hören können.
Der Gast begann nun von einem gewissen Sir Charles Clayton zu erzählen, den wohl beide Herren kennen. Diesen hatte er vor einigen Tagen in London auf einem Ball getroffen, und zwar in Begleitung einer ungewöhnlichen jungen Frau. Denn Sir Charles schätzt bei Frauen das Ungewöhnliche, wie der Gast grinsend hinzufügte. Master Cavender verzog sein Gesicht. Er schätzt das Ungewöhnliche nämlich ganz und gar nicht. Für ihn ist die Welt wie ein Zimmer, das nicht in Unordnung gebracht werden sollte, indem man Dinge an einen Platz rückt, wo sie nicht hingehören. Und diese Frau hat so einiges vom rechten Platz entfernt. Sie ist offenbar die Mätresse von diesem Sir Charles, eine Ausländerin, die von sich behauptet, Malerin zu sein, weil sie gelegentlich etwas für die Theater in London malt. Sie gehört jedenfalls nicht zu den Malern, deren Bilder Leute wie die Cavenders sich in ihren Häusern aufhängen. Außerdem sei sie belesen und könne Franzosen und Philosophen zitieren. Ich habe keine Ahnung, was das für Leute sind, doch offensichtlich mag unser junger Herr sie nicht. Das war deutlich an seinem Gesicht zu erkennen. Was ihn aber noch mehr aus der Ruhe brachte, war die Behauptung des Gastes, diese Frau sei eine Gräfin, wenn auch eine ausländische. Vielleicht stellte er sich vor, die alte Lady Cavender oder seine Frau würden plötzlich für das Theater malen, und sah deshalb so angewidert drein.
Es steht Damen nicht an, für Geld zu arbeiten, ebenso wenig wie adeligen Herren. Mein Herr bestand darauf, diese Frau müsse eine Lügnerin sein, die sich einen ausländischen Adelstitel zugelegt hätte, um sich interessant zu machen, doch sein Gast lachte nur. Das hatte er zunächst auch angenommen, aber einige Tage später war er bei dem russischen Botschafter eingeladen, was offenbar der Botschafter des Landes sein muss, aus dem die Abenteurerin stammt. Ich habe wenig Ahnung, welche Länder außer diesem hier noch von Weißen bevölkert werden. Der Gast meinte, russische Adelige hielten sich gern im Ausland auf, also kann dieses Russland ja wirklich kein so besonders schönes Land sein. Oder gibt es dort vielleicht nicht genug Bedienstete für die reichen Herrschaften? Auf jeden Fall kannte der Botschafter den Namen dieser Frau. Anfangs konnte ich ihn gar nicht verstehen oder gar aussprechen, da er ziemlich merkwürdig war, sehr lang, aber durchaus klangvoll. Natalja Serbinskaja. Reicher russischer Adel angeblich.
Unser Master Cavender runzelte nun die Stirn und ließ sich von mir nochmals nachschenken. »Trotzdem kann sie eine Hochstaplerin sein«, meinte er dann. »Vielleicht hat sie einfach diesen Namen angenommen. Im Ausland merkt das so schnell niemand.«
Ich staunte, wie nah ihm diese ganze Geschichte ging, als stelle eine Ausländerin, welche trotz ihres Titels für Geld malte, eine Bedrohung für ihn dar. Aber ich kann es auch verstehen. Für den jungen Herrn ist die Welt wie ein Turm aus einzelnen Ziegelsteinen. Manche liegen unten, andere oben. Zieht man nur einen Stein aus diesem Turm heraus, droht er einzustürzen. Der Gast jedenfalls beteuerte, er hätte das auch gedacht, aber es stimme vermutlich nicht, denn der russische Botschafter hatte eine Erklärung für das seltsame Verhalten der jungen Gräfin. Ein Sohn aus dieser Familie hat sich vor vielen Jahren ins Ausland abgesetzt, was ja die Lieblingsbeschäftigung russischer Adeliger zu sein scheint. Dieser Sohn jedoch muss tatsächlich gute Gründe gehabt haben, die Heimat zu verlassen. Seine seltsamen Ansichten und die Heirat mit der falschen Frau hätten der Familie missfallen. Der Sohn machte sich also aus dem Staub.
»Danach kehrte er angeblich nie mehr zurück und keiner weiß so genau, was aus ihm geworden ist«, beendete der Gast seine Rede gleichzeitig mit seiner Zigarre. »Aber es ist gut möglich, dass er eine Tochter hatte. Diese junge Frau würde dazu passen, nicht nur wegen des Namens, sondern auch, was ihr Benehmen betrifft. Du glaubst nicht, was für Bücher sie zitieren konnte! Vieles davon aufwieglerische Schriften von französischen Freidenkern. Was ein Mann sich wohl dabei denken mag, einem jungen Mädchen solche Lektüre in die Hand zu geben? Ihr Geist muss bereits in frühen Jahren vergiftet worden sein, worin mir auch der russische Botschafter zustimmte. Leider musste ich mir dann den Rest des Abends seine Pläne bezüglich der Erziehung seines Sohnes anhören, der angeblich mathematisch begabt ist und nur hier in England angemessen ausgebildet werden kann. Was stimmt denn nur mit diesem Russland nicht, frage ich mich. Aber wie dem auch sei, vermutlich ist sie also doch echt, diese Gräfin Natalja Serbinskaja.«
Ich hielt ihm ein Gefäß hin, in dem er seine Zigarre ausdrücken konnte, als plötzlich die Stimme unserer Lady Marylouise hinter mir erklang. Sie soll den Raum, in den sich die Herren zum Rauchen zurückziehen, eigentlich nicht betreten, und das müsste sie mittlerweile auch wissen, aber aus irgendeinem Grund kann die junge Lady es nicht lassen, immer wieder gegen die Gebote ihres Mannes zu verstoßen.
Master Cavender versucht stets, ihr dieses Verhalten abzugewöhnen, aber manchmal bricht ihr altes Naturell noch durch. Ich weiß eigentlich nicht, warum sie in das Zimmer kam. Falls sie ihrem Mann etwas Wichtiges hatte sagen wollen, dann vergaß sie es in dem Moment, sobald sie diesen merkwürdigen Namen hörte.
»Natalja Serbinskaja! Sie kennen sie?«, rief die Lady Marylouise, als sie auf den Gast zueilte, ausnahmsweise ohne den missbilligenden Blick ihres Mannes auch nur wahrzunehmen. Es lag eine solche Aufregung in ihrer Stimme, dass der Gast erst einmal erstaunt aufblickte.
»Kennen Sie sie denn?«, fragte unser Master Cavender seine Frau nun bissig, und sie schien endlich zu begreifen, dass er verärgert war. Die Weißen sind eigentlich nur wirklich weiß, wenn sie krank, erschrocken oder tot sind. Ansonsten ändert sich ihre Gesichtsfarbe immer wieder und ganz besonders oft geschieht das bei der jungen Lady. Sie wurde zunächst so blass wie ein frisch gewaschenes Bettlaken, um anschließend dunkelrot anzulaufen.
»Natürlich kenne ich sie. Sie kennen sie doch auch. Sie war meine Freundin in Prag, wo Sie meine Bekanntschaft machten. Auf dem Ball des Freiherrn von Stein habe ich neben ihr gesessen. Später gingen wir einmal alle zusammen am Fluss spazieren. Sie kam in Begleitung eines anderen jungen Russen namens Sergej. Haben Sie das vergessen?«
Ein anderer Mann hätte es vielleicht als Vorwurf aufgefasst, denn immerhin zweifelte sie daran, ob er sich an ihre erste Begegnung erinnern konnte. Aber es läge unserem jungen Herrn fern, sich von seiner Frau etwas vorwerfen zu lassen. Stattdessen dachte er nur einen Augenblick nach.
»Dieses junge Mädchen? Aber sie sah sehr anständig aus.«
»Warum sollte sie das denn nicht sein?« Der verwirrte Blick der Lady Marylouise wanderte von ihrem Mann zu seinem Gast. »Haben Sie sie denn in schlechter Gesellschaft gesehen?«
»Aber nein, aber nein«, erwiderte dieser versöhnlich. »Sie ist eine gute Bekannte von Sir Charles Clayton.«
»Das heißt, sie ist in London?«
Die junge Lady war nicht mehr von diesem Thema abzubringen. Der Gast musste mitteilen, was er alles über ihre alte Freundin wusste, und versprechen, am nächsten Tag ein Schreiben mitzunehmen, das er dieser Gräfin mit dem seltsamen Lebenswandel bei der ersten Gelegenheit persönlich überreichen würde. Ich lernte die Lady Marylouise von einer völlig neuen Seite kennen. Sie setzte tatsächlich ihren eigenen Willen durch! Die russische Gräfin muss wohl auf dieses Schreiben geantwortet haben und kurz darauf wurde eine Einladung an sie verschickt.
Es war die alte Lady Cavender, welche als Erste von einer Abenteurerin sprach. Unser Master Cavender nahm die Einladung der malenden Gräfin hin, obwohl er darüber nicht gerade begeistert war. Er ist kein dummer Kopf, der junge Herr. Er behandelt seine Frau nicht wesentlich anders als uns: mit Strenge, die gelegentlich durch ein wenig Nachsicht oder Großzügigkeit gemildert wird. Und ich glaube, er ist der Überzeugung, dass man Untergebenen gelegentlich ein paar Freiheiten lassen muss, damit sie nicht zum Äußersten getrieben werden. Er hatte wohl beschlossen, dass diese russische Gräfin so schlimm nicht sein konnte, nun, da er sich an sie erinnerte.
Der alten Lady Cavender gefiel das nicht. Sie ist in kleinen Dingen strenger als ihr Sohn, beharrt noch mehr auf der Einhaltung von Regeln und auf vollkommener Ordnung. Der junge Herr hat große Achtung vor seiner Mutter, betrachtet sich selbst aber trotzdem als ihr überlegen. Deshalb trifft er alle wichtigen Entscheidungen, abgesehen vielleicht von Fragen der Haushaltsführung, die er weitgehend der alten Lady Cavender überlässt. Er war in dieser Geschichte jedenfalls nicht willens, sich auf die Seite seiner Mutter und damit gegen seine Frau zu stellen, was die alte Lady missmutig machte. Sie wollte mehr und mehr Dinge über die eingeladene russische Gräfin erfahren, vermutlich, um weitere Gründe zu finden, warum sie diese Person von vornherein nicht mochte.
Und irgendwann sagte sie dann: »Sie ist eine Abenteurerin! In Russland geboren, in Wien und Prag aufgewachsen. Und nun hat sie nichts Besseres zu tun, als weiter von einem Land zum anderen zu springen, als sei die Welt ein Jahrmarkt, auf dem sie sich nach Lust und Laune herumtreiben kann. Was hat diese Person in London verloren, frage ich mich. Eine Frau sollte sich um ihr Heim und ihre Familie kümmern, anstatt ständig von Ort zu Ort zu ziehen wie die Zigeuner.«
Unsere Lady Marylouise machte ein trotziges Gesicht wie ein Kind, dessen liebstes Spielzeug soeben beleidigt worden war. Aber sie sagte nichts. Es hat wenig Sinn, der alten Lady zu widersprechen. Master Cavender schlürfte seinen Tee. Sein Schweigen drückte aus, wie sehr er sich diesen zwei zankenden Weibern überlegen fühlte. Vielleicht, weil er selbst einmal von Land zu Land gezogen ist. Anders hätte er seine junge, hübsche, reiche Frau niemals kennen gelernt.
20. März 1787
Es ist inzwischen so viel geschehen, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Wir sind hier in einem Herrenhaus auf dem Lande untergekommen, einige Meilen von Bristol entfernt. Marie Luise meint, wir könnten einmal einen Ausflug ans Meer machen, aber es ist immer noch recht frisch draußen. In der Nachbarschaft befinden sich ein paar kleinere Dörfer, deren Bewohner die Pächter der Cavenders sind. Diese Einnahmen reichen aber nicht, um einen Lebensstil entsprechend den Ansprüchen von Anthony Cavender zu ermöglichen. Das meiste Geld stammt wohl von der Zuckerplantage in Jamaika. Diese Plantage hat er vergrößert und ausgebaut – mit Hilfe von Marie Luises beachtlicher Mitgift, wie ich vermute. Nun ist er mit seiner Familie wieder nach England zurückgekehrt, denn die Plantage scheint zu seiner Zufriedenheit zu laufen und er hat einen vertrauenswürdigen Aufseher gefunden, der in seiner Abwesenheit nach dem Rechten sieht.
Die Cavenders sind Sklavenhalter! Ich hätte es mir eigentlich denken können, aber es wurde mir zuvor nicht wirklich bewusst. Marie Luise erwähnte in den wenigen Briefen, die sie mir nach ihrer Hochzeit schickte, jedenfalls keine Sklaven und scheint auch jetzt nicht sonderlich willens, auf dieses Thema einzugehen. Sie erzählte mir, die Leute würden aus Afrika geholt, wo sie als Wilde hausen. Die Sklaverei würde sie der Zivilisation und dem rechten Glauben näher bringen. Außerdem seien sie keine vollwertigen Menschen. Bei ihrer Ankunft wären sie zum Beispiel nicht in der Lage zu sprechen, sondern müssten dies erst allmählich lernen. Mir kam das seltsam vor, denn zwar mag man Tieren die Nachahmung menschlicher Laute beibringen können, doch nicht das Bilden zusammenhängender Sätze. Aus den Büchern meines Vaters weiß ich auch, dass die Wilden durchaus ihre Sprachen haben. Reisende berichten davon. Vermutlich sprechen diese Afrikaner also Sprachen, die wir nicht verstehen, und lernen erst allmählich die unsere.
Marie Luise schien verärgert, als ich ihr widersprach. Sie ist überhaupt sehr empfindlich geworden. Bei ihrer Rechtfertigung der Sklaverei klang sie wie ein braves Schulmädchen, das einen auswendig gelernten Text aufsagt.
»Ich verstehe nicht, worüber du dich aufregst. In Russland versklavt ihr sogar eure eigenen Leute.«
Ich hatte mich eigentlich nicht aufgeregt. Und sie hatte Recht. Mein Vater hatte mir von den Leibeignen erzählt, die dazu verpflichtet waren, auf den Feldern der Serbinskijs zu arbeiten oder von ihren eigenen Einkünften Abgaben zu entrichten. Zwar hatten der Zwist meines Vaters mit seiner Familie sowie der Einfluss meiner fortschrittlichen Mutter dazu geführt, dass er auf den größten Teil seines Erbes verzichtete, aber auch das Wenige, was ihm sein Schwager regelmäßig schickte, war auf dem Rücken jener Menschen gewonnen, die ohne Lohn für meine Familie arbeiten mussten. »Seelen«, so nennt man sie. Meine Tante in Moskau besitzt mehrere tausend Seelen, also männliche Leibeigene, denn die Frauen zählen nicht. Ich lag als Kind manchmal im Bett und dachte an jene Seelen, die in weiter Ferne für mich arbeiteten, doch sah ich sie mehr als Geister oder Engel denn als echte Menschen. Denn wären sie einfach nur Menschen gewesen, wie sehr mussten sie mich dann hassen …
Die einzige Leibeigene, welche ich jemals zu Gesicht bekam, war Jelena. Sie trat einige Monate nach dem Tod meiner Mutter in mein Leben, doch war ich damals noch so jung, dass ich mich an diesen Moment ebenso wenig erinnern kann wie an meine Mutter. Jelena, ein Mädchen von 15 Jahren, übernahm ihre Rolle. Mein Vater brachte sie damals aus Russland mit. Er war dorthin zurückgekehrt, um sich mit meinem Großvater und meiner Tante zu versöhnen, um meinetwillen, wie er stets behauptete, denn ich sollte nicht ohne Vermögen und Angehörige leben müssen. Aber die offen gezeigte Abneigung gegen seine mittlerweile verstorbene Frau machte es ihm unmöglich, mich zu meinen Verwandten zu bringen. Er wollte, dass ich eines Tages stolz sei auf meine Mutter und nicht dazu erzogen würde, sie wegen ihrer bürgerlichen Herkunft oder gar ihrer politischen Ideale abzulehnen. Jelena zu erwerben hatte er aber nicht geplant, und es dauerte lange, bis er mir erzählte, wie diese Leibeigene in seinen Besitz gekommen war.
Er gewann Jelena bei einem Kartenspiel. Betrunken war er gewesen, wie er immer zu seiner Entschuldigung wiederholte, als sei meine Mutter, eine überzeugte Gegnerin der Leibeigenschaft, am Tisch zugegen und starre ihn vorwurfsvoll an. Betrunken aus Kummer über ihren Tod, nach dem er allein in der Fremde zurückgeblieben war. Betrunken, weil eine Versöhnung mit seiner Familie unmöglich schien und es daher wohl sein Los sein würde, auch weiterhin allein in dieser Fremde zu bleiben. Der Graf Baranzov, ein Bekannter aus früheren Jahren, schenkte ihm kräftig Wodka ein und mischte die Karten bei immer höherem Einsatz. Mein Vater bekam nicht mehr mit, dass er am Ende der Sieger war, aber der Graf Baranzov blieb ehrenhaft genug, ihm den Gewinn trotzdem zu überlassen: ein fünfzehnjähriges Mädchen.
Der Graf Baranzov hatte sich aus seinen Leibeigenen eine Art persönlichen Harem zusammengestellt. Dorfmädchen, die ihm bei gelegentlichen Besuchen auf dem Land ins Auge stachen, wurden in seinem Stadtpalais untergebracht, hübsch eingekleidet und mit ausreichend Nahrung versorgt. Es erging ihnen nicht schlecht, solange sie die Wünsche des Grafen erfüllten, und manche dieser Mädchen mochten froh über ihr Schicksal gewesen sein, denn das Leben der einfachen Bauern ist hart. War der Graf ihrer überdrüssig, suchte er unter den wohlhabenderen seiner Bauern oder jenen Männern, die als »starosta«, also Aufseher und Verwalter, für ihn arbeiteten, Gatten für diese Mädchen, damit sie gemeinsam mit potenziellen Kindern bis ans Lebensende ein gutes Auskommen hatten. Brach jedoch eine seiner Gespielinnen die ihr gesetzten Regeln, so waren die Strafen hart. Einmal versuchte eines dieser Mädchen mit seinem Verlobten aus dem Heimatort durchzubrennen, wurde allerdings bald eingefangen. Die Ausreißerin musste viele Tage lang mit einer Kette um den Hals unbeweglich auf einem Stuhl sitzen; ihren Verlobten schlug man so gründlich mit der Rute, dass er sich von den Prügeln nicht mehr erholte. Mein Vater erzählte mir diese Geschichte als Beispiel für den verderblichen Einfluss unkontrollierter Macht auf die menschliche Seele. Der Graf Baranzov, so meinte mein Vater, sei nämlich kein so übler Kerl gewesen, bis sein Dasein als Besitzer von Leibeigenen ihn allmählich immer zügelloser werden ließ. In dem Wissen, tun zu können, was ihm beliebte, suchte er nach seinen eigenen Grenzen. Mir selbst erschienen solche brutalen Ereignisse unwirklich und nicht Teil jener Welt, in der ich lebte. In Marie Luises geliebten Romanen geschahen manchmal solche Dinge, nur dass dort am Ende der alte Bösewicht starb, das Liebespaar weitgehend unversehrt wieder zusammenkam und, wie sich zu guter Letzt herausstellte, selbst adeliger Abkunft war. Geschichten über irgendwelche russischen Leibeigenen hätte Marie Luise nicht gelesen.
Es sind nur drei Sklaven hier, die sie aus Jamaika mitgebracht haben. Eine Frau, die etwa in Jelenas Alter sein dürfte, sieht am wenigsten fremdartig aus, denn ihre Haut hat nur einen feinen Bronzeton, mit dem sie sich ohne Schwierigkeiten als Süditalienerin oder Spanierin ausgeben könnte. Ihre Augen sind sogar grün. Sie ist auf eine sehr europäische Art schön, ich meine, so wie wir uns schöne Frauen vorstellen, mit zarten, ebenmäßigen Gesichtszügen, langen Wimpern und fein geschwungenen Lippen. Die bräunliche Haut macht sie nur noch ein wenig reizvoller. Als sie jung war, müssen die Männer ihr in Scharen hinterhergelaufen sein, oder hätten es getan, wäre sie damals schon in Europa gewesen. Ich habe keine Ahnung, was die Männer in Jamaika reizvoll finden. Ihre Kinder hat sie jedenfalls von keinem Europäer, denn sie sind beide wesentlich dunkelhäutiger als sie selbst. Der Junge scheint mir die bemitleidenswerteste Kreatur von allen Dreien. Er hat einen Klumpfuß und sieht auch sonst verwachsen aus, denn seine kleine Statur lässt ein viel jüngeres Alter vermuten als sein drolliges, aber auch nachdenkliches Gesicht. Er hat etwas Skurriles an sich wie ein Geschöpf, das auf Jahrmärkten ausgestellt wird, nur wäre dies in seinem Fall höchst grausam, denn aus seinen Augen spricht ein sehr wacher und feinfühliger Geist. Ich hätte ihn mir vielleicht genauer angesehen, wäre da nicht seine Schwester gewesen.
Sie ist die fremdartigste Erscheinung, welche ich seit Jahren zu Gesicht bekommen habe: Ihre Haut schimmert so schwarz wie die Federn eines Raben. Träfe ich sie irgendwann im Dunkeln, könnte ich vermutlich nichts erkennen außer dem Weiß in ihren Augen. Ich denke, ich würde mich erschrecken. Trotzdem kann ich sie nicht hässlich nennen, nur eben anders als alles, woran ich gewöhnt bin. Mein Vater meinte, die Menschen hätten meist Angst vor dem Unbekannten, und vielleicht ist dies der Grund für das Befremden, welches ihr Anblick in mir auslöst. Denn hässlich ist sie nicht.
In London habe ich bereits einige Schwarze zu Gesicht bekommen, hauptsächlich Männer. Sie übten meist einfache Tätigkeiten aus, waren Lastenträger oder Laufbursche. Einige bettelten auch am Straßenrand. Die vornehmen Damen werden gelegentlich von ihren kleinen schwarzen Pagen begleitet, wenn sie das Theater aufsuchen. Manchmal führen sie diese an der Leine wie Äffchen. Und als ich mit Charlie einmal nach einem Theaterbesuch noch in einem Wirtshaus Wein trinken ging, saß nicht weit von uns entfernt ein dunkler Mann am Tisch. Er war gut gekleidet und wirkte weitaus selbstbewusster als alle anderen Menschen seiner Rasse, denen ich bis dahin begegnet war. Wie Charlie mir erklärte, handelte es sich bei ihm um einen Zuhälter, der für eine benachbarte Bordellbesitzerin arbeitete. Aber an keinen dieser schwarzen Menschen war ich jemals nahe genug herangekommen, um ihn genauer betrachten zu können, so dass dieses Mädchen meine Neugierde weckte. Als sie uns das Abendmahl servierte, verfolgten meine Augen die Bewegungen ihrer Hände, deren Flächen heller sind als der Rest ihres Körpers. Ich glaube, ich sollte vorsichtig sein, diese Schwarze nicht allzu sehr anzustarren. Sie scheint meine Blicke zu spüren.
Alles in ihrem Gesicht wirkt auf den ersten Blick zu groß und zu breit, doch fügt es sich bei genauerem Hinsehen in eine stimmige Harmonie. Ihre Augen haben die Form von Mandeln, so wie bei den chinesischen Porzellanfiguren, welche zurzeit so modern sind. Nur wirken sie aufgrund ihrer Größe in diesem dunklen Gesicht noch viel eindrucksvoller. Sie ist hochgewachsen und dünn, ohne dabei zerbrechlich zu wirken, wie man es mir immer nachsagt. In ihren Bewegungen liegt Grazie. Nicht jene, welche adeligen Damen von klein auf beigebracht wird. Die ihre ist weniger steif und ergibt sich aus einem weichen Fließen ihrer Bewegungen, als sei ihr Körper ein sich im Wind wiegendes Gewächs. Mein Wunsch nach einem Blatt Papier und Tusche wuchs mit jedem Augenblick, da ich dieses fremdartige Geschöpf betrachten konnte. Seit ich Theaterkostüme entwerfe, überlege ich manchmal, wie ich besonders eindrucksvolle Menschen wohl passend einkleiden würde, hätte ich die Gelegenheit dazu. Aber bei ihr wollte mir nichts so recht einfallen. Die schlichten, züchtigen Gewänder einer englischen Magd passen jedenfalls nicht zu ihr. Es ist, als trüge sie Fesseln.
Irgendwann schubste Marie Luise mich an und fragte mich flüsternd, was ich denn an dieser Negerin so besonders fände.
»Am Anfang, in Jamaika, hatte ich große Angst vor ihnen«, fügte sie hinzu. »Aber jetzt habe ich mich an sie gewöhnt. In England fühle ich mich natürlich auch sicherer, weil es nicht so viele von ihnen gibt. Ich bin lieber von zivilisierten Menschen als von Wilden umgeben. In Jamaika haben sie des Nachts Flüche gegen uns ausgesprochen. Manchmal drangen die Stimmen und Gesänge der Zauberer bis in mein Schlafgemach. Ich konnte in den ersten Wochen kein Auge zutun.«
Ich dachte mir, dass diese Flüche nicht allzu wirksam sein können, da sie nichts daran geändert hatten, wer Herr und wer Diener war. Aber das sagte ich nicht zu Marie Luise. Sie kann Zynismus nur in geringen Mengen vertragen. Im Moment erinnert sie mich an ein Gebäude, das kurz vor dem Einsturz steht. Nur die Fassade scheint auf den ersten Blick noch gut erhalten, damit der Betrachter zufrieden ist. Dahinter bröckelt es bereits so stark, dass eine kleine Erschütterung den sofortigen Zusammenbruch bewirken könnte. Ich frage mich nach dem Grund, denn eigentlich kann ich nichts Schlimmes an ihren derzeitigen Lebensumständen finden.
Sie ist mir bei unserem Wiedersehen mit einer Inbrunst um den Hals gefallen, die ich bei ihr bisher nicht kannte. Damals in Prag hatte ich stets das Gefühl, dass ich Marie Luise weitaus mehr brauchte als sie mich. Jeder mochte die Tochter des wohlhabenden österreichischen Barons mit ihren Grübchen und ihrem reizenden Lachen. Sie war das einzige noch lebende Kind ihrer Eltern, ein verwöhntes reiches Mädchen, aber ein nettes. Ich hingegen hatte einen Sonderling zum Vater, einen russischen Grafen, der seiner Abkunft und der Heimat den Rücken gekehrt hatte. Nach dem Tod meiner Mutter geriet er zunehmend ins gesellschaftliche Abseits, denn die aufgeklärten Geister und Freidenker, welche zu ihrem Bekanntenkreis gehört hatten, mied er. Sie erinnerten ihn zu sehr an die glückliche Zeit mit seiner Frau, erklärte er mir später. Es ist allerdings auch möglich, dass sie von selbst allmählich den Kontakt zu ihm aufgaben, denn für ihren Geschmack kümmerte er sich zu wenig um Politik und Reformen. So vereinsamte er zunehmend und ich mit ihm. Als Jelena ihn schließlich davon überzeugte, dass ich irgendwann in die besseren Kreise Prags eingeführt werden musste, standen die Voraussetzungen denkbar ungünstig. Ich hatte kaum Aussichten auf eine größere Mitgift und wusste mich in Gesellschaft nicht zu benehmen, da ich die meiste Zeit mit meinem Vater in seinem Studierzimmer verbracht hatte.
Mein Titel öffnete einige Türen. Jelena staffierte mich angemessen aus und sprach mir Mut zu. Ich sei ein hübsches Mädchen, ich hätte einen Adelstitel und gute Erziehung. Während ich in einem schönen, unbequemen Kleid auf Bällen saß und wartete, ob einer der anwesenden jungen Herren es mir vergönnen würde zu tanzen oder mir die öffentliche Bloßstellung als Mauerblümchen bevorstand, machte ich die Bekanntschaft von Marie Luise.
Ich weiß bis heute nicht, was sie an mir mochte. Meine Belesenheit mit Sicherheit nicht, denn Marie Luise konnte sich nur für abenteuerliche Liebesromane begeistern und betrachtete jene Bücher, die ich mit Vorliebe las, als Teufelszeug. Rousseau hatte es ihr angetan, die »Nouvelle Héloise«, doch brauchte sie auch für dieses Buch sehr lange, denn sie konnte sich nicht gut konzentrieren. Ich machte sie noch mit Samuel Richardsons Werken bekannt, da er in ähnlich rührender Weise Tugend und Enthaltsamkeit preist. Mir persönlich schienen diese Romane stets etwas lachhaft, da sie die menschliche Natur beschönigen, anstatt ihren wahren Charakter zu zeigen. Ich mag den scharfen, bösen Witz Voltaires und Diderots, was meine Freundin nie verstehen konnte.