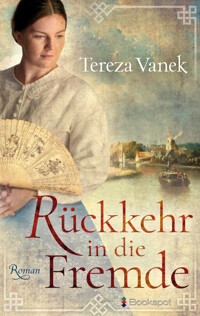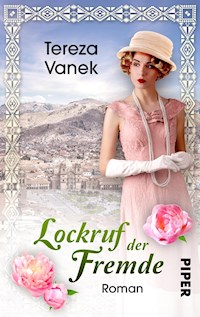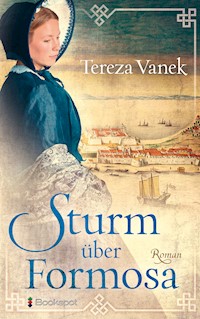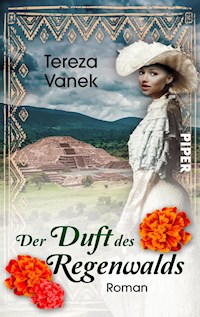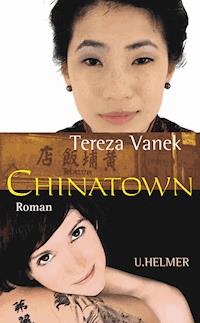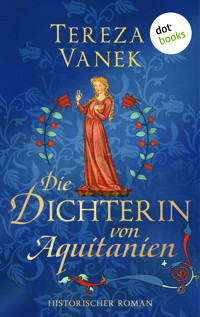
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe, Intrigen und Machtspiele am Königshof: Der historische Roman "Die Dichterin von Aquitanien" von Tereza Vanek jetzt als eBook bei dotbooks. Mitte des 12. Jahrhunderts, nahe Paris: Die junge Marie wächst in einfachen Verhältnissen auf. Kurz nach dem Tod ihres trinkfreudigen Vaters erhält sie die Nachricht, sie sei die illegitime Tochter von Geoffrey VI., und damit die Nichte des englischen Königs Henri II. Sie wird nach England an den Hof gebracht, doch der Prunk des Hofes macht es ihr schwer, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Um ihre Einsamkeit zu vertreiben, beginnt Marie schließlich, heimlich zu dichten. Als Königin Eleonore von Maries Gedichten erfährt, wird die junge Frau bald zu einer ihrer liebsten Hofdamen. Aber Marie zieht nicht nur Bewunderung, sondern auch viel Neid auf sich ... Ein großer Roman über das ebenso glanzvolle wie gefährliche Leben der Marie de France, der ersten Dichterin der französischen Literatur. Jetzt als eBook: Der farbenprächtige Historienroman "Die Dichterin von Aquitanien" von Tereza Vanek wird alle Fans von Philippa Gregory, Alison Weir und Sabine Weigand fesseln. dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 897
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Mitte des 12. Jahrhunderts, nahe Paris: Die junge Marie wächst in einfachen Verhältnissen auf. Kurz nach dem Tod ihres trinkfreudigen Vaters erhält sie die Nachricht, sie sei die illegitime Tochter von Geoffrey VI., und damit die Nichte des englischen Königs Henri II. Sie wird nach England an den Hof gebracht, doch der Prunk des Hofes macht es ihr schwer, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Um ihre Einsamkeit zu vertreiben, beginnt Marie schließlich, heimlich zu dichten. Als Königin Eleonore von Maries Gedichten erfährt, wird die junge Frau bald zu einer ihrer liebsten Hofdamen. Aber Marie zieht nicht nur Bewunderung, sondern auch viel Neid auf sich ...
Das spannende Leben der Marie de France, der ersten Dichterin der französischen Literatur.
Über die Autorin:
Tereza Vanek wurde 1966 in Prag geboren und kam als kleines Kind mit ihren Eltern nach München. Sie studierte Anglistik, Romanistik und Slawistik und promovierte über die Darstellung verbrecherischer Frauen im englischen Drama des 7. Jahrhunderts. Sie arbeitete als Fremdsprachenlehrerin, Übersetzerin und verkaufte im Internet nostalgische Kleidung, bevor sie Schriftstellerin wurde. Tereza Vanek lebt und arbeitet in München.
***
Neuausgabe September 2013
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House, GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2013 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nicola Bernhart Feines Grafikdesign, München
Titelbildabbildung: © akg-images
ISBN 978-3-95520-349-8
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Die Dichterin an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
www.gplus.to/dotbooks
Tereza Vanek
Die Dichterin von Aquitanien
Roman
dotbooks.
Me numerai pur remembrance: Marie ai num, si sui de France.
(Ich will meinen Namen nennen, um nicht vergessen zu werden/Marie bin ich, und stamme aus Frankreich)
Aus dem Epilog der Fabeln der Marie de France
Prolog
1152
Es war ein grauer Märztag. Die Wolken hingen tief über den Dächern des Dorfs, andauernder Regen hatte den letzten Schnee fortgeschwemmt, die Erde in schwammigen, dreckigen Brei verwandelt. Schweine und Hunde wühlten darin herum. Marie watete mühsam durch den Schmutz, der ihr fast bis zu den Waden reichte. Vor zwei Monaten war sie vier geworden und ihre Füße mussten sich ebenso plötzlich verlängert haben, wie die Zahl ihrer Lebensjahre sich erhöht hatte. Ihre hölzernen Schuhe hatte ihr Ziehvater Guillaume im vorigen Sommer aus Paris mitgebracht. Sie zwängten bereits ihre Zehen ein, sodass jeder Schritt sich anfühlte wie ein Tritt gegen die Klinge eines Messers. Glücklicherweise war es nicht mehr weit bis zum Brunnen, doch würde der Rückweg mit einem hoffentlich wenigstens halb vollen Eimer noch anstrengender werden. Guillaume war wieder einmal angetrunken vom gestrigen Dorffest gekommen und hatte das Fass umgeworfen, in dem Regenwasser aufgefangen werden sollte. Marie wusste, dass seine Kehle durstig brennen würde, sobald er aufwachte. Agnès, die gelegentlich aushalf, um die wuchernde Unordnung einzudämmen, hatte nur mit den Schultern gezuckt.
»Soll der Schwätzer doch aus seinen Fehlern lernen!«
Aber Marie mochte es nicht, wenn Guillaume schlechter Laune war.
Sie nickte den Dorfbewohnern zu und ging entschlossen weiter, auch wenn nicht alle ihren Gruß erwiderten. In ihrem Rücken summte das übliche Getuschel. Sie hatte bereits gelernt, ihre Ohren davor zu verschließen. Pierre, der Sohn des Schmieds, lächelte sie freundlich an, und der Anblick seines vertrauten Gesichts wärmte ihr Herz. Nicht alle Menschen hier dachten schlecht von ihr.
Glücklicherweise stand niemand vor dem Brunnen, sodass sie nicht warten musste. Marie stieg auf einen Stein, befestigte den Henkel des Eimers am Seil und ließ das Gefäß in die schwarze Tiefe fahren. Kurz darauf krallten ihre Finger sich entschlossen um den hölzernen Hebel, damit das Seil um die Winde gewickelt und so der Eimer wieder nach oben befördert werden konnte. Da sie selbst für ihr Alter recht klein war, musste sie dabei die Arme hochstrecken. Im Gegensatz zu den anderen Mädchen im Dorf hatte sie keine von harter Arbeit gestählten Muskeln. Sie musste nur selten im Haushalt helfen, denn Guillaume hielt das für unwichtig. Schmutz oder Unordnung würde er erst bemerken, wenn er darüber stolperte und dann auch noch mit dem Gesicht hineinfiel, wie Agnès immer wieder anmerkte. Stattdessen hatte er vor Kurzem begonnen, Marie im Lesen und Schreiben zu unterweisen, sodass sie ihre Zeit über eine Schiefertafel gebeugt zubrachte. Diese Tätigkeit gefiel ihr, befähigte sie aber nicht unbedingt, Eimer aus tiefen Brunnen zu ziehen. Marie stöhnte laut, als das hölzerne Gefäß endlich den Brunnenrand erreicht hatte. Ihre Handflächen brannten vom Druck des Hebels. Das glatte, feuchte Holz entglitt ihr, sobald sie es über den Brunnenrand hieven wollte. Zum Glück schwappte nicht alles Wasser wieder in die Tiefe. Keuchend vor Erschöpfung stellte Marie schließlich einen nicht ganz halb vollen Eimer neben sich in den Schlamm. Ihre Arme fühlten sich an, als würden sie jeden Moment abfallen.
»Da kommen Leute!«, erklang es in ihrem Rücken. Sie wandte sich um.
Auf der platt getretenen Straße rückten tatsächlich Gestalten heran. Marie erblickte drei Reiter und im Hintergrund weitere Umrisse, die ein Gefolge andeuteten. Es kam gelegentlich vor, dass Händler in Huguet, dem winzigen, verschlafenen Dorf im Umland von Paris, haltmachten, doch die hatten nur Esel und Karren. Bei diesen Männern musste es sich um Ritter handeln, jene Helden und Abenteurer, von denen Guillaume ihr oft erzählt hatte. Nun ritten sie in Maries Leben hinein. Die anderen Anwohner drängten sich verunsichert an Hauswände, aber Marie blieb wie angewurzelt stehen. Die Geschichten ihres Ziehvaters bekamen plötzlich Farbe. Die duftende, bunte Weite der Welt rückte näher heran.
Die Reiter trugen dunkle, wollene Umhänge, die sie vor der Unwirtlichkeit des Wetters schützten. In ihrer Mitte saß eine etwas kleinere Gestalt mit schmalen Schultern auf einem weißen Pferd, an dessen Zaumzeug farbenfroh verzierte Glocken bimmelten. Sie war ebenfalls eingemummt, doch als sich das Gesicht unter der Kapuze seiner Umgebung zuwandte, erstarrte Marie vor Staunen. Guillaumes Beschreibungen von Feen und zauberhaft schönen Damen erblühten in ihrem Gedächtnis.
»Ihre Hoheit ist durstig«, durchbrach eine herrische Männerstimme das allgemeine Schweigen. Die Dorfbewohner blieben in ihrer furchtsamen Starre gefangen. Marie deutete zaghaft auf den Eimer an ihrer Seite.
Sie sah, wie der Sprecher sich aus dem Sattel schwang und auf sie zukam. Sein Gesicht war faltig und hart wie abgenutztes Leder. Ein Schwert hing an seinem Gürtel, bewegte sich im Rhythmus seiner Schritte. Er hielt ihr einen Becher entgegen.
»Das ist zwar nur fades Brunnenwasser, aber wir haben nicht viel Zeit. Sonst würde ich den Tölpeln hier Manieren beibringen, damit sie schleunigst Wein besorgen. Jetzt mach schon, Mädchen! Und wenn du den Becher zerbrichst, dann bist du tot.«
Marie gehorchte, als sei sie eines von Guillaumes dressierten Tieren. Obwohl es ihr nun leidtat um das mühsam erkämpfte Wasser, von dem ohnehin nicht viel übrig war, senkte sie den Behälter in ihren Eimer, zog ihn gefüllt wieder heraus und bemerkte erst dann, dass er aus einem Material gemacht war, das den Hintergrund nicht verbarg, sondern milchig hindurchschimmern ließ. Wieder meinte sie, sich in einer von Guillaumes Geschichten zu befinden, und dieses Gefühl der Unwirklichkeit gab ihr den Mut, einfach mit dem Becher in der Hand auf die Unbekannte zuzugehen.
Aus der Nähe betrachtet schien die Fremde noch zauberhafter. Ihre Haut war weiß wie frisch gefallener Schnee, die blaugrauen Augen erinnerten Marie an wolkenlosen Himmel im Morgengrauen. Sie streifte den Handschuh ab, und eine schmale, mit bunten Ringen geschmückte Hand streckte sich Marie entgegen, um das Wasser in Empfang zu nehmen.
»Danke, mein Kind. Wie ist dein Name?«
Marie wurde leicht schwindelig. Vielleicht lag es an dem süßen, schweren Duft, der von der Dame ausging. Dennoch klang ihre Stimme sicher und gefasst, als sie sich vorstellte.
»Du bist ein nettes Mädchen, kleine Marie. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Es würde mich freuen«, erwiderte die Dame mit einem Lächeln, bevor sie zusammen mit den anderen Reitern auf der Straße Richtung Paris verschwand.
Marie starrte stumm hinterher. Die Welt schien sich zu verdüstern, sobald der Horizont die berittenen Gestalten verschluckt hatte. Sie bemerkte kaum, wie ihr Freund Pierre sich zu ihr gesellte.
»Weißt du überhaupt, mit wem du da gesprochen hast?«, riss er sie aus ihren Träumereien.
»Mein Vater sagt, das war die Königin Aliénor«, meinte er triumphierend. »In Paris wird zurzeit über die Auflösung ihrer Ehe mit dem König verhandelt. Weiß der Teufel, warum sie hier entlanggeritten kam, nur von ein paar Rittern begleitet.«
Marie war der Grund für den Ausritt völlig gleich. Sie sah das vornehme, schmale Gesicht immer noch vor sich und ahnte, dass sie es nicht so schnell vergessen würde.
1. Buch
Murt ert la la dame en graut tristur,
Od lermes, od suspir e plur;
Da beuté pert en teu mesure
Cume cele ki n'en ad cure.
De sei meisme mieuz vousist
Que mort hastive la preisist.
Die Dame lebte in tiefer Trauer, in Tränen und Seufzern. Sie verlor dadurch ihre Schönheit, die ihr gleichgültig geworden war; sie hatte nur noch einen Wunsch: durch einen schnellen Tod erlöst zu werden.
Maleeit seient mi parent
E li autre communalement
Ki a cest gelus me donerent
E de sun cors me marierent!
Verflucht seien meine Eltern und alle, die mich diesem eifersüchtigen Mann übergaben und mich ihn heiraten ließen!
(Aus dem Lai »Yonec« der Marie de France)
1. Kapitel
Der Galgen war in der Mitte des Marktplatzes aufgestellt worden. Trommelschläge trieben die letzten der Einwohner heran, die bisher noch nichts von dem Ereignis gewusst hatten. Hinrichtungen fanden nicht oft statt, denn der Vogt verhielt sich im Allgemeinen milde, doch im Falle einer Gattenmörderin konnte er keine Gnade walten lassen.
Die Verurteilte hing wie ein schwerer, lebloser Sack im Griff der Büttel, die sie heranschleppten. Ihr ratloser Blick streifte die Anwesenden nur kurz und drückte nichts weiter als Staunen aus. Noch nie in ihrem Leben hatte Adèle derartige Aufmerksamkeit erhalten wie in dem Augenblick ihres Todes. Sie schien nicht zu begreifen, woran dies liegen konnte, und es war durchaus möglich, dass sie gar nichts von dem verstand, was sich hier gerade abspielte. Die rechte Hälfte ihres Gesichts wies blaugrüne Schwellungen auf, die vielleicht von den Bütteln stammten oder auch die letzte Hinterlassenschaft jenes Mannes waren, den sie erschlagen hatte. Der Vogt verlas nochmals sein Urteil, beschrieb eine widernatürliche Tat, die gegen alle Gebote des Herrn verstieß. Marie versuchte vergeblich, ihre Ohren zu verschließen. Ein stummer Wutschrei steckte in ihrer Kehle, sie schluckte ihn pflichtbewusst und schämte sich gleichzeitig für ihre Feigheit.
Es schmerzte sie, dass sie manchmal zu jenen Kindern gehört hatte, die Adèle hänselten, weil sie unfähig schien, die einfachsten Spiele zu begreifen und bei Scherzen niemals lachte, sondern ebenso verwirrt dreinblickte wie in dem Moment ihrer Hinrichtung. Guillaume hatte Marie erklärt, dass kein Mensch Schuld daran trug, wenn der Herr ihm einen beschränkten Verstand schenkte. Danach hatte sie versucht, Adèle vor dem beißenden Spott der anderen Dorfkinder zu schützen. Seit sie allmählich zu einer Frau heranzuwachsen begann, war Marie weniger schüchtern geworden. Ihre Wortgewandtheit und jene aufregenden Geschichten, die sie dank ihres Lehrmeisters zu erzählen verstand, hatten sie die Anerkennung von Altersgenossen gewinnen lassen, obwohl sie nicht wirklich Teil der Dorfgemeinschaft war, sondern eine Außenseiterin, der Misstrauen entgegenschlug. Aber es war Marie nicht möglich gewesen, Adèle vor den Schlägen einer Mutter zu bewahren, die kein weiteres Mädchen und vor allem kein so begriffsstutziges auf die Welt hatte bringen wollen. Auch nicht vor der Ehe mit einem unbeherrschten Trinker, der seine halbwüchsige Frau noch schlimmer zurichtete, als sie es von klein auf gewohnt war.
Die schlaffe, leblose Verurteilte musste auf dem Schemel gestützt werden, sonst wäre sie bereits zusammengebrochen, bevor man ihn wegstieß. Danach ließ allein der Strick um ihren Hals Adèle aufrecht in der Luft schweben. Kurz darauf spürte Marie den Druck von Guillaumes Hand an ihrem Arm.
»Wir können jetzt gehen«, flüsterte er ihr zu. »Es war wichtig, dass wir bei der Hinrichtung anwesend waren, sonst hätten wir dem Vogt und dem Pfarrer zu sehr missfallen. Aber nun ist es vorbei.«
Marie wandte sich schnell um und folgte ihm mit gesenktem Blick. Sie wollte niemanden sehen, der Adèle gekannt hatte, aber ihr ebenso wenig zu Hilfe gekommen war wie sie selbst.
Guillaume steuerte entschlossen aus dem Dorf hinaus. Ihr Zuhause lag am Rand des Waldes, ein halb verfallener, steinerner Bau, der noch aus der Römerzeit stammte.
»Warum lief Adèle nicht fort, nachdem sie Mathieu getötet hat?«, fragte Marie nun, als sie nicht mehr fürchten musste, von den Dorfbewohnern gehört zu werden.
»Ich glaube, sie verstand nicht, was sie getan hatte. Oder sie sah keinen Ausweg«, antwortete er.
»Aber«, fuhr Marie hartnäckig fort, »Adèle hat sich zum ersten Mal gewehrt. Zeugt das nun von Verstand oder von Verderbtheit, wie der Vogt meinte?«
Guillaume blieb stehen. Er grübelte eine Weile, dann meinte er leise: »Von Verstand, denke ich. Aber behalte das für dich. Gott hat ihr einen lichten Moment geschenkt. So wurde sie von ihren irdischen Qualen erlöst. Doch anschließend war der Augenblick des Begreifens wieder vorbei. Wohin hätte das Mädchen auch gehen sollen?«
Marie begehrte empört auf: »Hättest du ihr denn nicht helfen können? Du kennst die Straßen nach Paris und Saint Denis? Wäre sie doch zu uns gekommen.«
Guillaume setzte seinen Weg ruhig fort. Sein Blick war auf die Umrisse des Hauses gerichtet, das nun vor ihnen auftauchte.
»Es gibt keinen Ort, wo sie willkommen gewesen wäre«, meinte er unterdessen. »Eine junge Frau ohne Familie, nicht hübsch genug, um einem edlen Herrn zu gefallen, und ohne jede Gerissenheit, die es braucht, sich in der Welt durchzuschlagen. Ich will nicht wissen, was aus ihr geworden wäre.«
Er schüttelte den Kopf, dann ergriff er Maries Hand.
»Vergiss es, Kind. Denke nicht mehr daran.«
Marie schloss kurz die Augen. Das wunderschöne Gesicht der Dame tauchte wieder vor ihr auf, wie jedes Mal, wenn die Wirklichkeit zu hässlich wurde und sie vor ihr fliehen wollte. Sie hatte seitdem viele üble Gerüchte über Aliénor, die Herzogin von Aquitanien gehört. Die Ehe des Königs mit dieser verderbten, eitlen, treulosen Frau, die keinen Sohn geboren hatte, war annulliert worden. Allerdings hatte Aliénor schon wenige Monate später Henri, den Grafen von Anjou umgarnt, der nun König von England geworden war. Als dessen Gemahlin war sie mächtiger als in ihrer ersten Ehe. Dies erzählten Pariser Händler und andere Reisende, die unterwegs manchmal in Huguet haltmachten, mit einer Mischung aus Abscheu und Bewunderung. Angeblich kannten die Menschen in Aquitanien, der Heimat Aliénors, weder Zucht noch Ordnung. Frauen durften dort von ihren Vätern erben und wurden nicht einmal für Ehebruch bestraft. Marie wusste, dass sie dies entsetzlich finden sollte, weil es dem Willen des Herrn widersprach. Trotzdem drängte sich immer wieder die sündhafte Frage in ihr Bewusstsein, was schlimm daran sein sollte, eine geborene Siegerin zu sein wie diese Aliénor. Guillaume hatte ihr bisher keine Antwort geben können. Er meinte nur, es sei manchmal nicht gut, zu viel nachzudenken.
»Vielleicht hätte die Königin Aliénor Adèle geholfen, wenn sie von ihrem Schicksal gehört hätte«, sagte Marie nun. Sie wünschte sich, die schöne Dame wäre noch in Paris, dann hätte sie zu ihr gehen und um Gnade für die Verurteilte bitten können.
Guillaumes schallendes Lachen schlug ihr entgegen.
»Glaub mir, Marie, die Königin, egal welches Land sie jetzt beherrscht, hat andere Sorgen, als sich um eine bäuerliche Gattenmörderin zu kümmern!«
Marie beschloss, dieses Thema nicht weiter zu verfolgen, denn Guillaumes Spott tat weh. Inzwischen hatten sie ihr vertrautes Zuhause erreicht. Die verfallenen Teile der Wände waren vor vielen Jahren durch Holzbalken ersetzt worden, die allmählich morsch zu werden begannen. Einst schien Guillaume ein einigermaßen fähiger Handwerker gewesen zu sein, doch an diese Zeit konnte Marie sich nicht erinnern. Mittlerweile schob er alle notwendigen Arbeiten vor sich her, verlegte sie von einem Tag auf den nächsten, bis Marie schließlich Pierre um Hilfe bat oder versuchte, dringende Reparaturen selbst vorzunehmen. Als sie über die Türschwelle getreten waren, stieg modrig feuchter Geruch in ihre Nasen. Der große Esstisch glänzte nass. Entsetzt stellte Marie fest, dass ihr verzweifelter Versuch, das Loch in der Decke mit einem Stück Leder abzudichten, dem kurzen, aber heftigen Regenschauer am Vormittag nicht standgehalten hatte.
Cleopatra, der große grüne Vogel, saß in ihrem geschützten Unterschlupf in der Zimmerecke, wo sie sicher vor dem eindringen Nass geblieben war. Marie legte eine Wolldecke über das Korbgeflecht, das Guillaume einst für sein Lieblingstier gebastelt hatte. Cleopatra stammte aus dem Süden, angeblich hatte ein dunkelhäutiger Gaukler sie Guillaume vor vielen Jahren überlassen, und das nasskalte Wetter tat ihr sicher nicht gut. Der Hund hieß Abélard, so wie jener Philosoph, den Maries Ziehvater bewunderte. Er konnte auf Befehl durch Reifen springen, was bei Dorffesten für gute Einnahmen sorgte, und war dem Regen entkommen, indem er sich unter den Tisch gelegt hatte. Ihr kostbarstes Tier war Jeanne gewesen, eine menschenähnliche, haarige Kreatur, die vor zwei Jahren gestorben war. Marie hatte sie hinter dem Haus begraben. Sie vermisste die witzige, anschmiegsame Jeanne noch mehr als alle Münzen, die allein ihr Anblick in Guillaumes Beutel hatte fallen lassen.
»Hier sieht es ja nicht gerade gemütlich aus«, sagte Guillaume, als er sich auf einen Stuhl plumpsen ließ. »Damals, als ich mit deiner Mutter in diese Ruine zog, dachte ich schon, es wäre schlimm. Aber sie war zufrieden, unser Zuhause gefiel ihr. Ich weiß nicht, was sie jetzt noch dazu sagen würde.«
Marie schluckte ihren Unmut und ergriff stattdessen ein Tuch, um den Tisch abzuwischen. Der Regen hatte zum Glück aufgehört, aber es wurde allmählich Herbst, und bald schon würden sie trotz des Herdfeuers erbärmlich frieren, wenn weiterhin kalte Luft ins Haus drang.
»Jemand sollte das Dach richten«, meinte sie nur.
»Ja, ja, das Dach«, seufzte Guillaume. »Haben wir noch Wein im Haus?«
Marie ging in den Nebenraum, der noch ganz aus Stein bestand und ihre kostbarsten Vorräte beherbergte. Außer der Schiefertafel und Kreide befanden sich dort eine zerschlissene, lateinische Kopie von Ovids Kunst der Liebe und schließlich auch ein Schlauch Wein, den sie vergangene Woche für ihren Ziehvater geholt hatte. Sie wollte ihm nicht eines seiner wenigen Vergnügen missgönnen. Im Vergleich zu anderen Trinkern des Dorfes war Guillaume harmlos. Er wurde niemals gewalttätig, entwickelte nur einen rasenden Redefluss, wobei er jedes Gespür dafür verlor, ob er seine Zuhörer langweilte oder gar empörte. Daher war es besser, wenn er sich zu Hause betrank. Marie leistete ihm dabei gern Gesellschaft. Als ein Laib Brot und etwas Käse vor ihnen auf dem Tisch lagen, hoffte sie, Guillaume würde sie wieder in eine fremde, aufregende Welt entführen, damit der hilflos zappelnde Körper von Adèle für eine Weile aus ihrer Erinnerung verschwand. Sie wollte Geschichten über Ritter und Feen hören, über jene schöne Gemahlin des König Artus, die sich in Lancelot verliebte, oder auch eine Beschreibung der prächtigen Bauten, wo der Ziehvater einst gesungen hatte und mit seinen Tieren aufgetreten war. Doch diesmal wurde sie enttäuscht.
»Der Pfarrer hat mit mir gesprochen«, meinte Guillaume nur, nachdem er den ersten Schluck getan hatte.
»Worüber denn?«
»Über dich.« Guillaume schnitt sich eine Scheibe Brot ab, an der er bedächtig kaute. »Er macht sich Sorgen um dich.«
Marie fühlte ein Kribbeln in ihren Eingeweiden. Sie wusste, dass der Pfarrer sie nicht mochte, seitdem sie einmal bei einem Dorffest leichtfertig erzählt hatte, sie würde im Lesen, Schreiben und auch in Latein unterrichtet. Danach hatte er sie bei der Beichte immer wieder gefragt, ob sie sich keiner weiteren Sünden bewusst sei denn gelegentlicher Aufsässigkeit gegenüber ihrem Ziehvater.
»Der Pfarrer findet uns beide eigenartig«, wandte sie ein. »Das ist schon so gewesen, seit ich denken kann. Wir gehören nicht wirklich hierher. Die meisten Menschen leben in Huguet, weil schon ihre Eltern und Großeltern es taten. Aber du bist erst mit meiner Mutter hierhergekommen, hast ein verlassenes Haus bezogen, arbeitest nicht auf den Feldern und zahlst keine Abgaben an den Landesherrn. Stattdessen bringt uns ein unbekannter Mann regelmäßig Geld. Die Leute verstehen nicht, warum dem so ist.«
Sie sprach nicht aus, dass sie selbst es ebenso wenig verstand. Angeblich hatte Guillaume einst eine schwangere Witwe kennengelernt und geheiratet, war mit ihr nach Huguet gezogen, wo ein Kind zur Welt kam und die geliebte Ehefrau leider schon nach wenigen Monaten starb. Im Dorf wurde ihrer Mutter manchmal eine anrüchige Vergangenheit unterstellt, doch Marie verdrängte dies aus ihrem Bewusstsein. Regelmäßig traf ein vornehm gekleideter Herr ein, der ihrem Ziehvater einen Beutel mit Münzen überreichte, sodass sie weitere Monate überleben konnten. Guillaumes Einnahmen bei seinen gelegentlichen Auftritten auf dem Marktplatz hätten niemals gereicht, ihre Mägen zu füllen, geschweige denn die Magd zu bezahlen. Der feine Herr war angeblich ein Verwandter ihres Vaters. Aber er sprach niemals mit Marie, schenkte ihr keinerlei Beachtung, sondern konnte es kaum erwarten, der ärmlichen Umgebung wieder zu entkommen.
»Ich weiß, dass wir dem Pfaffen ein Dorn im Auge sind.« Guillaume winkte ab, schnitt sich etwas Käse zurecht und reichte Marie ein Stück davon. »Darum geht es jetzt nicht. Er wollte wissen, welches Leben ich mir für dich vorstelle. Ein Mädchen wie eine Gelehrte auszubilden, das scheint ihm unangemessen, geradezu gefährlich. Gott, was für ein beschränkter Haufen deine Diener auf dieser Welt doch sind! Abélard, der wollte ihnen den Kopf zurechtrücken, aber sie haben ihn mundtot gemacht.«
»Was gefällt dem Pfarrer denn nicht an meiner Ausbildung?«, warf Marie ein, um Guillaume von seinem Lieblingsthema abzulenken. Sie hatte schon zu oft gehört, welch kluge Reden dieser Abélard in Paris geführt hatte und wie übel ihm mitgespielt worden war. Nach Adèles Hinrichtung hatte sie für heute genug von der Ungerechtigkeit dieser Welt.
»Na ja, es gefällt ihm nicht, dass du schlauer werden könntest als er, denn sein Latein ist miserabel, das merke ich bei jeder Messe«, erwiderte Guillaume und kicherte. Dann fuhr er etwas ernsthafter fort. »Er fragte mich, wie ich mir dein zukünftiges Leben vorstelle. Eine Frau, die sogar lateinisch schreiben kann, aber beim Kochen und Backen lustlos dreinblickt, die will kein Bauerntölpel heiraten.«
Marie fühlte einen Stich im Herzen, doch sie tröstete sich damit, dass Pierre sie mochte, so wie sie war.
»Ich habe bisher niemanden angefleht, mich zur Frau zu nehmen«, entgegnete sie bissig.
Guillaume nickte.
»Nein, warum solltest du auch? Trotzdem, ich habe dich in meinem Geist erzogen, aber niemals überlegt, was später aus dir werden soll. Jetzt frage ich mich manchmal, ob das nicht sehr selbstsüchtig von mir war.«
Marie fuhr zusammen. Guillaume war der Mittelpunkt ihres bisherigen Daseins, kein Felsen, eher ein dünner Ast, aber sie hatte sich immer an ihn klammern können, wenn sie sich verloren fühlte. Sie wollte nicht, dass er sich ihretwegen Vorwürfe machte, vor allem, wenn diese völlig unnötig waren.
»Ich bin sehr froh, dass du mir Dinge beibringst, an denen ich Freude habe«, erwiderte sie heftig. »Und eines Tages, da ziehe ich durch die Welt, so wie du es einst getan hast. Ich werde schöne, aufregende Geschichten erzählen. Das kann ich bereits recht gut. Die jungen Leute im Dorf, sie hören mir gern zu.«
Zufrieden, diese Schwierigkeiten vom Tisch gefegt zu haben, biss sie in den Käse. Morgen würde Agnès wiederkommen, und sie freute sich bereits auf gekochtes Essen, das wohlige Wärme in ihrem Bauch verbreiten konnte.
Guillaume schenkte sich nachdenklich einen weiteren Becher Wein ein.
»Marie, nur Männer ziehen als Spielleute durch die Welt. Frauen haben ein Zuhause. Nur Äbtissinnen wie Abélards Héloise verbringen ihre Zeit mit dem Studium von Büchern. Aber wie soll eine Nonne aus dir werden? Ich habe dir zu viel von meinem Denken vermittelt. Die Zeit im Kloster, ich habe sie gehasst.«
Auch diese Geschichte hatte Marie mehrfach gehört. Guillaume stammte aus Nantes in der Bretagne. Als kleiner Junge war er in ein Kloster gegeben worden, doch es hatte ihm nicht gefallen, sich an die Regeln des Gehorsams zu halten. Wie ein störrischer Esel bäumte er sich jedes Mal auf, wenn jemand versuchte, ihm Zaumzeug anzulegen. Er war geflohen, hatte sich einem Spielmann angeschlossen und verbrachte dann viele Jahre damit, durch die Welt zu ziehen, um sich als Sänger, Gaukler und Geschichtenerzähler durchzuschlagen. Die Zeit im Kloster, wo er das Lesen, Schreiben und etwas Latein gelernt hatte, war bei dieser Laufbahn durchaus hilfreich gewesen, auch wenn er es ungern zugab. Zwar studierte er im Kloster hauptsächlich die Bibel und Heiligenlegenden, doch als er später die Gelegenheit bekam, die Liebesgeschichten Ovids, Vergils Gedichte und auch weitere, weniger gottgefällige Texte in den Händen zu halten, war er in der Lage gewesen, sie zu entziffern und zu begreifen. Wer selbst Geschichten erfand, meinte Guillaume immer wieder, sollte erst einmal lernen, wie sie geschickt aufgebaut wurden.
»Ich will auch keine Nonne werden«, erwiderte Marie nun. »Ich sagte doch bereits, wie ich mir mein Leben vorstelle. Glaube mir, ich finde schon einen Weg. Und jetzt erzähle mir, wie es weiterging mit diesem Fürsten, der sich regelmäßig in einen Werwolf verwandelte.«
Sie nippte an dem Wein, den sie sich selbst eingeschenkt hatte, dann füllte sie Guillaumes Becher erneut. Sie wollte ihn zum Reden bringen. Vor drei Tagen hatte sie angefangen, Pierre und seinen Freunden die Geschichte über den Bisclavret zu erzählen, einen Mann, der nachts manchmal die Gestalt eines Wolfes annahm, doch war ihr immer noch nicht klar, wie diese ungeheuerliche Begebenheit ausgehen sollte. Zwar widerstrebte es ihr, Guillaumes Fassung sklavisch nachzuahmen, aber sie konnte Anregungen aus ihr ziehen.
»Na, wie sollte es schon weitergehen?«, erwiderte Guillaume ohne große Begeisterung. »Der Bösewicht wurde überführt, vom König zum Tode verurteilt, und seine arme Witwe fand einen anderen Mann, der sich ihrer annahm.«
Marie verzog das Gesicht.
»Das klingt fad«, sagte sie. »Fast wie eine Predigt des Pfarrers. Gewöhnlich geht es in deinen Erzählungen aufregender zu.«
Guillaume leerte seinen zweiten Becher mit erstaunlicher Geschwindigkeit, um ihn dann heftig auf den Tisch zu knallen.
»Auch darüber hat der Pfarrer mit mir gesprochen. Diese Dinge, die du dir ausdenkst, um die Dorfkinder zu unterhalten.«
»Was gefällt ihm daran nicht?«, fragte Marie, ohne es wirklich wissen zu wollen.
Guillaume holte tief Luft.
»So ziemlich alles, fürchte ich. Marie, du lässt deine Vorstellungskraft galoppieren, ohne an die Folgen zu denken. Dein Werwolf klang wie ein netter Mann mit einer absonderlichen Eigenart.«
»Vielleicht war er das auch!«, entgegnete sie sogleich.
Auf einmal erhob Guillaume seine Stimme. In diesen Momenten war Marie besonders dankbar, dass sie nicht mitten im Dorf wohnten.
»Den Werwolf gab es nicht. Ich habe jedenfalls noch keinen solchen Mann getroffen. Wer Leuten Geschichten erzählt, muss sie so gestalten, dass sie gefallen.«
»Den Kindern im Dorf gefiel meine Geschichte. Sie brennen darauf, das Ende zu hören. All das habe ich von dir gelernt, warum rügst du mich jetzt dafür?«
Guillaume senkte den Kopf, dieser Vorwurf schien ihn getroffen zu haben.
»Ich bin ein alter Mann«, lenkte er ein. »Mein Leben liegt hinter mir, und die meisten Menschen würden es weder als erfolgreich noch als gottgefällig bezeichnen. Aber du bist ein junges Mädchen, Marie. Für dich gelten andere Regeln. Wenn du eine Kreatur Satans, den Werwolf, als liebenswürdig beschreibst, dann bringst du nicht nur den Dorfpfarrer gegen dich auf. Frauen werden in diesen Dingen strenger beurteilt, weil sie die Töchter Evas sind.«
Marie setzte zum Widerspruch an, doch Guillaume erhob die Hände.
»Bitte, erspare mir deine Empörung. Es ist alles meine Schuld. Ich habe dich nicht wie eine Frau erzogen, aber du musst trotzdem als solche leben. Es wird Zeit, dass du dich weiblichen Aufgaben widmest, anstatt immer nur das Schreiben zu üben und mich als Geschichtenerzähler nachzuahmen.«
Ein Feuer begann in Marie zu lodern, drang in jeden Winkel ihres Bewusstseins und verbrannte den letzten Rest an Vorsicht. Es war zu viel gewesen an einem Tag. Der Tod von Adèle und nun Guillaumes Sinneswandel. Mit einer heftigen Handbewegung fegte sie ihren Becher vom Tisch.
»Ich ahme dich nicht nach, ich erfinde meine eigenen Geschichten. Wahrscheinlich gefällt gerade das dir nicht. Du hast Angst, ich könnte besser werden als du.«
Guillaume seufzte nur.
»Der Dorfpfarrer hatte recht. Ich habe dich falsch erzogen. Kein Mädchen im Dorf würde es wagen, so mit seinem Vater zu reden. Du musst lernen, dich wie eine Frau zu verhalten, sonst wird dein Leben sehr schwierig sein.«
Er hatte nicht zornig geklungen, nur niedergeschlagen. Doch Marie kam nicht gegen jene Wut an, die in ihr aufgeflammt war.
»Wenn du willst, dass ich mich wie eine Frau benehme, dann lerne erst einmal, selbst ein Mann zu sein«, schrie sie ihn an. »Benimm dich wie ein Mann und richte das Dach! Pierres Vater hätte es schon längst getan.«
Sie sprang auf und entzog sich weiteren Auseinandersetzungen, indem sie in ihre Kammer lief, einem winzigen, nur mit Holz umzäunten Raum, in dem eine Strohmatte lag. Marie entfernte die Stofffetzen von ihren Füßen und streckte sich aus. Sie wollte in den Schlaf flüchten, aber er mied sie. Die Scham, ihren Ziehvater verletzt zu haben, saß wie ein Stachel in ihrer Brust. Guillaume hatte recht gehabt. Nicht nur ein Mädchen, sondern auch ein Junge wie Pierre hätte die Rute zu spüren bekommen, wenn er seinen Vater derart beleidigte, wie sie es gerade eben bei Guillaume getan hatte.
Aber Guillaume erhob niemals seine Hand gegen sie.
Am nächsten Morgen, wenn ihrer beider Gemüter sich beruhigt hatten, würde sie ihm sagen, dass sie tausendmal lieber in seiner Obhut lebte als bei Pierres Vater, dem Schmied, der dank seines Geschicks, das selbst Kundschaft aus Paris anlockte, der wohlhabendste Mann des Dorfes war, aber jedes Familienmitglied ohrfeigte, das sich erdreistete, ihm zu widersprechen. Dieser Entschluss schenkte ihr Erleichterung, machte es möglich, nach diesem grauenhaften Tag in das Reich der Träume zu sinken.
Drängendes Winseln erklang, als Marie im Schloss der schönen Dame Einlass gefunden hatte und sich ehrfurchtsvoll vor ihr verneigte. Sie wollte um Adèles Begnadigung bitten und suchte nach den richtigen Worten, doch das blasse, stolze Gesicht verschwamm, anstatt klare Formen anzunehmen. Irgendwann umgab sie nur noch graue Leere, während die Klagelaute immer deutlicher wurden. Sie schlug die Augen auf, musterte die Holzbalken an der Decke. Langsam drang die unschöne Wirklichkeit in ihr Bewusstsein. Von dem prächtigen Palast hatte sie nur geträumt, sie befand sich weiterhin in ihrem Zuhause und Adèle war bereits tot. Schnell wollte sie wieder in das tröstende Dunkel des Schlafs flüchten, doch Abélards Winseln machte es ihr unmöglich.
»Schon gut, du bekommst bald dein Morgenmahl«, rief sie dem Hund durch die geschlossene Tür zu. Abélard verstummte für einen Augenblick, sodass nur noch das eintönige, heftige Prasseln des Regens an Maries Ohr drang. Sie zwang sich, sogleich aufzustehen. Guillaume war sicher noch damit beschäftigt, seinen Rausch auszuschlafen, und würde erst aufwachen, wenn das Wasser bis zu seinen Ohren reichte.
Sie wickelte die Lappen wieder um ihre Füße. Die alten Holzschuhe hatte sie vor Jahren einem Bettelmädchen geschenkt, und Guillaume hatte das Geld des geheimnisvollen Verwandten ihres Vaters in letzter Zeit dazu verwendet, sich nach zerschlissenen und daher günstig angebotenen Büchern und Schriftrollen umzusehen, wenn er nach Paris aufgebrochen war. Dass Marie keine Schuhe mehr hatte, war ihm vermutlich nicht einmal aufgefallen. Sie störte sich nicht daran, denn es war ihr wichtiger aufregende Geschichten lesen zu können als geschützte, trockene Füße zu haben.
Marie wusch sich mit den letzten Stück Seife, das noch übrig war, zog sich das wollene Gewand über ihr schon hundertfach geflicktes Leinenhemd und band den Gürtel fest. Rasch fuhr sie sich noch mit den Fingern durch das zerzauste Haar. Es war braun und matt wie das Fell der Straßenhunde im Dorf, aber widerspenstig gelockt. Ihr Gesicht hatte Marie bisher nur selten sehen können. Manchmal schwamm es verzerrt auf der Oberfläche des Teiches am Dorfrand. Aber auch ohne ihr eigenes Aussehen genau zu kennen, wusste Marie, dass sie kein Mädchen war, dessen Anblick Männern den Kopf verdrehte. Bei den Tänzen auf dem Marktplatz wurde sie kaum beachtet. Nur durch Witz und Einfallsreichtum konnte sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie sah das als Ansporn, an diesen Eigenschaften weiter zu feilen, sie zur Vollkommenheit reifen zu lassen.
Cleopatra krächzte erfreut, als Marie die Tür zum großen Raum aufschob, und streckte die Flügel aus, um ein paar Runden zu drehen. Der Hund lief ihr entgegen, schnappte nach dem Stoff ihres Gewands und zerrte daran. Ungeduldig schob sie ihn zurück, doch er biss sich beharrlich an ihr fest, zappelte und stieß weiter Klagelaute aus. Die Ahnung von etwas Bösem stieg in Marie hoch, denn aus Abélards Verhalten sprach keine Vorfreude auf eine dicke Scheibe Speck. Er sprang nun aufgebracht herum, bellte und begann, an der Ausgangstür zu kratzen. Angespannt stieß sie diese auf und stellte sich der eisigen Morgenluft, die ihr entgegenblies. Der Hund schoss nach draußen. Bald schon war sein Bellen quälend laut geworden. Marie wurde erst jetzt bewusst, dass sie nirgendwo im großen Raum Guillaumes schlafende Gestalt entdeckt hatte. Er musste es trotz mehrerer Becher Weins noch in seine Kammer geschafft haben.
Sie trat ins Freie. Regen prasselte so heftig auf sie nieder, dass ihr wollenes Gewand sogleich schwer und feucht zu werden begann. Sie rieb sich die Augen und machte schnell das Zeichen des Kreuzes, um sich vor dem Bösen zu schützen, dessen Nähe sie ahnte. Der Wald ruhte dunkel im Regenschauer, und kein verdächtiges Leben regte sich in ihm. Immer verzweifelter bellte Abélard nun, Marie zwang sich, in seine Richtung zu blicken.
Zunächst sah sie nur die Leiter an der Hauswand lehnen. Guillaume musste sie noch in der vergangenen Nacht dorthin gebracht haben. Aber warum in Gottes Namen wollte er im Dunkeln das Dach richten? Und wo war er jetzt?
Sie entdeckte ihn ein Stück neben der Leiter. Er lag völlig still, und auch als sie an ihm zu zerren begann, regte er sich nicht. Verzweifelt schrie Marie seinen Namen, doch er reagierte nicht. Als sie ihn packen wollte, um ihn ins Haus zu ziehen, sah sie das Rot auf dem Stein neben seinem Kopf. Mit zitternden Händen strich sie über seine Wangen und entdeckte die Wunde. Guillaumes rechte Schläfe war ein brauner Fleck aus verkrustetem Blut und nasser Erde. Nochmals sah sie sich ängstlich nach einem Angreifer um. Die Zusammenhänge wollten nicht so recht in ihr Bewusstsein dringen. Erst als ihr langsam klar wurde, dass der Ziehvater nicht niedergeschlagen worden war, sondern bei dem Versuch, die Leiter zu erklimmen, gestürzt und auf den Stein gefallen sein musste, setzten ihre Füße sich in Bewegung. Sie schienen kein Teil ihres Körpers mehr zu sein, sondern bewegten sich eigenständig, trugen sie ins Dorf hinein. Vielleicht fühlte ein Werwolf sich derart betäubt, wenn er zu einem Wesen wurde, das fremden Regeln folgte. Abélards treues Hecheln an ihrer Seite war der einzige Trost in diesem Albtraum, aus dem sie einfach nicht erwachen konnte.
2. Kapitel
Marie, es ist nicht deine Schuld«, murmelte Pierre sanft und drückte ihre Hand. Marie presste die Zähne zusammen, konnte aber nicht verhindern, dass sie weiter lautstark klapperten. Ihr ganzer Körper bebte, als leide sie an einem starken Fieber. Zu sprechen wagte sie nicht, denn sie fürchtete, kein verständliches Wort herauszubringen.
»Nimm einen Schluck Wasser, Marie«, flüsterte der Junge und blickte sich im großen Raum der ausgebesserten Ruine um.
Aus Guillaumes Kammer drang Stimmengewirr. Der Pfarrer befand sich dort, gemeinsam mit einem heilkundigen Mönch, den er aus dem nächsten Kloster hatte kommen lassen. Marie versuchte verzweifelt, Ruhe zu finden. Irgendwann kämen die beiden wieder heraus, und es widerstrebte ihr, vor jenem Mann, dem sie verhasst war, wie ein klägliches Häufchen Elend dazusitzen.
Aber vermutlich hatte der Pfarrer recht. Sie war ein schlechtes, von Grund auf verdorbenes Mädchen, das durch seine frechen Reden den einzigen Menschen, der sie wirklich liebte, in den Tod getrieben hatte. Ihre Hände schossen in die Höhe, und sie kratzte mit den Nägeln ihre Wangen auf, um den rasenden Schmerz in ihrem Inneren durch einen anderen zu betäuben, der erträglicher war. Pierres Griff legte sich um ihre Handgelenke und hielt sie eisern fest.
»Nun hör doch auf, Marie!«, rief er. »Du hast nichts Schlimmes getan, ihn nur aufgefordert, das Dach zu richten. Das war doch wirklich nötig.«
Marie wollte widersprechen, doch abermals brach sie in Tränen aus. Sie schnappte nach Luft, schluckte und japste kläglich, während Pierre seine Arme tröstend um ihre Schultern legte.
»Ich habe ihn dazu herausgefordert, verstehst du?«, stieß sie schließlich hervor. »Er war gekränkt, deshalb wollte er sogleich das Dach richten, obwohl es dunkel war und er getrunken hatte.«
»Er tat es, weil er völlig betrunken war«, widersprach Pierre. »Er konnte nicht mehr klar denken, sonst hätte er bis zum nächsten Morgen gewartet.«
Marie senkte den Kopf. Guillaume hatte stets zu sprunghaftem, launischem Verhalten geneigt, aber eben dies hätte sie wissen müssen.
Die Tür der Kammer öffnete sich knarrend. Marie richtete ihren Blick entschlossen auf die beiden Männer, obwohl sie Angst vor deren Botschaft hatte.
»Er lebt«, erklärte der Mönch. »Aber er ist nicht bei Bewusstsein. Die Verletzung an seinem Kopf war schwer. Ich habe ihn verbunden und ihn auch zur Ader gelassen, um seine Körpersäfte in Ordnung zu bringen. Durch den Sturz ist sein Blut vielleicht geschädigt worden.«
Marie stand auf und lief los, um den Beutel mit den Münzen zu holen. Ein Aderlass war sicher nicht billig, aber wenn er Guillaume geholfen hatte, war sie gern bereit, den letzten Rest der Summe, die der Verwandte ihres Vaters gebracht hatte, herzugeben. Der Mönch steckte seinen Lohn zufrieden ein.
»Du musst beten, Marie«, meinte der Pfarrer mit einem strengen Blick. »Um die Vergebung deiner Sünden bitten und Besserung geloben, damit Gott der Herr Erbarmen mit deinem Vater hat.«
Marie nickte. Alle Lust auf Widerspruch war ihr vergangen, sie wollte mit Freude jenes gottgefällige Mädchen sein, das der Pfarrer sich wünschte, wenn ihr dadurch Guillaume erhalten blieb.
»Sieh regelmäßig nach ihm«, fuhr der Mönch fort. »Er kann in jedem Augenblick wieder zu sich kommen. Sollten unsere Gebete unerhört bleiben, dann wende dich an den Pfarrer.«
Beide Herren verabschiedeten sich. Pierre saß noch eine Weile an Maries Seite, umarmte und streichelte sie, doch schien er dabei immer unruhiger zu werden.
»Ich weiß, dass dein Vater auf dich wartet«, sagte sie schließlich. »Geh jetzt heim! Ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst, sobald es möglich ist.«
Pierre löste sich mit niedergeschlagenem Blick von ihr. Zum ersten Mal fiel ihr auf, dass er ein ansehnlicher Junge war mit seinem breiten, ehrlichen Gesicht, der hohen Gestalt und dem dichten, haselnussfarbenen Haar. Zwar sehnte sie sich heftiger nach seiner Nähe als jemals zuvor, aber sie wusste, dass sie ihn gehen lassen musste, damit er zu Hause keine Prügel bezog. Er versprach, am nächsten Tag nach ihr zu sehen, dann fiel auch hinter ihm die Tür zu. Marie vergrub ihr Gesicht in Abélards Fell, sog die Wärme seines Körpers in sich auf. Cleopatra landete auf ihrer Schulter. Die Anwesenheit von Fremden hatte sie verunsichert, doch nun knabberte sie zufrieden an Maries Ohrläppchen.
Marie wurde bewusst, dass sie außer diesen Tieren niemanden mehr auf der Welt hätte, falls Guillaume starb. Sie stand und ging in die Kammer, wo er auf seiner Strohmatte lag. Der Mönch hatte ein Tuch um seinen Kopf gewickelt, an dem das Blut langsam zu trocknen begann. Marie beugte sich zu der leblosen Gestalt und legte ihren Kopf auf seine Brust. Der schwache, aber regelmäßige Schlag seines Herzens drang beruhigend an ihr Ohr.
»Verzeih mir, wie frech ich so oft zu dir gewesen bin«, flüsterte sie leise. »Und bitte, bitte verlass mich nicht.«
Als es Mittag wurde, hörte Marie ihren Magen knurren. Sie grub ein paar Rüben aus der Erde, durchsuchte die Vorratskammer nach dem letzten Rest von gepökeltem Fleisch und Brot. Agnès war nicht erschienen, was Marie erleichterte, denn es war kein Geld mehr im Haus, um ihre Dienste zu bezahlen. Obwohl das Kochen ihr keine besondere Freude bereitete, hatte Marie der Magd manchmal geholfen und sich einiges eingeprägt. Sie warf Fleisch und Gemüse in den großen Kessel über der Feuerstelle, schüttete Wasser hinzu, um eine Brühe zuzubereiten. Dann streute sie Salz und ein paar getrocknete Kräuter darüber, bevor sie den Inhalt in zwei Holzschalen verteilte. Damit ging sie in Guillaumes Kammer zurück. Vielleicht konnte der Geruch von Essen ihn aus seiner Bewusstlosigkeit erwecken.
Sie stellte eine der Schalen neben ihm ab und begann aus ihrer eigenen zu löffeln. Bald breitete sich wohltuende Wärme in ihrem Körper aus. Guillaume regte sich weiterhin nicht, doch meinte sie, seine Atemzüge seien ein wenig lauter geworden.
»Du hast mir nie viel erzählt«, begann Marie zu reden. Sie wollte es nicht hinnehmen, dass Guillaume zwar neben ihr lag, aber nicht mehr Teil ihrer Welt war. Der Klang ihrer eigenen Stimme erleichterte sie, denn sie kam sich weniger einsam vor. »Ich weiß nur, dass meine Mutter Jeanne hieß. So wie der Affe, der angeblich nach ihr benannt wurde. Dass sie sehr schön war und bereits einige Monate nach meiner Geburt verstarb. Aber woher stammte sie? Und wie war der Name meines Vaters? Warum tuscheln die Leute im Dorf, wenn sie uns sehen? In den letzten Jahren hatte ich oft den Wunsch, danach zu fragen, aber ich wagte es nicht, denn mir schien, es sei dir unangenehm. So beschloss ich immer wieder, auf den richtigen Augenblick zu warten. Aber was ist, wenn er nun nicht mehr kommt? Ich möchte wissen, wer ich wirklich bin, Guillaume.«
Als nur Stille ihr antwortete, löffelte sie die Brühe zu Ende. Danach streichelte sie versonnen Guillaumes Arm, der ebenfalls verbunden war.
»Wenn du mich verlässt, was wird dann aus mir? Ich weiß nicht, wo ich diesen Verwandten meines Vaters finden kann. Bis er wieder zu uns kommt, werden noch Monate vergehen. Soll ich hier ganz alleine leben? Ich habe Angst.«
Sie erinnerte sich, wie völlig überzeugt von ihren eigenen Talenten sie tags zuvor noch gewesen war. Jetzt schien die Vorstellung, sich selbst als Geschichtenerzählerin durchzuschlagen, nur noch der dümmliche Traum eines unreifen Mädchens, als hätte allein die Gegenwart ihres verrückten Ziehvaters ihr die Kraft geben können, an sich selbst zu glauben. Wieder stiegen ihr Tränen in die Augen, und Marie verbarg ihr Gesicht in den Händen. Sie wünschte sich, in jenes ewige Vergessen sinken zu können, das auch Guillaume befallen hatte.
»Heirate«, drang plötzlich ein heiseres Krächzen an ihr Ohr. »Heirate Pierre. Er liebt dich und wird gut zu dir sein.«
Marie nahm die Finger von ihren feuchten Augen. Guillaume sah sie nun an. Seine Lider flackerten, und er zuckte in dem erfolglosen Versuch, sich aufzurichten.
»Dein Vater ist vor vier Jahren gestorben, Marie. Ich weiß nicht, wie lange noch Geld kommen wird. Deine Mutter, sie ...«
Ein böser Husten schüttelte Guillaume, bevor er weitersprechen konnte.
»Deine Mutter war eine Küchenmagd. Sie gefiel ihm. Er behandelte sie besser, als viele Männer seines Standes es getan hätten, warb um sie und machte Liebeserklärungen. Sie waren beide noch sehr jung, gerade einmal vierzehn. Er schenkte ihr ein schönes Gewand, in dem sie aussah wie eine Dame und wünschte, dass sie bei den Mahlzeiten an seiner Seite saß. Deinem Großvater wurde diese Buhlschaft seines Sohnes zu innig. Er schickte ihn fort und wies deine Mutter aus der Burg, versprach ihr jedoch einen Ehemann, bei dem sie ein gutes Leben hätte, wenn sie seinen Sohn in Zukunft in Frieden ließ. Aber sie war so verrückt, mich zu wählen. Weil ich sie zum Lachen bringen konnte, wenn sie traurig war.«
Marie hörte, wie der Herzschlag ihr in den Ohren dröhnte. Hoffnungsvoll hielt sie Guillaume die Brühe hin, und als er nicht in der Lage war, die Schüssel festzuhalten, flößte sie ihm vorsichtig einen Löffel nach dem anderen ein. Er schluckte, auch wenn ein Teil der Flüssigkeit über sein Kinn rann. Danach wurde sein Atem ruhiger, und seine Stimme klang klar.
»Jeanne wollte nicht in den Ländereien des Vaters ihres Geliebten leben, und ich schlug vor, dass wir nach Paris gehen könnten. In der Stadt sind die Menschen freier. Aber ihr gefiel dieses gottverlassene Dorf. Es erinnerte sie an ihren Heimatort. Ihren jungen Geliebten sah sie niemals wieder, doch sein Vater schickte regelmäßig einen Boten, um unseren Lebensunterhalt zu sichern.«
Marie legte ihren Arm um Guillaumes Schultern und half ihm, sich aufzurichten.
»Wie fühlst du dich?«, fragte sie. »Ein Mönch war hier, um dich zu versorgen. Soll ich ihn noch einmal holen lassen?«
»Herrgott noch mal, nein! Verschone mich mit irgendwelchen frömmelnden Quacksalbern, die mich zu Tode pflegen!«
Marie lächelte erleichtert, denn das klang ganz nach dem Guillaume, den sie kannte.
»Na gut, dann versorge ich dich eben selbst. Hast du noch Hunger?«
Er schüttelte den Kopf.
»Mir ist nur etwas schwindelig, aber das wird schon wieder.«
Marie hatte plötzlich den Wunsch, singend und tanzend durch das Haus zu springen. Sie betrachtete Abélard, der glücklich die Hände seines Herrn leckte. Dann öffnete sie die Tür, um Cleopatra hereinflattern zu lassen.
»Ruh dich aus, Guillaume. Meine Fragen haben dich sicher angestrengt. Ich räume inzwischen etwas auf, dann komme ich gleich wieder«, rief sie beschwingt und wollte hinauseilen, doch Guillaumes Finger krallten sich in den Ärmel ihres Gewands.
»Vergiss nicht, was ich gesagt habe. Falls ich sterbe, dann heirate Pierre. Sollten die Verwandten deines Vaters dich rufen, dann gehe nicht zu ihnen, hörst du. Die edlen Herrschaften haben schon deiner Mutter nichts als Kummer bereitet.«
Marie schüttelte verwirrt den Kopf.
»Aber warum sollten sie mich denn plötzlich rufen, wenn ich ihnen all die Jahre unwichtig war? Ich bleibe bei dir, bis ich in der Lage bin, mich selbst mit meinen Geschichten durchzuschlagen.«
Sie sah Guillaume nachsichtig lächeln.
»Marie, bist du denn taub? Nur Männer können als Sänger oder Gaukler herumziehen, sage ich die ganze Zeit. Und deine Stimme, so leid es mir tut, klingt nicht besonders schön.«
Marie schoss es sogleich durch den Kopf, dass sie sich in diesem Fall eben einen geeigneten Sänger suchen müsste, doch sie bezwang erfolgreich den Drang, wie gewohnt zu widersprechen. In Zukunft würde sie weniger aufsässig und streitlustig sein, hatte sie sich vorgenommen. Ein gutes Mädchen werden, so wie der Pfarrer es von ihr verlangte. Den großen Raum, wo noch die Weinbecher von gestern Abend standen, in Ordnung zu bringen, wäre ihr erster Schritt in diese Richtung. Entschlossen wollte sie hinauseilen, doch ein lautes Schreien hielt sie zurück.
»Marie, mein Kopf, es ... es tut so weh ...«
Sie fuhr herum und sah, wie Guillaume seine Hände gegen die Schläfen presste. Dann fiel er wie ein Stein auf die Strohmatte. Erschrocken eilte sie zu ihm und strich sanft über sein Gesicht. Speichel tropfte aus dem halb geöffneten Mund. Er regte sich nicht mehr und sagte kein Wort, obwohl Marie immer lauter seinen Namen rief. Als ihre Stimme heiser zu werden begann und ihre Kehle schmerzte, sank sie erschöpft auf seine Brust. Sie hörte keinen Herzschlag mehr.
3. Kapitel
Wieder war Marie im Schloss der schönen Dame, die auf einem Thron aus schimmernden Edelsteinen saß und versonnen das Fell eines großen Löwen streichelte, der ihr zu Füßen lag.
»Ich bitte Euch, edle Frau, helft Guillaume«, sagte Marie und staunte, wie gefasst ihre Stimme klang. »Ich weiß, allein Eure Hände können die Toten zum Leben erwecken.«
Die Dame musterte sie nachdenklich, nahm einen Schluck aus ihrem durchscheinenden Becher, dann holte sie Luft.
»Du hast großes Vertrauen in meine Fähigkeiten, kleine Marie. Verrate mir, wie kommst du darauf?«
Marie wurde schwindelig, als sie nach den richtigen Worten suchte. Wer in solcher Pracht lebte, musste von Gott gesegnet und zudem begabter sein als andere, gewöhnliche Menschen. Als sie ebendies sagen wollte, begann die Gestalt der Dame plötzlich hinter einem grauen Nebel zu verschwinden. Die Umrisse des Raums verblassten und wurden zu einem schlichten Braun. Marie fröstelte, und sie drängte sich an den weichen, warmen, haarigen Körper, den sie an ihrer Seite spürte. Als etwas ihr Gesicht leckte, öffnete sie die Augen und umarmte Abélard.
In dem kleinen Raum stand ein Tisch mit einem Krug und einer Kerze darauf. Zu ihren Füßen entdeckte Marie einen Eimer Wasser. Die Umgebung ähnelte ihrem Zuhause, doch wirkte hier alles geordneter und sauberer, als sie es gewohnt war. Cleopatras Krächzen drang an ihr Ohr. Sie blickte auf und stellte mit Entsetzen fest, dass der grüne Vogel nun in einem kleinen Metallkäfig saß, ebenjenem Gefängnis, das Guillaume ihm immer hatte ersparen wollen. Beharrlich nagte Cleopatra bereits an den Stäben. Marie wollte aufspringen, um sie zu befreien, doch der Klang von Stimmen ließ sie zusammenfahren.
»Mutter, ich bitte Euch, wir konnten sie doch nicht allein in dieser Ruine am Waldrand lassen. Dort können Wölfe oder andere wilde Tiere eindringen.«
Marie wusste, wer hier sprach, und es erleichterte sie, Pierre in der Nähe zu wissen, obwohl sie ihn nicht sehen konnte.
»Nun, meinetwegen, auch wenn ihre letzte teuflische Geschichte klang, als hätte sie eine Schwäche für Wölfe«, entgegnete die Frau des Schmieds. Widerwillig musste Marie grinsen.
»Das sind doch nur Dinge, die sie sich ausdenkt. Sie hat es von Guillaume gelernt. Mutter, bitte glaubt mir, sie ist ein liebenswürdiges Mädchen mit einem guten Herzen. Gott der Herr kann keinen Groll gegen sie hegen. Es wäre ein Verstoß gegen das Gebot der Barmherzigkeit, Marie nun im Stich zu lassen.«
Pierres Mutter schnaubte lautstark.
»Und warum auch noch einen verlausten Köter aufnehmen und diesen geflügelten Dämon aus dem Heidenland, eine Kreatur Satans, die mein ganzes Haus verdreckt?«
»Mutter, es ist doch nur ein Vogel! Ich habe ihm einen Käfig gebaut, damit er nichts anderes schmutzig macht. Marie liebt diese Tiere. Bei ihnen kann sie Trost in ihrem Unglück finden.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!