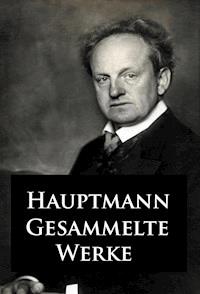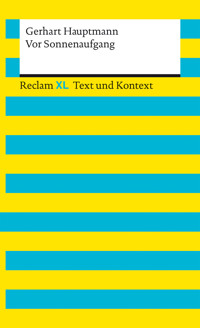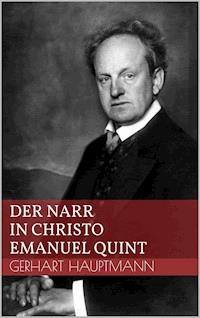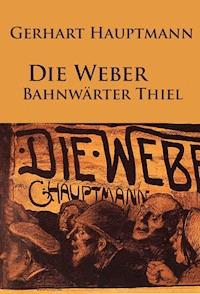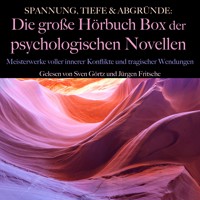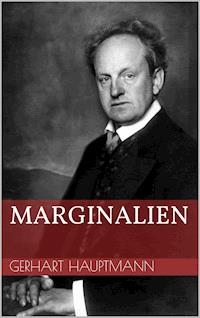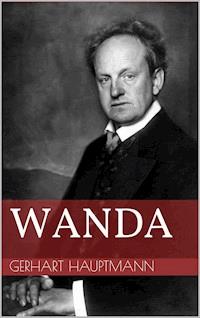Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Gral-Phantasien
- Sprache: Deutsch
Diese Neuinterpretation der gleichnamigen Sage durch Hauptmann, versehen mit seiner persönlichen Note, verspricht ein Eintauchen in die mythische Sagenwelt. Lohengrin, auch Schwanen-Ritter genannt, ist der Sohn des sagenumwobenen Parsival. Wie sein Vater zieht er in die Welt hinaus und erlebt zahlreiche spannende Abenteuer.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhart Hauptmann
Lohengrin
Saga
Lohengrin
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1913, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726956528
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1. Kapitel
Unter Glockengeläut und Volksjubel geschah die Hochzeit Parsivals und Blancheflours. Als ein besiegter, irrender Ritter, sein schwarzes Ross am Zügel führend, war Parsival in der Hauptstadt Blancheflours eingezogen, und nun war er ihr Gatte und König geworden. Welche Irrfahrten er bis dahin durchgemacht hatte, ist in der besonderen Geschichte Parsivals aufgezeichnet, auch dass er und warum er seine Gattin schon am Morgen nach der feierlichen Hochzeit heimlich verliess.
Dreiviertel Jahre nach dem Verschwinden Parsivals gebar Blancheflour ihren einzigen Sohn Lohengrin.
Der witwenhafte Ernst, der ihr eigen war, hinderte nicht, dass der junge Prinz und Nachkomme Parsivals mit allem Glück der Jugend gesättigt seine Kinderjahre verleben durfte. So war Lohengrin bald zu einem schlanken glücklichen Knaben geworden, dessen gläubige Heiterkeit unbesieglich schien. Der blonde Knabe, der Stadt und Reich mit Bürgern und Untertanen seiner Mutter zu seinen Füssen sah, ward gleichsam von allen auf Händen getragen. Das erhöhte natürlich den Zustand seiner Glückseligkeit, der auch immer wieder in den trüben Dämmer, der das Herz seiner Mutter erfüllte, hineinstrahlte. Güte und Kraft waren vermählt in dem Knaben und noch mehr in dem Jüngling Lohengrin, dessen Schönheit so blendend war, dass man nach dem geheimnisvollen Verschwinden seines Vaters geradezu von göttlicher Herkunft munkelte.
Blancheflour, die nach Parsivals Verschwinden in ihrem Sohne das Einzige sah, was sie im Leben festhalten konnte, hatte ihn mit den vorzüglichsten Lehrern umgeben und zu seinem Umgang nicht nur die edelsten Sprossen seiner Altersstufe aus dem Adel des Landes ausgewählt, sondern auch junge Priester und Philosophen, so dass der Jüngling im Bereiche der sieben freien Künste ebenso meisterlich ausgebildet, als im Reiten und Fechten war.
Überdies ward Lohengrin aus dem unerschöpflichen Reichtum seiner Mutter jeder nur halb geäusserte Wunsch erfüllt, trotzdem er an Wünschen fast noch reicher, als seine Mutter an irdischen Gütern war.
Er liebte die Jagd, er liebte den Glanz, er baute sich hie und da im Lande romantische Burgen und Lustschlösser, die er mit köstlichen Gärten umgab und abwechselnd mit seinem grossen Gefolge besuchte. Er feierte Feste, hielt weltberühmte Tourniere ab, während seine Mutter in der Stille der Bibliothek mit einem Araber über den Gralsbüchern grübelte.
Blancheflour vertiefte sich unter Leitung eines Arabers in das Studium vom heiligen Gral, hauptsächlich um den Weg dorthin zu ergründen und ihren verlorenen Gatten wiederzusehen. Aber weil es der Gral gewesen war, der, stärker als sie, ihren Gatten und früher Gornemant an sich gezogen hatte, betrachtete sie seine Segnungen mit Sehnsucht sowohl als mit Bitterkeit und mit einer Ehrfurcht, die, wenn sie an Lohengrin dachte, der nackten kahlen Furcht zum verwechseln ähnlich sah.
So hatte sie einen geheimen, strengen Befehl an jedermann ausgehen lassen, der mit Lohengrin in Berührung kam, dass er bei Strafe des Köpfens oder Hängens niemals vom heiligen Grale sprechen, ja auch nur seinen Namen erwähnen dürfte. Ebenso blieb der Teil der Bibliothek, wo die Gralsbücher aufgestapelt lagen, imme rvor dem Prinzen verschlossen, auch dann, wenn die Königin mit dem Araber in diesem Raume ihre Studien trieb.
Blancheflour war für Lohengrin nicht nur die Mutter, sondern er sah in ihr eine Heilige. Der sanfte, doch tiefe Schmerz, der ihr Wesen durchtränkte, auch wenn sie lächelte, galt dem Knaben, dem Jüngling, dem jungen Manne als Zeichen tiefster Weisheit und des tiefsten Wissens, das in der Welt zu erlangen ist.
Der Prinz, der weisse arabische Pferde zu reiten liebte, zog nie auf die Jagd, ohne dass er durch seine silbernen Jagdhörner die Mutter beim Auszug begrüssen liess. Bei jeder Tafel erhob er sich feiersich, wenn er das erste Glas Wein an die Lippen setzte und trank es auf seiner erhabenen Frau Mutter Wohl. Es war bezaubernd, wie er, an lich der gewinnendste Mann, seiner Königin Mutter begegnete, wie er mit edelstem Anstand und kindlicher Devotion behutsam die lange weisse Hand Blancheflours an die Lippen nahm, jene Hand, die einst der Vater Parsival in glühendster Liebe geküsst hatte. Nie trug Lohengrin andere Farben, als die seiner Mutter, grün und weiss, beim Tournier, und niemals, auch dann nicht, wenn fremde Königinnen zugegen waren, verneigte er sich auf dem Tornierplatz eher vor jemand anderem, als vor ihr. Er sagte laut, seiner Mutter ein einziges Lächeln abzugewinnen, bedeute ihm mehr als der Besitz von aller Könige Land und die Gunst aller Königstöchter der Erde.
Was Wunder, wenn er nur lachend den Kopf schüttelte, als seine Mutter ihm die Notwendigkeit, ein Weib zu nehmen, vorstellte. Nein, er wollte nicht heiraten. Und er heiratete nicht.
Lohengrin hatte die Unmut und sanfte Selbstherrlichkeit solcher Prinzen, die ohne einen Vater, der sie in Schatten stellt, aufgewachsen sind. Erst als er im zwölften Jahre war, fing er an, sich über seinen Vater, den er nicht einmal dem Namen nach kannte, heimlich Gedanken zu machen. Er würde den Namen Parsival ohne Zweifel längst erfahren haben, wenn nicht der Wille der allgeliebten Königin Blancheflour es verhindert hätte. Sie wollte den Sohn auf keine Weise in das dunkle Schicksal des verschollenen Gatten verwickelt sehen.
Nach Art eines guten Sohnes trat Lohengrin eines Tages mit der gewohnten, ehrerbietigen Herzlichkeit in die Frauengemächer der Mutter ein. Er wollte die Fragen, die ihn beschäftigten, von niemand als ihr beantwortet wissen.
Die Mutter sagte: Du hast ein Recht nach deinem Vater und seinem Schicksal zu fragen, Lohengrin, und so muss es wohl scheinen, als habe ich, als Mutter, nicht das Recht dir eine Auskunft zu verweigern. Gerade aber, weil ich deine Mutter bin, tu ich das.
Aber Blancheflour verbesserte sich. Du weisst es, fing sie von neuem an, dass ich dir gegen deinen klaren und ausgesprochenen Wunsch nichts zu verweigern imstande bin. Deshalb bitte ich dich, nimm deine Fragen aus freiem Willen zurück, verzichte, um meiner besseren Einsicht Willen, auf ihre Beantwortung.
Lohengrin, der die Hand seiner Mutter während sie sprach, zärtlich gehalten hatte, kniete nieder und legte sie an die Stirn, womit er seinen herzlich freien Gehorsam ausdrückte. Was du mir zu verschweigen wünschest, hohe Frau Mutter, sagte er, danach will ich nicht fragen. Dein Schweigen soll mir so wert und werter als aller anderen Menschen Antwort sein.
Nun aber sagte die in heimlicher Angst um das Glück ihres Sohnes erbebende Königin Blancheflour: willst du mir ein Versprechen geben? Jedes, gab er zur Antwort, was du von mir verlangst, Mutter Königin! So gelobe mir, sagte sie wiederum, niemals und niemand nach deinem Vater und niemals und niemand nach dem geheimnisvollen Gegenstand zu fragen, in dessen Studium ich hinter den Mauern unserer Bibliothek versunken bin. Ich gelobe es! sagte, sich tief verneigend, der Knabe.
Unzweifelhaft war dem Prinzen durch diese Vorsicht der Mutter und durch den ritterlichen Gehorsam, der es ihm ganz unmöglich machte, je sein Gelübde zu verletzen, der schöne, freie und sorglose Wuchs seiner Knaben- und Jünglingsjahre erhalten geblieben.
2. Kapitel
Eines Tages befand sich Prinz Lohengrin auf der Falkenjagd. Tagelang war er zu Pferde mit vielen Falken in grosser Gesellschaft durchs Land geritten. Man hatte so einen entlegenen See erreicht, bei dessen Anblick Lohengrin äusserte, er komme ihm vor, wie der Styx, das ist jener Strom der Unterwelt, über den der Totenfährmann abgeschiedene Seelen ins Reich der Schatten hinüberrudert.
Kaum dass der junge Prinz diesen Gedanken ausgedrückt hatte, so schien ihn ein Nachen mitten im See zu bestätigen, in dem sich die hohe, unbewegte Gestalt eines Anglers abzeichnete.
„Der dort könnte wahrhaftig Charon sein,“ sagte Lohengrin, „und der See sieht nicht anders aus, als hätten ihn Tränen statt Himmelsregen gebildet.“
Als er diese Betrachtung anstellte, hatte der schöne Mann und Jagdherr — er war damals fünfundzwanzig Jahre alt — den weissen Lieblingsfalken auf der Faust und sein weisses arabisches Pferd unter sich: zugleich aber kam eine Wildtaube aus der Gegend, wo eben die Sonne blutig unterging, über den See herangeflogen. „Lieber Täubrich,“ sagte da in einer Anwandlung frevlen Übermutes Lohengrin, „für dich soll dieser See nun wahrhaft und wirklich den Styx bedeuten.“ Damit nahm er dem Falken die Kappe ab, warf ihn hoch, und in kurzer Zeit, als der Kampf in der Luft entschieden war, fiel die ermordete Taube aus grosser Höhe und zwar, wie man deutlich sah, in den Nachen des angelnden Fischers hinein.
Über den sonderbaren Zufall suchten die Herren des Gefolges mit lautem Lachen hinwegzukommen. Man erwartete lärmend den langsam herwärts treibenden Kahn, der, wie es schien, sich ohne das Ruder des Anglers den Ufern näherte. Sowie der Nachen zwischen dem Schilf zum Stillstand kam, war es, als habe ein eisiger Hauch die Flamme der Freude unter den Wartenden ausgeblasen.
Der Fischer sagte: Hier hast du dein blutendes Opfer, Prinz Lohengrin! Du tötest den Schwachen, Parsival pflegte den Starken zu töten. Er schoss den Sperber, du hast die Taube ums Leben gebracht.
Da war nun zum grossen Entsetzen des Gefolges der Name Parsival vor den Ohren des Prinzen genannt worden.
Ein Jeder erschrak, denn die gute Königin Blancheflour hatte auch diese Verfehlung mit Todesstrafe belegt. Aber man liess den Fischer unbehelligt davonrudern. Schien es doch, als habe der Prinz die Worte des Mannes überhört, und man würde zudem nicht recht gewusst haben, wie man die Gefangennahme des Fremden begründen sollte, ohne Lohengrin das Geheimnis ganz zu enthüllen, dessen bergender Vorhang ja erst kaum merklich gelüftet war.
Allein die Rätselworte des Fischers hatten sich in die Seele des Prinzen eingebrannt und alle eigentümlichen Umstände, die den Tod der Taube begleitet hatten. Von da ab kam es zuweilen vor, dass den Prinzen das schmerzverzehrte Antlitz des Anglers nach frohen Gelagen im Traume ängstete. Gern hätte er nun mit seinen Gedanken und Zweifeln, die ihm das wunderliche Erlebnis erregt hatten, bei der Mutter Belehrung gesucht. Aber er fühlte zu wohl, wie nahe ihm die Gefahr gekommen war, das Blancheflour gegebene Versprechen zu verletzen, das ihm die Frage nach seiner Herkunft, das heisst nach seinem Vater, verbot.
So starb eines Tages Blancheflour, ohne ihr irdisches Schweigen gebrochen zu haben, und ging in das grössere Schweigen des Todes ein.
Bald nach ihrem Hingang hatte der neue König ein Gespräch mit dem alten Araber, der seiner Mutter bei ihren geheimnisvollen Studien nicht von der Seite gewichen war.