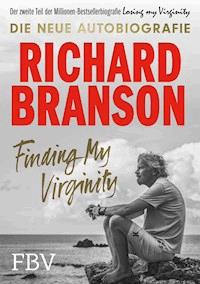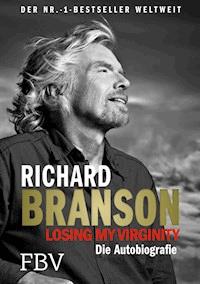
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Legastheniker und Versager. Mit 16 Jahren bricht Richard Branson 1968 die Schule ab. Deren weitsichtige Einschätzung seiner Zukunft: Knacki oder Millionär. Nicht einmal drei Jahre später eröffnet er in der Oxford Street den ersten Virgin-Plattenladen und landet kurz darauf mit einem Plattenvertrag den ersten Millionen-Deal. Damit legt Branson den Grundstein seiner Virgin-Group, die heute mehr als 20 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet und mehr als 50 000 Menschen beschäftigt. In seinem Millionen-Bestseller Losing my Virginity spannt das umtriebige Multitalent den Bogen von 1950 bis an die Schwelle des Millenniums. Es ist die beeindruckende Autobiografie eines Abenteurers und Paradiesvogels, für den Aufgeben nur eines ist: keine Option
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
3. Auflage 2021
© 2018 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89, 80799 München
Tel.: 089 651285-0, Fax: 089 652096
Copyright der deutschsprachigen Erstausgabe: © 1999 Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Copyright der Originalausgabe: © Richard Branson 1998, 2002, 2005, 2007
The right of Sir Richard Branson to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
First published in 1998 by Virgin Books. Virgin Books is a part of the Pengiun Random House group of companies.
Die Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Losing My Virginity« bei Virgin Publishing, London.
Die deutschsprachige Ausgabe erschien zuerst 1999 beim Campus Verlag, eine Taschenbuchausgabe erschien 2005 beim Wilhelm Heyne Verlag, München.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Patricia Künzel und Stefan Rohmig
Redaktion: Heike Neumann und Johann Lankes
Korrektorat: Sonja Rose
Umschlaggestaltung: Maria Wittek, nach dem Cover der Originalausgabe
Umschlagabbildung: © by Dustin Rabin, Dustinrabin.com. Originally published in Power Magazine. Powermaghk.com
Satz und E-Book: Daniel Förster, Belgern
ISBN Print 978-3-95972-140-0
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-256-8
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-257-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Inhalt
Prolog»AUGEN ZU UND DURCH!«Dienstag, 7. Januar 1997, Marokko
Kapitel 1IN UNSERER FAMILIE HÄTTEN WIR ALLES FÜREINANDER GETAN1950 bis 1963
Kapitel 2»ENTWEDER DU LANDEST IM GEFÄNGNIS ODER DU WIRST MILLIONÄR«1963 bis 1967
Kapitel 3WIE DIE JUNGFRAU ZUM KINDE1967 bis 1970
Kapitel 4 ICH BIN BEREIT, ALLES GENAU EINMAL AUSZUPROBIEREN1970 bis 1971
Kapitel 5EINE HEILSAME LEKTION1971
Kapitel 6DURCH SIMON WURDE VIRGIN RICHTIG ›COOL‹1971 bis 1972
Kapitel 7»TUBULAR BELLS – NIE ZUVOR HABE ICH SO ETWAS GEHÖRT«1972 bis 1973
Kapitel 8DER EWIGE ZWEITE1974 bis 1976
Kapitel 9DIE TÜCKEN DER LINGUISTIK, ODER: »NEVER MIND THE BOLLOCKS«1976 bis 1977
Kapitel 10»ICH DACHTE, ICH ZIEH’ HIER EIN«, SAGTE JOAN1976 bis 1978
Kapitel 11AUF MESSERS SCHNEIDE1978 bis 1980
Kapitel 12PLÖTZLICHER ERFOLG1980 bis 1982
Kapitel 13NUR ÜBER MEINE LEICHE1983 bis 1984
Kapitel 14LAKERS KINDER1984
Kapitel 15DAS BLAUE BAND FÜR GROSSBRITANNIEN1984 bis 1986
Kapitel 16DER GRÖSSTE BALLON DER WELT1986 bis 1987
Kapitel 17ICH DACHTE, MEIN LETZTES STÜNDLEIN HÄTTE GESCHLAGEN1987 bis 1988
Kapitel 18ALLES STAND ZUR DISPOSITION1988 bis 1989
Kapitel 19SPRUNGBEREIT1989 bis 1990
Kapitel 20»FÜR WEN HÄLT SICH DIESER RICHARD BRANSON EIGENTLICH?«August bis Oktober 1990
Kapitel 21ZWEI SEKUNDEN FÜR EIN LETZTES GEBETNovember 1990 bis Januar 1991
Kapitel 22TURBULENZEN Januar bis Februar 1991
Kapitel 23SCHMUTZIGE TRICKSFebruar bis April 1991
Kapitel 24»FÜR MADONNA HÄTTE ICH DAS NICHT GETAN«April bis Juli 1991
Kapitel 25»VERKLAGEN SIE DIESE HALUNKEN«September bis Oktober 1991
Kapitel 26BARBAREN AM FLUGSTEIGOktober bis November 1991
Kapitel 27»SIE NENNEN MICH EINEN LÜGNER«November 1991 bis März 1992
Kapitel 28DER SIEGMärz 1992 bis Januar 1993
Kapitel 29VIRGIN TERRITORYseit 1993
EpilogVIEL FREUD, VIEL LEID
Firmengeschichte der Virgin-Gruppe
Bildnachweis
Mein besonderer Dank gilt Edward Whitley für seine Unterstützung bei diesem Projekt. Edward verbrachte zwei Jahre in meinem Unternehmen, lebte praktisch in meinem Haus, wühlte sich durch 25 Jahre Notizbuchgekritzel und half mir, diese Geschichte zum Leben zu erwecken.
Gewidmet Alex Ritchie und seiner Familie
Prolog »AUGEN ZU UND DURCH!« Dienstag, 7. Januar 1997, Marokko
5.30 Uhr
Joan schlief noch, als ich mich im Bett aufsetzte. Vom anderen Ende von Marrakesch her hörte ich den klagenden Ruf der Muezzins, die über Lautsprecher zum Gebet riefen. Ich hatte Holly und Sam immer noch nicht geschrieben. Daher riss ich eine Seite aus meinem Notizbuch und schrieb ihnen einen Brief, für den Fall, dass ich nicht zurückkehrte.
Liebe Holly, lieber Sam,
das Leben kommt einem manchmal ziemlich unwirklich vor. An einem Tag ist man gesund, lebendig und voller Liebe. Am nächsten ist man nicht mehr da. Wie Ihr beide wisst, verspürte ich immer den Drang, das Leben in vollen Zügen auszukosten. So hatte ich das Glück, in meinen 46 Jahren das Leben vieler Menschen zu leben. Ich habe jede einzelne Minute davon genossen, vor allem die Zeit mit Euch und Eurer Mum. Ich weiß, dass uns viele Leute für verrückt erklärten, weil wir uns auf dieses letzte Abenteuer eingelassen haben. Ich war überzeugt, dass sie sich irrten. Meiner Ansicht nach sprach alles, was wir bei unseren Abenteuern über dem Atlantik und Pazifik gelernt hatten, für eine sichere Fahrt. Ich hielt die Risiken für vertretbar. Offensichtlich habe ich mich getäuscht. Mir tut nichts leid, was ich in meinem Leben gemacht habe – außer, dass ich Joan nicht helfen kann, Euch auf dem Weg ins Erwachsensein zu begleiten. Aber im Alter von zwölf und fünfzehn hat sich euer Charakter bereits herausgebildet. Wir sind beide sehr stolz auf Euch. Joan und ich hätten uns keine besseren Kinder vorstellen können. Ihr seid beide liebenswürdig, rücksichtsvoll, voller Leben (sogar witzig!). Was hätten wir uns sonst noch wünschen können? Seid stark! Ich weiß, dass das nicht einfach sein wird. Aber wir hatten ein wunderbares Leben zusammen, und Ihr werdet nie vergessen, wieviel Spaß wir hatten. Holt auch Ihr aus Eurem Leben alles heraus, was Ihr könnt. Genießt jede einzelne Minute. Liebt und kümmert Euch um Mum, als stünde sie für uns beide.
Ich liebe Euch,
Dad
Ich faltete den Brief zusammen und steckte ihn in meine Tasche. Komplett angezogen legte ich mich neben Joan und umarmte sie. Während ich hellwach und nervös war, kuschelte sie sich warm und schläfrig in meine Arme. Holly und Sam kamen in unser Zimmer und legten sich zwischen uns. Dann lief Sam mit seinen Cousins zum Startplatz, um den Ballon zu sehen, in dem ich in Kürze um die Welt zu fahren hoffte. Joan und Holly blieben bei mir, als ich mit Martin, unserem Meteorologen, sprach. Es sei, so meinte er, die ideale Zeit für diesen Flug. Wir hätten die besten Wetterbedingungen seit fünf Jahren. Dann rief ich unseren Arzt Tim Evans an. Er war gerade bei unserem dritten Piloten Rory McCarthy gewesen und hatte schlechte Neuigkeiten: Rory könne nicht mitkommen. Er hatte eine leichte Lungenentzündung, und wenn er drei Wochen in der Kapsel zubrächte, könnte sie sich erheblich verschlimmern. Auf der Stelle rief ich Rory an, um ihm zu sagen, wie leid mir das tat.
»Wir sehen uns gleich im Speisesaal«, sagte ich. »Lass uns zusammen frühstücken.«
6.20 Uhr
Als Rory und ich uns im Speisesaal des Hotels trafen, war keine Menschenseele zu sehen. Die Journalisten, die in den vergangenen 24 Stunden unsere Startvorbereitungen verfolgt hatten, waren schon zum Startplatz aufgebrochen. Rory und ich stürzten aufeinander zu und umarmten uns. Uns liefen Tränen übers Gesicht. Als dritter Pilot bei unserer Ballonfahrt war Rory nicht nur ein enger Freund geworden, sondern hatte in letzter Zeit auch einige geschäftliche Projekte mit mir angefangen. Kurz vor der Abreise nach Marokko hatte er eine Beteiligung an unserem neuen Plattenlabel V2 erworben und in die Modefirma Virgin Clothes sowie unsere neue Kosmetikfirma Virgin Vie investiert.
»Ich kann nicht fassen, dass ich dich im Stich lasse«, sagte Rory.
»Ich war noch nie krank – kein einziges Mal.«
»Mach dir keine Gedanken«, beruhigte ich ihn. »So etwas kann passieren. Wir haben Alex, und der wiegt halb so viel wie du. Mit ihm an Bord werden wir viel weiter fliegen.«
»Jetzt mal im Ernst«, meinte Rory, »wenn du nicht wiederkommst, werde ich da weitermachen, wo du aufgehört hast.«
»Besten Dank!«, sagte ich und lachte nervös.
Alex Ritchie überwachte zusammen mit Per Lindstrand, dem erfahrenen Heißluftballonfahrer, der mich in diesen Sport eingeführt hatte, bereits die hektischen Startvorbereitungen am Startplatz. Alex war der geniale Ingenieur, der die Kapsel für den Ballon konstruiert hatte. Bis dahin war es noch niemandem gelungen, ein Ballonsystem zu bauen, das Fahrten auf der Höhe des Jet-Streams zuließ. Obwohl er schon die Kapsel für die Atlantik- und Pazifiküberquerung gebaut hatte, kannte ich ihn nicht besonders gut. Jetzt war natürlich keine Zeit mehr, viel über ihn in Erfahrung zu bringen. Obwohl er kein Flugtraining absolviert hatte, fällte er die mutige Entscheidung, uns zu begleiten. Wenn mit dem Flug alles glattging, hatten wir ungefähr drei Wochen Zeit, uns kennenzulernen. So gründlich, wie wir nur wollten.
Im Gegensatz zu meiner Atlantik- und Pazifiküberquerung im Heißluftballon mit Per würden wir auf dieser Reise nur dann Luft erwärmen, wenn es unbedingt erforderlich war: Der Ballon hatte einen Heliumkern, der uns in die Höhe tragen würde. Per wollte die Luft um den Heliumkern herum in der Nacht erwärmen, um zu verhindern, dass sich das Helium zusammenzog, schwerer wurde und absank. Joan, Holly und ich umarmten uns. Wir mussten aufbrechen.
8.30 Uhr
Wir sahen ihn alle gleichzeitig. Als wir den unbefestigten Weg zu dem marokkanischen Luftstützpunkt entlangfuhren, erinnerte er an eine neue, über Nacht aus dem Boden gewachsene Moschee. Über windschiefen, staubigen Palmen erhob sich wie eine Perlmuttkuppel ein beeindruckender weißer Bogen. Es war der Ballon. Reiter galoppierten mit geschultertem Gewehr am Straßenrand entlang in Richtung Luftstützpunkt. Alle wurden magisch von dem riesigen, weiß schimmernden Ballon angezogen, der groß und schlank in der Luft hing.
9.15 Uhr
Hinter den Absperrungen zum Ballon hatte sich eine erstaunliche Menschenmenge versammelt. Auf der einen Seite stand die gesamte Besatzung des Stützpunkts in ihren schicken marineblauen Uniformen stramm. Vor ihnen stimmten traditionelle marokkanische Tänzerinnen mit weißen Kopfbedeckungen klagende Gesänge an. Plötzlich galoppierte eine als Berber kostümierte Reitergruppe mit gezückten, antiken Musketen heran und stellte sich in einer Reihe vor dem Ballon auf. Einen schrecklichen Augenblick lang glaubte ich, sie würden zur Feier des Ereignisses mit einer Salutsalve ein Loch in die Ballonhülle schießen. Per, Alex und ich überprüften noch einmal alle Systeme in der Kapsel. Die Sonne stieg rasch höher, und das Helium begann sich auszudehnen.
10.15 Uhr
Wir hatten alle Tests abgeschlossen und waren startklar. Ein letztes Mal umarmte ich Joan, Holly und Sam. Ich bewunderte Joans Stärke. Holly war in den vergangenen vier Tagen nicht von meiner Seite gewichen, und auch sie schien die Situation völlig im Griff zu haben. Ich dachte, dass auch Sam relativ gefasst sei, bis er plötzlich in Tränen ausbrach und sich so fest an mich klammerte, als wolle er mich nie wieder loslassen. Die verzweifelte Kraft seiner Umarmung werde ich nie vergessen. Dann küsste er mich, ließ mich los und hielt sich an Joan fest. Ich küsste meinen Vater und meine Mutter zum Abschied. Mum drückte mir einen Brief in die Hand. »Öffne ihn nach sechs Tagen«, sagte sie. Ich hoffte im Stillen, dass wir so lange durchhalten würden.
10.50 Uhr
Jetzt mussten wir nur noch die Stahlstufen zur Kapsel hinaufsteigen. Eine Sekunde lang zögerte ich und fragte mich, wann und wo ich wieder festen Boden unter den Füßen haben würde – oder Wasser. Für Zukunftsprognosen hatten wir keine Zeit. Ich kletterte durch die Luke. Per saß am Hauptsteuerpult, ich neben der Kamera, und Alex machte es sich auf dem Sitz neben der Ausstiegsluke bequem.
11.19 Uhr
Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf … Während Per den Countdown herunterzählte, konzentrierte ich mich auf die Kamera. Mit einer Hand prüfte ich immer wieder nervös meine Fallschirmschnalle. Vier, drei, zwei, eins … Per legte einen Hebel um und aktivierte so die Bolzen, mit denen die Halteleinen durchtrennt wurden. Wir stiegen geräuschlos und schnell in den Himmel. Von den Brennern war nichts zu hören: Wie der Luftballon eines Kindes stiegen wir einfach immer weiter. Als uns der sanfte Morgenwind erfasste, begannen wir in Richtung Marrakesch zu treiben. Durch den noch offenen Notausstieg winkten wir den immer kleiner werdenden Schaulustigen zu. Unter uns lag Marrakesch in seiner ganzen Pracht: die eckigen rosa Mauern, der große Marktplatz, die grünen Gärten und die Brunnen hinter den hohen Mauern. Auf 3000 Meter Höhe wurde die Luft kalt und dünn. Wir schlossen die Luke. Von nun an waren wir auf uns gestellt. Das Belüftungssystem ließ den Druck in unserer Kapsel steigen.
Unser erstes Fax kam kurz nach Mittag an.
»Oh, mein Gott!« Per reichte es mir. »Sieh dir das an.«
»Achtung: Die Halterungen der Brennstofftanks sind arretiert«, las ich. Das war unser erster Fehler. Die Halterungen durften nicht arretiert sein, sodass wir im Notfall sowie beim Absinken des Ballons einen Eintonnen-Brennstofftank als Ballast abwerfen konnten.
»Wenn das unser einziger Fehler ist, sind wir gar nicht so schlecht«, versuchte ich Per aufzuheitern.
»Wir müssen runter auf 1600 Meter. Dann klettere ich hinaus und löse die Arretierung«, meinte Alex. »Das ist kein Problem.«
Während des Tages konnten wir unmöglich tiefer gehen, da die Sonne das Helium erwärmte. Die einzige Sofortlösung wäre gewesen, Helium abzulassen. Das wäre dann aber für immer verloren gewesen, und so etwas konnten wir uns nicht leisten. Also beschlossen wir, den Ballon erst nach Einbruch der Dunkelheit absinken zu lassen. Eine nagende Furcht blieb, denn wir wussten nicht, wie sich dieser Ballon in der Nacht verhalten würde – und mit den arretierten Brennstofftanks konnten wir uns unter Umständen nicht aus einer schwierigen Lage retten. Alex und ich versuchten, das Problem abzuschütteln, doch Per wurde ganz depressiv. Zusammengesunken und wütend saß er am Steuerpult und sprach nur noch, wenn er direkt gefragt wurde. Den ganzen Tag über flogen wir ruhig dahin. Der Blick über das Atlasgebirge war atemberaubend schön; die zerklüfteten, schneebedeckten Gipfel glänzten unter uns in der strahlenden Sonne. In der Kapsel war es eng: Die dort aufgestapelten Vorräte sollten ja für 18 Tage reichen. Wie sich herausstellte, hatten wir nicht nur vergessen, die Arretierung an der Brennstoffzufuhr zu lockern. Wir hatten auch kein Toilettenpapier mitgenommen, sodass wir auf eingehende Faxe warten mussten, bevor wir die Toilette am unteren Ende der winzigen Wendeltreppe benutzen konnten. Dabei benötigte mein marokkanischer Magen viele Faxe. Per hüllte sich weiter in düsteres Schweigen, aber Alex und ich waren einfach froh, dass wir von dem Problem mit den arretierten Halterungen schon vor Eintreten des Ernstfalls erfahren hatten. Als wir uns der algerischen Grenze näherten, wartete bereits der nächste Schock auf uns. Die Algerier teilten uns mit, dass wir uns direkt auf ihre wichtigste Militärbasis in Béchar zubewegten. Sie ließen uns wissen, dass wir diese auf keinen Fall überfliegen durften: »Sie sind NICHT befugt, in diesen Luftraum einzudringen«, stand in dem Fax. Aber wir hatten keine andere Wahl.
Ich sprach etwa zwei Stunden lang per Satellitentelefon mit unserem Fluglotsen Mike Kendrick und versuchte, mehrere britische Minister zu kontaktieren. Schließlich kam uns André Azoulay, der marokkanische Minister, der alle Hindernisse für einen Start in seinem Land aus dem Weg geräumt hatte, noch einmal zu Hilfe. Er erklärte den Algeriern, dass wir unsere Richtung nicht ändern könnten, aber auch keine starken Kameras an Bord hätten. Sie akzeptierten das und gaben nach. Als uns diese positive Nachricht erreichte, machte ich mir Notizen in meinem Bordbuch. Ich blätterte um und fand einen handgeschriebenen Zettel von Sam in dicker schwarzer Tinte, der mit Klebestreifen auf der Seite befestigt war: »An Dad: Ich hoffe, es macht dir viel Spaß. Komm gesund zurück. Ich liebe dich sehr. Dein Sohn Sam.« Jetzt wusste ich, warum Sam am Vorabend ohne mich in die Kapsel geschlüpft war! Um 17.00 Uhr befanden wir uns immer noch auf 10 000 Meter Höhe. Per schaltete die Brenner ein, um die Luft in der Hülle zu erwärmen. Obwohl sie eine Stunde lang brannten, begann der Ballon kurz nach 18.00 Uhr langsam, aber sicher an Höhe zu verlieren.
»Irgendwas stimmt an der Theorie nicht«, sagte Per.
»Was ist los?«, fragte ich.
»Ich weiß es nicht.«
Per ließ die Brenner ohne Unterlass laufen, doch der Ballon bewegte sich weiter in Richtung Erde. Wir sanken erst um 300 und dann noch um weitere 150 Meter. Als die Sonne hinter dem Horizont verschwand, wurde es immer kälter. Es war klar, dass sich das Helium rasch zusammenzog und über uns zum Totgewicht wurde.
»Wir müssen Ballast abwerfen«, sagte Per. Er hatte Angst. Alex und mir ging es nicht besser. Wir drehten die Hebel, um die Bleigewichte an der Unterseite der Kapsel abzuwerfen. Sie sollten etwa zwei Wochen in Reserve gehalten werden. Auf meinem Bildschirm beobachtete ich, wie sie wie Bomben zur Erde fielen. Ich hatte das schreckliche Gefühl, dass dies erst der Anfang einer Katastrophe war. Die Kapsel war größer als diejenigen für die Atlantik- und Pazifiküberquerung, aber es war trotzdem nur eine Metallkiste, die an einem riesigen Ballon hing und der Gewalt von Wind und Wetter ausgeliefert war.
Allmählich wurde es dunkel. Ohne die Bleigewichte blieben wir eine Zeitlang stabil, doch plötzlich begann der Ballon wieder an Höhe zu verlieren, diesmal jedoch schneller. Wir sackten in einer Minute 600 Meter ab und weitere 600 Meter in der nächsten. Meine Ohren wurden taub und knackten; ich spürte, wie mein Magen sich hob und gegen meine Rippen presste. Wir waren nur noch auf 5000 Meter Höhe.
Ich bemühte mich sehr, ruhig zu bleiben, und konzentrierte mich voll auf Kamera und Höhenmesser, während ich im Geiste in Windeseile alle Optionen durchging. Wir mussten die Brennstofftanks abwerfen. Damit war aber die Reise vorbei. Ich biss mir auf die Lippen. Wir befanden uns mitten in der Nacht irgendwo über dem Atlasgebirge auf dem besten Weg zu einer furchtbaren Bruchlandung. Keiner von uns sprach ein Wort. Ich machte blitzschnell einige Rechnungen.
»Bei diesem Tempo bleiben uns noch sieben Minuten«, sagte ich.
»Okay«, sagte Per. »Öffnet die Luke. Wir müssen den Druck ausgleichen.«
Wir öffneten die Ausstiegsluke bei 4000 Meter Höhe, sanken auf 3500 Meter. Eiskalte Luft strömte in die Kapsel, nahm uns den Atem und glich den Druck aus. Alex und ich begannen, alles, was nicht niet- und nagelfest war, über Bord zu werfen: Wasser, Lebensmittel, Ölkanister. Alles. Sogar ein Bündel Dollar. Fünf Minuten lang konnten wir dadurch unsere Höhe halten. Es ging nicht mehr darum, den Flug fortzusetzen. Wir kämpften jetzt ums nackte Überleben.
»Es reicht nicht«, sagte ich, als der Höhenmesser auf 3000 Meter gefallen war. »Wir verlieren immer noch an Höhe.«
»Okay, ich klettere jetzt aufs Dach«, sagte Alex. »Die Tanks müssen weg.«
Da Alex die Kapsel praktisch selbst gebaut hatte, wusste er genau, wie man die Arretierung lösen musste. Trotz meiner Panik wurde mir klar, dass wir nichts hätten tun können, wenn stattdessen Rory an Bord gewesen wäre. Wir hätten mit dem Fallschirm abspringen müssen. In diesem Augenblick wären wir über dem Atlasgebirge in die Dunkelheit gesprungen. Die Brenner zischten und warfen einen leuchtenden orangefarbenen Lichtschein über uns.
»Bist du schon mal mit dem Fallschirm abgesprungen?«, rief ich Alex zu.
»Nein, noch nie«, erwiderte er.
»Das ist deine Reißleine«, sagte ich und führte seine Hand an die betreffende Stelle.
»Wir sind jetzt bei 2500 Meter und sinken weiter«, rief Per. »2200 Meter.«
Alex kletterte durch die Luke auf das Dach der Kapsel. Es war schwierig festzustellen, wie rasch wir an Höhe verloren. Meine Ohren waren jetzt zu. Wenn die Arretierung festgefroren war und Alex die Tanks nicht lösen konnte, mussten wir springen. Uns blieben nur noch wenige Minuten. Ich warf einen Blick aus der Luke und spielte im Geiste durch, was wir tun mussten: eine Hand an den Rand, hinaustreten und dann hinein in die Dunkelheit. Meine Hand tastete instinktiv nach meinem Fallschirm. Ich vergewisserte mich, dass Per seinen angeschnallt hatte. Per ließ den Höhenmesser nicht aus den Augen. Die Zahlen fielen rasch.
Uns blieben nur noch 2000 Meter, und es war dunkel. Jetzt waren es nur noch 1800 Meter. Wenn Alex eine weitere Minute dort oben blieb, wären wir auf 1200 Meter. Ich steckte den Kopf durch die Luke und beobachtete, wie Alex sich am Dach der Kapsel entlangtastete. Es war stockfinster und bitterkalt. Wir konnten die Erde unter uns nicht sehen. Telefon und Fax klingelten pausenlos. Die Bodenkontrolle fragte sich wohl, was zum Teufel wir da oben trieben.
»Einer ist locker«, schrie Alex durch die Luke.
»1200 Meter«, sagte Per.
»Nummer zwei«, rief Alex.
»1100 Meter.«
»Noch einer.«
»1000 Meter, 800.«
Für einen Absprung war es zu spät. Bis wir sprangen, würden wir von den Bergen direkt unter uns zerschmettert.
»Komm wieder rein«, schrie Per. »Sofort!«
Alex ließ sich durch die Luke fallen. Wir machten uns bereit. Per drehte den Hebel, um einen Tank abzuwerfen. Wenn der Bolzen sich nicht löste, blieben uns noch ungefähr 60 Sekunden bis zu unserem sicheren Tod. Der Tank fiel herab, und der Ballon kam abrupt zum Stillstand. Es war, als würde man in einem Aufzug auf dem Boden aufprallen. Wir wurden in unsere Sitze gepresst; mein Kopf wurde zwischen meine Schultern gedrückt. Dann begann der Ballon zu steigen. Wir starrten auf den Höhenmesser: 850, 900, 950 Meter. Wir waren in Sicherheit. Nach zehn Minuten befanden wir uns wieder auf über 1000 Meter, und der Ballon stieg weiter in den nächtlichen Himmel. Ich kniete auf dem Boden neben Alex und umarmte ihn.
»Gott sei Dank, dass du bei uns bist«, sagte ich. »Ohne dich wären wir jetzt alle tot.«
Es wird behauptet, sterbende Menschen würden in den letzten Sekunden vor dem Tod ihr Leben Revue passieren lassen. In meinem Fall stimmte das nicht. Während wir auf die Erde zurasten und auf dem besten Weg waren, uns über dem Atlasgebirge in einen Feuerball zu verwandeln, hatte ich nur einen einzigen Gedanken: Wenn ich da lebend rauskäme, würde ich so etwas nie wieder tun.
Die ganze Nacht über kämpften wir damit, den Ballon unter Kontrolle zu halten. Einmal begann er ohne ersichtlichen Grund stetig zu steigen, bis wir schließlich bemerkten, dass einer der verbleibenden Brennstofftanks ein Leck hatte: Wir hatten Brennstoff abgelassen, ohne es zu merken. Im Morgengrauen bereiteten wir uns auf die Landung vor. Unter uns erstreckte sich die algerische Wüste: selbst unter günstigsten Bedingungen ein unwirtlicher Ort, aber angesichts des Bürgerkriegs, der das Land erschütterte, weniger einladend denn je. Die Wüste bestand nicht aus den weichen gelben Sanddünen, die einem Filme wie Laurence von Arabien vorgaukeln. Der kahle Boden war rot und felsig, unfruchtbar wie die Marsoberfläche. Felsen ragten wie riesige Termitenhügel steil empor. Alex und ich saßen auf dem Dach der Kapsel und bewunderten den Sonnenaufgang über der Wüste. Uns war bewusst, dass hier ein Tag anbrach, den wir beinahe nicht mehr erlebt hätten. Die steigende Sonne und die zunehmende Wärme des Tages erschienen uns wie ein kostbares Geschenk. Als wir den Schatten des Ballons über den Wüstenboden wandern sahen, konnten wir kaum glauben, dass es sich hier um das gleiche Gefährt handelte, das sich mitten in der Nacht wie ein Geschoss auf das Atlasgebirge zubewegt hatte. Die noch nicht abgeworfenen Tanks versperrten Per die Sicht, sodass Alex ihm den Weg wies. Als wir uns der Erde näherten, rief Alex: »Stromleitung voraus!«
Per gab zurück, dass wir uns mitten in der Sahara befänden und es sich unmöglich um eine Stromleitung handeln könne. »Du siehst wohl eine Fata Morgana«, brüllte er. Alex schlug ihm vor, aufs Dach zu klettern und sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass es uns gelungen war, die einzige Stromleitung in der Sahara zu finden. Trotz der ungeheuren Weite der kahlen Wüste um uns herum sahen wir binnen weniger Minuten nach unserer Landung die ersten Anzeichen von Leben. Eine Gruppe von Berbern tauchte plötzlich hinter den Felsen auf. Zunächst hielten sie Abstand. Wir wollten ihnen gerade etwas Wasser und einige der verbliebenen Vorräte anbieten, als wir über uns die klappernden Rotorflügel von Militärhubschraubern hörten. Sie mussten uns auf ihrem Radar verfolgt haben. Die Berber verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Zwei Hubschrauber landeten direkt neben uns und wirbelten große Staubwolken auf. Bald waren wir von Soldaten mit steinernem Blick umringt, die offenbar nicht wussten, wohin sie ihre Maschinengewehre richten sollten. »Allah«, sagte ich ermutigend.
Einen Moment lang standen sie stumm da. Dann übermannte sie die Neugier, und sie kamen näher. Wir zeigten ihrem Offizier die Kapsel. Er bewunderte die verbleibenden Brennstofftanks. Als wir vor der Kapsel standen, fragte ich mich, was diese algerischen Soldaten wohl von unserem Ballon hielten. Ich drehte mich um und versuchte, ihn einen Augenblick lang mit ihren Augen zu sehen. Die noch nicht abgeworfenen Tanks waren leuchtend rot und gelb bemalt und sahen aus wie überdimensionale Dosen Virgin Cola und Virgin Energy. Die Seitenwand der Kapsel schmückten Slogans für Virgin Atlantic, Virgin Direct, Virgin Territory und Virgin Cola. Es war wohl unser Glück, dass diese gläubigen Moslems den Spruch auf dem oberen Rand der Virgin-Energy-Dose nicht verstanden: ENTGEGEN ALLER GERÜCHTE GIBT ES ABSOLUT KEINEN BEWEIS DAFÜR, DASS VIRGIN ENERGY EIN APHRODISIAKUM IST.
Als ich im roten Sand der algerischen Wüste vor meinem geistigen Auge nochmals den grauenhaften Sinkflug über dem Atlasgebirge durchlebte, schwor ich mir erneut, dass ich so etwas nie wieder versuchen würde. Gleichzeitig wusste ich aber auch tief in meinem Herzen, dass ich mich nochmals zu einem letzten Versuch aufraffen würde, wenn ich nach meiner Rückkehr mit anderen Ballonfahrern gesprochen hatte, die ebenfalls eine Weltumrundung anstrebten. Es ist eine unwiderstehliche Herausforderung, die inzwischen viel zu tief in mir verwurzelt ist, als dass ich sie aufgeben könnte. Die beiden Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden, lauten: »Wieso riskieren Sie Kopf und Kragen mit Ihren Ballonfahrten?« und »Wohin bewegt sich die Virgin-Gruppe?« In gewisser Hinsicht beantwortete die über und über mit Virgin-Marken geschmückte Ballonkapsel in der Mitte der algerischen Wüste genau diese zentralen Fragen. Ich wusste, dass ich wieder versuchen würde, mit dem Ballon rund um die Welt zu fahren, weil dies eine der wenigen noch verbleibenden Herausforderungen ist. Sobald ich den Schrecken des eigentlichen Fluges verdaut hatte, würde ich überzeugt sein, dass wir aus unseren Fehlern lernen können und bei der nächsten Fahrt nicht in Gefahr geraten würden. Die globalere Frage nach meinem letztendlichen Ziel für die Virgin-Gruppe kann ich unmöglich beantworten. Anstelle einer hochtheoretischen Erklärung, die nicht zu meiner Denkweise passen würde, habe ich dieses Buch geschrieben, um zu zeigen, wie wir Virgin zu dem gemacht haben, was es heute ist. Wenn Sie sorgfältig zwischen den Zeilen lesen, werden Sie hoffentlich verstehen, welche Vision wir mit der Virgin-Gruppe verfolgen und in welche Richtung wir uns bewegen. Manche Menschen behaupten, meine Vision für Virgin würde alle Regeln brechen und ein übermäßig buntes Kaleidoskop schaffen. Andere sagen, Virgin sei auf dem besten Weg dazu, einer der führenden Markennamen des nächsten Jahrhunderts zu werden. Wieder andere analysieren den Konzern bis ins kleinste Detail und schreiben dann akademische Traktate darüber. Was mich anbelangt, so greife ich einfach nach dem Telefonhörer und mache weiter. Meine Ballonfahrten und die zahlreichen Virgin-Unternehmen, die ich gegründet habe, bilden eine nahtlose Kette der Herausforderungen, die ich bis in meine Kindheit zurückverfolgen kann.
Dieses Buch ist der erste Band meiner Autobiografie. Es deckt die ersten 43 Jahre meines Lebens ab. Nachdem ich über dem Atlasgebirge dem Tod so nahe war, dachte ich, es sei besser, dieses Buch jetzt zu schreiben für den Fall, dass mich mein Schutzengel bei meinem nächsten Versuch im Stich lässt. Ähnlich wie bei meinen Ballonfahrten ging es während meiner ersten 43 Lebens- und Berufsjahre immer ums Überleben. Dieses Buch endet mit Virgin Atlantics außergewöhnlichem Sieg über British Airways im Januar 1993. Knapp ein Jahr zuvor war ich gezwungen, Virgin Music zu verkaufen und erreichte damit den Tiefpunkt meiner beruflichen Karriere. Der Sieg über British Airways war der Wendepunkt für Virgin. Allen Widerständen zum Trotz hatte ich 43 Jahre lang überlebt und zum ersten Mal in meinem Leben Geld zur Verfügung. Wir wollten viele Träume verwirklichen, und ich begann zu erkennen, was wir mit Virgin erreichen könnten. Wie wir diese Träume erfüllen, wird Gegenstand des nächsten Buches sein. Hier geht es zunächst einmal darum, wie es uns mit Hängen und Würgen gelang, so lange zu überleben, bis wir diesen Punkt erreichten.
Als ich nach einem Titel für dieses Buch suchte, meinte David Tait, der die Aktivitäten von Virgin Atlantic in den USA leitet, ich solle es Virgin: Die Kunst der Geschäftsstrategie und der Wettbewerbsanalyse nennen. »Nicht schlecht«, meinte ich nachdenklich, »aber ich bin mir nicht sicher, ob das den richtigen Pepp hat.«
»Natürlich«, fuhr er fort, »würde der Untertitel lauten: Augen zu und durch!«
Kapitel 1IN UNSERER FAMILIE HÄTTEN WIR ALLES FÜREINANDER GETAN1950 bis 1963
Die Erinnerung an meine Kindheit ist inzwischen etwas verblasst, doch einige herausragende Ereignisse sind mir im Gedächtnis geblieben. Ich weiß noch, dass meine Eltern uns pausenlos vor neue Herausforderungen stellten. Meine Mutter war entschlossen, uns zu unabhängigen Menschen zu erziehen. Als ich vier Jahre alt war, hielt sie das Auto einige Kilometer von zu Hause entfernt an und zwang mich, selbst meinen Heimweg über die Felder zu suchen. Ich verirrte mich hoffnungslos. Das Erste, an das sich meine jüngste Schwester Vanessa erinnert, war, wie sie eines Morgens im Januar in der Dunkelheit geweckt wurde, weil meine Mutter beschlossen hatte, dass ich an jenem Tag nach Bournemouth radeln sollte. Mum packte mir ein paar Sandwiches und einen Apfel ein und erklärte, Wasser müsse ich mir unterwegs selbst beschaffen. Bournemouth war 80 Kilometer entfernt von unserem Haus in Shamley Green in Surrey. Ich war noch keine zwölf Jahre alt, aber Mum dachte, dieses Abenteuer würde mir zeigen, wie wichtig Durchhaltevermögen und ein guter Orientierungssinn sind. Ich kann mich vage erinnern, wie ich in der Dunkelheit aufbrach und die nächste Nacht bei Verwandten verbrachte. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich ihr Haus fand und am nächsten Tag wieder nach Shamley Green zurückfuhr, aber ich weiß noch gut, wie ich schließlich wie ein siegreicher Held in unsere Küche spazierte, ungemein stolz auf meinen Radmarathon war und einen begeisterten Empfang erwartete.
»Gut gemacht, Ricky«, sagte meine Mutter. Sie war gerade beim Zwiebelschneiden. »Hat’s Spaß gemacht? Könntest du bitte gleich zum Pfarrer hinüberlaufen? Er bräuchte jemanden, der ihm etwas Holz hackt, und ich habe gesagt, dass du jeden Augenblick zurückkommen würdest.«
Unsere Herausforderungen waren eher körperlicher als intellektueller Natur. Schon bald begannen wir, sie uns selbst zu suchen. So erinnere ich mich etwa daran, wie ich schwimmen lernte. Ich war vier oder fünf, und wir verbrachten mit den Schwestern meines Vaters, Tante Joyce und Tante Wendy, und Wendys Mann, Onkel Joe, unsere Ferien in Devon. Tante Joyce mochte ich besonders gerne. Zu Beginn der Ferien hatte sie mit mir um 10 Schilling gewettet, dass ich nicht bis zum Ende der zwei Ferienwochen schwimmen lernen könne. Stundenlang kämpfte ich im Meer gegen eiskalte Wellen an, doch am letzten Ferientag konnte ich immer noch nicht richtig schwimmen. Ich paddelte nur und hüpfte dabei mit einem Fuß auf dem Boden. Ich tauchte in die Wellen, bevor ich spuckend wieder an die Oberfläche kam und versuchte, möglichst wenig Meerwasser zu schlucken.
»Macht nichts, Ricky«, tröstete mich Tante Joyce. »Nächstes Jahr klappt’s bestimmt.«
Aber ich war fest entschlossen, nicht so lange zu warten. Tante Joyce hatte mit mir eine Wette abgeschlossen, und ich bezweifelte, dass sie sich im nächsten Jahr noch daran erinnern würde. An unserem letzten Tag standen wir früh auf, packten die Autos und brachen zur zwölfstündigen Heimfahrt auf. Die Straßen waren schmal, unsere Wagen langsam und der Tag heiß. Alle wollten möglichst schnell nach Hause. Während der Fahrt entdeckte ich einen Fluss.
»Daddy, könntest du bitte anhalten?«, bat ich.
Der Fluss war meine letzte Chance: Ich war sicher, dass ich schwimmen und die Wette mit Tante Joyce gewinnen konnte.
»Bitte halt an!«, rief ich.
Mein Vater blickte in den Rückspiegel und fuhr langsam an den Straßenrand.
»Was ist los?«, fragte Tante Wendy, als wir alle aus dem Wagen kletterten.
»Ricky hat den Fluss dort unten gesehen«, erklärte Mum. »Er möchte ein letztes Mal versuchen zu schwimmen.«
»Wollen wir nicht alle möglichst schnell heim?«, jammerte Tante Wendy. »Die Reise ist so furchtbar lang.«
»Komm schon, Wendy. Gib dem Jungen noch eine Chance«, meinte Tante Joyce. »Schließlich sind es meine zehn Schilling.«
Ich riss mir die Kleider vom Leib und rannte in Unterhosen zum Flussufer hinunter. Ich wagte nicht stehenzubleiben für den Fall, dass sie ihre Meinung änderten. Als ich ans Ufer kam, hatte ich ziemliche Angst. In der Mitte des Flusses sprang das Wasser in einem Strom von Blasen über die Felsen. Ich fand eine von Kühen niedergetrampelte Stelle und watete in die Strömung. Schlamm hing zwischen meinen Zehen. Ich drehte mich um. Onkel Joe, Tante Wendy und Tante Joyce, meine Eltern und meine Schwester Lindi sahen mir zu: die Damen in geblümten Kleidern, die Herren in Sportjacketts und Krawatten. Dad zündete seine Pfeife an und setzte eine völlig unbeteiligte Miene auf; Mum lächelte wie üblich ermutigend. Ich holte tief Luft und sprang in die Strömung, spürte aber sofort, wie ich sank und meine Beine hilflos im Wasser zappelten. Die Strömung warf mich hin und her, zerrte an meiner Unterhose und riss mich flussabwärts. Ich bekam keine Luft und schluckte Wasser. Ich versuchte, an die Oberfläche zu gelangen, fand aber keinen Halt. All mein Strampeln und Zappeln half nichts. Dann fand mein Fuß einen Stein, und ich stieß mich mit aller Kraft ab. Ich kam wieder an die Oberfläche und holte tief Luft. Das brachte mich wieder ins Gleichgewicht. Ich wurde ruhiger. Ich musste unbedingt diese zehn Schilling gewinnen. Ich trat langsam Wasser, breitete meine Arme aus und stellte fest, dass ich auf der Wasseroberfläche schwamm. Zwischendurch tauchte ich zwar immer noch unter, doch plötzlich war eine Last von mir abgefallen: Ich konnte schwimmen. Mir war gleichgültig, dass mich der Fluss mitriss. Ich schwamm triumphierend hinaus in die Mitte der Strömung. Über dem Rauschen und Gluckern des Wassers hörte ich, wie meine Familie applaudierte und jubelte. Nachdem ich eine schiefe Kreisbahn geschwommen war und vielleicht 50 Meter flussabwärts wieder ans Ufer kletterte, sah ich Tante Joyce in ihrer großen schwarzen Handtasche nach ihrem Geldbeutel kramen. Ich stieg aus dem Wasser, lief durch ein Brennnesselfeld und kletterte die Böschung hinauf. Mir war kalt, ich war voller Schlamm und hatte mich an Brennnesseln verbrannt – aber ich konnte schwimmen.
»Das ist für dich, Ricky«, sagte Tante Joyce. »Gut gemacht.«
Ich blickte auf den Zehnschillingschein in meiner Hand. Er war groß, braun und nagelneu. Ich hatte noch nie zuvor so viel Geld in der Hand gehabt; es kam mir vor wie ein Vermögen.
»Steigt ein«, sagte mein Vater. »Wir fahren weiter.«
Erst in diesem Augenblick fiel mir auf, dass auch er völlig durchnässt war. Er hatte die Nerven verloren und war hinter mir ins Wasser gesprungen. Er nahm mich ganz fest in seine Arme.
Ich kann mich an keinen Augenblick in meinem Leben erinnern, in dem ich nicht die Liebe meiner Familie spürte. Wir hätten alles füreinander getan – und daran hat sich bis heute nichts geändert. Meine Eltern liebten sich sehr, und in meiner Kindheit gab es kaum ein scharfes Wort zwischen ihnen. Meine Mutter Eve war stets voller Lebensenergie und spornte uns zu allen möglichen Aktivitäten an. Mein Vater Ted war der Ruhigere, der gerne seine Pfeife rauchte und Zeitung las. Beide liebten sie jedoch Abenteuer. Ted wollte eigentlich Archäologe werden, aber sein Vater, ein hochrangiger Richter, wünschte sich, dass er der Branson-Tradition folgen und Jura studieren sollte. Drei Generationen von Bransons waren bereits Juristen gewesen. Mein Großvater engagierte also einen Karriereberater, der mit Ted mögliche Berufswege besprechen sollte. Als sich herausstellte, dass Ted Archäologe werden wollte, weigerte sich mein Großvater, die Rechnung des Berufsberaters zu bezahlen mit der Begründung, dass er seine Arbeit nicht ordentlich erledigt habe. Widerwillig ging Ted also nach Cambridge, um Jura zu studieren, und machte seine Sammlung antiker Artefakte und Fossilien, die er sein »Museum« nannte, zu einem Hobby.
Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1939 meldete sich Ted freiwillig bei den Staffordshire Yeomanry, einem im Umfeld der englischen Juristenverbände, der »Inns of Court«, organisierten Kavallerieregiment. Seine Einheit kämpfte in Palästina, und Ted nahm im September 1942 an der Schlacht von El Alamein sowie an späteren Gefechten in der libyschen Wüste teil. Dann war er beim Einmarsch in Italien dabei und kämpfte in Salerno und Anzio. Bevor Ted in den Krieg zog, dachte er sich einen Geheimcode aus, um meinen Großeltern seinen Aufenthaltsort mitzuteilen: Sie vereinbarten, dass in seinen Briefen von der Front der Keller die Welt und die einzelnen Fächer in den Kellerschränken bestimmte Länder symbolisieren sollten. Ted bat in seinen Briefen seine Mutter, seine alten Reithandschuhe aus dem linken oberen Fach des rechten Schranks zu nehmen, und sie wussten, dass er damit Palästina meinte. Es überrascht nicht, dass diese Geheimbotschaften ohne weiteres durch die Zensur schlüpften und meine Großeltern immer wussten, wo er sich befand. Als Ted Soldat wurde, war sein Onkel Jim Branson in der Armee schon recht berüchtigt, weil er dafür eintrat, Gras zu essen. Großonkel Jim hatte ein Gut in Hampshire besessen. Dieses teilte er schließlich unter den Pächtern auf und zog nach Balham, das 1939 ein abgelegener Vorort von London war. Er war besessen von der Idee des Grasessens. Die Zeitschrift Picture Post veröffentlichte einen Artikel über ihn mit einem Bild, das ihn in seinem Bad in Balham zeigte, wo er in Bottichen Gras zog, das er zu Heu verarbeitete. Wenn Jim zum Essen eingeladen war (mit seiner zunehmenden Berühmtheit geschah dies immer öfter), brachte er seinen Futtersack mit und aß sein Gras. In der Armee machten sich alle über meinen Vater lustig: »Du musst Jim Bransons Sohn sein! Hier, knabber ein bisschen Gras! Du bist ein munteres Fohlen. Wann werden sie dich kastrieren?«
Ted leugnete standhaft jede Beziehung zu Onkel Jim. Als sich der Krieg aber hinzog, richtete David Stirling den Special Air Service ein: eine Eliteeinheit, die hinter den feindlichen Linien operieren sollte. Der SAS musste mit leichtem Gepäck reisen, und bald wurde bekannt, dass Jim Branson David Sterling und seiner Elitetruppe zeigte, wie man sich von Gras und Nüssen ernähren konnte. Von da an erwiderte Ted auf die Frage »Branson? Sind Sie mit Jim Branson verwandt?« mit stolzgeschwellter Brust: »Ja, er ist mein Onkel. Was er mit dem SAS macht, ist sensationell, nicht wahr?«
Im Grunde genoss Ted diese fünf Jahre in der großen, weiten Welt. Die Rückkehr nach Cambridge zum Jurastudium fiel ihm recht schwer. Einige Jahre später, als er schon ein junger Rechtsanwalt war, kam er relativ spät zu einer Cocktailparty, wo ihn eine blonde Schönheit namens Eve begrüßte, die quer durch den Raum auf ihn zusegelte, ihm eine Platte mit Honigwürstchen vor die Nase hielt und sagte: »Der Weg zum Herzen eines Mannes führt durch seinen Magen. Darf ich Ihnen dies hier anbieten?«
Eve Huntley-Flindt hatte ihre bewundernswerte Energie teilweise von ihrer Mutter Dorothy geerbt, die zwei britische Rekorde aufstellte: Im Alter von 89 Jahren bestand sie als älteste Person in Großbritannien die Fortgeschrittenenprüfung im Turniertanz für lateinamerikanische Tänze. Mit 90 war sie der älteste Mensch, der jemals beim Golf ein Hole-in-One erzielte.
Meine Großmutter starb im Alter von 99 Jahren. Kurz zuvor hatte sie mir in einem Brief mitgeteilt, die letzten zehn Jahre seien die besten ihres Lebens gewesen. Im gleichen Jahr war sie bei einer Kreuzfahrt um die ganze Welt auf Jamaika nur mit einem Badeanzug bekleidet zurückgelassen worden. Sie hat sogar Stephen Hawkings Eine kurze Geschichte der Zeit gelesen (was mir noch nicht gelungen ist!). Sie hat nie aufgehört zu lernen. Ihrer Meinung nach war das Leben eine einmalige Chance, aus der man das Beste machen sollte. Meine Mutter hatte Grannys Liebe zu Sport und Tanz geerbt. Mit zwölf Jahren trat sie in einer West-End-Revue auf, deren Komponistin Marie Stopes sich später mit ihrer Arbeit in der gesundheitlichen Aufklärung von Frauen einen Namen machen sollte. Einige Zeit später wurde Mum um ein Haar gezwungen, für ein weiteres Bühnenengagement zu strippen: in einem Tanz für The Cochran Show in Her Majesty’s Theatre im Londoner West End. Sir Charles Cochrans Shows waren berüchtigt dafür, dass dort die schönsten Mädchen der Stadt ihre Kleider ablegten. Es war Krieg, und Arbeitsplätze waren Mangelware. Eve beschloss, die Stelle anzunehmen mit der Begründung, dass es sich hier nur um einen harmlosen Spaß handle. Wie zu erwarten war, teilte mein Großvater diese Meinung keineswegs und drohte ihr, ins Theater zu stürmen und sie von der Bühne zu zerren. Eve richtete das Sir Charles Cochran aus, der ihr daraufhin erlaubte, beim Tanzen ihre Kleider anzubehalten. Damals wie heute setzte sie praktisch immer ihren Willen durch. Eve sah sich nach einer anderen Arbeitsstelle für den Tag um. Der Segelfliegerclub in Heston brachte den Rekruten der Königlichen Luftwaffe das Segelfliegen bei, bevor sie Piloten wurden. Sie bewarb sich als Pilot, wurde aber mit der Begründung abgewiesen, dass diese Stellen nur für Männer seien. Das schreckte sie keineswegs ab: Sie beschwatzte einen Fluglehrer so lange, bis er ihr heimlich die Stelle gab unter der Voraussetzung, dass sie sich als Junge ausgab. Mit schwarzer Lederjacke, die Haare unter einem Lederhelm versteckt und künstlich tiefer Stimme lernte Eve also Segelfliegen und unterrichtete neue Piloten. Im letzten Kriegsjahr schloss sie sich den »Wrens«, der britischen Marineorganisation für Frauen, als Funkerin an und war auf der Black Isle in Schottland stationiert. Nach dem Krieg wurde Eve Stewardess – damals einer der glamourösesten Berufe. Die Messlatte war sehr hoch: Man musste hübsch, unverheiratet und zwischen 23 und 27 Jahre alt sein, Spanisch sprechen können und gelernte Krankenschwester sein. Die Tatsache, dass sie weder Spanisch konnte noch Krankenschwester war, schreckte meine Mutter nicht ab: Sie plauderte lange mit dem Nachtportier im Einstellungsbüro und schlüpfte auf diese Weise in den Ausbildungskurs für Stewardessen der British South American Airways. Die BSAA bot Flüge zwischen London und Südamerika in zwei Flugzeugtypen an: Lancasters, die 13 Passagiere beförderten, und Yorks, in denen 21 Fluggäste Platz fanden. Diese Maschinen hatten klangvolle Namen wie Star Stream und Star Dale, und die Stewardessen wurden »Star Girls« genannt. Wenn das Flugzeug zur Startbahn rollte, musste meine Mutter den Passagieren als erstes Kaugummi, Malzbonbons, Watte und Taschentücher anbieten und ihnen erklären, dass sie sich vor Start und Landung die Nase putzen mussten. In der Kabine fand kein Druckausgleich statt, und die Flüge waren der reinste Marathon: fünf Stunden nach Lissabon, acht Stunden nach Dakar und dann 14 Stunden hinüber nach Buenos Aires. Für die Strecke von Buenos Aires nach Santiago wurden die Yorks durch robustere Lancasters ersetzt, und über den Anden mussten alle Sauerstoffmasken tragen. Nachdem meine Mutter ein Jahr für die BSAA gearbeitet hatte, wurde die Gesellschaft von der BOAC (British Overseas Airways Corporation) übernommen. Eve wurde auf Maschinen vom Typ Tudor eingesetzt. Die erste Tudor, die nach Bermuda fliegen sollte, die Star Tiger, explodierte in der Luft. Eve flog mit der nächsten Maschine und kam heil an. Aber das Flugzeug danach, die Star Ariel, verschwand spurlos im Bermuda-Dreieck. Anschließend durften die Tudors nicht mehr starten. Später fand man heraus, dass der Rumpf dieses Flugzeugs zu schwach war, um dem vor kurzem installierten Druckausgleich standzuhalten.
Zu dieser Zeit glaubte Ted vermutlich, dass Eve irgendwo über dem Atlantik verschwinden würde, wenn er ihrer Karriere als Stewardess nicht durch Heirat ein Ende bereitete. Er machte ihr einen Heiratsantrag, als sie beide auf seinem Motorrad dahinbrausten, und sie schrie so laut sie konnte »Ja!«, damit er es trotz des Fahrtwinds hören konnte. Meine Eltern wurden am 14. Oktober 1949 getraut. Ich wurde auf ihrer Hochzeitsreise auf Mallorca gezeugt.
Meine Eltern behandelten meine Schwestern Lindi und Vanessa und mich stets wie Gleichberechtigte, deren Meinung ebenso viel galt wie die ihre. Als wir noch klein waren (bevor Vanessa auf die Welt kam), nahmen meine Eltern Lindi und mich mit, wenn sie zum Abendessen ausgingen. Wir lagen auf Decken auf dem Autorücksitz. Dort schliefen wir, während meine Eltern aßen, wachten aber immer auf, wenn sie die Heimfahrt antraten. Lindi und ich verhielten uns ganz ruhig, blickten in den nächtlichen Himmel hinauf, hörten zu, wie sich meine Eltern unterhielten und Witze über ihren Abend machten. Wir wuchsen als Freunde unserer Eltern auf. Als Kinder besprachen wir mit Dad seine rechtlichen Fälle und diskutierten über Pornographie und die Legalisierung von Drogen, lange bevor wir überhaupt wussten, wovon wir da eigentlich redeten. Meine Eltern ermutigten uns stets, eigene Meinungen zu vertreten, und gaben uns selten Ratschläge, es sei denn, wir baten sie darum. Wir lebten in einem Dorf namens Shamley Green in Surrey. Vor Vanessas Geburt wuchsen Lindi und ich in Easteds auf, einem efeuumrankten Häuschen mit winzigen weißen Fenstern und einem weißen Holztor, das auf die Dorfwiese hinausführte. Ich war drei Jahre älter als Lindi und neun Jahre älter als Vanessa. Meine Eltern hatten während meiner Kindheit sehr wenig Geld, und ich kann mich erinnern, viel Brot und Bratenfett gegessen zu haben – vielleicht, weil meine Mutter nicht besonders gerne kochte, aber vielleicht auch, weil sie sparen musste. Nichtsdestoweniger wurden Traditionen aufrechterhalten: Wir durften den Esstisch nicht verlassen, bis wir unseren Teller leer gegessen hatten. Wir bekamen auch Zwiebeln, die in unserem Garten wuchsen. Ich hasste Zwiebeln und versteckte meine immer in einer Schublade im Tisch, die nie geputzt wurde. Erst als wir zehn Jahre später umzogen, wurde sie geöffnet und meine vertrockneten Zwiebeln kamen zum Vorschein. Das Essen war bei den Mahlzeiten weniger wichtig als die Geselligkeit. Unser Haus war stets voller Menschen. Um über die Runden zu kommen, lud meine Mutter deutsche und französische Studenten ein, damit sie in einem typisch englischen Haushalt unsere Sprache lernen konnten. Wir mussten sie unterhalten. Mum verlangte, dass wir im Garten arbeiteten, ihr bei der Zubereitung der Mahlzeiten halfen und hinterher abräumten. Wenn ich mich drücken wollte, lief ich quer über die Dorfwiese zu meinem Freund Nik Powell. Anfangs war das Beste an Nik der phantastische Pudding, den seine Mutter kochte. Nachdem ich also daheim Zwiebeln in die Tischschublade gestopft hatte, schlich ich mich zu Nik und ließ die radebrechenden Deutschen hinter mir, die von meiner Familie lachend berichtigt wurden. Wenn ich zum richtigen Zeitpunkt kam (und dafür sorgte ich), stand der Pudding schon auf dem Tisch. Nik war mein bester Freund, ein stiller Junge mit glatten schwarzen Haaren und schwarzen Augen. Schon bald waren wir unzertrennlich: Wir kletterten auf Bäume, fuhren Fahrrad, jagten Kaninchen und versteckten uns unter Lindis Bett, um sie am Knöchel zu packen, wenn sie das Licht ausschaltete. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, zu der Nik und ich nicht Freunde waren. Meine Mutter hatte zwei fixe Ideen: Sie erfand ständig neue Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für uns und dachte sich immer wieder neue Erwerbsquellen aus. Wir hatten nie einen Fernseher, und ich glaube auch nicht, dass meine Eltern jemals Radio hörten. In einem Gartenschuppen stellte Mum Kistchen für Papiertaschentücher und Papierkörbe aus Holz her, die sie dann an Läden verkaufte. Ihr Schuppen roch nach Farbe und Klebstoff und war voll von Stapeln versandbereiter lackierter Kistchen. Dad war sehr einfallsreich und ein geschickter Bastler; er konstruierte Spezialklemmen, die die Kisten zusammenhielten, während der Klebstoff trocknete. Irgendwann begann Mum, Harrods zu beliefern. Ihr Geschäft wurde zu einer richtiggehenden Heimindustrie. Wie bei allem, was sie tat, war Mum auch hier das reinste Energiebündel, dem kaum jemand widerstehen konnte. Teamarbeit wurde in unserer Familie großgeschrieben. Wenn wir in Mums Nähe kamen, fand sie immer Arbeit für uns. Schoben wir anderweitige Verpflichtungen vor, hieß es unmissverständlich, dass wir nicht so selbstsüchtig sein sollten. Daher lernten wir schon bald, den Belangen anderer Priorität zu geben. Einmal verbrachte ein Junge, den ich nicht besonders gut leiden konnte, das Wochenende bei uns. Während des Gottesdienstes schlich ich mich aus unserer Bank, um auf der anderen Seite des Ganges bei Nik zu sitzen. Mum war wütend. Als wir nach Hause kamen, wies sie meinen Vater an, mir eine Tracht Prügel zu verabreichen. Dad und ich trabten also brav in sein Arbeitszimmer und schlossen die Tür. Anstatt eines zornerfüllten Blicks schenkte mir Dad ein Lächeln.
»Sorg dafür, dass du überzeugend heulst«, sagte er und klatschte dann sechsmal in die Hände, damit es sich anhörte wie richtige Ohrfeigen. Ich stürmte laut flennend aus dem Zimmer. Mum setzte einen strengen Blick auf, der mir signalisieren sollte, dass dies alles zu meinem Besten sei, und schnitt energisch ihre Zwiebeln in der Küche weiter – und meine Portion verschwand beim Mittagessen wie immer in der Tischschublade.
Großonkel Jim war nicht der einzige Exzentriker in der Familie. Respektlosigkeit vor der Autorität wurde auf beiden Seiten vererbt. Wir hatten uns einen alten Wohnwagen gekauft, den wir im Garten aufstellten. Manchmal kamen Kinder vorbei und läuteten bei uns. Mum gab ihnen immer etwas Silbergeld und ließ sie in der Scheune nach Sachen suchen, die sie brauchen konnten. Einmal gingen wir alle zur Surrey County Show in Guildford. Dort drängten sich Zirkusleute: glitzernde Kunstspringer und Männer in Tweedanzügen und Melonen. Als wir an einer der Buden vorbeikamen, sah Mum eine Gruppe weinender Artistenkinder. Wir gingen hinüber, um den Grund für ihre Tränen herauszufinden. Sie hatten sich alle um eine mit einer Schnur angebundene Elster geschart.
»Die Polizei hat uns befohlen, diesen Vogel abzugeben, damit sie ihn einschläfern können. Sie sagen, es sei nicht erlaubt, wilde Vögel als Haustiere zu halten«, erklärten sie uns.
Noch während sie uns von ihrem Unglück berichteten, sahen wir einen Polizisten auf uns zukommen.
»Macht euch keine Sorgen«, sagte Mum. »Ich werde den Vogel retten.« Sie nahm die Elster und wickelte sie in ihren Mantel. Dann schmuggelten wir sie an dem Beamten vorbei aus dem Ausstellungsgelände hinaus. Die Kinder trafen uns draußen und sagten, wir sollten die Elster behalten, weil sie ihnen doch nur wieder abgenommen würde. Mum war begeistert, und wir fuhren mit unserem Vogel nach Hause. Die Elster liebte Mum. Sie saß auf ihrer Schulter, wenn sie in der Küche oder in ihrem Schuppen arbeitete. Gelegentlich flog sie hinaus auf die Koppel und ärgerte die Ponys, indem sie sich auf ihren Rücken setzte. Sie ließ sich im Sturzflug auf Dad fallen, wenn er nach dem Mittagessen die Times las, und wirbelte die Seiten durcheinander.
»Verflixter Vogel!«, schimpfte Dad dann und wedelte mit den Armen, um die Elster zu verscheuchen.
»Ted, steh auf und mach dich nützlich«, sagte Mum. »Der Vogel will dir sagen, dass du im Garten arbeiten sollst. Und ihr, Ricky und Lindi, lauft zum Pfarrer hinüber und fragt ihn, ob er Hilfe gebrauchen kann.«
In den Sommerferien fuhren wir nicht nur mit Dads Familie nach Salcombe in Devon, sondern auch zu Mums Schwester Clare Hoare. Wenn ich groß war, wollte ich so werden wie Tante Clare. Sie war eng befreundet mit Douglas Bader, einem Starpiloten aus dem Zweiten Weltkrieg, der bei einem Flugzeugabsturz beide Beine verloren hatte. Tante Clare und Douglas besaßen einen alten Doppeldecker, den sie zusammen flogen. Manchmal sprang Tante Clare nur so zum Spaß mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug. Sie rauchte ungefähr zwanzig Zigarillos am Tag.
Wenn wir Tante Clare besuchten, schwammen wir im Teich am Ende ihres Gartens. Douglas Bader schnallte seine Beinprothesen ab und stürzte sich in die Fluten. Ich versteckte seine Blechbeine oft im Schilf. Douglas zog sich aus dem Wasser und verfolgte mich: Seine Arme und Schultern waren sehr muskulös, und er konnte auf den Händen gehen. Als er Kriegsgefangener in Colditz war, hatten die Nazis nach zwei missglückten Ausbruchsversuchen seine Beine konfisziert.
»Du bist genauso schlimm wie die Nazis«, brüllte er und schwang auf seinen Händen hinter mir her wie ein Orang-Utan.
Tante Clare dachte ebenso unternehmerisch wie Mum. Sie war begeistert von walisischen Bergschafen und kaufte einige dieser schwarzen Tiere, um sie vor dem Aussterben zu retten. Irgendwann züchtete sie eine große Herde, mit der es ihr tatsächlich gelang, die Schafe von der Liste der gefährdeten Tierarten zu streichen. Sie gründete dann die »Black Sheep Marketing Company« und begann, Keramik mit dem Konterfei ihrer Lieblinge zu verkaufen. Kaffeebecher mit dem Kinderreim »Baa Baa Black Sheep« waren besonders beliebt. Schon bald strickten die alten Damen im Dorf aus Tante Clares schwarzer Wolle Umhängetücher und Pullover. Tante Clare bemühte sich nach Kräften, »Black Sheep« zum Markenzeichen zu machen. Das gelang ihr auch: Noch 40 Jahre später hat es nichts an Beliebtheit eingebüßt. Einige Jahre später erhielt ich kurz nach der Gründung von Virgin Music einen Anruf von Tante Clare: »Ricky, du wirst es nicht glauben: Eines meiner Schafe singt.«
Erst dachte ich, ich hätte mich verhört. Doch so etwas war typisch für Tante Clare. »Was singt es denn?«, fragte ich und versuchte, mir ein Schaf vorzustellen, das »Come on, baby, light my fire« sang.
»Natürlich ›Baa Baa Black Sheep‹«, knurrte sie. »Jetzt will ich eine Plattenaufnahme. Das Schaf wird wahrscheinlich nicht ins Studio gehen und singen. Könntest du wohl ein paar Toningenieure bei mir vorbeischicken? Und sie sollen sich beeilen, denn das Schaf kann jeden Augenblick aufhören zu singen.«
An jenem Nachmittag fuhr ein Trupp Toningenieure mit einem mobilen 24-Spur-Tonstudio nach Norfolk und nahm Tante Clares singendes Schaf auf. Sie verpflichteten noch einen ganzen Chor von Schafen, Enten und Hühnern als Background-Sänger, und wir veröffentlichten »Baa Baa Black Sheep« als Single. Sie stieg in den Charts bis auf Platz 4.
Meine Freundschaft mit Nik beruhte auf Zuneigung und zugleich auch auf starker Konkurrenz. Ich war entschlossen, alles besser zu machen als er. Einmal bekam Nik zum Geburtstag ein nagelneues Fahrrad. Wir beschlossen sogleich, damit »River Run« zu spielen, ein Spiel, bei dem man einen Hügel ohne zu bremsen hinunterrasen und dann so nahe wie möglich am Flussufer schleudernd zum Stehen kommen musste. Es war ein sehr spannender Wettkampf, und ich bin ein schlechter Verlierer. Da es sein Fahrrad war, kam Nik als Erster an die Reihe. Er bremste mit einer sehr überzeugenden 180-Grad-Drehung, die sein Hinterrad fast 30 Zentimeter ans Ufer heranbrachte. Nik forderte mich meistens zu haarsträubenden Heldentaten heraus. Diesmal versuchte er jedoch, mich aufzuhalten. »Besser kannst du das nicht«, meinte er. »Meine Drehung war perfekt!«
Ich war da anderer Meinung und wollte Nik unbedingt übertrumpfen. Also schob ich sein Rad den Hügel hinauf und raste wild in die Pedale tretend zum Fluss hinunter. An der Uferböschung merkte ich, dass ich die Kontrolle über das Fahrrad verloren hatte und nicht mehr stoppen konnte. Im Vorbeirasen sah ich kurz Niks offenen Mund und seinen entsetzten Gesichtsausdruck. Ich versuchte zu bremsen, aber es war zu spät. Mit einem Salto landete ich im Wasser. Das Fahrrad versank unter mir in den Fluten. Die Strömung riss mich flussabwärts, doch gelang es mir schließlich, wieder ans Ufer zu klettern. Dort erwartete mich ein tobender Nik.
»Du hast mein Fahrrad im Wasser verloren! Das war doch mein Geburtstagsgeschenk!«
Er heulte vor Wut und schubste mich ins Wasser zurück.
»Hol’s wieder raus!«, brüllte er.
»Ich werde es finden«, keuchte ich und spuckte Wasser aus.
»Mach dir keine Sorgen. Ich werde es herausfischen.«
»Das wär auch besser für dich!«
Zwei Stunden lang tauchte ich immer wieder auf den Grund des Flusses und tastete zwischen Schlamm, Steinen und Wasserpflanzen nach seinem neuen Fahrrad. Ich konnte es nirgends finden. Das Kinn auf die Knie gestützt, saß Nik am Ufer und starrte mich zornig an. Er war Epileptiker, und ich hatte bereits ein paar Anfälle miterlebt. Ich hoffte bloß, dass sein Zorn nicht einen weiteren Anfall auslösen würde. Endlich, als ich so sehr fror, dass ich kaum noch sprechen konnte und meine Hände weiß und gefühllos waren und vom Abtasten der Steine auf dem Grund des Flusses bluteten, gab Nik nach. »Lass uns heimgehen«, sagte er. »Du wirst es nie finden.«
Auf dem Heimweg versuchte ich, ihn mit einem Versprechen aufzuheitern: »Wir kaufen dir ein neues.«
Meine Eltern müssen gestöhnt haben, denn das Fahrrad kostete über 20 Pfund – fast so viel wie der Monatsumsatz, den meine Mutter mit ihren Taschentuchkistchen erzielte. Im Alter von acht Jahren wurden Nik und ich getrennt, als ich ins Internat Scaitcliffe in Windsor Great Park geschickt wurde.
In meiner ersten Nacht in Scaitcliffe lag ich hellwach in meinem Bett, hörte die anderen Jungen im Schlafsaal schnarchen und schniefen, fühlte mich unendlich einsam und unglücklich und hatte Angst. Irgendwann in dieser ersten Nacht wusste ich, dass ich mich übergeben musste. Mir wurde plötzlich so übel, dass ich nicht mehr ins Bad rennen konnte, sondern mich auf meinem Bettzeug erbrach. Die Hausmutter wurde gerufen. Sie war nicht etwa mitfühlend, wie meine Mutter es gewesen wäre, sondern maulte mich an und zwang mich, mein Bett selbst zu reinigen. Noch heute kann ich mich an dieses Gefühl der Erniedrigung erinnern, das ich damals empfand. Offenbar dachten meine Eltern, sie täten mir etwas Gutes, indem sie mich ins Internat schickten, aber in jenem Augenblick fühlte ich nur Verwirrung und Hass auf sie und eine ungeheure Angst vor dem, was mich erwartete. Nach wenigen Tagen hatte ein älterer Junge in meinem Schlafsaal seine Vorliebe für mich entdeckt und mich überredet, zu ihm ins Bett zu steigen, um »Doktor« zu spielen. Am ersten Wochenende zu Hause erzählte ich meinen Eltern emotionslos, was unter der Bettdecke geschehen war. Mein Vater sagte ganz ruhig: »So etwas sollte man besser lassen.« Es war der erste und einzige Vorfall dieser Art.
Mein Vater war im gleichen Alter ins Internat geschickt worden – wie schon sein Vater vor ihm. Es war die traditionelle Erziehung für einen Jungen aus meiner Gesellschaftsschicht und sollte uns zu unabhängigen, selbstständigen Menschen machen, die auf eigenen Beinen stehen konnten. Aber ich hasste es, in so jungen Jahren von zu Hause fort zu müssen, und ich habe mir geschworen, meine Kinder erst dann in ein Internat zu schicken, wenn sie alt genug sind, selbst für sich zu entscheiden. In meiner dritten Woche in Scaitcliffe wurde ich in das Büro des Direktors zitiert. Mir wurde eröffnet, dass ich eine Regel gebrochen hätte. Ich glaube, ich hatte ein »heiliges« Rasenstück betreten, um einen Fußball zu holen. Ich musste mich niederbeugen und erhielt sechs Stockschläge auf meinen Allerwertesten.
»Branson«, sagte der Direktor mit Stentorstimme. »Sag ›Danke, Sir.‹«
Ich traute meinen Ohren nicht. Für was sollte ich ihm danken?
»Branson!« Der Direktor hob seinen Stock. »Ich warne dich.«
»Danke …, Sir.«
»Mit dir wird’s noch Ärger geben, Branson.«
»Ja, Sir. Ich meine, nein, Sir.«