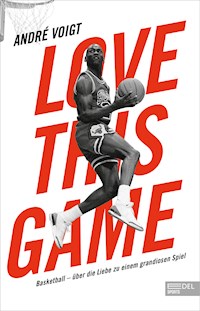
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Für viele gibt es keinen faszinierenderen und trendigeren Sport als Basketball. Weltweit verfolgen Millionen von Fans die Spiele der amerikanischen Liga NBA, die heimischen Bundesliga-Arenen sind regelmäßig ausverkauft und immer mehr Jugendliche begeistern sich für das Spiel unter dem Korb. Pünktlich zur Europameisterschaft in Deutschland holt der renommierte TV-Experte und Journalist André Voigt mit seinem Buch alle Basketball-Liebhaber ab. Er taucht ein in die Geschichte und die Kultur dieser technisch anspruchsvollen und hochspannenden Ballsportart, erklärt die NBA, die wichtigsten Spieler, Teams und Taktiken – und liefert dabei jede Menge Fun Facts, die man braucht, um mitreden zu können. Ein unterhaltsamer Guide und ein wunderbares Lesebuch, gespickt mit Wissen und Anekdoten für die Basketball-Community und alle, die dazugehören wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Für Isabel, Ylva, Edith und Fritz.
INHALT
VORWORT
FUNDAMENTALS
Hoop Dreams
Keiner ist gestorben, fünf Sterne
Learning by Doing
Von Käfigen zu Arenen
Big George
Feindliche Übernahme
Rettung in der Bowlingbahn
SUPERSTARS
Erster Kontakt
Die Besten der Besten
Müller, Meier, Schulze, Nowitzki
DIE ASSOCIATION
Der Manager auf dem Sitz neben mir
Not the American Dream
Hard Cap, nein danke!
Die Luxussteuer
Superteams
Tauschgeschäfte
Try Trade!
Trades für alle!
Die NBA-Draft
Das Ende der Freiheit
Der beste Weg zum Erfolg
Von Gier und Planwirtschaft
Der kalte Umschlag
The Process
Unangenehme Wahrheit
BUILT TO WIN
Ein Nachthemd vom Chef
Archetypes – das Ende der Positionen
Das perfekte Team
PLANET BASKETBALL
Mit Abstand verlieren
NBA-Reisen: Wie geht das?
Es muss nicht immer NBA sein!
Deutschland … es ist kompliziert
Als ich Pau Gasol rettete
Bucket List
Da hilft auch kein Mittelstrahl
DANKE
VORWORT
Es war ein Samstag im Januar 1988. Ich weiß noch, wie Micha den auf Barock gemachten Metallschlüssel drehte. Er stand an einer dieser Schrankwände, die damals gefühlt jede Familie im Wohnzimmer stehen hatte. Dunkles Holz, viel Stauraum, eine Vitrine für die „guten Gläser“ und – so war das in den 1980ern halt – eine Bar. Genau die öffnete Micha. Er klappte die schwere Tür vorsichtig nach unten, wodurch sie zu einer Ablage wurde. Praktisch, denn so ließ sich auf Bauchhöhe direkt ein Drink mixen … und zu mixen gab es einiges. Seine Eltern waren nicht zu Hause. Ich meine, dass sein Vater Schütze oder Kegler war oder beides – auch so ein 1980er-Ding. Auf jeden Fall war bei Micha im vierten Stock im Dresdener Ring 47 im Wolfsburger Stadtteil Westhagen sturmfrei. Wir wohnten damals im Dritten. Ich war 14, Micha und sein Kumpel Sven waren ein Jahr älter. In Sachen pubertärer Entwicklung waren sie mir wahrscheinlich sogar noch weiter voraus – auch wenn ich beide um einen Kopf überragte. Micha hatte mich nachmittags auf dem Flur eingeladen, doch abends „hochzukommen“. Warum, steckte er mir nicht. Jedenfalls erinnere ich mich nicht mehr daran. Dafür aber an die Flasche mit dieser blauen Flüssigkeit namens „Blue Curaçao“, an den dicken Hinweis „mit Farbstoff“. Ich erinnere mich auch an eine weiße Flasche mit der Aufschrift „Malibu“, an klitzekleine Gläser … vor allem aber an dieses Gefühl, gleich etwas Verbotenes zu tun.
Wir probierten uns durch so ziemlich jede Art von Alkohol, die dieser als Barschrank getarnte Übergang in die Erwachsenenwelt zu bieten hatte. Immer nur kleine Mengen – Michas Eltern durften nichts merken –, dafür alles durcheinander. Zum ersten Mal Alkohol, wow! Ich dachte, dass dieser Moment, so bitter brennend er zum Teil auch schmeckte, das nachhaltig Wichtigste sein würde, was ich an diesem Tag erleben sollte. „Endlich Haare auf der Brust!“ und so … Da machte Sven den Fernseher an. Er schaltete zielsicher über die etablierten Sender hinweg, ARD, ZDF, sogar vorbei an den neuen privaten RTL, SAT.1, bis zu einem Kanal namens „Super Channel“. Den hatte ich noch nie wirklich wahrgenommen – genau wie das, was jetzt dort gezeigt wurde. Sven spielte beim VfL Wolfsburg Basketball, und aus irgendeiner Programmzeitung musste er erfahren haben, dass genau dort jetzt dieser Sport lief. Kein Spiel aus der deutschen Bundesliga, sondern eines aus den USA, der NBA – „der besten Basketballliga der Welt“, wie mir versichert wurde.
Natürlich wusste ich, dass es diesen Sport mit den Körben gab. Wir hatten ihn mal in der Grundschule angetestet – mit diesen farbigen Gummibällen, die ein oranges Ventil hatten –, aber von der F- bis zur C-Jugend brannte ich nur für Fußball. Kicken war alles, Pierre Littbarski mein Idol. Die größte Strafe: Trainingsverbot. Der wendige Dribbler „Litti“, das Vorbild für einen Jungen, dem sein Trainer die Dehnbarkeit „einer Bahnschranke“ attestierte und ihn aufgrund seiner Länge ins Tor stellte? War das nicht denkbar unrealistisch? Ja. Immerhin spielte ich mich bis in die Abwehr vor, wo ich dann vom selben Übungsleiter, lieb gemeint, „André Ruderfuß“ gerufen wurde, weil ich mit meinen langen Beinen jeden Angreifer abgrätschen würde … Ja, der Herr Dau, er war ein Poet des grünen Rasens.
Mit Fußball war es jedoch schon länger vorbei. Zwei Armbrüche in einem Jahr ließen mich in meinem zweiten Verein den Anschluss verlieren. Unser Trainer, der seinen Schützlingen nach dem Spiel in der Kabine vor versammelter Mannschaft eine Schulnote für die gezeigte Leistung gab (gern auch lautstark verbalisiert eine Sechs), sorgte dafür, dass ich die Lust verlor und irgendwann einfach nicht mehr zum Training ging. Und jetzt flimmerten da diese Bilder über den Röhrenfernseher. Grüne Trikots, gelbe mit ein wenig lila an der Seite. Was gesagt wurde, verstand ich als Siebtklässler nicht. Drei Dinge fielen mir jedoch auf. Zum einen lief da dieser supergroße Spieler über das Parkett, dessen Name zu lang für sein Trikot war: „Abdul-Jabbar“. Dazu trug er eine Brille. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Sah aus, als hätte jemand zwei Wassertropfen eingefroren, in der Mitte zusammengeklebt und ihm übergezogen. Die Brille schmiegte sich um seinen kahl geschorenen Kopf, war durchsichtig und wurde hinten von einem schwarzen Gummiband gehalten. Auch warf er anders als alle anderen. Abdul-Jabbar führte den Ball am langen Arm weit über den Kopf (mit der Tropfenbrille), dann ließ er ihn seitlich gen Korb fliegen. Zum zweiten war da sein Mitspieler namens Johnson. Der war zwar um einiges kleiner als dieser Abdul-Jabbar, aber viel länger als sein Verteidiger. Irgendwie spielte auch er anders. Sven merkte an, dass der mit Vornamen Magic heiße. Und es wurde noch wilder: Schrempf. Der sollte ein Deutscher sein. Ich weiß noch, dass ich dachte: Ein Deutscher in den USA? Wie geht denn das?
Ehrlich gesagt hatte ich nach einer guten Stunde auch andere Probleme: In meinem Bauch wurde es irgendwie warm. Ich war redseliger als sonst. Das musste der Alkohol sein. Ich machte mir Sorgen, ob ich nicht eine meilenweit zu riechende Fahne vor mir hertrug. Als wenig rebellischer Teenager wollte ich es mir auf keinen Fall mit meinen Eltern verscherzen. Also verabschiedete ich mich und ging langsam runter in den dritten Stock. Im Dunkeln. Nicht, dass mich noch einer der Nachbarn sah. War meine Zunge blau von diesem Curaçao-Zeug? Oh Gott, würde ich lallen, wenn ich zur Tür reinkam? Auf keinen Fall lallen oder schlimmer noch: torkeln! Das Zimmer von meinem Bruder und mir lag am Ende des langen Flurs, links davon das Wohnzimmer, wo meine Erziehungsberechtigten fernsahen. Schnellen Schrittes ging ich bis zur Toilette zwischen Wohn- und Kinderzimmer, rief: „Ich bin wieder da“, schloss die Tür zum Klo, putzte mir übergründlich die Zähne, gefolgt von einer Guinness-Buch-würdigen Gurgelarie, und verabschiedete mich ins Bett. An diesem Tag hatte sich mein Leben nachhaltig verändert, und zwar ganz anders, als ich gedacht hatte. Basketball wurde mein Leben. Magic Johnson?, grübelte ich vor dem Einschlafen. Komischer Name.
Basketball oder Fünf!
„Klaus Hantelmann“ mag ein nicht ganz so komischer Name sein, dafür spielt er in dieser Geschichte eine weitaus wichtigere Rolle als der von Earvin „Magic“ Johnson. Der Mann, der mich schlussendlich zum Basketball brachte, war Lehrer am Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) in Wolfsburg. Er unterrichtete Biologie und Erdkunde im … nun … wenig charmanten Freizeit- und Bildungszentrum – einem 1970er-Jahre-Bau, der, wie der Rest des Stadtteils Westhagen, von den Stadtplanern vor allem „funktional“ gestaltet worden war. In seiner Freizeit kümmerte sich Hantelmann als Abteilungsleiter um die Basketballsparte des VfL Wolfsburg. Spielerisch wenig begabt, hatte er sich als junger Mann in seiner Heimat Wolfenbüttel dennoch in den orangen Ball verliebt. Kein Wunder. Basketball hat dort Tradition. Der MTV Wolfenbüttel gewann 1972 und 1982 den deutschen Pokal und spielte als Gründungsmitglied von 1966 bis 1984 in der Ersten Bundesliga. In seiner nur knapp 55 000 Einwohner zählenden Heimatstadt war der MTV über Jahrzehnte DIE große Nummer. Eltern nahmen ihre Kinder mit zu den Spielen. Kinder wollten so sein wie die Helden, die in der Lindenhalle oder am Landeshuter Platz spielten. In der Zuschauerreihe direkt hinter der Spielerbank saß gern der Bürgermeister. Wolfenbüttel war eine dieser Basketballhochburgen, von denen es in der alten Bundesrepublik nur wenige gab. In Wolfsburg konnte davon keine Rede sein. Hantelmann leistete also sportliche Entwicklungshilfe und die beinhaltete, groß gewachsene Schüler anzusprechen, die er täglich unter einigen hundert Jugendlichen auf den Fluren des ASGs an sich vorbeilaufen sah. Ob sie schon mal was von Basketball gehört hätten? Wollten sie den Sport nicht vielleicht mal ausprobieren? Super, genau dafür gab es die von Klaus Hantelmann selbst geleitete Basketball-AG!
Ich muss so um die 1,90 Meter lang gewesen sein, als mich Hantelmann auf dem Flur der Sekundarstufe 1 ansprach. Allerdings hatte er mehr als nur seine Standardsätze im Gepäck. Der Mann wusste, dass er im kommenden Schuljahr unsere Klasse in Erdkunde unterrichten würde. Und so schloss er seinen Anwerbeversuch mit folgendem Satz, den er mit einem schelmischen Grinsen untermalte: „Also, wenn du keine Fünf in Erdkunde möchtest – komm mal zur AG.“ Wer war ich, 14,5 Jahre alt, das Gesicht voller Akne und zu dieser Zeit außer Summer Games beziehungsweise MicroProse Soccer am C64 ohne jegliche sportliche Betätigung, dass ich dieses Angebot ablehnen würde? Es war die beste Entscheidung meines Lebens (und, ja, dieser Satz gibt zu Hause sicher Ärger …).
34 Jahre später sitze ich hier und schreibe ein Buch über meine Liebe zum Basketball. Über das Spiel, das so viel mehr für mich wurde als eine Freizeitbeschäftigung – oder das Hintergrundrauschen eines pubertären Alkoholabends. Basketball wurde zur Orientierung und zur Identität. Zur Bestätigung, Leidenschaft und auch zur Heimat. Ich lief für eine US-Highschool-Mannschaft auf, schlug zwei College-Angebote aus, spielte drei Jahre in der Zweiten Bundesliga, wurde Deutscher Hochschulmeister, coachte die zweite Herrenmannschaft meines Heimatvereins von der Kreis- bis in die Bezirksliga … und machte schließlich mein Hobby zum Beruf.
Über die Jahre war ich bei einigen der schönsten Basketballspiele aller NBA- und FIBA-Zeiten live in der Halle. Mit einer Handvoll Freunde gründete ich eine eigene Zeitschrift (Five), später einen Podcast (Got Nexxt), noch später eine weitere Zeitschrift (Got Nexxt – The Magazine), ich durfte im Fernsehen (sogar live) über Basketball sprechen, NBA-Partien kommentieren. Vor allem aber traf ich seit 1988 eine Menge Menschen, die diese Liebe zum Basketball nicht nur teilten, sondern weiter anfachten. Von meinen ersten Coaches beim VfL Wolfsburg (Henning Schlieker, Bernd Uellendahl und Conny Pawlak) über unzählige Freunde und Bekannte im Sport bis zu Dirk Nowitzki. Am Ende sind es die Menschen und ihre Geschichten, die den Sport zu dem machen, was er ist.
Diese Liebe wollte ich immer weitertragen. Sei es als Jugendtrainer damals beim VfL, in meinem Podcast, mit unserer Zeitschrift, an einem Samstagabend auf der Party des Babamixed in Braunschweig … oder eben mit diesem Buch.
Viel Spaß!
FUNDAMENTALS
HOOP DREAMS
Basketball ist die individuellste Teamsportart der Welt. Das mag auf den ersten Blick paradox, ja sogar abschreckend klingen. Dabei liegt genau hier vielleicht das größte Geheimnis der Faszination dieses Sports. Deshalb zur Erklärung ein kleines Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, wir sind allein in einer Turnhalle. Uns stehen alle Bälle, Tore, Netze und was es sonst noch zur Ausübung von Mannschaftsspielen gibt, zur Verfügung … alles außer Mitspielern. Wir schnappen uns den Fußball. Ein paar Schüsse auf das leere Tor später passen wir das Leder vielleicht gegen die Wand, damit es zu uns zurückspringt, nur um es dann wieder gegen die Backsteine zu spielen. Also her mit dem Handball. Nach jedem Wurf ins Tor das Gleiche: das Spielgerät aus dem Netz friemeln, hinter den Kreis gehen, ein, zwei Dribblings, Wurf … Eventuell versuchen wir die Latte zu treffen, vielleicht ein paar Hechtsprünge in den Kreis plus Rolle auf dem Boden nach dem Wurf ins leere Tor. Jetzt Hockeyschläger und -ball? Schuss, Tor … Selbst Hockey-Enthusiasten, Hand- und Fußballer müssen zugeben: Das macht nicht lange Spaß. Es fehlt der Wettbewerb, die Challenge namens Torwart. Also Volley-, Völker-, Faust-, Brenn-, Base-, Wasserball, Rugby, American Football, Cricket, Lacrosse, Quidditch? Nee, lass mal …
Irgendwann greifen wir zum Basketball. Wahrscheinlich – unsere Turnhalle steht in Deutschland – müssen wir jetzt irgendwo an einer der vier Wände eine Kurbel drehen, die eine schlimm ächzende Konstruktion in Gang bringt, die den Korb von der Decke auf die gewünschten 3,05 m Höhe herunterfahren lässt. Sofort ist klar, was getan werden muss: Das Runde muss ins Runde. Von oben. Ein Selbstläufer ist das nicht, aber selbst ohne irgendeine Vorbildung im Bereich Korbwurf geht der ein oder andere Versuch recht schnell rein. Natürlich werfen wir zunächst mit beiden Armen. Denn diese Bewegung ist uns fremd. Richtig fühlt sich das nicht an, aber wenn das Ergebnis stimmt … wen kümmert’s? Irgendwie kickt das. Jedes Mal wenn dieser rotorange Lederball durch das weiße Nylongeflecht rauscht, macht das etwas mit uns.
Wahrscheinlich sind es kleine Endorphinausstöße, verbunden mit dem „Swish“ des Balls, der durchs Netz rauscht, die uns konditionieren. Das Werfen wird zur Mikrochallenge mit sofortiger Erfolgskontrolle. Und die funktioniert ganz wunderbar allein. Der Torwart ist der Korb in der Höhe. Der Schwierigkeitsgrad kann selbst gewählt werden. Anfänger versuchen es näher am Ring, Fortgeschrittene von weiter weg oder nach einem Dribbling durch die Beine. Da ist sogar eine Linie. Wer von dahinter trifft, bekommt drei statt zwei Punkte. Muss ich probieren! So fängt es an. Überall auf der Welt. Es mag sich für jeden, der nicht selbst Basketball spielt, komisch lesen: Diese so grundlegende Faszination verlässt Basketballer nie. Sie können in der Kreisliga spielen oder in der NBA Millionen verdienen. Ein Ball, ein Korb, ein halbwegs ebener Boden – mehr braucht es nicht, um glücklich zu sein … egal ob im Madison Square Garden in Manhattan, in der Ischelandhalle in Hagen oder auf den Dong Dan Courts gleich um die Ecke vom Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Allein auf einen Korb zu werfen ist die Grundlage des besten Teamsports der Welt und war es von Anfang an. Sein Erfinder wollte eigentlich nur ein paar Halbstarke davon abhalten, sich umzubringen …
KEINER IST GESTORBEN, FÜNF STERNE
Der Kanadier James Naismith ist 31 Jahre alt, als er Basketball erfindet. Der Winter des Jahres 1891 steht vor der Tür. Eine Zeit, der die Lehrkörper der International YMCA Training School in Springfield, Massachusetts, traditionell mit Sorge entgegenblicken. Denn im Nordosten der USA wird es dann kalt, sehr kalt. Es fällt viel Schnee. So viel Schnee, dass noch heute Privatleute während eines der berüchtigten Blizzards Schneepflüge an ihre eigenen Autos schnallen, um die Straßen passierbar zu machen. Damals wie heute sind Winter in Neuengland ein Problem. 1891 kommt ein nicht sofort ersichtlicher Grund hinzu. Am College von Naismith werden seit 1887 Sportlehrer ausgebildet. Im Sommer sind die jungen Männer gut ausgelastet. Sie spielen American Football, Fußball und ein bisschen Lacrosse. Diese Sportarten sind zu dieser Zeit vor allem eins: ziemlich brutal. Während es bei Lacrosse und Fußball nur anständig auf die Knochen gibt, sterben noch im Kalenderjahr 1905 unfassbare 19 Studenten bei Football-Partien zwischen US-Colleges. Präsident Theodore Roosevelt sieht sich genötigt einzugreifen. Er trifft sich mit Vertretern verschiedener Unis, setzt Regeländerungen durch und gründet so nebenbei den Vorläufer der National Collegiate Athletic Association (NCAA), die heute quasi das Milliardengeschäft des US-Unisports organisiert.
Während also im Sommer für ordentlich Aggressionsabbau und Adrenalin gesorgt ist, hält der Winter einen Lehrplan für die Studenten bereit, der aus Marschieren, Geräteturnen und Freiübungen besteht. Wohin mit der angestauten Aggressivität? Woher den Kick nehmen? Da das mit Kniebeugen und dem gelegentlichen Unterschwung am Reck nicht so recht gelingen will, schlagen die jungen Herren anderweitig über die Stränge und gern in Gesichter. Es muss etwas passieren, fordert Luther Halsey Gulick. Er gilt heute als Vater des US-Sportunterrichts und ist damals Professor des Doktoranden James Naismith. Im Sommersemester 1891 hatte Gulick in einem Seminar gesagt, dass es ein neues Spiel brauche. Einen Hallensport, der „interessant, leicht zu erlernen und unter künstlichem Licht zu spielen sein muss“. Daran erinnert sich Naismith, als der Winter naht. Denn der aktuelle Jahrgang ist schwierig, Interesse am öden Winterprogramm quasi nicht vorhanden.
Naismith erklärt gegenüber seinen Kollegen, dass das System das Problem sei und nicht die Studenten. Man müsse an ihre spielerischen Instinkte appellieren, schlägt er vor. Gulick freut sich über diese Idee. „Naismith, ich will, dass Sie diesen Jahrgang übernehmen und schauen, was Sie damit machen können“, erklärt er. Er gibt Naismith auf den Weg, dass sein neuer Sport bitte anstrengend sein und keine Knochenbrüche der Studenten nach sich ziehen soll. So eine neue Sportart erfindet sich aber nicht einfach so nebenbei. Naismith tüftelt lange. Zwei Ideen, die er hat (Abwandlungen von American Football und Lacrosse für die Halle), stoßen bei den jungen Männern auf gar keine Gegenliebe. Dann kommt Naismith zu dem Schluss, Elemente verschiedener Sportarten, die seine Studenten kennen, miteinander zu verknüpfen. Als Spielgerät wählt er einen alten Fußball. Eine Art Tor soll es auch geben, aber nicht ebenerdig, sondern in der Höhe. Zu Beginn einer Partie und nach jedem Tor gibt es einen Sprungball, wie er aus dem englischen Rugby bekannt ist. Er erinnert sich an ein Kinderspiel, mit dem er und seine Freunde sich in seiner Heimat Ontario die Zeit zu vertreiben pflegten: Duck on a rock. Die Regeln sind simpel: In eine Baumgabel oder auf einen großen Felsen wird ein kleinerer Stein gelegt – der Drake. Ein Spieler ist so etwas wie ein Torwart, er bewacht den Drake. Die anderen Spieler versuchen, mit Steinen (Ducks) danach zu werfen. Fällt der der Drake zu Boden, können die Werfer ihn klauen. Kinder, die mit Steinen werfen, als Vorbild für eine neue, sichere Sportart … das liest sich bis hierhin absurd. Bis hierhin …
Die Grundidee von Naismith ist also, einen Ball in ein in der Höhe befestigtes Tor zu werfen. Brillant! Er fragt beim Hausmeister, ob der nicht zwei Kisten hat, in die ein Fußball locker passt. Hat der nicht, dafür aber zwei Körbe, in denen normalerweise Pfirsiche aufbewahrt werden. Besser als nichts. In der Turnhalle überlegt Naismith, wie hoch die Körbe eigentlich aufgehängt werden sollen. Pragmatisch, wie er ist, orientiert er sich an einer architektonischen Gegebenheit. Auf einer Höhe von 3,05 m (zehn Fuß) läuft ein Balkon einmal rund. Das ist damals in so ziemlich allen Sporthallen in den USA der Fall, dort können Zuschauer stehen. An das untere, hölzerne Ende des Balkons montiert Naismith seine Körbe. So weit so gut. Doch was sind eigentlich die Regeln seines neuen Spiels? Naismith schnappt sich seine Sekretärin und diktiert:
1.Der Ball darf mit einer oder beiden Händen in jede Richtung geworfen werden.
2.Der Ball kann mit einer oder beiden Händen in jede Richtung geschlagen werden – allerdings nicht mit der Faust.
3.Ein Spieler darf nicht mit dem Ball laufen. Der Spieler muss den Ball von dem Punkt, an dem er ihn fängt, weiterspielen. Wenn ein Spieler den Ball im schnellen Lauf fängt, darf er erst zum Stehen kommen.
4.Der Ball darf mit den Händen gehalten werden, nicht aber mit den Armen oder dem Körper.
5.Jegliches Stoßen mit der Schulter, Halten, Schubsen, Beinstellen oder Schlagen des Gegners ist verboten. Die erste Regelverletzung dieser Art wird als Foul gewertet, die zweite führt zu einer Disqualifikation des Spielers bis zum nächsten Korb. Wenn der Foulende seinen Gegner offensichtlich verletzen wollte, wird er vom Spiel ausgeschlossen und darf von seinem Team nicht ersetzt werden.
6.Schlägt ein Spieler den Ball mit der Faust, wird das als Foul gewertet, genau wie Verstöße gegen die Regeln 3, 4 und 5.
7.Begeht ein Team drei aufeinanderfolgende Fouls, ohne dass die andere Mannschaft ein Foul begeht, wird der gegnerischen Mannschaft ein Punkt gutgeschrieben.
8.Wird der Ball vom Feld aus so in den Korb geschlagen oder geworfen, dass er im Korb liegen bleibt, zählt das als ein Korb – es sei denn, die verteidigende Mannschaft berührt den Korb: Bewegt sie den Korb, während der Ball sich auf dem Rand befindet, zählt auch dies als Korb.
9.Wenn der Ball ins Aus geht, darf die erste Person, die ihn berührt, einwerfen. Sollte nicht klar sein, wer den Ball als Erstes berührt hat, wirft der Referee den Ball zurück ins Feld. Der Einwerfer hat fünf Sekunden Zeit, den Ball zurück ins Spiel zu bringen. Hält er ihn länger, geht der Ballbesitz an das gegnerische Team über. Verzögert eine Mannschaft das Spiel weiter, pfeift der Referee ein Foul.
10.Der Oberschiedsrichter schreibt die Fouls auf und verständigt den Referee, wenn ein Team drei Fouls in Folge begangen hat. Er kann auch Spieler nach Regel 5 disqualifizieren.
11.Der Referee entscheidet, ob der Ball im Spielfeld oder im Aus ist, welche Seite in Ballbesitz ist, und nimmt die Zeit. Er entscheidet, wann ein Korb geworfen wurde und erhebt den Spielstand.
12.Die Spielzeit beträgt zweimal 15 Minuten, mit einer fünfminütigen Pause dazwischen.
13.Die Mannschaft, die in dieser Zeit die meisten Punkte erzielt, wird zum Sieger erklärt. Bei Unentschieden kann das Spiel – wenn sich die Kapitäne beider Teams darauf einigen – verlängert werden. Es gewinnt das Team, welches als Erstes einen Korb erzielt.
Zwei zusätzliche Regeln: Jedes Team besteht aus neun Akteuren und nach jedem Korb beginnt das Spiel wieder mit einem Sprungball. Bei der Namensfindung zeigt sich Naismith so pragmatisch wie wenig kreativ: Basket Ball. Als die Sekretärin fertig getippt hat, nimmt sie die beiden Blätter und nagelt sie ans Schwarze Brett, damit die Studenten sie vor der nächsten Stunde verinnerlichen können. Am 21. Dezember 1891 ist es so weit. Naismith bittet zum allerersten Sprungball aller Basketballzeiten. Der Rest ist wunderschöne Sporthistorie … Wenn es denn so gewesen wäre. War es nicht.
Also nicht falsch verstehen. Natürlich erfand James A. Naismith Basket Ball. Er diktierte 13 Regeln in die Schreibmaschine seiner Sekretärin. Nur … das erste Spiel und die Sache mit den Regeln, das lief ein wenig weniger rund. Im Jahr 2015 entdeckte Professor Dr. Michael J. Zogry von der University of Kansas etwas, was die Entstehungsgeschichte des Basketballs in ein etwas anderes Licht rückt. Zogry stieß bei der Recherche für sein Buch Religion and Basketball: Naismith’s Game auf einen Mitschnitt eines Radiointerviews mit dem Erfinder des Spiels. Der war 1939 in New York City beim dortigen Radiosender WOR-AM zu Gast. In der Show We the People sprach Naismith über das erste Basketballspiel aller Zeiten. „Eines Tages hatte ich eine Idee. Ich rief die Jungs in die Halle und teilte sie in zwei Teams auf und gab ihnen einen Fußball“, erklärt Naismith. „Ich zeigte ihnen die beiden Pfirsichkörbe, die ich an beiden Enden der Halle an die Wand genagelt hatte. Ich erklärte ihnen, dass das Ziel des Spiels sei, den Ball in den Korb des Gegners zu werfen. Ich pfiff und das erste Basketballspiel begann.“ … „Welche Regeln hatten Sie bei diesem ersten Spiel?“, wird Naismith gefragt. „Nun, nicht genug“, gibt er zu. „Das war mein größter Fehler. Die Jungs fingen an sich zu tacklen, zu treten und zu schlagen. Es kam zu einer Massenschlägerei auf dem Boden in der Mitte der Halle. Als ich sie endlich auseinandergebracht hatte, war einer der Jungs bewusstlos, mehrere trugen Veilchen davon und einer kugelte sich die Schulter aus. Es war mörderisch. Ich dachte bei diesem ersten Spiel wirklich, die bringen sich um.“
Aller körperlichen Gewalt zum Trotz: Irgendetwas hat dieses Basket Ball. Die Studenten bitten Naismith, weitere Regeln festzulegen, die das Spiel verfeinern beziehungsweise überhaupt möglich machen. Naismith: „Die wichtigste war, dass das Laufen mit Ball verboten wurde. Das stoppte das Tackling und Schlagen. Wir probierten es mit diesen Regeln und hatten keine Opfer zu beklagen. Wir hatten jetzt einen feinen, sauberen Sport.“ Hätte es damals schon Internet-Bewertungen gegeben, hätten die sich wohl wie folgt gelesen: Alle hatten Spaß, keiner ist gestorben, fünf Sterne. Dabei hat Basket Ball nur Grundzüge mit dem heutigen Basketball gemein. Der Sport ist statisch, das Dribbeln war ja noch nicht eingeführt und wäre mit den schweren Fußbällen auch kaum möglich gewesen. Nach jedem erfolgreichen Wurf muss ein Spieler das Leder aus dem Korb holen – erst nach ein paar Jahren wird es keinen Boden mehr in den Körben geben, sodass der Ball hindurchfallen kann – und es geht mit einem Sprungball weiter. Entsprechend wenig spektakulär kam die allererste Partie daher. Endergebnis: 1:0. William R. Chase erzielte den einzigen Korb, der damals nur einen Punkt wert war, aus knapp 25 Fuß (7,60 m) Entfernung. Der erste erfolgreiche Feldwurf in der Geschichte wäre also heute ein Dreier gewesen.
Was damals wie heute gilt: Ein Ball, ein Korb, ein Spieler – mehr braucht es nicht, um sich in diesen Sport zu verlieben. Wahrscheinlich verbreitete sich das Spiel auch deshalb in Rekordzeit auf dem Planeten. „Zehn Jahre nach unserer ersten Partie wurde Basketball schon in den ganzen USA gespielt“, erklärt Naismith in dem Radiointerview. „1936 sah ich es bei den Olympischen Spielen in Berlin.“
LEARNING BY DOING
Komisch eigentlich, dass dieses Spiel einen Siegeszug rund um die Welt antritt. Immerhin ist es zu Beginn nicht gerade dynamisch und im Vergleich zu anderen Sportarten Ende des 19. Jahrhunderts Ringelpiez ohne Anfassen. Es muss diese Faszination der Grundidee sein. Werfen auf ein Ziel, das irgendwo über dem eigenen Kopf hängt. Was immer Naismith und seine Freunde in Kanada Steine auf Steine werfen ließ, funktioniert auch mit braunem Lederball und Pfirsichkorb. Gleichzeitig engen Naismiths Regeln die ersten Spieler wenig ein. Sie sind nur die Grundlage, auf der sich der Sport entwickeln soll. Die 13 Regeln laden dazu ein, zu erforschen, was sie eigentlich erlauben und was nicht. Sein Erfinder weiß das ja selbst nicht. Er hat kein fertiges Produkt vor Augen, er definiert einen Startpunkt. Naismiths Sport ist eine fast weiße Leinwand, auf der die Aktiven sich jetzt ausprobieren können … Herrgott, es gibt ja noch nicht mal einen eigenen Ball!
So schnell ihm die Idee kam, so schnell sich immer mehr Menschen in Basket Ball verlieben, es dauert noch Jahrzehnte, bis das Spiel zu dem wird, was es heute ist. Die erste Phase dieser Liebesbeziehung ist geprägt vom Learning by Doing, von Kreativität, von Irrwegen und brillanten Ideen. Basketball wird zu einem großen Crowdsourcing-Projekt.
1893 Die Narragansett Machine Company produziert erstmals Körbe aus Eisen. Sie bestehen neben dem Ring aus einem Eisennetz, an dem eine Kette hängt. Wird diese gezogen, fällt der Ball heraus.
1894 Freiwürfe werden eingeführt und zählen – genau wie ein normaler Korberfolg – einen Punkt.
1895 Einführung von Brettern hinter den Körben. Grund: Zuschauer auf den Balkonen schlagen zu oft Bälle weg, die auf den Korb zufliegen.
1896 Ein Korb zählt ab jetzt zwei, ein Freiwurf nur einen Punkt.
1897 Spieler der Yale University dribbeln erstmals. Sie passen sich den Ball quasi über den Boden selbst zu und laufen von einer Stelle zur anderen. Das ist ungewöhnlich, aber laut Regelwerk nicht verboten.
Kurzer Einschub. In dieser Phase entstehen einige kuriose „Taktiken“. Spieler pritschen zum Beispiel wie beim Volleyball das Spielgerät über den Kopf nach vorne und laufen dorthin, wo der Ball hinfliegt. Es ist eine wilde Zeit des Ausprobierens und ein echter Test des Basketballregelwerks.
1898 Diese Manöver werden allesamt verboten. Neben dem Pritschen werden auch beidhändige Dribblings sowie dribbeln, abstoppen, den Ball aufnehmen und dann weiter dribbeln jetzt mit Verlust des Ballbesitzes geahndet.
1903 Spieler dürfen zwar den Ball dribbeln und sich bewegen, danach ist es ihnen aber verboten, auf den Korb zu werfen. Sie müssen das Spielgerät weiterpassen.
1908 Es wird festgelegt, dass ein Spieler nach fünf persönlichen Fouls nicht mehr eingesetzt werden darf. Vorher lag die Grenze bei vier Vergehen.
1909 Das Dribbling, wie wir es heute kennen, wird eingeführt. Werfen nach dem Dribbling bleibt aber verboten.
1912 Offene Nylonnetze werden zugelassen. Endlich fliegt der Ball durch das Netz, was dem Spiel einen gehörigen Geschwindigkeitsschub verleiht.
1914 Eine neue Regel besagt, dass bei einem Ausball das Team, welches das Spielgerät nicht zuletzt berührt hat, einwerfen darf. Vorher durfte die Mannschaft einwerfen, die den im Aus liegenden Ball als erste wieder berührte … was zu einigen wilden Szenen und Verletzungen geführt hatte.
1915 Spieler dürfen nach einem Dribbling jetzt auch auf den Korb werfen.
1923 Ab sofort muss der gefoulte Spieler die Freiwürfe ausführen, vorher durfte das Team den Werfer aussuchen.
1933 Ein Team muss den Ball in zehn Sekunden in die Hälfte des Gegners bringen oder es verliert den Ballbesitz.
1936 Steht ein Spieler länger als drei Sekunden in der Zone unter dem gegnerischen Korb, verliert sein Team den Ballbesitz.
1938 Der Sprungball nach jedem Korb und Freiwurf wird abgeschafft. Ab sofort geht das Spiel direkt mit einem Einwurf des Teams weiter, welches den Korb kassiert hat.
1942 Erstmals werden Basketbälle nicht genäht, sondern in Formen gegossen. Endlich springen die Teile beim Dribbeln nicht sonst wohin, weil auf eine der dicken Nähte gedribbelt wurde …
1944 Ab sofort ist es der Verteidigung verboten, einen auf den Korb zufliegenden Ball wegzuschlagen, wenn dieser bereits den höchsten Flugpunkt überschritten hat und sich im Fallen befindet.
1960 Verlängerungen werden eingeführt und ersetzen das Sudden-Death-Format.
1967 Die American Basketball Association führt erstmals einen Dreipunktewurf ein. Die NBA übernimmt den Dreier 1977.
Frauen spielen übrigens schon 1892 zum ersten Mal Basketball. Zu verdanken ist das Senda Berenson. Sie arbeitet als Sportdozentin am Smith College in Northampton, Massachusetts, an dem nur Frauen eingeschrieben sind. Berenson liest im Magazin Physical Education über diesen neuen Sport und führt ihn als Early Adopter an ihrem College ein, weil sie denkt, er könne die körperliche Gesundheit steigern. Frauen, die mehr Ausdauer haben, würden weniger krank und hätten so bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, meint sie. Damit geht Berenson jedoch ein Risiko ein. Denn bisher gibt es keinen Teamsport für Frauen. Sie macht sich zudem Sorgen, ob ihre Studentinnen mit den Anforderungen dieses Spiels klarkommen. Nicht, dass ihre Schutzbefohlenen im Anschluss unter „nervöser Müdigkeit“ leiden, weil das ja alles so anstrengend ist. Na ja, und nicht, dass dieses Werfen auf die beiden von Berenson im Alumnae Gym angebrachten Mülleimer so etwas wie Ehrgeiz in den Frauen hervorbringt. Denn laut allgemeiner Lehrmeinung ist es einfach nicht weiblich, ehrgeizig zu sein und ein Spiel gewinnen zu wollen. Die Befürchtungen bewahrheiten sich, also abgesehen von der Sache mit der Müdigkeit …
Am 22. März 1893 organisiert Berenson nach einigen Wochen Training das erste Frauenbasketballspiel zwischen dem Freshman- und dem Sophomore-Jahrgang ihres Colleges. 800 Studentinnen sitzen in den Zuschauerrängen. Die Ehre des ersten Sprungballs übernimmt Berenson selbst. Als sie den Ball in die Höhe wirft, trifft sie allerdings den ausgestreckten Arm der Sophomore-Centerin, die sich so die Schulter auskugelt. Danach wird es nicht viel besser … „Die Mädchen spielten verrückt“, erinnert sich ein Augenzeuge in der Tageszeitung New York Herald. „Sie rannten wie aufgedreht das ganze lange Feld entlang, schlugen nach und griffen den Ball. Ein wildes Durcheinander herrschte auf der Tribüne, wo die Zuschauerinnen aus vollem Hals schrien und sie anfeuerten.“ Die Sophomores gewinnen am Ende 5:4. Es gibt kein Halten mehr. Die Fans des Siegerteams stürmen das Parkett, schwenken Fahnen, klatschen und tragen die Sieger-Kapitänin auf ihren Schultern. Schwere Verletzung noch vor dem ersten Sprungball, Platzsturm danach … Frauenbasketball begann auf jeden Fall episch! Berenson ist so erschrocken, dass sie sofort mit ihren Studentinnen Naismiths Regeln modifiziert. Das Spielfeld wird in Drittel geteilt. Jeweils drei Spielerinnen dürfen in diesen Arealen stehen, sich aber nicht von einem zum anderen bewegen. Immerhin sind bis zu drei Dribblings erlaubt, das Spielgerät darf nur bis zu drei Sekunden gehalten werden. Berensons Regeln verbreiten sich schnell in den USA, werden aber auch oft abgewandelt. Zehn Jahre später schreibt sie in ihrem Buch Basket Ball for Women: „Das große Begehren, zu gewinnen, und die Erregtheit des Spiels lassen unsere Frauen unweibliche Dinge tun.“
VON KÄFIGEN ZU ARENEN
Es dauert keine sieben Jahre, bis die erste professionelle Basketballliga in den USA gegründet wird: die National Basketball League (NBL). Eine im wahrsten Sinne sportliche Entwicklung. Erst 1897 wurde das Dribbling erfunden, der heutige Sport ist nur schemenhaft zu erkennen. Aber in den USA findet eine vermeintlich gute Geschäftsidee immer schnell jemanden, der sie umsetzt. Die Menschen finden ja Gefallen an diesem Sport, warum also nicht ein paar Dollars damit verdienen? So bilden sich im Nordosten des Landes zu dieser Zeit die ersten Profiteams. Basketballer, die zusammen an YMCAs, Schulen, Unis oder Ähnlichem spielen, geben sich Teamnamen und schließen sich in und um Philadelphia lose zusammen. Arenen gibt es so gut wie keine. Also wird überall gespielt, wo zwei Körbe aufgehängt werden und zahlende Zuschauer dem Spektakel beiwohnen können. Bald gibt es mehrere lokal operierende Ligen, die mit Ach und Krach einen Spielbetrieb organisiert bekommen. Weil es aber in den verschiedenen Lokalitäten stellenweise sehr eng ist, wird das Spielfeld mit Maschendraht eingezäunt, um das Spiel schneller zu machen und die Fans zu schützen.
Das ist auch nötig … Naismiths Ideal des körperlosen Spiels wird von den Profis nicht verfolgt. „Die ganze Nummer erinnerte mehr an einen Mixed-Martial-Arts-Wettbewerb, an dem eine Truppe kleiner Menschen teilnahm, als an modernen Basketball“, schreibt das Blogger-Kollektiv Freedarko in seinem Buch The Undisputed Guide to Pro Basketball. Wieso kleine Menschen? Zu dieser Zeit werden lange Spieler nur beim Sprungball nach einem Korb eingesetzt. In der Regel sind wenige Akteure über 1,80 m lang. Die damalige Presse nennt sie nach dem Quasikäfig, in dem sie antreten, verächtlich Cagers. „Nach einer Partie konntest du auf jedem von uns Tic-Tac-Toe spielen“, erinnert sich Joel Gotthoffer in When Basketball was Jewish. „Der Zaun zeichnete sich überall auf der Haut ab. Wenn du den Ball nicht schnell weitergepasst hast, warst du in Lebensgefahr.“ Während an den US-Colleges Naismiths Regeln die Grundlage bilden, operieren die Profis bis in die 1920er-Jahre hinein unter der Prämisse „Gewalt ist nicht so schlimm“. Die Spiele erinnern zwischen den Korbwürfen stellenweise sehr an Rugby oder American Football. Dribbler rennen in die Verteidiger rein und rammen sie aus dem Weg. Nicht selten nutzen Angreifer die heute eher verpönte Taktik der vehementen Kopfnuss, um sich den Weg zum Korb zu bahnen. In einer Halle in Nanticoke, Pennsylvania, nutzen die Cagers gern eine lokale Besonderheit, um sich einen Vorteil zu verschaffen: glühend heiße Rohre, in denen Wasserdampf transportiert wird. Gegen die checken sie die Gegner ohne Reue, wie Robert Peterson in seinem Buch Cages to Jump Shots beschreibt.
1925 ist es dann so weit: Mit der American Basketball League (ABL) geht erstmals eine Liga an den Start, die den Namen verdient. Im Nordosten der USA treten von Boston bis Chicago neun Teams gegeneinander an. Es gibt erstmals Spielerverträge, die die Akteure exklusiv an eine Mannschaft binden. Finanziell läuft es über Jahre erstaunlich gut und auch auf dem Feld funktioniert die ABL. Die Verantwortlichen verbieten die Käfige und das erneute Dribbeln nach Aufnehmen des Balles. Wer allzu brutal agiert, wird heftig zur Kasse gebeten. Wie Freedarko in The Undisputed Guide to Pro Basketball beschreibt, ändert sich jetzt auch der Spielstil. Durch die Ankunft von immer mehr ehemaligen College-Basketballern bei den Profis hält das mannschaftsdienliche Spiel Einzug. Es wird mehr gepasst und sich ohne Ball bewegt, in der Manndeckung wird das Wechseln des Gegenspielers (Switching) eingeführt, sogar die ersten Spielzüge (vor allem nach Einwürfen) werden gelaufen. Warum die ABL dennoch 1931 den Spielbetrieb für zwei Saisons einstellen musste und danach nicht mehr so richtig auf die Beine kam? Geld. Die Weltwirtschaftskrise der frühen 1930er-Jahre wird ihr zum Verhängnis.
1935 wird die ABL von der MBC beerbt, der Midwestern Basketball Conference. Ebendiese benennt sich bereits 1937 in National Basketball League um. Das Zentrum der neuen NBL befindet sich im American Heartland, dem mittleren Westen der USA. Gleich drei Teams spielen in Indiana, dem bis heute basketballverrücktesten Bundesstaat. Indiana und Basketball ist wie Fußball und Brasilien, nur mit viel weniger Rhythmusgefühl. Tausende Zuschauer finden sich selbst bei Highschool-Spielen ein, College-Basketball ist bis heute eine Religion im Hoosier State. Die NBL-Mannschaften sind zum Teil privat finanzierte Clubs, zum Teil Werksteams. Die Firmen General Electric, Firestone und Goodyear sind alle rund um die Great Lakes angesiedelt; sie bieten ihren Spielern oft Jobs, damit sie für sie auf Korbjagd gehen. Natürlich spiegelt sich das auch in den Namen der Teams wider: Akron Firestone Non-Skids (Reifen), Chicago Studebaker Flyers (Autos), Toledo Jeeps (nun … Jeeps) oder die Fort Wayne Zollner Pistons (Motorkolben) tragen allesamt den Geldgeber oder die Produkte desselbigen im Namen. Der Spielbetrieb ist indes eher wild organisiert. Das Heimteam entscheidet, ob in vier Vierteln à zehn Minuten oder drei Dritteln von je 15 Minuten gespielt wird. Einen Spielplan gibt es zu Beginn nicht. Jeder Club muss in Eigenregie mindestens zehn Partien absolvieren, vier davon auswärts. Über die Jahre steigern die Teams die Anzahl der Partien, denn die Leute wollen das. Die Hallen füllen sich und fassen je nach Location 900 bis 15 000 Fans. Kein Wunder – durch die Abschaffung des Sprungballs nach jedem Korb wird das Spiel schneller. Plötzlich sind auch lange Spieler gefragt, sie rebounden am gegnerischen Korb und legen den Ball gern direkt wieder in den Ring. Das gefällt jedoch längst nicht jedem. In Cages to Jump Shots berichtet Robert Peterson davon, dass diese neumodischen Ideen Basketballveteranen sauer aufstoßen. Sie fordern höhere Körbe und ein Verbot der Bretter hinter dem Ring. Ohne Offensiv-Rebounds würde das Spiel groß gewachsene Akteure nicht mehr bevorteilen, argumentieren sie. Zur gleichen Zeit findet eine weitere Neuerung Einzug in den Sport, die heute nicht wegzudenken ist: der Sprungwurf.
Wer wirklich der erste Mensch ist, der zu dem Schluss kommt, dass aus dem Stand zu werfen einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weiß niemand. Der bekannteste Pionier dieser revolutionären Technik ist jedoch ein Star seiner Zeit. Kenny Sailors erinnert sich, dass er erstmals auf der elterlichen Farm südlich von Hillsdale, Wyoming, 1934 beim Spielen mit seinem älteren Bruder Bud abhebt. Bud ist 1,96 m lang, Kenny 13 Jahre alt und so weit von einer Bosstransformation entfernt wie die Erde vom Mond – Jahre später, am College, wird er gerade mal 1,78 m groß sein. Immer und immer wieder blockt sein Bruder Kennys Würfe. Also versucht er es anders. Er springt hoch und wirft mit einer Hand. „Ich kann mich nicht daran erinnern, ob der Wurf reinging oder nicht“, erklärt er Jahrzehnte später gegenüber der Sports Illustrated. Wohl aber daran, dass sein Bruder ihm sagt: „Das ist ein guter Wurf, daran solltest du arbeiten.“ Das tut er. Sailors perfektioniert seine Erfindung auf dem Lehmboden der Farm, indem er auf ein zu einem Ring gebogenes Rohr wirft. „Als ich anfing den Sprungwurf zu nutzen, merkte ich, dass ich gegen jeden Gegner werfen konnte“, sagte Sailors einmal. „Das hat mir jedes Mal geholfen, wenn ich gegen einen 1,95-Meter-Mann antreten musste, der mir Probleme bereitete.“
Und wie er das tat … Am College von Wyoming gewinnt Sailors für seine Uni den bis heute einzigen Titel. Beim Finalturnier 1943 wird er zum „Most Outstanding Player“ gewählt – also zum besten Spieler. Sailors wirft allerdings nicht nur in der Luft, sein Spielstil ist wild und schnell. Er attackiert mit dem Dribbling und geht aus vollem Lauf zum Schuss hoch. „Sein Wurf sieht aus, wie ein Sprungwurf von Russell Westbrook heute“, beschreibt es Dirk Nowitzki in der Doku Jump Shot: The Kenny Sailors Story.





























