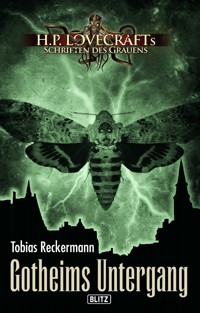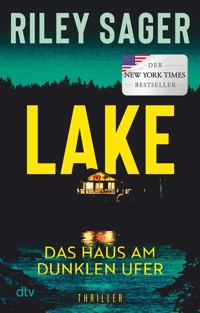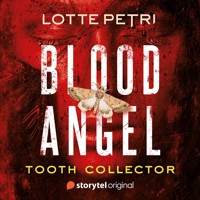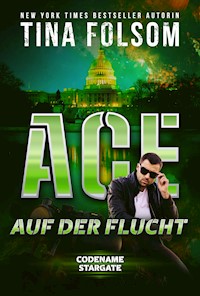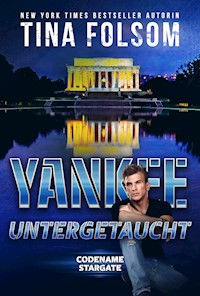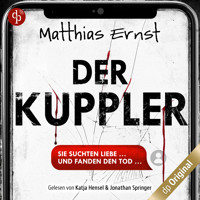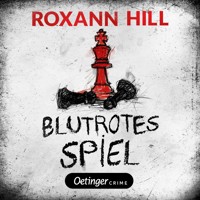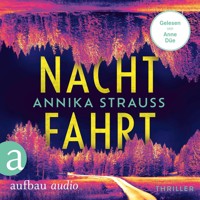Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lovecrafts Schriften des Grauens
- Sprache: Deutsch
Verborgene Bibliotheken mit versteckten Büchern, Steintafeln und Manuskripten, gefährliche Notizhefte und eine Geschichte, die sich gegen ihre Auslöschung wehrt. Wer sich auf den Weg macht, unaussprechliche Geheimnisse zu ergründen, sollte seinen Verstand in Neopren hüllen, denn es geht abwärts, bis das Wasser am Hals steht und Feuchtigkeit aus der Wahrheit geatmet werden muss. Vorsicht ist geboten. Unterwegs könnte man sich selbst abhandenkommen, von bösen Drillingen in die Irre geführt werden oder der wirkmächtigen Ziegenmilch Shub-Nigguraths erliegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen:
2101 William Meikle Das Amulett
2102 Roman Sander (Hrsg.) Götter des Grauens
2103 Andreas Ackermann Das Mysterium dunkler Träume
2104 Jörg Kleudgen & Uwe Voehl Stolzenstein
2105 Andreas Zwengel Kinder des Yig
2106 W. H. Pugmire Der dunkle Fremde
2107 Tobias Reckermann Gotheim an der Ur
2108 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Xulhu
2109 Rainer Zuch Planet des dunklen Horizonts
2110 K. R. Sanders & Jörg Kleudgen Die Klinge von Umao Mo
2111 Arthur Gordon Wolf Mr. Munchkin
2112 Arthur Gordon Wolf Red Meadows
2113 Tobias Reckermann Rückkehr nach Gotheim
2114 Erik R. Andara Hinaus durch die zweite Tür
2115 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo
2116 Adam Hülseweh Das Vexyr von Vettseiffen
2117 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 2
2118 Alfred Wallon Salzburger Albträume
2119 Arno Thewlis Der Gott des Krieges
2120 Ian Delacroix Catacomb Kittens
2121 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 3
2122 Tobias Reckermann Gotheims Untergang
2123 Michael Buttler Schatten über Hamburg
2124 Andreas Zwengel Finsternacht
2125 Silke Brandt (Hrsg.) Feuersignale
2126 Markus K. Korb Treibgut
2127 Tobias Reckermann (Hrsg.) Drommetenrot
2128 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 4
2129 Peter Stohl Das Hexenhaus in Arkheim
2130 Silke Brandt (Hrsg.) Das Kriegspferd
2131 Anton Serkalow Berge des Verderbens
2132 Klaus-Peter Walter Sherlock Holmes gegen Cthulhu
2133 T. E. Grau Diese alten und dreckigen Götter
2134 Anton Serkalow Träume im Heckenhaus
2135 Michael Buttler Die Astronautenvilla
2136 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 5
2137 Anton Serkalow Das Fest
2138 Julia A. Jorges Hochmoor
2139Manuela Schneider Unbekannter Feind
2140 Jörg Kleudgen & Uwe Voehl Halligspuk
2141 Anton Serkalow Die Aussenseiter
2142 Jörg Kleudgen & Uwe Voehl Halligspuk
2143 Tobias Reckermann (Hrsg.) Kryptologicae
2144 Michael Blihall Die Brücke
Kryptologicae
Ein Novellenkreis des Teams Feuerernte
H. P. Lovecrafts Schriften des Grauens
Buch 42
Tobias Reckermann
Felix Woitkowski
Christian Veit Eschenfelder
Ina Elbracht
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
© 2024 Blitz Verlag
Ein Unternehmen der SilberScore Beteiligungs GmbH
Mühlsteig 10 • A-6633 Biberwier
Redaktion: Danny Winter
Titelbild: Mario Heyer unter Verwendung der KI Software Midjourney
Logo: Mark Freier
Vignette: Jörg Kleudgen
Satz: Gero Reimer
2142 vom 02.08.2024
ISBN: 978-3-689-84053-2
Inhalt
Der geheime Katalog
Tobias Reckermann
Collektivsingularis
Felix Woitkowski
Calibans Stimme
Christian Veit Eschenfelder
XVII / 121
LXVI / 121
CIII / 121
CIII / 121
LIV / 121
LXVI / 121
CIII / 121
XVIII / 121
LXVI / 121
XVIII, LXVI / 121
XVIII, LXVI / 121
LXVI / 121
LXVI / 121
LXVI / 121
LIV / 121
LXVI / 121
LXVI / 121
LXVI / 121
LXVI / 121
LXVI / 121
Die sieben Mysterien des Voynich-Manuskripts endlich gelöst: wer es schrieb und was es bedeutet, kein Scheiß! Der letzte Plot-Twist wird dich umhauen!
Ina Elbracht
Vorbemerkung
Das Tuch
Geht es später noch in den Club oder eskaliert man heute hier?
Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen, Exodus 22,17
Die Darstellung der Frauen im Voynich-Manuskript hat nichts Obszönes oder Voyeuristisches an sich!
Dreifaltigkeit
Der Schlüssel zum Begreifen des Manuskripts ist der Bewusstseinszustand!
Sieben Mysterien, na von wegen!
Über den Autor
Der geheime Katalog
Tobias Reckermann
„A rose is a rose is a rose.“
– Gertrude Stein
Seit meinem ersten Besuch in einer Leihbücherei, noch bevor ich lesen konnte, habe ich Bibliotheken geliebt. Vielleicht weil mich Kulturwüsten aus Beton und Leuchtreklamen einerseits damals schon in Beklemmung versetzten und mir andererseits die freie Natur schon immer irgendwie trostlos erschien, auf eigene Weise bedrückend. Orte an denen es Bücher gab – viele Bücher zumal – waren etwas ganz anderes, eine Art dritter Orte, und an diesen konnte ich frei atmen. Bibliotheken begeisterten mich noch mehr als Buchläden. Ich habe sehr viele besucht, ein halbes Leben in ihnen verbracht, und wenn zeit meines Lebens eine Bibliothek niederbrannte, habe ich heiße Tränen vergossen.
Am meisten Zeit verbrachte ich während meines Studiums in der Universitäts- und Landesbibliothek meiner Stadt, im zweiten Stockwerk des nach dem Krieg neuerbauten Schlosses, und den damals noch in anderen Gebäuden untergebrachten Institutsbibliotheken meiner Hauptfächer. Ich erinnere mich an die Einführungstage meines ersten Semesters, und wie unsere Tutoren uns auf Schnitzeljagd von einem zum anderen Büchersaal scheuchten, um uns die Räumlichkeiten, die Bestände und Katalogsysteme – die damals noch auf Karteikarten verzeichnet waren – kennenlernen zu lassen. Auch daran, wie groß meine Ehrfurcht vor alledem war, und wie sehr ich schon bald darauf die Beschränktheit der Bestände verfluchen sollte. Immer waren gerade diejenigen Bücher, die ich für meine Hausarbeiten brauchte, nicht vorhanden, existierte von ihnen nur ein Exemplar in der Stadt und war dieses bereits verliehen oder unauffindbar. Je weiter ich im Studium voranschritt und je spezieller sich mein Fachgebiet gestaltete, desto häufiger wurden mir diese Grenzen bewusst, die mich zwangen, über sie hinaus auf Fernleihen zurückzugreifen. Bis dahin hatte ich allerdings auch alle übrigen Illusionen aufgegeben, die, bevor ich seiner Realität ausgesetzt wurde, meine Vorstellung von einem Universitätsstudium ausgemacht hatten. Ja, ich war wohl ein Träumer, und bin es vielleicht noch, schließlich ist der Prozess des Erwachens ein ewiger. Tür um Tür öffnet sich die Wahrheit dir, und ihre Flucht ist wie jene einander gegenübergestellter Spiegelwelten endlos.
Ich arbeitete mich in Regionen vor, in die mir die wenigsten meiner Kommiliton*innen folgen wollten, und auch die wenigsten der Professor*innen. Erzähltheorie und Fiktionsforschung bewegen sich im Grenzgebiet zwischen Literaturwissenschaft und Philosophie und in diesem Feld kreisten meine Gedanken täglich um Theorien der Intertextualität und verschiedener, möglicher und geteilter Welten. Es ist nicht Physik oder Astrophysik und schon gar nicht Mathematik, aber Spekulationen über Parallelwelten blühen auf verschiedenen Zweigen der Wissenschaft. Verglichen mit einem Quantenphysiker oder Wurmlochexperten, der sich mit möglichen Durchgängen zwischen Universen beschäftigen mag, waren meine Studien sicherlich nicht streng zu nennen, und doch gibt es auch in meinem Spezialgebiet eine gewisse Strenge, der man sich freiwillig unterwirft. Zum Beispiel gewöhnte ich mir mit Fleiß und Disziplin an, jede alltägliche Beobachtung als ein Zufallbringen einer Wellenfront zu betrachten, durch das aus einem Schaum möglicher Zustände erst ein konkretes Ereignis erschaffen wird. Der Möglichkeit nach war etwa ein bestimmtes Buch, das ich lesen musste, im Regal meiner Institutsbibliothek sowohl vorhanden als auch abhanden, und erst wenn ich hinschaute, entschied sich die Realität für den einen oder anderen Zustand. Ich hätte folglich auf spontane Veränderungen im Wirklichkeitsgefüge vorbereitet sein sollen. Doch war ich es nicht. Einmal saß ich einen halben Vormittag an meinem Lesetisch und versuchte, aus dem wenigen, das ich zur Hand hatte, etwas zu machen, solange ich auf eine Zusendung weiterer Materialien aus einer anderen Stadt zu warten hatte. Schließlich legte ich eine Pause ein, ging einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen, und als ich zurückkam, lag an meinem Platz im Lesesaal obenauf eben jenes Buch, das ich im Bestand nicht hatte finden können. Es handelte sich um einen Band mit Beiträgen von Dolezel, Walton, Kristeva, Martinez und anderen. Mir erschien dieses unverhoffte und für unmöglich gehaltene Auftauchen wie aus dem Nichts zugleich wie ein Scherz und ein DejaVu. Ich zweifelte vor allem an mir selbst. Ich schaute mich um und mein Blick begegnete dem eines Kommilitonen, der mich offen grinsend über den Rand seiner eigenen Lektüre hinweg ansah. Wir kannten uns seit meinem ersten Semester. Er gehörte zum Inventar der Institutsbibliothek, arbeitete dort länger als irgendjemand sonst, den ich kannte. Ich nahm das Buch auf und ging hinüber, legte den Band vor ihn auf den Tisch und hob fragend die Brauen. Man konnte Axel gut für einen Schauspieler halten, für einen Narren, einen Künstler, einen Popstar, und im engen Rahmen unserer Stadt war er all dies zusammen. Nicht gänzlich von seiner Ernsthaftigkeit als Person überzeugt, meinte ich, hier einem Streich aufgesessen zu sein. Und wie sich herausstellte, war ich damit der Wahrheit am nächsten, wenn auch nicht auf den Punkt genau. „Das brauchst du“, gab Axel knapp wie bei der Übergabe eines Spintschlüssels bekannt und widmete sich dann wieder dem Inhalt seiner Lektüre.
War ich der Willkür eines Pförtners ausgeliefert? Dessen Wohlwollen oder Missgunst, die über den Pfad meines Schicksals entschieden? Oh ja. Vielleicht zahlten sich nun die vielen kleinen Gespräche aus, die wir in den Jahren miteinander geführt hatten. Das Plaudern über dies und jenes. Nette Worte, gegenseitig bezeugter Respekt. Wenn man wie ich studiert, und sich vom ersten Tag an in das Unterreich alles Abseitigen verliert, streift man den Universitätsbetrieb und die Mehrheit der Studierenden nurmehr, anstatt wirklich Teil davon zu sein. Man wandelt auf vernachlässigten Pfaden und merkt mitunter erst viel zu spät, dass man sich im Dickicht selbst verliert. Bis dahin hätte ich nicht zu sagen gewusst, ob ein Abschluss meines Studiums in erreichbarer Nähe oder in astronomischer Ferne lag. Ich kreiste um mögliche Wahrheiten, mögliche Fehlschlüsse und Illusionen, und die ich auf meinen Wegen traf, waren ebenso wenig Herr ihrer Entscheidungen wie ich selbst. Doch das änderte sich nun.
Axel erzählte mir bei einem Treffen am darauffolgenden Tag, die Sache sei sowohl aus Not wie tatsächlich aus einem Scherz entstanden. Zusammen mit zwei anderen studentischen Hilfskräften in einer weiteren Institutsbibliothek sowie der eigentlichen Universitätsbibliothek habe er vor Jahren damit begonnen, zu abseitigen Spezialgebieten gehörende Bücher, die nur das Interesse der Wenigsten weckten und von denen in der ganzen Stadt jeweils nur ein Exemplar existierte, zu verschieben. „Mir ging es“, sagte er, „am Anfang wie dir.“ Alle außer den Standardwerken schienen immer dann verliehen zu sein, wenn er sie brauchte. Und oft genug wurden Bücher nie zurückgegeben oder blieben, obwohl sie da sein sollten, verschollen. Also verabredete er sich mit den beiden Freunden, genau diese Bücher, sobald sie zurückgegeben wurden oder nachbestellt waren, beiseitezulegen, und sie nach einem eigenen geheimen Katalogsystem im Bestand der Bibliothek unterzubringen. „Über die Jahre haben wir sie alle zur Seite geschafft.“ Mit diesen Worten grinste er mich auf seine schelmische Weise an, die bei aller vordergründigen Narretei von wahrer innerer Befriedigung sprach.
Ich schaute ihn entgeistert an, fassungslos, um genau zu sein, und versuchte herauszufinden, ob er mich zum Narren hielt. Da war ich, im siebten Semester, und hatte mich so oft über die Bestände geärgert. Ich hätte ihn an den Ohren packen und schütteln können. Was er mir erzählte, war so unglaublich dreist und verstieß sicher gegen jeden Ehrenkodex im Bibliothekswesen, außerdem hatte es mich zu viele Nerven gekostet, um jetzt nicht laut herauszubrüllen, dass ich ihn für ein Arschloch hielt. Doch ich hielt mich zurück. Ich stand an der Schwelle, und ich war ihm tatsächlich auf gewisse Weise ausgeliefert. „Ich biete dir die rote Pille an“, gab Axel zu verstehen, was typisch für ihn war. Er widmete sich mit großer Vorliebe dem Thema Mindfuck in der Literatur und beabsichtigte, seine Magisterarbeit darüber zu schreiben. Um mich zu beruhigen, atmete ich mehrmals tief durch. Mein Herz klopfte laut. Dann brachte ich hervor, dass ich natürlich bereit sei, in sein Kaninchenloch zu kriechen.
Wir trafen uns am Abend in einer Studentenkneipe. Mit Axel erschienen auch die anderen beiden Mitverschwörer, Jan und Christian. Ich kannte die beiden. Sie und Axel waren im selben Alter, ein paar Jahre älter als ich, und lebten zusammen in einer Wohngemeinschaft. Jan wirkte auf mich immer etwas neben der Spur, er war immerzu mit irgendwelchen intellektuell-kreativen Projekten beschäftigt, von denen er auf eine Weise berichtete, die zumindest bei mir stets mehr Fragen aufwarf, die zu beantworten er nicht fähig schien, ohne sich in seinen Erklärungen zu verstricken, ihren Faden zu verlieren, um einen anderen, gerade wie zufällig sich anbietenden aufzunehmen. Christian hingegen kontrastierte Jans Wirrnis mit einem Eindruck von Kontrolliertheit bis hin zur Strenge, was sich allein schon in seinem gepflegten Aktenkoffer ausdrückte, in dem – ganz im Gegensatz zu Jans Army-Rucksack – alles seine Ordnung zu haben schien. Axel trug wie immer seine Umhängetasche bei sich, und als ich mich zu ihnen an den Tisch setzte, klopfte er theatralisch darauf und flüsterte mir zu: „Hier ist der Katalog, frisch für dich kopiert.“ Axel arbeitete neben dem Bibliotheksjob auch in einem Copyshop. Unwillkürlich schaute ich mich um, so als könnte uns jemand belauschen oder bei der Übergabe geheimer Dokumente beobachten. Die anderen beiden am Tisch fingen zu lachen an. Nur Axel ließ sich nicht aus der Rolle bringen. Er war ganz Geheimagent, oder, wie ich später dachte, Großmeister seines Geheimordens, seiner Bruderschaft. Er reichte mir die kopierten Seiten über den Tisch und ich fing gewohnheitsmäßig sofort an, sie zu überfliegen. Da waren sie tatsächlich. Schon auf den ersten Blick. All die Bücher, die ich in den vergangenen Jahren gebraucht und nur über Fernleihe bekommen hatte. Ein Band zur Rhetorik im Barock, zwei Bücher zum Nonsens, Waltons Mimesis As Make-Believe, Dolezels Heterocosmica, Vaihingers Buch über den Fiktionalismus. Nun würde alles besser werden. Natürlich war an Fernleihe nichts Falsches. Es ging schnell. Nur störte es gewaltig die Immersion, mein Eintauchen in den Kosmos des Wissens, wenn ich auch nur einen Tag auf ein Buch warten musste und vor allem, wenn ich davor erfolglos am angegebenen Ort in der Bibliothek suchte, nicht fand, was laut Katalog hätte vorhanden sein müssen. Als nächstes vielen mir die Signaturen zu den einzelnen Titeln auf. Jedes Buch in der Bibliothek trägt eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die seine thematische Zuordnung und seinen Standort bezeichnet. Die Buchstaben und Zahlen im Ausdruck ergaben jedoch keinen Sinn. Schon ein Blick genügte meinem geübten Auge, um zu sehen, dass sie mich nirgendwo hinführen würden, nicht, wenn ich dem offiziellen Katalogsystem der Universitätsbibliothek folgte. Offensichtlich fehlte hierzu ein Schlüssel. Mein Mund wurde wässrig. Diese seltsame und haarsträubende Geschichte hatte es geschafft, mich in ihren Bann zu ziehen.
Die Vorstellung einer zweiten, geheimem Bibliothek, egal wie klein an Umfang, die sich in der offiziellen versteckte und außer durch bloßen Zufall keinem Uneingeweihten zugänglich war, war ebenso spitzbübisch wie verführerisch. Natürlich fielen mir auch die diversen intertextuellen und metaphorischen Bezüge daran auf. Es fiel zumindest leicht, sich Axel als einen Casaubon oder Jacopo Belbo vorzustellen, der sich in sein eigenes intellektuelles Spiel verstrickte, und die Bibliothek – wenn auch dies mit etwas mehr Fantasie – als die eines gewissen Benediktinerklosters im mittelalterlichen Appenin.
Ich bemerkte, dass Jan und Christian etwas zurückhielten und glaubte zunächst, es handle sich dabei um den Schlüssel, ihren Code, mit dem es mir möglich wäre, nach ihrem System Bücher ausfindig zu machen. Sie wirkten angespannt, schauten zu Axel, der wiederum sie beide ansah, als ob sie drei sich zuerst gegenseitig versichern mussten, dass ich vertrauenswürdig – oder überhaupt würdig – war. Doch da war noch mehr. Mich fröstelte, als ich begriff, dass in ihren Augen Furcht zu lesen war. Der Moment ging vorüber, und sie traten in stillem Einvernehmen von der Entscheidung zurück. Ihre Blicke klärten sich und Jan schob mir mit verhalten feierlicher Geste einen kleineren Zettel von einem Abreißblock zu, auf dem in Blockbuchstaben ein lächerlich einfaches Tauschsystem erklärt war. Zahlen im Originalregister waren demnach mit Buchstaben, und Buchstaben mit Zahlen ersetzt. Ich musste wirklich darüber lachen, wie einfach es war, und zugleich so effektiv.
Danach wurde für eine Weile wirklich alles besser. Alle Bücher, die ich für meine letzten Arbeiten brauchte, waren verfügbar, sofort, und ich ging bald daran, meine Magisterarbeit vorzubereiten. In jenem Sommer war es unerträglich heiß. Ich wohnte im flachen Teil der Stadt, wo sich die Luft nicht bewegte, mit einem Höhlenmenschen von einem Mitbewohner zusammen, also verbrachte ich noch mehr Zeit in der Bibliothek als üblich. Den Verschwörern begegnete ich nun auf Augenhöhe, war praktisch einer von ihnen. Die Bücher aus dem Geheimkatalog lieh ich immer bei ihnen aus, ja sie bestanden darauf, die Ausleihe und Rückgabe sogar zu verzeichnen. Ohne sie wäre es allerdings schwierig geworden, die Bände aus den Gebäuden herauszubringen.
Ich verbrachte einen ganzen Nachmittag schwitzend in der Bibliothek für Geschichte mit Jan, der mir von seinen Plänen für eine Show im Studentenclub Schlosskeller erzählte. Ich wurde nicht schlau daraus, aber wir hatten Spaß und kamen uns näher. Seine Art zu denken war für mich eine Herausforderung geworden. Im Vergleich zu ihm war Axel geradezu ein Rationalist, auch wenn er gerne intuitive Abkürzungen nahm, waren sie immer nachvollziehbar. Jan hingegen hastete seinen schriftstellerischen Ambitionen hinterher wie ein Messie, der alles aufliest und nichts wegwerfen kann. Sein Gehirn schien wie eine Black Box höchstens einmal zufällig auszuwerfen, wonach er gerade suchte, lieferte aber immer etwas Interessantes, wenn auch völlig Unerwartetes, und man konnte ihm bei seinen Hasensprüngen lange Zeit amüsiert folgen, bis man schließlich merkte, dass man selbst den Zusammenhang verlor und – wie ich – davon Kopfschmerzen bekam.
Bei den Germanisten saß Christian hinter der Ausleihe. Er war völlig anders als Jan und Axel immer distanziert, manchmal fast unfreundlich, eher wie ein Beamter oder sonst ein Bürokrat, der nur unverhofft dann und wann einen trockenen Witz rauslässt, und ich empfand ihn als arrogant. Die anderen beiden sprachen auf meine zuweilen abwegigen und immer randständigen Theorien zumeist interessiert, manchmal auch begeistert an, wohingegen er halb belustigt und halb gelangweilt reagierte, was mich verunsicherte. Erst nach einer Weile fing ich an dahinterzukommen, dass er zu allen so war, auch zu seinen Mitbewohnern, die sich allerdings nicht daran zu stören schienen. Vielleicht schätzte ich ihn falsch ein. Jedenfalls interessierte er mich und wenn auch womöglich nur deshalb, weil er Teil des Spiels war und seine Teilnahme vermuten ließ, dass da hinter seiner Fassade noch mehr sein musste.
Doch dann, am Ende des Sommers, verschwand Christian. Zuerst bekam ich das nicht mit, nur, dass sowohl Jan als auch Axel sich ungewöhnlich verhielten. Sie wirkten beide nervös, furchtsam, und warfen heimliche Blicke um sich. Ich sprach Axel darauf an, was los sei, und er erzählte es mir. Zwei Wochen zuvor hatten sie bemerkt, dass er seit Tagen nicht in der Gemeinschaftsküche gewesen, ihnen nicht im Flur oder Treppenhaus begegnet war, und dass aus seinem Zimmer keine Geräusche kamen.
„Vielleicht ist er für ein paar Tage weggefahren?“, fragte ich leichthin. Doch Axel schüttelte den Kopf. „Das hätte er uns gesagt. Da bin ich mir sicher.“
Ich fand mich in ihrer Wohngemeinschaft ein und gemeinsam öffneten wir die Tür zu Christians Zimmer. Christian war nicht da. Das Bett war nicht gemacht. Auf dem Boden lagen Klamotten. Mir erschien es nicht zu seiner Person zu passen, dass er seine Dinge für mehr als einen Tag in Unordnung hinterlassen sollte. Christian gehörte zu der Sorte Studenten, die rein dem Äußeren nach ebenso Maschinenbau oder Recht wie Philosophie oder Soziologie studieren mögen. Ganz im Gegensatz zu Axels Hippiemäßigkeit mit den Dreadlocks und exotischen Wohfühlhosen oder Jans Skaterlook in Cargos, Hoodie und Chucks traf man Christian stets in Hemd und Sportjacket und mit einem ordentlichen Haarschnitt an. Sein Zimmer indes war an den Wänden bis unter die Decke mit Büchern ausgekleidet. Selbst über dem Bett und dem einzelnen Fenster zur Straße hinaus verliefen Regalbretter auf Wandhaken von IKEA.
„So ist es seitdem wir vor einer Woche zuerst reingeschaut haben“, sagte Jan, der in der Tür lehnte. Axel, der mit mir eingetreten war, sah betroffen drein, Beide wussten offensichtlich nicht, was mit der Situation anzufangen war, und ich fragte mich, ob sie mich tatsächlich als mehr von dieser Welt einschätzten als sich selbst. Wenn sie nicht wussten, was nun zu tun war, woher sollte ich es wissen? Ich murmelte etwas von Polizei, dann kam mir der Gedanke, man sollte womöglich zuerst jemanden aus Christians Familie nach seinem Verbleib fragen, doch Axel und Jan, die bei der Erwähnung des Worts Polizei schon weit die Augen aufgerissen hatten, versicherten, dass sie keine Ahnung davon hatten, wie man Christians Familie erreichen sollte. „Wir haben immer nur über Filme und Bücher und über das Studium gesprochen“, meinte Jan. Axel nickte und ergänzte: „Und über den Katalog.“ Also lag doch die Aufgabe einer Vermisstenanzeige am nächsten. Einzig eine Durchsuchung von Christians Sachen kam noch in Frage, doch mit der Aussicht auf eine kriminaltechnische Behandlung des Raums drückten wir uns nur etwas verschämt herum. Dabei fiel mir immerhin ein schwarzes und stark abgegriffenes Notizbuch auf dem Schreibtisch auf. Ich deutete darauf und hob fragend den Blick zu Axel. Ihm trat Schweiß auf die Stirn. Gedanken schienen sich dahinter zu überschlagen, die sich förmlich wie auf einem Bildschirm davon ablesen ließen. Was, wenn darin etwas über den Geheimkatalog stand? War das strafrechtlich relevant? Bevor man Polizisten in die Wohnung ließ, musste man da sicher gehen. Ich klemmte mir das Notizbuch unter den Arm und drängte mich an den beiden vorbei in die Küche. In einer eiligen Krisensitzung überflogen wir die ersten Seiten des Journals, stellten fest, dass es private Aufzeichnungen enthielt und in der hinteren Hälfte zumindest mehrere Einträge von Signaturen aus dem Katalog, also nahm ich es mit zu mir nach Hause, während Christians Mitbewohner sich darüber einig zu werden versuchten, wer nun den Notruf tätigen sollte.
In den darauffolgenden Tagen hielt ich Abstand zu den Verschwörern und so erfuhr ich erst eine Weile später, dass sie am Ende wirklich die Vermisstenanzeige aufgegeben hatten und einige Tage darauf auch tatsächlich ein Ermittler sie in ihrer Wohngemeinschaft aufgesucht und sich das Zimmer angesehen hatte. Mehr wussten auch Jan und Axel nicht. Wir gingen uns dann wieder aus dem Weg. Nach etwa einem Monat dann stand fest, dass Christian wirklich verschwunden war, dass auch seine Familie nichts über seinen Verbleib wusste, dass die Polizei schließlich keinen Verdacht gegen seine Mitbewohner zu hegen schien. Es kommt wohl eben vor, dass Studierende einfach verschwinden. Manchmal tauchen sie für eine Weile unter und dann irgendwann wieder auf. Manchmal sind sie auch für immer weg.
Es blieb die Frage, was nun mit Christians Zimmer geschehen sollte. Die Wohngemeinschaft brauchte dringend einen Nachmieter und da meine eigene Wohnsituation mit dem Höhlenmenschen mir schon lange sehr an die Nieren ging, zog ich selbst in die WG ein. Ich bekam sogar Christians Job an der Institutsbibliothek für Germanistik. Ich behielt auch seine Bücher, änderte an sich nichts an dem Zimmer, außer, dass ich meine eigenen Bücher und den wenigen sonstigen Kram, den ich besaß, noch dazustellte. Während der ganzen Zeit, seitdem ich das Journal besaß, hatte ich kaum mehr damit angefangen, als die ersten und die letzten paar Seiten durchzusehen, um sicherzugehen, dass daraus nichts über Christians Verschwinden zu ermitteln war. Erst jetzt begann ich es ernsthaft zu studieren, und was mir zuvor als unwichtig und recht zusammenhanglos erschienen war, fügte sich nun auf eine beunruhigende Weise zu einem Sinn.
Ich nahm es überall mit hin, natürlich in die Bibliothek, aber auch ins Café, auf Zugfahrten, sogar auf Toilette, um mich von der Magisterarbeit abzulenken, und es bot mehr als nur einfache Lektüre. Die Handschrift war abschnittsweise kaum zu entschlüsseln, auch immer wieder von Code durchsetzt, von persönlichen Abkürzungen, einer Kurzschrift ähnlich, und so sehr von offensichtlichen Stimmungsschwankungen mitgenommen, dass ich bisweilen glauben konnte, ich hätte es mit mehreren Verfassern zu tun. Die Eingangsseiten enthielten Fließtext in Prosa, in dem sich Christian über seine derzeitige Beziehung zu einer Kommilitonin verbreitete. Einmal davon überzeugt, dass sich der Text rein ins Private verortete, überging ich so viel davon wie möglich, ohne einen Themenwechsel zu übersehen. Auf Seite zehn brach der Gedankenfluss ab, und wurde von erratischen Kurzeinträgen abgelöst, die lose Gedanken verzeichneten. Etwas über Christians Bruder, der in Hamburg lebte, der ausgehöhlte Zustand des Kühlschranks, die Eigenart eines Autors, der seine Protagonisten ohne Hinweis an den Lesenden wechselte. Es folgten eine Mitschrift einer Vorlesung über narrative Strategie, Notizen eines Seminars über modale Logik, schließlich mehr und mehr Studieninhalte, in die sich Privates mischte und irgendwann im weiteren Verlauf Fetzen von Gesprächen, die Christian sichtlich kursiv geschrieben hatte. Mir sagten die Inhalte wenig und ich überflog einige Seiten, dann stieß ich auf ein Wort, dass mich erst innehalten und dann zurückblättern ließ. Bis hierhin hatte ich den Eindruck, dass die ersten Einträge viele Jahre alt und die folgenden sporadisch über die nächsten Jahre entstanden sein mussten. Der Anfang war einem Tagebuch treu vielleicht täglich oder zumindest in kurzen Abständen verfasst worden, doch danach musste Christian es lange Zeiten über liegengelassen haben und als sein Studium ihn zu fordern begann, war es weniger Tagebuch als Sammelsurium von Gedanken und Notizen geworden. In etwa in der Mitte fand sich nun dieser Seitenlange Eintrag, der mir das wiederkehrende Wort Bibliothek förmlich entgegenschrie. Christians Schrift war schnell und wie im Fieber aufs Papier geworfen, in Teilen kaum lesbar, so als hätte der Verfasser seinen eigenen Gedanken hinterhergejagt, um keinen von ihnen davonkommen zu lassen, bevor er ihn nicht wenigstens in Grundzügen notiert hatte. Auf einmal war ich mittendrin. Christian, Jan und Axel, die sich über Borges und Eco unterhielten und über Moers, und anfingen, ihren Streich auszuhecken. Niemals hätte ich gedacht, dass Christian so verrückt auf Bücher und Geschichten war, dass er offenbar alles las, was er in die Finger bekam und alles, was er las, wie unterschiedslos miteinander verknüpfte. Er behauptete hier, dass er nun bald so weit wäre, sich ganz von Büchern zu ernähren – nein, nicht von Büchern, berichtigte er sich selbst, sondern von der Luft, dem Licht, der Nahrung ihrer Welten.
* * *
Es ist eine einfache Wahrheit, und daran kann kein Zweifel bestehen: Das Universum ist überall. Doch mit der Zeit verstand ich, dass Bibliotheken Orte voller Türen zu anderen Welten sind. Freilich liegt darin ein Widerspruch. Das Universum ist die gesamte Raumzeit und hat damit zwar eine Ausdehnung – dreiundneunzig Milliarden Lichtjahre, sagt man – aber keine Grenzen. Keine Orte also, an denen ein Übergang zu irgendeinem anderen Universum möglich wäre. Und wenn doch, ist das Universum schon in seiner Grundstruktur paradox.
Selbst wenn man, wie Christian, Bücher als andere Welten betrachtete, sollte es nicht möglich sein, aus ihnen Nahrung zu ziehen, oder in sie überzuwechseln. Trotzdem fühlte es sich an, als geschehe genau das oder etwas sehr ähnliches mit mir. Ich lebte in Christians Zimmer, umgeben von seinen Sachen. Ich hatte seinen Job in der Bibliothek. Und ich wühlte in seinen Gedanken. Genauso gut konnte ich er sein.
Zu dieser Zeit bekam ich das Problem mit den Augen. Ein Rauschen nistete sich in meinem Blickfeld ein und trübte es von dessen Rändern her. Zuerst bemerkte ich eine Unschärfe der Umrisse von Gegenständen, dann eine fortschreitende Auflösung aller Gegenstände, und wenn auch ich ersteres noch zu ignorieren gewillt war, veranlasste mich letzteres dazu, in einem Gefühl aufflammender und sich wie ein Flächenbrand durch meinen Körper ausbreitender Panik Ärzte aufzusuchen. Ich ging in eine Augenklinik, wurde aber als für deren Augen völlig gesund beurteilt und in die Notaufnahme des städtischen Krankenhauses geschickt und dort neurologisch untersucht. Als auch dort keine Ursache für mein Leiden zu finden war, galt die nächste Empfehlung bereits meiner Vorstellung in der Psychiatrie und mit der haderte ich so gründlich, dass sich mein Entschluss, mich behandeln zu lassen ebenso auflöste wie die Dinge in meinem Sehfeld. Diese Auflösung hatte sich unterdessen ohnehin auf ein Ausmaß festgefahren, mit dem ich meinte, vorläufig leben zu können. Ausgefranst und fadenscheinig blieben Gegenstände doch gerade ausreichend umrissen, um identifizierbar zu sein, und mir blieb bei allen Kopfschmerzen, die mich nun täglich wie ein Tinnitus begleiteten, doch eine Zuflucht. Von jeder Auflösung und Unschärfe ausgenommen, blieben nämlich sämtliche Buchstaben, Ziffern, Satz- und Sonderzeichen sowie Symbole, sowohl gedruckte als auch mit Hand gezeichnete Zeichen, ob auf Papier oder Buchrücken, Umschlägen und so weiter, und überdies alles, was auf Bildschirmen dargestellt wurde. Allein diese Sonderbarkeit wies freilich, wenn nicht auf eine spezielle Hirnschädigung, dann auf eine psychiatrische Ursache des Problems hin. Die Möglichkeit eines Tumors in meinem Schädel ließ sich nun noch leidlich verdrängen, die einer Geisteskrankheit ebenfalls und ich stürzte mich umso mehr auf Geschriebenes, auf den Gegenstand meiner Magisterarbeit und auf Christians Journal. Mir war wohl bewusst, dass mein Verhalten eine Flucht nach vorn darstellte, die mich ins Unbekannte, vielleicht in ein Nirgendwo führte. Aber mir blieb nichts anderes übrig.
Der erste Philosophiestudent, den ich in meinen Einführungstagen im ersten Semester gesehen hatte, war mit einem offenen Buch in der Hand und der Nase darin Kopf voran gegen eine Säule gelaufen. Eigenartigerweise passierte mir so etwas nicht. Vielmehr war ich mir sicher, dass die Festigkeit der Dinge selbst zunehmend an Gültigkeit verlor und ich deshalb, weil sie weniger fest umrissen waren, ohne mich zu verletzen an ihnen vorbeikam. Das galt nicht allein für Wände und Säulen, Stufen und Türen, sondern auch für Kommiliton*innen und, ja, auch für meine Mitbewohner. Ich konnte mir ja kaum sicher sein, es bei den nebelhaften Phantomen, denen ich auf dem Weg von meinem Zimmer in die Küche oder ins Bad begegnete, wirklich mit letzteren, Axel und Jan also, zu tun zu haben. Allein in der Bibliothek wurden mir zur Ausleihe Leseausweise entgegengehalten, anhand derer sich Identitäten einigermaßen zweifelsfrei feststellen ließen. Selbst wenn ich mit meinen Mitbewohnern, Mitverschwörern, den Brüdern unserer Bruderschaft zusammensaß, blieb immer eine Ungewissheit übrig. Warum erschienen sie mir wie in schwarze Talare gekleidet? Ihre Köpfe in Kapuzen gehüllt? Ihre Hände so fließend, als führten sie Beschwörungen aus? Und ihre Stimmen so voller Hall, als ob sie aus tiefen Gewölben heraus zu mir sprachen?
Ich machte es mir zur Angewohnheit, in jeder Situation etwas Geschriebenes zur Hand zu haben, an dem ich mich festhalten konnte, wenn mich der Schwindel meiner allzu weichgezeichneten Umgebung ergriff. Ein Teil meines Gehirns und sozusagen eine meiner Hände arbeiteten indes weiter an meiner Abschlussarbeit, die sich mit Fragen der Fiktionalität beschäftigte. Natürlich machte ich es falsch. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich längst einen Dozenten finden müssen, der die Arbeit begleitete. Dazu wiederum hätte ich entscheiden müssen, welche Disziplin ich vorrangig zuordnen wollte, ob der Literaturwissenschaft oder der Philosophie. Stattdessen beging ich sogar den klassischen Fehler, sie mit niemand anderem zu besprechen, als mit mir selbst. Auf diese Weise verstrickt man sich unweigerlich in sein eigenes Gespinst, sieht irgendwann sozusagen die Bibliothek vor lauter Büchern nicht mehr, was bedeutet, dass man nicht nur den Überblick verliert, sondern den Sinn für Systematik überhaupt, und über kurz oder lang nicht mehr objektiv zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden kann, was letztlich darauf hinauslaufen muss, dass man niemals einen Ausgang findet. Dabei fühlte ich mich noch heroisch, wie der Erforscher eines unbekannten Höhlensystems. Und wie viele namenlose Höhlenforscher mag es wohl geben, die allein in Tiefen vordringen, aus denen sie nie wieder herausfinden? Anstatt mich der Kritik zu stellen, auch der Möglichkeit, dass mir jemand sagte, wie abwegig und abstrus meine Forschung sein mochte, gab ich mich einem Perfektionismus hin, der mir diktierte, alles zuerst dingfest zu machen, meine Ladung an Zitaten und Querverweisen wie die Ladung eines Forschungsschiffs für jahrelange Fahrt ins Ungewisse festzuzurren und so meine mir selbst nicht eingestandene tiefsitzende Unsicherheit ob des Werts meiner Unternehmung zu verdrängen, anstatt ihr auf den Grund zu gehen.
Wenigstens mit meinen Mitbewohnern, wenn schon mit sonst niemandem, hätte ich die Arbeit wohl besprechen können, ihrer aber war ich mir nun schon ebenso unsicher wie meiner selbst. Viel wirklicher als sie und ich erschien mir mein selbstgeschaffener Kosmos zwischen den Disziplinen. Hayden Whites These von der Fiktionalität aller Historiographie sowie deren Fortführung im Rahmen von Lubomir Dolezels Fassung möglicher Welten in den Modalitäten des Wahren und Falschen, des Notwendigen und des Möglichen leuchtete mir nicht nur ein, sie leuchtete mir gleichsam auf meinen sich zunehmend verdunkelnden Pfaden voran. Radikaler Fiktionalismus mochte zwar keine Veränderung an der Faktizität von einmal Geschehenem zulassen, sprach allen sich widersprechenden Interpretationen dessen jedoch einen hohen Grad an Wirklichkeit im Sinne von Wirksamkeit zu. Demnach konnte Christians wirres Denken mitsamt darin sich manifestierender Paranoia hinsichtlich ihn in den Gebäuden der Universität und speziell der Bibliothek selbst verfolgender Schemen sehr wohl für ein die Schatten wirklicher Ereignisse akkurat wiedergebendes Theater gelten.