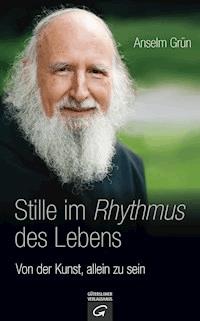14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vier-Türme-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Benediktinermönch Anselm Grün und der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Nikolaus Schneider, gehen in diesem Buch der Frage nach, was Martin Luthers Thesen für den Menschen von heute und die moderne Gesellschaft bedeuten. Für die beiden Autoren hat Luther als Mensch und Gottsucher Fragen aufgeworfen, die auch heute noch eine große Rolle spielen. Die unterschiedlichen Zugänge und Blickweisen des katholischen Ordensmannes und des ehemaligen evangelischen Kirchenvorstandes machen das Besondere an der Beschäftigung mit dem theologischen Urheber der Reformation aus. Ohne sich in konfessionelle Streitigkeiten zu verwickeln, liefern Anselm Grün und Nikolaus Schneider eine aktuelle Interpretation der zentralen Fragen Luthers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Anselm Grün
Nikolaus Schneider
Luther gemeinsam betrachtet
Reformatorische Impulse für heute
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2017
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Thomas Uhlig, www.coverdesign.net
Umschlagfoto: Catherine Avak, www.by-avak.de
ISBN 978-3-7365-0046-4 (print)
ISBN 978-3-89680-991-9 (epub)
www.vier-tuerme-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Noch ein Buch über Luther? Ich war skeptisch, als die Anfrage kam. Im Bücherregal der Kirchenredaktion des Hessischen Rundfunks stehen fast zwei Dutzend Neuerscheinungen zum Reformationsjahr 2017 und warten darauf, gelesen zu werden. Doch ein Buch wie dieses, das Sie in Händen halten, hat kein anderer Verlag im Angebot. »Luther gemeinsam betrachtet«: Das sind zwei prominente Theologen im Gespräch, einer katholisch, einer evangelisch, beide weit über ihre Konfession hinaus bekannt und geachtet, beide mit den Lebensfragen der Menschen heute zutiefst vertraut. Sowohl der Benediktiner Anselm Grün wie der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider haben gut sechs Jahrzehnte bewussten Christseins und religiöser Suche gelebt. Es waren Jahrzehnte, in denen sich die jahrhundertelang bis aufs Blut verfeindeten Konfessionen rasant angenähert haben. Und für diese Lernerfahrung in der Annäherung stehen Pater Anselm und Nikolaus Schneider. Bei klarer Verwurzelung in ihrer konfessionellen Tradition bringen sie Neugier, Sympathie und Offenheit für den Partner mit.
Die Aussicht, diese beiden Glaubensdenker und Glaubensinterpreten zwei Tage lang für ein Buch und einige Radiosendungen im Hessischen Rundfunk in ein intensives Gespräch verwickeln zu dürfen, hat mich als katholischen Theologen und Radiojournalisten begeistert. Mein Kollege, der evangelische Theologe und hr-Kirchenredakteur Lothar Bauerochse, kam mit ins Herausgeberteam, sodass aufseiten der fragenden Journalisten ebenfalls beide Konfessionen zum Zuge kommen.
Von Anfang an war uns klar, dass wir keine geschichtliche Abhandlung und auch kein reformationstheologisches Seminar wollten, sondern vielmehr ein Gespräch »zur Zeit«, wir wollten wissen, wie Anselm Grün und Nikolaus Schneider Luther heute sehen, was von dieser Figur und seinem reformatorischen Impuls uns auch im 21. Jahrhundert noch ansprechen und den eigenen Glauben inspirieren kann – über Konfessionsgrenzen hinweg.
Die theologischen Stichworte, an denen entlang wir dieses Gespräch führen, gehen zurück auf die Leitgedanken der Reformation. Luther hat mit seiner »reformatorischen Entdeckung« die eigene Angst beruhigt und den Glauben als Sprung in das Vertrauen entdeckt. Angst und Vertrauen haben heute andere Erscheinungsformen, sie bilden aber existenzielle Themen, die viele betreffen und über die sich mit Luther nachzudenken lohnt. Wie fand er und wie finden wir heute zum »Glauben können«, wie geht es heute wie damals, aus einer Hoffnung heraus zu leben?
Fast überzeitlich und archetypisch wirken manche Szenen aus Luthers Leben. Sein »Hier stehe ich« vor Kirche und Kaiser in Worms beeindruckt bis heute – und wirft Fragen auf: Wie sind absoluter Widerstand und Eintreten für eine Überzeugung zu rechtfertigen, wo doch der Fundamentalismus heute als eine große Gefahr erscheint? Wie lässt sich Luthers Überzeugung von der Freiheit eines Christenmenschen verstehen, wenn Individualismus heute die Gemeinschaft aushöhlt? Wie steht es um die Verantwortung? Kann man vom ihm lernen, Risiko und Wagnisse einzugehen?
Ist Luthers wuchtiger Angriff auf die Institution Kirche, auf Klerikalismus und Machtgebaren noch aktuell? Und hat er mit seiner Kritik nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet? War die Abschaffung des Mönchtums ein Fehler? Wie viel Spiritualität hat Luther den Protestanten vermacht? Sind seine Spiritualität des Berufs und seine Verweltlichung der Ehe zeitgemäß?
Es war spannend zu hören und ist nun spannend zu lesen, wie sich Anselm Grün und Nikolaus Schneider diesen Fragen zuwenden. Die unterschiedlichen konfessionellen Perspektiven, aus denen sie sprechen, machen den Reiz des Gespräches aus. Der Brückenschlag vom Mittelalter ins Heute gelingt auf inspirierende Weise. In vielen Fragen offenbaren der Mönch und der langjährige Kirchenführer große inhaltliche Nähe, es werden aber auch Grenzen deutlich, die zwischen den Konfessionen kaum zu überwinden sind. Aber so sehr sie der Wunsch nach einem gemeinsamen Zeugnis der getrennten Christen umtreibt, wollen beide keine organisatorische Einheit der Kirche als Ökumenemodell der Zukunft. Sie sprechen von »Vielfalt in der Einheit«, von einer »Ökumene der Gaben«. So lassen sich Identität der Kirchen und gegenseitige Bereicherung besser denken.
Beide sind so frei, Luthers Anfragen und Herausforderungen auch auf den Zustand der eigenen Kirchen zu beziehen. Sie fragen, wo der jeweils andere die eigene Tradition bereichert hat und wo Traditionen abgebrochen sind, die zu einer Verarmung führten.
Anselm Grün und Nikolaus Schneider liefern mit ihrem Gespräch einen verständlichen und anregenden Zugang zu Luther und zur Reformation. Es wird die Energie spürbar, die in dem reformatorischen Impuls heute noch liegt, denn die existenziellen Fragen altern nicht mit den Jahrhunderten. Luther war ein leidenschaftlicher Mensch und Gottsucher und die Gesprächspartner dieses Buches sind es ebenfalls. Die Vitalität der großen Fragen, die Luther umtrieben, wird hier für den Leser deutlich. Und die Antworten, die er gab und die Anselm Grün und Nikolaus Schneider geben, schenken auch 500 Jahre danach starke Impulse für den eigenen Glauben. Deshalb verspreche ich Ihnen eine Lektüre, die Sie informieren, inspirieren und berühren wird.
Klaus Hofmeister
Ökumenische Grunderfahrungen
Pater Anselm, erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit der evangelischen Konfession?
Anselm Grün
In Lochham, wo ich großgeworden bin, hatten wir einen Nachbarn, der evangelisch war. Mein Vater hat immer mit großem Respekt von ihm gesprochen. Es war zwar kein herzliches, aber ein freundlich-distanziertes Verhältnis. In der Schule hatte ich ausschließlich katholische Mitschüler, ebenso später im Internat. Richtig in Kontakt gekommen mit der anderen Konfession bin ich erst in meinem Studium. In Rom hörte ich den evangelischen Theologen Professor Völker sowie einen Vertreter der Waldenser, die beide Vorlesungen gehalten haben. Das waren sehr gute Gespräche, bei denen ich gespürt habe, dass der Unterschied nicht besonders groß ist. Während der Studienzeit habe ich auch viele Werke evangelischer Theologen gelesen, zum Beispiel von Friedrich Gogarten, Eberhard Jüngel, Gerhard Ebeling, Karl Barth und natürlich Rudolf Bultmann.
Erinnern Sie sich noch an das erste Mal, als Sie in eine evangelische Kirche eintraten?
Anselm Grün
In Lochham gab es eine evangelische Kirche, die ich auch besucht habe. Sie war nüchterner und kleiner, als ich es von katholischen Kirchen gewohnt war. Die evangelischen Kirchen in München habe ich kaum betreten, meistens waren sie damals geschlossen. Evangelische Gottesdienste erlebte ich erst später als Mönch. Die Bruderschaft von Gnadenthal in Volkenroda hatte mich eingeladen und wir haben dort auch gemeinsam Eucharistie gefeiert.
Herr Schneider, welchen kirchlichen Hintergrund bringen Sie mit?
Nikolaus Schneider
Ich stamme aus einem unkirchlichen, im Grunde sogar atheistischen Elternhaus. Der Hintergrund meines Vaters, dessen Familie aus Lothringen kommt, war katholisch, aber seine Familie ist schon in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts aus der Kirche ausgetreten. Der Hintergrund meiner Mutter war evangelisch. Sie ist bei einem Pfarrer, der zur Bekennenden Kirche gehörte, konfirmiert worden. Obwohl sie ihn in guter Erinnerung hatte, trat sie später auch aus der Kirche aus. Mein Großvater väterlicherseits arbeitete im Walzwerk, mein Vater am Hochofen. Ihre Familien waren den Gewerkschaften verbunden und zum Teil auch Mitglieder der kommunistischen Partei. Über die Kirche wurde in meiner Kindheit immer kritisch geredet. Meine Eltern kannten allerdings kirchliche Menschen, die sie sehr hoch schätzten, weil sie in der Zeit des Nationalsozialismus Widerstand oder Widerspruch geleistet und Menschen geholfen hatten. Das war meine Prägung. Ich wurde als Kind nicht getauft und hatte im Ansatz ein kritisches Verhältnis zur Institution Kirche.
Wie haben Sie damals die Katholische Kirche wahrgenommen?
Nikolaus Schneider
Dem Katholizismus »live« bin ich zum ersten Mal bei Prozessionen begegnet, mit denen die Kirche ihren Christusglauben öffentlich zeigte. Ich stand an der Straße und habe zugeschaut, wie die Menschen an mir vorüberzogen, zum Teil redend, mit Gesängen, in Andacht. Ich habe das damals nicht wirklich reflektiert, es war eher eine emotionale Sache. Aber ich weiß noch genau, wie sehr es mich beeindruckt hat, dass Menschen für ihren Glauben so in die Öffentlichkeit gingen, und das in einem Stadtteil, der eigentlich von einer unkirchlichen Arbeiterschaft geprägt war. Wenn die Gewerkschaften am ersten Mai zu Demonstrationen einluden, dann zog bei uns morgens um sechs ein Spielmannszug durch die Siedlung, und fast die gesamte Siedlung – das waren Tausende, und auch ich mit meiner Familie mittendrin – ging in geschlossener Marschkolonne nach Duisburg-Stadtmitte. Doch hier trat nun die Kirche in einer überschaubaren Zahl mit ihrem Glauben in die Öffentlichkeit.
Wie kommt ein Kind aus einem so unkirchlichen Elternhaus in Berührung mit dem Glauben und der Religion?
Nikolaus Schneider
In der Grundschule sollte ich nicht am Religionsunterricht teilnehmen, so hatten es meine Eltern entschieden. Ersatz- oder Alternativunterricht gab es nicht. Also wurde das dann gelöst, indem die Lehrerin sagte: »Setz dich hinten in die Ecke und lies ein Buch«. Das hab ich auch getan. Doch zwischendurch begann ich zuzuhören. Die Lehrerin erzählte spannende biblische Geschichten und konnte sie so vermitteln, dass für uns Kinder klar wurde: Diese Geschichten haben etwas mit dir zu tun. Schließlich legte ich mein Buch beiseite und hörte nur noch zu. Irgendwann habe ich mich dann auch am Unterricht beteiligt, weil es mich drängte, zum Gehörten Stellung zu nehmen. Nach der Grundschule wechselte ich als Einziger aus unserer Siedlung aufs Gymnasium. Mein damaliger Klassenlehrer, der Latein und evangelische Religion unterrichtete, sagte zu meiner Mutter: »Wer diese Welt verstehen will, der muss etwas von Religion verstehen. Sie sollten Ihren Sohn zum Religionsunterricht anmelden.« Er argumentierte also mit Bildung, und auf dieser Schiene waren meine Eltern ansprechbar, sodass meine Mutter schließlich sagte: »Gut. Dann soll er eben, und evangelisch wäre nicht so schlimm wie katholisch.« Diesen Kommentar habe ich noch heute im Ohr. Und so kam ich in den evangelischen Religionsunterricht.
»Evangelisch ist nicht so schlimm wie katholisch« – richtig begeistert klingt das tatsächlich nicht.
Nikolaus Schneider
Ich fand den Religionsunterricht schon interessant, aber richtig begeistert war ich zu der Zeit eher für Fußball. Der entscheidende Punkt war später der Konfirmandenunterricht. Ich war nicht getauft, habe aber trotzdem am Konfirmandenunterricht teilgenommen, weil Glaubensinhalte mich zunehmend interessierten. Was den pädagogischen Anspruch anging, war der kirchliche Unterricht damals noch sehr bescheiden. Er bestand überwiegend darin, dass auswendig gelernte Bibelverse und Lieder abgefragt wurden und man uns am Ende der Stunde die nächste Lektion zum Auswendiglernen aufgab. Doch das hat mich nicht abgeschreckt, und ich bin bis heute dankbar dafür, weil ich dadurch eine Grundkenntnis der Bibel und der Gesangbuchlieder bekommen habe, die trägt.
Dann kam der Augenblick, in dem ich im Beisein des Pfarrers mit meinen Eltern darüber gesprochen habe, dass ich mich taufen lassen wollte. Sie waren nicht gerade begeistert, aber Verbote gab es keine. Sie fanden meinen Wunsch eher merkwürdig. Sie sagten zu mir: »Wenn du es möchtest, dann mach es.« Damit war dann der Grundstein meines »evangelischen Karrierewegs« gelegt. Nach der Taufe trat ich in verschiedene Jugendgruppen ein, habe dort Freundschaften geschlossen und auch schnell Verantwortung übernommen und wurde schließlich Kindergottesdiensthelfer. Das war für mich im Rückblick der entscheidende Schritt zum Theologiestudium. Damals kamen 120 Kinder zum Kindergottesdienst und mir wurde bald die Leitung einer Gruppe übertragen. Einmal in der Woche setzten wir uns, nach einer theologisch fundierten Vorbereitung bei unserem Pfarrer, mit den biblischen Texten auseinander, die wir zu erzählen hatten. Wir stellten uns auch der Frage, welche Bedeutung die Texte heute für uns und im Besonderen für Kinder haben.
Meldete sich damals schon der Berufswunsch Pfarrer?
Die endgültige Entscheidung zum Theologiestudium und zum Pfarrberuf kam erst recht spät. Ich wollte zuvor Arzt werden. Dieser Wunsch wurde von meinen Eltern sehr gestützt. Nach dem Abitur begann ich – angeregt durch ein intensives Gespräch mit meinem Gemeindepfarrer – noch einmal darüber nachzudenken, was ich wirklich wollte. Im Ergebnis habe ich mich für die Theologie entschieden. Anders als bei meiner Taufentscheidung zeigten meine Eltern jetzt doch auch ablehnende Reaktionen: Meine Mutter war so enttäuscht darüber, dass ich nun kein »Halbgott in Weiß« wurde, dass sie einige Zeit nur noch das Notwendigste mit mir sprach. Mein Vater kommentierte meine Entscheidung mit dem Satz, es sei sehr schade, dass nun auch ich das Volk betrügen würde. Obwohl beide mein Theologiestudium für einen falschen Weg hielten, haben sie mich dennoch finanziell unterstützt. Meine Mutter söhnte sich einige Jahre später mit meinem Pfarrberuf aus, trat wieder in die evangelische Kirche ein und engagierte sich in ihrer und meiner Kirchengemeinde.
Pater Anselm, Lochham war ein katholisches Milieu, Ihre Familie katholisch, große Auseinandersetzungen wurden Ihnen da wohl nicht zugemutet?
Anselm Grün
Mein Vater kommt aus Essen-Katernberg, wo er im Bergbau tätig war, allerdings im Büro. 1920 besuchte er ein Turnfest in München. Er war so vom katholischen Bayern fasziniert, dass er ohne Geld und alles nach München zog. Es hatte ihn immer sehr geärgert, dass er an Epiphanie, einem katholischen Feiertag, in Nordrhein-Westfalen arbeiten musste. In München schlug er sich erst im Baugewerbe durch, bis er schließlich ein Elektrogeschäft eröffnete.
Meine Mutter stammt aus Dahlem in der Eifel, also aus einer ganz katholischen Gegend. In die Kirche zu gehen war bei uns kein Muss, sondern eher selbstverständlich. Wir wohnten damals neben der Kirche und meine drei Brüder und ich waren Ministranten. Die Erstkommunion mit zehn Jahren war eine faszinierende Erfahrung für mich. In diesem Alter ist man schon sehr empfänglich, und ich habe die Erstkommunion ernster genommen als manch andere. Damals habe ich zum ersten Mal mit meinem Vater darüber gesprochen, ob der Beruf des Priesters nicht etwas für mich wäre. Er war sofort begeistert und hat nachgefragt, ob Weltpriester oder Ordenspriester. Sein Bruder war Benediktiner, aber ich wusste damals noch gar nicht, was ein Ordenspriester ist. Mein Vater hat sich dann gleich mit meinem Onkel in Verbindung gesetzt, und ich kam mit zehn Jahren ins Internat nach Unterfranken, in die Nähe von Münsterschwarzach. Das war anfangs nicht so einfach, da ich großes Heimweh hatte, aber die Richtung war von da an klar. Natürlich gab es in der Pubertät auch Zweifel wie auch vor dem Abitur. Ich hatte großes Interesse an der Naturwissenschaft, besonders an der Biologie. Ich besaß ein eigenes Mikroskop, das ich mir zu Weihnachten hatte schenken lassen und mit dem ich damals Pantoffeltierchen untersuchte. Doch dann interessierte mich die Mission, mein Ehrgeiz war es damals, möglichst weit weg, nach Korea, zu gehen, eine schwierige Sprache zu lernen und etwas für die Kirche zu leisten.
Als Sie beide entschieden waren, in welcher Konfession Sie Ihre Heimat finden, wie offen haben Sie damals auf die jeweils andere Konfession geblickt? Gab es ein Profilierungsbedürfnis in dem Milieu, in dem Sie standen, oder fielen Ihnen die »Andersgläubigen« eigentlich gar nicht auf?
Anselm Grün
Als Kind war die andere Konfession weder ein Gegensatz noch ein Thema. Als wir im Religionsunterricht am Gymnasium die Reformation behandelten, war es uns natürlich schon wichtig zu beweisen, dass wir Recht hatten. Zwar wurde die Praxis des Ablasshandels zu Luthers Zeiten schon auch kritisch gesehen, aber ansonsten war die Grundtendenz mehr apologetisch, auf die Verteidigung des Katholischen ausgerichtet. Im Theologiestudium war ich dann sehr offen und interessiert an der evangelischen Theologie. Mein Doktorvater Magnus Löhrer kam aus der Schweiz. Dort ist man sowieso etwas liberaler. Löhrer hat damals Karl Barth bei seinem Rombesuch geführt und wie Barth die Vorliebe gehabt, vor Beginn seiner Arbeit immer eine Mozartplatte zu hören. 1967, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, gab es eine große Offenheit gegenüber evangelischer Theologie. Meine Lizentiatsarbeit habe ich über den evangelischen Theologen Paul Tillich geschrieben und wollte ihn auch zum Thema meiner Promotion machen, doch dann hat Magnus Löhrer herausgefunden, dass bei Küng schon jemand über Tillich arbeitet und es sich deshalb nicht lohnen würde. Ich habe dann zunächst die liberale evangelische Theologie wie zum Beispiel Albrecht Ritschl gelesen, aber das war mir dann doch etwas zu abstrakt, und schließlich bin ich auf den katholischen Theologen Karl Rahner gekommen. In meiner Promotion habe ich den Ansatz von Rahner mit den evangelischen Ansätzen von Tillich und Jürgen Moltmann verglichen, der auch über das Kreuz geschrieben hat. Während meiner Zeit in Rom war da also immer eine große Offenheit. Zum Beispiel habe ich die Schwestern der evangelischen Communität vom Schwanberg durch die Stadt geführt, als sie einmal in Rom waren.
Können Sie sich noch erinnern, was Sie damals aus theologischer Sicht an der anderen Konfession am meisten neugierig gemacht hat?
Anselm Grün
Damals ist mir die evangelische Theologie radikaler vorgekommen. Im Vergleich dazu erschien mir die katholische etwas bieder. Später, als ich für meine Doktorarbeit noch einmal Gogarten gelesen habe, habe ich gemerkt, dass mir das zu verkopft ist. Am Anfang war da also die Faszination des Radikaleren, doch dann hatte ich gerade bei Gogarten irgendwann das Gefühl, dass es mir da zu wenig Boden unter den Füßen gab.
Herr Schneider, wie war das bei Ihnen, als Sie entschieden evangelisch wurden? Wie blickten Sie auf die Katholiken, wie erschienen sie in Ihrem Weltbild damals? Kamen Sie überhaupt vor?
Nikolaus Schneider
Zwei Elemente waren für meinen Umgang mit Menschen katholischen Glaubens von Beginn an prägend: Zum einen die Erfahrung, dass ein engagierter christlicher Glaube mehr Verbindendes hat als die konfessionelle Beheimatung Trennendes. Zum anderen die zunehmende Vergewisserung, dass die evangelische Kirche die für mich richtige und passende religiöse Beheimatung ist. In der Oberstufe des Gymnasiums war ich mit einem Mitschüler, Heinz-Jürgen Görtz, gut befreundet, der sehr bewusst katholisch war und später Theologieprofessor wurde. Wir galten in der Klasse als diejenigen, die sich für religiöse Fragen interessierten und die ganz offen für ihre jeweilige Kirche eintraten. Das hat uns einander sehr nahe gebracht. Wir haben bis heute Kontakt. Daneben hatte für mich mein Interesse an Glaubensfragen in diesen Jahren ganz wesentlich mit meiner Identitätsbildung zu tun, also in einem Stadium, in dem der Kopf schon eine ganz entscheidende Rolle spielt. Bei der Identitätsbildung geht es auch immer um die Fragen: Wofür stehe ich? und Was will ich auf gar keinen Fall? Als wir dann im Religionsunterricht die Reformation durchgenommen haben, wurde mir klar, dass ich bestimmte Eigenheiten der katholischen Kirche für mich niemals anerkennen wollte. Etwa den Machtanspruch, der mit dem päpstlichen Amt verbunden ist. Den päpstlichen Macht- und Unterwerfungsanspruch fand ich unerträglich. Es hat bis ins Studium hinein gedauert, ehe ich mein absolut negatives Bild des Papsttums korrigiert habe. Die Päpste waren für mich bis dahin unterschiedslos unaufrichtig: Sie redeten von Glaube und Kirche, aber meinten Macht und Staat. Sie lebten nicht die Moral, die sie predigten und von den Gläubigen forderten. Dies kam dann zusammen mit dem »Sturm und Drang«, den man in der Jugend durchlebt – eine Zeit, in der es auch darum geht, sich von überlieferten Moralvorstellungen zu befreien. Hier habe ich nicht zuletzt die Sexualethik der katholischen Kirche als sehr eng empfunden.
Noch zu Beginn meines Theologiestudiums bestimmte mich das Pathos: »Martin Luther hat gegen Kaiser und Papst die Freiheit des Glaubens gerettet. Wir Protestanten sind deshalb diejenigen, die im Blick auf alle theologischen Disziplinen wissenschaftlich und ergebnisoffen arbeiten können. Uns geben kein Papst und keine kirchliche Tradition vor, zu welchen Ergebnissen wir zu kommen haben. Bei uns gibt es ein freies Denken und einen freien Glauben, die dem Evangelium, also der frohen und befreienden Botschaft der Bibel, entsprechen.« Dieses protestantische Pathos änderte sich erst, als ich im Studium auch katholische Theologie anders als vermutet kennengelernt und die Schattenseiten der Reformation sowie dunkle Seiten Martin Luthers und seiner Theologie wahrgenommen habe. Ich sah dann manches, wo auch die Reformation ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurde. Zwar bekannten die Protestanten: »Nur das Wort gilt und nicht die Gewalt. Nur durch das Wort wollen wir die Menschen überzeugen, nicht durch Gewalt«. Doch die Geschichte zeigt, dass es durchaus auch anders gelaufen ist. Trotz all der Verfolgung, die Protestanten erlitten haben, haben auch sie Gewalt ausgeübt.
Pater Anselm, gab es damals Punkte, die Sie bei den Protestanten auf keinen Fall akzeptieren konnten, die Sie auch mit so einer Entschiedenheit ablehnten, wie wir das gerade bei Herrn Schneider erlebt haben? Und war das Papsttum mit seinem Machtanspruch für den jungen Bruder Anselm nicht auch anstößig?
Anselm Grün
Damals kannte ich die evangelische Theologie noch nicht so gut, dass ich hätte sagen können, dieses oder jenes muss man ablehnen. Was ich aber immer spürte, war der Schmerz über die Spaltung und darüber, dass es doch auch anders hätte sein können. Pater Cassius, unser Kirchengeschichtsprofessor in Rom, hatte es sich zum Hobby gemacht, die Skandale der römischen Päpste breit darzulegen. Wenn ich die Vorlesungen hörte, war mir schon klar, dass es da auch viel Dunkles gibt. Als Kind faszinierte mich Papst Pius XII., allerdings hatte auch der seine Schattenseiten, er war noch sehr autoritär. Johannes XXIII. fand ich auch faszinierend, mit ihm kam ein anderer Wind auf und das Papsttum wurde aufgelockert. Natürlich stehe ich diesem Verstecken hinter der Macht, das bei den letzten beiden Päpsten Johannes Paul II. und Benedikt XVI. wieder spürbar war, sehr kritisch gegenüber. Aber ich sehe es auch als eine Chance, wenn ein Sprecher der Christenheit da ist, der wie der jetzige Papst spirituell ist und für die Kirche sprechen kann. Mit der Dogmatik habe ich nie Probleme gehabt, weil für mich Dogmatik die Kunst ist, das Geheimnis offenzuhalten. Hier geht es nicht um Rechthaberei, sondern um eine Sprache, die das Geheimnis schützt, und das war natürlich auch im Studium wichtig. Als Abiturient wollte ich immer sofort beweisen, dass das Katholische richtig ist und das Evangelische verkehrt und dass Luther zu liberal war. Uns war damals zwar schon allen klar, dass die Reformation und die Kritik am Papsttum notwendig waren, aber trotzdem stand da immer noch das Apologetische im Vordergrund.
Eine spannende Entwicklung, die Sie genommen haben, Pater Anselm, vom Rechthabenwollen hin zu ihrer doch sehr intensiven Beschäftigung mit evangelischer Theologie. Gab es einen bestimmten Punkt, der Sie besonders reizte an den evangelischen Theologen?
Anselm Grün
Erst einmal haben mich natürlich die Exegeten gereizt, die katholische Kirche war ein wenig hinten dran mit der historisch-kritischen Exegese. Ich habe damals Rudolf Bultmann, Oscar Cullmann und die ganzen Kommentare der evangelischen Theologen gelesen. Für mich waren das einfach Informationen, wie man auch anders denken kann, freier denken kann. Das hat mich fasziniert wie auch ihre Neuformulierung des Glaubens. Paul Tillich ist nicht der typische evangelische Theologe, er steht mir eigentlich sehr nahe, weil auch er Theologie, Psychologie und Philosophie zusammenbringt. Später hat mich dann an den evangelischen Theologen gestört, dass der Dialog mit der Philosophie und mit der Psychologie nicht sehr ausgeprägt war. Wenn Philosophie, dann wurde immer nur Immanuel Kant zu Rate gezogen, und als Bayer kann ich den Kant nicht vertragen. Er ist mir zu verkopft und zu moralisierend. Die platonische Philosophie oder Aristoteles waren mir immer näher.
Gehen wir einen Schritt weiter und sprechen wir über erste prägende ökumenische Erfahrungen. Herr Schneider, Sie haben schon von Ihrem katholischen Mitschüler erzählt. Wo gab es weitere Berührungen mit Katholiken, die Sie in ihrer ökumenischen Haltung prägten?
Nikolaus Schneider
Weitere Berührungspunkte gab es für mich durch mein Engagement in der evangelischen Studierendengemeinde Wuppertals. Wir hatten Kontakt zu katholischen Studierendengemeinden und stellten große Schnittmengen fest in dem, was uns theologisch und politisch umtrieb. Ich habe im Sommersemester 1967 mit dem Studium begonnen. Das war eine Zeit des großen Aufbruchs. Zu diesem Aufbruch der sogenannten »68er« gehörte, dass Christentum und Kirchen fragwürdig und infrage gestellt wurden. Sich offen zu ihrem Glauben bekennende Studenten wurden häufig kritisch und oft auch unfair angegangen. Hier waren Gemeinschaft und Gemeinsames zwischen den beiden Hochschulgemeinden wirklich spürbar und tragend. Das half uns dann, in vielen Debatten über unsere als reaktionär verurteilten Kirchen bestehen zu können. Ich habe damals also die für mich bis heute prägende Erfahrung gemacht, dass katholische und evangelische Christen aus einer tiefen Verbundenheit im Glauben heraus zu vielen Themen gemeinsam sprechen und gemeinsam auftreten können. Und dass es bei massiver Infragestellung von außen hilfreich und notwendig ist, zusammenzustehen.
Haben Sie im Studium katholische Theologen gelesen?
Nikolaus Schneider
Im Studium habe ich mich durchaus auch mit katholischer Theologie beschäftigt. Karl Rahner etwa spielte eine wichtige Rolle für mich. Und es gab zu meinem großen Erstaunen auch katholische Exegeten, die ich wirklich mit großer Begeisterung gelesen habe. Der Neutestamentler Rudolf Schnackenburg hat zum Beispiel einen Römerbrief-Kommentar geschrieben, den ich wirklich sehr gut fand. Karl Rahner habe ich in Münster gehört. Das war wirklich ein großartiges Erlebnis, wie er so völlig frei eine Vorlesung halten konnte: gestochen formuliert, im Rahmen der Zeit, mit klarem Aufbau, ohne inhaltlich durcheinanderzugeraten. Meine Examensarbeit habe ich über Justin den Märtyrer aus dem zweiten Jahrhundert geschrieben. Ich habe mich also auch mit den Kirchenvätern intensiv auseinandergesetzt, die zu unserem gemeinsamen Erbe gehören.
Zu intensiven Begegnungen mit Katholiken kam es dann im Vikariat und im Pfarramt. Ich war Gastvikar der Rheinischen Kirche im westfälischen Münster. Dort gab es ein richtig gutes ökumenisches Miteinander mit der katholischen Nachbargemeinde und ich plante, gestaltete und feierte meine ersten ökumenischen Gottesdienste. Diese positiven ökumenischen Erfahrungen setzten sich dann in Duisburg-Rheinhausen fort, wo ich meine erste Pfarrstelle antrat. Ich hatte ein vertrauensvolles und freundschaftliches Verhältnis zu Pfarrern und Kaplänen der katholischen Nachbargemeinden. Damals gab es in Rheinhausen die ersten Auseinandersetzung um den Erhalt des Krupp’schen Hüttenwerkes, und in unserem Engagement für die »kleinen Leute«, die Angst um ihre Arbeitsstellen hatten, passte wirklich kein Blatt zwischen uns. Es war ein menschlich und theologisch wunderbares Miteinander. In unserer ökumenischen Zusammenarbeit haben wir Evangelische auch das Hoheitsgebiet »Predigt« abgetreten, das man gemeinhin als evangelische Spezialität erachtet. So hat der katholische Pfarrer in dem großen ökumenischen Walzwerksgottesdienst eine kirchennahe wie kirchenferne Menschen ansprechende und im Wortsinn »Geist-reiche« Predigt gehalten. Manche seine Sätzen sind mir heute – nach dreißig Jahren – noch präsent. Etwa: »Die Villa auf dem Hügel kann nur in Ruhe leben, wenn auch die Hütte im Tal in Ruhe leben kann. Sonst werden beide brennen.« In dieser Zeit des Rheinhauser Arbeitskampfes, der von unseren beiden Ortskirchen begleitet wurde, besuchte uns der damalige Bischof von Münster, Reinhard Lettmann. Man merkte, wie sehr sein Besuch die Gemeinden gestärkt hat. Er unterschied nicht zwischen evangelisch und katholisch. Meine eigene Kirchenleitung war zunächst etwas zurückhaltender, hat aber dann doch deutlich zu unserem Engagement gestanden. Die Konfession spielte also in meiner Pfarramtszeit in Rheinhausen eine ziemlich zurückgenommene Rolle. Allerdings blieben die Unterschiede im Amtsverständnis, und wir konnten trotz »Kanzeltausch« und vieler gemeinsamer Veranstaltungen nicht zusammen Abendmahl feiern, was uns durchaus wehtat. Es gab auch Punkte, bei denen ich merkte: Ein katholischer Priester hat – oder nimmt sich – in seiner Kirche eine größere Freiheit als ich in meiner. Wir hatten damals so einen Club von »Halbverrückten«, die hatte sich in ihrer Freizeit eine Ranch aufgebaut, wo Erwachsene miteinander Indianer und Cowboys spielten. Sie hatten dort auch eine Kirche errichtet. Irgendwann kamen sie und wollten in dieser Kirche einen ökumenischen Traugottesdienst haben, ein konfessionsverschiedenes Paar sollte dort getraut werden. Und ich als junger Pfarrer sagte: »Das geht doch gar nicht, man kann doch in dieser Kirche keinen Gottesdienst abhalten«. Aber mein katholischer Kollege widersprach: »Hör mal, natürlich machen wir das. Bedenke, was dort geleistet wird zur Integration dieser Menschen.« Ich kam ins Nachdenken und fragte nur noch: »Und was schreibst du ins Kirchenbuch?«, und er sagte: »Ist doch klar, ich Sankt Peter und du Erlöser.« Das waren damals unsere Gemeindenamen. Das rechte Maß von Freiheit und Bindung im Blick auf unsere Kirchenordnung habe ich also von meinem katholischen Kollegen gelernt. Ich lernte von ihm, Kirchenordnung als einen Solidaritätsrahmen zu verstehen, mit dessen Hilfe ich mit anderen in Gemeinschaft leben kann. Nichts anderes will eine Ordnung. Sie soll nicht herrschen, sondern sie soll Gemeinschaft ermöglichen.
Das vertrauensvolle Miteinander mit den katholischen Pfarrern habe ich in meiner gesamten Zeit als Gemeindepfarrer, als Diakoniepfarrer und als Superintendent als große Bereicherung erlebt. Es war über die Arbeitsebene hinaus zumeist auch ein herzliches, freundschaftliches Verhältnis, das bis heute trägt. Erst als ich ins Landeskirchenamt kam und Präses wurde, also auf die Ebene der Bischöfe, wurde manches schwieriger. Aber nach meiner Erfahrung gilt auch hier: Das Verhältnis zwischen den leitenden Geistlichen, zwischen den evangelischen und katholischen Bischöfen, ist sachlich und menschlich sehr viel besser, als es gelegentlich nach außen erscheint.
Pater Anselm, Sie haben die meiste Zeit Ihres Lebens in einem homogenen konfessionellen Milieu gelebt, zumindest im Kloster gibt es keine Evangelischen, oder?
Anselm Grün
Doch, zu uns kommen sehr viele evangelische Christen. Schon in den 1960er-Jahren saß immer ein Pfarrer aus Hamburg im Chorgestühl, wie auch ein evangelischer Bischof aus Norwegen. Sie nahmen an der Eucharistie teil, das war zwar nicht offiziell, aber wir haben es einfach gemacht. Auch der damalige Abt zeigte sich damit völlig einverstanden, obwohl er eher zurückhaltend war. Später habe ich im Gästehaus mit vielen evangelischen Pfarrern zu tun gehabt, und aus diesen Begegnungen sind echte Freundschaften entstanden. Dem Regionalbischof von Reutlingen und seiner Familie bin ich freundschaftlich verbunden. Mit den Schwanbergschwestern von der Communität Casteller Ring pflegen wir ein geschwisterliches Verhältnis, bei dem es überhaupt nicht um Profilierung geht, sondern ganz einfach um Hinhören: Was bewegt sie, was bewegt uns, wo ergänzen wir uns?
Waren diese Jahre nach dem Konzil mit den positiven Erfahrungen eine Zeit des Aufbruchs in den beiden Konfessionen?
Anselm Grün
Nach dem Konzil gab es sicherlich einen Aufbruch. Unter Papst Johannes Paul II. gab es dann wieder einen Rückschritt. Er hatte sicher seine Bedeutung für den Osten, für den Aufbruch in Polen und Tschechien, aber innerkirchlich war er doch sehr restriktiv. Das war für uns eher lähmend, auch die deutschen Bischöfe, vor allem Kardinal Lehmann, haben sich sehr verletzt gefühlt durch dieses autoritäre Auftreten. In jener Zeit stand wieder die Macht im Vordergrund und nicht das Hinhören. Es wurde wieder auf negative Weise Macht ausgeübt. Papst Benedikt XVI. ist als Theologe gut, er hat eine gute Sprache, was Liturgie und dogmatische Fragen betrifft, aber sobald es um Regeln geht und um Moral, kommt seine ängstliche Seite zum Vorschein. In dieser Hinsicht war er auch sehr restriktiv und es war keine Diskussion mehr möglich.
1972 habe ich auf dem Schwanberg bei den evangelischen Schwestern die Osterpredigt gehalten. Es war damals für mich auch überhaupt kein Problem, zur Kommunion zu gehen. Vor sechs Jahren habe ich dort wieder die Predigt gehalten, dieses Mal habe ich aber nicht an der Kommunion teilgenommen, weil es zu viel Wirbel hervorgerufen hätte. Als ich dieses Jahr zum Schwanbergtag eingeladen wurde, hat mich die Pfarrerin vorher gefragt, wie ich es mir vorstelle, und ich habe ihr geantwortet, dass wir gerne gemeinsam am Altar stehen und die Einsetzungsworte und Gebete sprechen können. Wir haben das nicht getan, damit es morgen in der Zeitung steht, wir haben es einfach getan, ohne es groß anzukündigen. Man darf die Eucharistie nicht zu einer Protestveranstaltung machen. Zu diesem Zeitpunkt war es einfach stimmig. Der alte evangelische Pfarrer Johannes Halkenhäuser hat anschließend gesagt, seit vierzig Jahren hätte er darauf gewartet, für uns war es aber einfach nur selbstverständlich. Allerdings würde ich die gemeinsame Eucharistiefeier wie gesagt nicht in die Zeitung setzen, weil sie dann zur Protestveranstaltung werden würde.
Nikolaus Schneider
Das kann ich gut nachempfinden. Ich habe als Pfarrer in den Gemeinden, in denen ich Dienst tat, immer wieder mit katholischen Christinnen und Christen gemeinsam Eucharistie gefeiert, sowohl in evangelischen wie auch in katholischen Kirchen. Es ergab sich aus dem jeweiligen Miteinander heraus. Die erlebte und gelebte Nähe miteinander und mit Christus hat es gleichsam erfordert, dass wir auch gemeinsam Abendmahl feiern.
Unsere jüngste Tochter hat sich sehr stark in der Jugendarbeit unserer katholischen Partnergemeinde engagiert. Dort gab es einen tollen Kaplan, der für sie persönlich und geistlich sehr wichtig wurde. Auch wir lernten ihn kennen und schätzen. Er kam zu ihrer Konfirmation und hat mit ihr und mit uns Abendmahl gefeiert. Und das empfand unsere Tochter und empfanden wir als ein großes Geschenk.
Ich sehe das genau wie Pater Anselm: Im geschützten Raum ist die gemeinsame Abendmahl-Eucharistie-Feier auch ohne kirchenrechtliche Grundlage möglich. Ich finde ebenso, man sollte das gemeinsame Abendmahl nicht zu Demonstrationszwecken missbrauchen. Wobei ich in meiner Amtszeit als leitender Geistlicher auch schon uneindeutige Momente erlebt habe. Besonders ist mir eine Situation während meiner Zeit als rheinischer Präses im Gedächtnis geblieben. Ich nahm an der Einführung eines katholischen Bischofs teil. Dabei gab es zwei bemerkenswerte Momente. Moment eins: Ich war eingeladen in den Dom, wir nahmen Aufstellung zur Prozession, und da war ein Zeremoniar, dem es auf konfessionelle Unterschiede ankam: ganz vorne das Kreuz, dann die ganzen Laien, dann der »niedere« Klerus: Priester, evangelische Pfarrer und der evangelische Präses. Als ich an der ganzen Korona der katholischen Bischöfe vorbeiging und auf die Höhe des Bischofs von Münster kam, hielt er mich fest und sagte: »Bruder Schneider, Sie gehen mit mir.« Das habe ich dann auch gemacht, der Zeremoniar war still. Es war eine wunderbare ökumenische Erfahrung. Moment zwei: Während dieses Gottesdienstes wurde Eucharistie gefeiert. Ich saß jetzt neben Bischof Lettmann und als bei der Austeilung die Reihe an mich kam, war ich unsicher, was nun geschehen würde. Der austeilende Priester schaute mich richtig traurig an und gab mir die Hostie nicht. Ich muss sagen, in diesem Moment war auch ich sehr traurig, dass ich mit Bischof Lettmann keine Mahlgemeinschaft feiern konnte. Die Wunde der Trennung am Tisch des gemeinsamen Herrn Christus schmerzt wirklich, das ist nicht nur ein theoretischer Satz, sondern ganz existenziell empfunden.
Anselm Grün
Wenn ich Kurse gebe in unserem Gästehaus in Münsterschwarzach, lade ich immer alle ausdrücklich ein, zur Kommunion zu gehen, weil manche evangelische Christen sich nicht trauen, aber wenn ich sie einlade, kommen sie gerne. Natürlich würde ich es in der Abteikirche nicht verkünden, hier gehe ich davon aus, dass es einfach getan wird. In der evangelischen Kommunität in Gnadenthal habe ich zum 70. Geburtstag von Andreas Felger die Eucharistie gefeiert und als mich der Prior vorher fragte, wie wir es machen, meinte ich: »Wir sagen gar nichts, die Leute kommen von alleine.« Es waren mehr Evangelische anwesend und sie sind einfach zur Kommunion gegangen.
Nikolaus Schneider