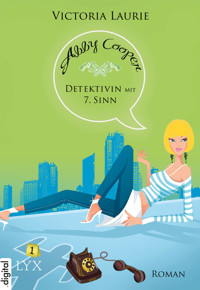9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Auch der zweite Band der Reihe »M. J. Holliday - Geisterjägerin« bietet die perfekte Mischung aus Spannung und Humor. Ein Muss für alle Romantic-Fantasy-Fans!
In einem Internat am Lake Placid treibt ein Axt schwingender Geist sein Unwesen. Zusammen mit ihrem Partner Gilley und dem attraktiven Dr. Steven Sable versucht M. J. Holliday, ihn durch ein Portal ins Jenseits zurückzuschicken. Kein leichter Job, denn dieser Geist ist der mächtigste, dem M. J. jemals begegnet ist. Während einer mörderischen Jagd fliegen zwischen ihr und dem charmanten Dr. Sable immer heftiger die Funken ...
»Ein fantastischer Lesespaß. Die spannende Krimihandlung mit ihren gefahrvollen Ermittlungen, der Hauch Romantik und die kräftige Prise Humor garantieren, dass der Leser dieses Buch so bald nicht mehr aus der Hand legt.« DARQUE REVIEWS
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
VICTORIA LAURIE
M.J. Holliday:
Geisterjägerin
Gespenster küsst man nicht
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Christine Blum
Zu diesem Buch
M. J. Holliday wird angeheuert, mysteriöseÜbergriffe an einer exklusiven New Yorker Schule zu untersuchen. Ein Axt schwingender Geist soll hier sein Unwesen treiben. Zusammen mit dem Computerspezialisten Gilley, dem attraktiven Dr. Steven Sable und dem zuweilen eifersüchtigen Papagei Doc macht sich M. J. auf, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Doch der Leiter der Schule befürchtet, dass M. J.s Ermittlungen die Presse anlocken und für negative Schlagzeilen sorgen könnten, und will daher jegliche Nachforschun-gen verhindern. Zum Glück hat Karen O‘Neal, die Auftraggeberin und Tante einer gepeinigten Schülerin, ihre ganz eigenen Methoden, ihn von der Notwendigkeit einer Geisteraustreibung zu überzeugen. Doch damit sind die Probleme noch längst nicht aus der Welt, denn keiner an der Schule will zugeben, etwas über das Gespenst zu wissen. Dabei treibt Hatchet Jack hier schon seit Jahren sein Unwesen. Selbst andere Geister haben Angst vor ihm. M. J. darf keine Zeit verlieren, den gefährlichen Jack zu bannen. Und während immer mehr Geheimnisse ans Licht kommen, plant jemand einen Mord, um die Wahrheit auch weiterhin zu verbergen …
Für Jim McCarthy –
Agent, Muse und Freund
1
»Er ist spät dran«, knurrte Gilley, mein Geschäftspartner und bester Freund, und starrte düster aus dem Fenster. »Jeden Tag kriegt er ein Riesentrinkgeld von mir, und was ist der Dank?«
Ich löste den Blick von dem Zeitschriftenartikel, den ich gerade las, und sah auf die Uhr. Es war zwei Minuten nach zehn.
»Oh Mann«, sagte ich sarkastisch. »Er ist zwei geschlagene Minuten zu spät! Mein Gott, wie hältst du das nur aus?«
Gil drehte sich zu mir um, und seine ganze Wut auf den Boten verlagerte sich auf mich. »M.J.«, grollte er, »ich verlange von diesem Kerl nur eine winzige Gefälligkeit, nämlich, dass er mir täglich um Punkt zehn eine Cola light und einen Bagel mit Frischkäse liefert. Nicht so um zehn rum. Oder kurz nach zehn. Oder irgendwann zwischen acht und zwölf. Um Punkt zehn, das heißt, nicht später als …«
Ich verdrehte die Augen und wandte mich wieder dem Artikel zu. Bis Gil ein paar Schlucke von seiner Cola light gehabt hatte, war es sinnlos, ein anständiges Gespräch mit ihm führen zu wollen. Ebenso sinnlos war es, ihm ein paar Vorschläge zu machen, wie es sich umgehen ließe, jedes Mal auf Entzug zu kommen, wenn der Bagel-Bote sich verspätete – er könnte zum Beispiel im Besenschrank einen Vorrat an Cola light bunkern oder sich schon auf dem Weg zur Arbeit eine kaufen. Nein, Gil wollte den morgendlichen Ablauf genau so haben, wie er war, einschließlich des Ausrasters, wenn sein Frühstück nicht pünktlich vor ihm stand. Ich hatte den starken Verdacht, dass er nur deshalb so an dieser Routine klebte, weil der Bote so schnuckelig war. Dass dieser definitiv nicht schwul war, störte Gil nicht; er flirtete trotzdem mit ihm.
Gil begann ungeduldig in meinem Büro hin- und herzustapfen, was furchtbar störend war, aber ich verkniff mir tunlichst, etwas dagegen zu sagen.
»Doc ist ein hübscher Vogel!«, krähte mein Graupapagei. »Doc will Schokopops!«
Ich lächelte während des Lesens in mich hinein. Doc hatte es drauf, die Spannung zu lockern. »Doc Sahneschnitte! Doc Sahneschnitte!«, krähte er aufgeregt.
Ich hob den Blick und sah Doc an. »Ist er da?«
Zur Antwort öffnete sich die Eingangstür unseres Büros, und aus dem Foyer ertönte ein »Guten Morgen!«.
Gil ließ das Herumtigern und gab sich sichtlich Mühe, eine entspanntere Miene aufzusetzen. »Wir sind hier«, rief er.
Rasch ließ ich meine Zeitschrift in einer Schublade verschwinden, zog meinen Laptop heran und legte die Finger auf die Tasten. Im nächsten Moment trat – über eins achtzig, dunkelhaarig und zum Anbeißen – Dr. Steven Sable durch die Tür, der dritte Partner unseres Geisterjäger-Unternehmens. »Hallo, Team«, sagte er mit seinem samtigen Bariton, der von einem spanisch-deutschen Akzent gefärbt war.
»Morgen«, sagten Gil und ich im Chor.
»Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass du heute Morgen kommst«, fügte ich hinzu. »Hast du nicht Vorlesungen?« Steven war im aktuellen Sommersemester, das gerade begonnen hatte, Gastdozent für kardiovaskuläre Thoraxchirurgie an der University of Massachusetts.
»Die fallen aus. Im Hörsaal gab es einen Wasserrohrbruch. Er wurde überschwemmt, und die Verwaltung hat die Lehrveranstaltungen vorerst abgesagt.«
»Es ist Juni«, wunderte sich Gil. »Wie kann im Juni ein Wasserrohr platzen?«
»Das weiß ich nicht«, sagte Steven und setzte sich mir gegenüber. Kurz sahen wir uns an, und es knisterte heftig.
»Oh, der Verband ist ab«, sagte ich, als mir seine vernarbte, noch leicht geschwollene Hand auffiel. Bei einer unglücklich verlaufenen Geisterjagd vor einigen Wochen war er von einer Kugel getroffen worden.
Steven drehte die Hand nach allen Seiten. »Ist so gut wie neu.«
»Freut mich für dich«, sagte ich. »Und schön, dass du da bist, aber leider ist heute nicht viel los. Keine Geisterjagd in Sicht, fürchte ich.«
»Keine neuen Fälle?«
»Nicht ein einziger«, sagte Gil. »Scheint, als wäre gerade Flaute.«
»Was ist mit den Hendersons?«, fragte Steven. Das war unser letzter Fall gewesen. »Hatten sie noch Probleme?«
»Nein«, sagte ich. »Ach, Mrs Henderson hat uns zum Dank einen Obstkorb vorbeischicken lassen. Das Haus war jetzt zwei Wochen lang ganz friedlich.«
»Also volle Hose«, sagte Steven. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass Englisch seine fünfte Sprache ist, und manchmal hapert es heftig.
Ich schielte zu Gil hinüber und bemerkte, dass er angefangen hatte zu schwitzen. Der Wanduhr nach hatte seine Cola jetzt offiziell zehn Minuten Verspätung. »Gil«, sagte ich sanft. »Fahr doch zum Imbiss und hol dir dein Frühstück.«
Gil nickte nur kurz und eilte davon.
»Was hat er denn?«, fragte Steven.
»Er braucht um Punkt zehn seinen Koffeinschub. Wenn nicht, müssen wir es alle ausbaden.«
»Oh, dann haben wir ja ein paar Minuten für uns«, meinte er mit vielsagendem Blick.
Ich verkrampfte mich. Als er aufstand und um den Schreibtisch herumkam, hob ich mahnend den Finger. »Aber, aber … Steven«, protestierte ich. Doch er drehte meinen Stuhl um hundertachtzig Grad und beugte sich über mich, bis seine Lippen dicht über meinen schwebten.
»Wo ist das Problem, M.J.?«, fragte er. »Wir sind allein. Gilley holt sich seine Koffeinspritze, es sind keine Klienten da …«
In diesem Moment hörten wir die Eingangstür.
Steven seufzte und streifte ganz leicht meine Lippen. Dann richtete er sich auf und spähte ins Foyer.
Ich rief: »Hallo?«
»Es ist deine Freundin«, flüsterte Steven. »Die, bei der die Männer kollabieren.«
Ich sah ihn ratlos an, aber dann war die Sache klar, denn Karen O’Neal betrat das Büro. Als Gilley sie damals kennenlernte, fand selbst er, dass sie umwerfend aussah – blond, blauäugig, gigantische Oberweite. Er gab ihr den Spitznamen TKO für »totaler Knock-out«, und der entwickelte sich mit der Zeit zu Teeko.
»Hi, M.J.«, sagte sie, als sie uns sah. »Hallo, Dr. Sable.«
Mir fiel sofort auf, dass Karen ziemlich mitgenommen wirkte, und ich war bestürzt, denn in all den Jahren hatte ich sie immer nur als die Ruhe selbst erlebt. Ich stand auf. »Hi, Teek. Was ist passiert?«
Karen lächelte steif. »Ist es so offensichtlich?«
Steven schob ihr einen Stuhl hin und setzte sich ebenfalls.
»Ich brauche eure Hilfe«, erklärte sie ohne Umschweife.
»Jederzeit«, sagte ich. »Egal was. Erzähl, und ich tue, was ich kann.«
Sie rang die Hände. »Es geht um meine Nichte.« Also um die vierzehnjährige Evie O’Neal. »Sie ist überfallen worden.«
»Oh Gott!«, stieß ich aus. »Teeko, wie schrecklich! Das tut mir furchtbar leid.«
Karen nickte. Sie hatte sichtlich Mühe, ihre Emotionen im Zaum zu halten. »In der Schule«, sagte sie heiser, den Blick auf ihre Hände gerichtet. »Sie kann kaum darüber reden.«
»Ist sie verletzt?«
Karen sah auf. In ihren Augen spiegelten sich Qualen. »Bei Gott, ich hoffe nicht, M.J.«
»Haben sie den Kerl gekriegt?«
Karen schüttelte den Kopf. »Genau deswegen brauche ich eure Hilfe. Man konnte aus Evie nichts weiter herausbekommen, als dass ein Mann mit einer Axt sie gegen Ende der ersten Stunde, so um acht herum, durch den Schulkorridor verfolgt hat. In einem alten, unbenutzten Klassenraum hat er sie in die Enge getrieben, und als er auf sie zukam, hat sie die Augen zugekniffen und geschrien. Dann hat sie gehört, wie neben ihr etwas gegen die Tafel prallte, aber als sie die Augen aufmachte, war niemand da.«
Ich legte den Kopf schief. »Wie lange hat sie gewartet, bis sie die Augen aufmachte?«
»Eine Sekunde höchstens. Sie sagte, sie habe die Augen aufgerissen, als sie das Geräusch hörte.«
»War die Tafel beschädigt?«
»Das weiß ich nicht. Mein Bruder wurde in die Schule gerufen, um Evie abzuholen. Sie ist völlig aufgelöst. Sie behauptet stur, den Mann gesehen zu haben, aber …« Karen verstummte.
»Aber was, Karen?«, fragte ich sanft.
Sie seufzte. »Anfang des Schuljahres sind in allen Klassenzimmern und Gängen Überwachungskameras installiert worden. Die Aufnahmen wurden nach dem Vorfall natürlich angeschaut. Mein Bruder sagt, man sehe deutlich, wie Evie den Korridor entlangrennt, als ob sie verfolgt würde, und dann starrt sie in dem Klassenraum etwas an, was ihr offenbar Entsetzen einjagt. Aber auf keiner Aufnahme ist ein Mann mit einer Axt zu sehen. Oder überhaupt irgendein Mann. Sie ist vollkommen allein.«
Meine Neugier war geweckt. »Hast du das Band gesehen?«
»Nein, noch nicht. Evie hat mich gerade vom Auto aus angerufen, und da hat sie so geweint, dass ich kaum verstehen konnte, was sie sagte. Weil ich sie nicht beruhigen konnte, habe ich sie gebeten, mir Kevin zu geben.« Karen seufzte. »Der ist mit seiner Geduld am Ende. Nicht, dass er jemals viel davon hatte.«
Ich behielt meine Meinung über Karens Bruder für mich, auch wenn es mich juckte, einen ähnlichen Kommentar abzugeben. »Was will er jetzt tun?«, fragte ich mit einem unguten Gefühl im Magen.
Karen warf verärgert die Hände in die Luft. »Ach, mein Idiot von Bruder! Er ist überzeugt, dass Evie eine Art Psychose hat und halluziniert, und überlegt schon, sie zum Psychiater zu schleppen!«
Ich runzelte die Stirn. Ich wusste, dass Karen und ihre Nichte sich sehr nahestanden, und auch, wie skeptisch Karens Bruder allem gegenüber war, was sich nicht mit wissenschaftlichen Methoden präzise messen ließ. Er glaubte weder an Geister noch an Hellseher oder irgend etwas Spirituelles. Ich hatte ihn erst einmal getroffen und sofort eine Abneigung gegen ihn gefasst. »Ich werde dir helfen, so gut ich kann«, wiederholte ich. »Sag mir einfach, was ich tun soll.«
»Ich will dich anheuern.« Sie griff in die Handtasche nach ihrem Scheckbuch. »Ich will, dass du diesen Dämon aufspürst, oder was immer es war, und dann sollst du ihn zur Hölle schicken, wenn das irgend geht.«
Steven und ich tauschten einen Blick. Er zuckte kaum merklich die Schultern, wie um zu sagen: Warum nicht?
»Du musst mich nicht anheuern«, sagte ich. »Das ist doch eine Selbstverständlichkeit.«
Steven hustete laut und starrte mich mit geweiteten Augen an. Karen lächelte. »Sei nicht bescheuert. Du brauchst das Geld, und ich brauche deine professionellen Dienste als Geisterjägerin. Ich zahle dafür, oder das Geschäft ist gestorben.«
Ich hob die Hände. »Okay. Von mir aus. Wie du meinst.«
Karen zog die Kappe von ihrem Tintenschreiber. »Gut. Schön, dass du so einsichtig bist. Wie hoch ist dein Honorar?«
»Hundert Dollar pro Tag.«
Steven bekam wieder einen Hustenanfall, und ich warf ihm einen warnenden Blick zu. Es kam nicht infrage, von meiner Freundin den vollen Preis zu verlangen.
»Tatsächlich?«, fragte Karen skeptisch. »Auf deiner Website heißt es zweihundertfünfzig pro Tag.«
»Muss ein Tippfehler sein«, gab ich leichthin zurück.
»Halte mich nicht für blöd«, sagte Karen und kritzelte etwas in das Zahlenfeld auf dem Scheck. Mit einem kräftigen Ruck riss sie ihn aus dem Block, stand auf und reichte ihn mir. »Das sollte für etwa eine Woche reichen. Und denk bloß nicht daran, ihn nicht einzulösen.«
Ich warf einen Blick auf den Scheck. Für mein Gewissen enthielt er viel zu viele Nullen. Ich öffnete schon den Mund, um zu protestieren, da hob Karen gebieterisch die Hand. »Nein, keine Widerrede, M.J., Geschäft ist Geschäft.«
»Aber Teek–«
»Nein«, sagte sie eisern. »Wir sind quitt. Ich rufe dich in einer Stunde an und gebe dir Bescheid, wann wir losfahren können. Die Schule liegt im Hinterland von New York, ganz in der Nähe von Lake Placid. Wenn wir heute Abend losfahren, können wir auf halber Strecke in einem netten Hotel übernachten, das ich kenne. Ist es für dich okay, ein Zimmer mit mir zu teilen?«
»Natürlich.« Ich warf einen Blick auf Steven. »Sofern du nichts dagegen hast, ein Zimmer mit Gilley zusammen zu nehmen?«
»Das ist kein Problem«, sagte er zuvorkommend.
Karen schenkte ihm ein Lächeln. »Perfekt. Dann buche ich zwei Doppelzimmer. Wenn wir um fünf abfahren, sind wir gegen elf dort. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass es so weit weg ist?«
»Nein, überhaupt nicht«, sagte Steven. »Dann können wir den neuen Van einweisen.«
»Einweihen«, berichtigte ich behutsam.
»Was ist der Unterschied?«, fragte er.
»Nach deiner Variante würden wir ihn in die Klapse befördern.« Ich drehte mich zu Karen um. »Wir werden die Erlaubnis der Schulleitung brauchen, Teek.«
»Überlass das mir«, sagte sie resolut.
»Ich muss auch mit Evie reden«, fügte ich hinzu.
»Kein Problem, das geht klar. Kevin und seine Frau wohnen etwa eine Stunde von der Schule entfernt. Und etwa zwanzig Minuten von der Schule entfernt hat meine Familie eine Skihütte. Die ist groß genug für uns alle. Wir können sie als Basislager nehmen.«
»Bist du sicher, dass Kevin mich an seine Tochter ranlassen wird?«
»Dafür sorge ich schon, glaub mir.«
In diesem Augenblick kam Gilley von seinem Ausflug zum Imbissstand zurück. Er war in Begleitung des Bagelboten und flirtete mit ihm auf seine typische Art. »Ach, schon okay, Jay«, sagte er gerade. »Jeder kann mal seinen Wecker verschlafen.« Als er Karen durch die Bürotür erspähte, rief er: »Teeko! Schön, dich zu sehen, Darling. Ach, was seh’n die Mädels heute prächtig aus. Der Pulli ist toll.« Er machte eine ausladende Geste. »Einfach spektakulär, diese Einblicke.«
Ich räusperte mich laut, weil mir klar war, dass Karen heute nicht in der Stimmung für Gilleys Komplimente war. Karen lächelte ihm dennoch zu. »Hi, Gil. Ich denke, M.J. wird dich über alles informieren. Wir hören uns in einer Stunde«, schloss sie und entschwand durch die Tür.
Gil warf mir einen neugierigen Blick zu, während der Bote geduldig darauf wartete, dass Gil Bagel und Cola bezahlte. Ich stand auf. »Tank den Van auf, Gil. Wir haben einen Auftrag!«
Gilley aß erst genüsslich seinen Bagel und trank die Cola, bevor er nach draußen zum Van ging, um schon mal Teile unserer Ausrüstung einzuladen.
Ein gewaltiges Plus bei Stevens Teilhaberschaft war seine finanzielle Unterstützung, die es uns ermöglicht hatte, eine kaum überbietbare technische Ausrüstung für die Geisterjagd anzuschaffen. Wir besaßen zwei Nachtsichtkameras, zwei tragbare elektronische Wärmebildkameras, drei Elektrofeldmeter, mehrere Walkie-Talkies der neuesten Generation, einige Videomonitoren, Digitalkameras und Laptops und – nicht zu vergessen – einen glänzenden neuen Van, um das alles auch zu transportieren. Mit Steven war uns so etwas wie ein Weihnachtsmann für Technikfreaks ins Haus geschneit.
»Nimmst du den Vogel auch mit?«, fragte Steven, während ich mit einer Liste von Sachen, die wir einpacken mussten, in unserem Büro herumflitzte.
Ich nickte. »Ich kann ihn doch nicht allein hierlassen.«
Aus den Augenwinkeln sah ich Steven die Stirn runzeln. Ich sah von meiner Liste auf. »Was ist?«
»Nichts«, antwortete er auf eine Art, die ganz deutlich verriet, dass doch etwas war.
Ich seufzte. Offenbar musste ich es ihm aus der Nase ziehen. »Wirklich? Das sieht aber anders aus.«
»Ich finde nur, dass Doc manchmal ein Stimmungsmörder ist.«
Ich unterdrückte ein Grinsen. »Stimmungsmörder. Das klingt gefährlich.«
Steven erhob sich von seinem Stuhl, kam ganz nahe heran und fuhr sanft die Linie meines Kinns nach. »Weißt du noch, als ich das letzte Mal bei dir war?«
Ich erinnerte mich schmunzelnd, wie er mich in meiner Wohnung besuchte und Doc ihn im Sturzflug attackierte, als er zärtlich werden wollte. »Gut, da war er ein bisschen eifersüchtig«, sagte ich. »Er muss sich erst an dich gewöhnen.«
Steven seufzte. »Nun gut.« Er küsste mich flüchtig und trat zurück. »Ich gehe jetzt nach Hause und packe für die Reise. Um fünf bin ich wieder da.«
Ich nickte und wandte mich wieder meiner Liste zu. Als ich fast alles gepackt hatte, kam Gilley herein. »Puh, ist das nass draußen!«, rief er und schüttelte sich den Regen vom Mantel.
»Hast du den Wetterbericht gehört?«, fragte ich.
Gil verzog das Gesicht und stöhnte. »Ja. Soll bis nächsten Dienstag regnen.«
»Ideales Geisterjagdwetter«, sagte ich. Meine unbeständigen Freunde lieben Regen. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto leichter können sie sich sichtbar machen.
»Ja, okay, aber wir haben ein paar lange, kalte Nächte vor uns. Menschenskinder, es ist Juni!«
Ich verdrehte die Augen. »Wir haben gerade mal Mitte Juni, Gil. Und wir sind in Neuengland. Du weißt doch, dass man hier wettermäßig immer mit allem rechnen muss.«
Gils Miene hellte sich auf. »Vielleicht ist es in New York nicht so schlimm.«
Ich lächelte bedauernd. »Tut mir leid, Kumpel. Ich hab nachgeschaut. Die Regenfront wandert genau in unsere Richtung. Sieht so aus, als würde sie uns auf dem Trip Gesellschaft leisten.«
»Wir brauchen unbedingt mal Urlaub«, grübelte Gil. »M.J., was hältst du davon: Wenn wir mit dem Auftrag fertig sind, buchen wir Cabo San Lucas oder so was.«
»Ich dachte, wir hätten gerade einen finanziellen Engpass?«
Gilley warf mir einen Seitenblick zu. »Ich hab die Bilanz ein bisschen aufpoliert.«
Da horchte ich auf. »Du hast was?«
»Ach, nichts Besonderes«, sagte er und spielte mit dem Reißverschluss seines Mantels.
»Gil«, sagte ich ruhig. »Was ist da gelaufen?«
»Na ja, unser guter Doktor hat wohl irgendwie unserer Portokasse ’ne kleine Geldspritze verpasst. Nur für den Notfall.«
»Und wie groß bitte ist die kleine Geldspritze?«
Gil murmelte etwas Unverständliches.
Ich legte ihm die Hand auf die Schulter. »Wie groß?«
»Zehntausend.«
»Was?«, japste ich. »Gilley Gillespie, du gibst dieses Geld sofort zurück!«
»Nein«, sagte er halsstarrig, schob meinen Arm weg und flüchtete hinter seinen Schreibtisch.
Ich stellte ihn in seinem Bürostuhl und ließ nicht locker. »Das ist kein Scherz, Gil! Du gibst jeden Cent dieses Geldes zurück!«
»Können wir ihn nicht einfach mit nach Cabo einladen?«
»Ja, das würde dir gefallen«, fauchte ich. »Garantiert würde er da auch deine Portokasse aufbessern!«
»Was schadet’s denn, M.J.? Der schwimmt im Geld! Und er hat doch nicht in unsere kleine Firma investiert, weil er ein riesiges Gewinnpotenzial darin sieht!«
»Du nutzt seine Großzügigkeit aus, und da mache ich nicht mit.«
»Ich nutze überhaupt nichts aus«, beharrte Gil. »Für ihn sind wir ’ne Art Freizeitvergnügen. Ich bin also dafür zuständig, dass ihm nicht langweilig wird, und wenn er mich dafür großzügig entlohnt, ist das seine Sache.«
»Na großartig«, versetzte ich. »Dann solltest du ab morgen in Stilettostiefeln und Leopardenmini erscheinen, denn du bist gerade dabei, uns zu prostituieren.«
»Ach, komm schon, M.J.!«, wehrte er ab. »So darfst du nicht denken. Sieh’s doch so, dass wir jetzt einen Mäzen haben.«
»Einen Mäzen!« Dann gab ich ihm wortlos zu verstehen, dass er wohl nicht mehr richtig tickte.
»Oh ja!«, beharrte Gil im Brustton der Überzeugung. »Was wir machen ist selten und außergewöhnlich, und man braucht ein gewisses Maß an Talent, um solche Dienste anbieten zu können. Also ist es Kunst, würde ich sagen.«
Ich verdrehte ausgiebig die Augen und schüttelte den Kopf. »Und der kleine Tanz, den du jeden Morgen aufführst, bevor dein Bageltyp kommt, ist dann wohl deine Auffassung von Performance-Art, hmmm?«
»Wenn wir dafür zehn Riesen in die Portokasse kriegen, können wir es nennen, wie’s der gute Doktor will.«
Ich sah ihn eindringlich an. »Gil.«
»Hm?«
»Gib das Geld zurück!«
Gilley seufzte so abgrundtief verzweifelt, als hätte man ihm gerade gesagt, dass er unheilbar krank sei. »Naaaa guuuut«, sagte er und ging mit wütenden Schritten hinaus, um den Van weiter zu beladen.
Später am Nachmittag waren wir dann unterwegs. Gil saß am Steuer und folgte Teekos Mercedes in geringem Abstand. Steven saß auf dem Beifahrersitz, ich hatte mich nach hinten verzogen und testete unsere Geräte.
»Und wie macht sich die neue Wärmebildkamera?«, fragte Steven.
»Sie ist einfach genial!« Ich hielt den Apparat hoch und blickte aufs Display. Das Gerät zeigte Temperaturunterschiede durch verschiedene Farben an. Anhand der Wärme oder Kälte, die sie abstrahlen, konnte man die Form von Menschen oder Gegenständen erkennen. Steven und Gilley leuchteten in verschiedenen Gelb- und Rottönen, ihre Kleidung hatte einen etwas kühleren Ton. »Ich liebe dieses Ding«, sagte ich und richtete es aufs Fenster. Die Landschaft entfaltete sich in kühlem Blau und Grün mit einem Hauch Gelb, aber ein Stück vor uns war direkt neben der Straße deutlich eine Person zu sehen, die ziellos auf und ab lief.
Als wir daran vorbeikamen, senkte ich die Kamera und schaute, aber niemand war zu sehen. Hastig drehte ich mich um und hielt sie mir wieder vor die Augen. Als ich sie scharf gestellt hatte, konnte ich im Display den Umriss eines Menschen klar erkennen, aber körperlich war niemand dort.
»Gilley!«, schrie ich. »Fahr rechts ran!«
Gil trat hart auf die Bremse, und wir kamen leicht schleudernd auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Eines unserer Funkgeräte piepste, und Teekos Stimme fragte: »Was ist los?«
»M.J. hat mich angeschrien, ich solle rechts ranfahren«, erklärte Gilley durchs Funkgerät.
»Da hinten ist jemand«, sagte ich, während ich weiter das Wärmebildgerät hochhielt und die Gestalt am gegenüberliegenden Straßenrand beobachtete.
»Wo?«, fragte Steven und spähte mit zusammengekniffenen Augen über die öde Landschaft.
»Da.« Ich hielt das Gerät so, dass sie beide hindurchschauen konnten.
»Wow«, sagte Gil.
»Cool«, fügte Steven hinzu.
Ich löste meinen Gurt. »Ich gehe jetzt hinüber.«
»Warte, M.J.«, sagte Gil. »Es ist kaum Verkehr. Ich versuche mal ein Stück zurückzufahren.« Vorsichtig begann er auf dem Seitenstreifen rückwärtszufahren. Leider war genau das der Augenblick, wo ein Streifenwagen um die Kurve bog.
»Mist«, sagten wir alle gleichzeitig.
Das Funkgerät piepte wieder. »Ihr sitzt hochoffiziell in der Scheiße, Leute«, sagte Teeko. Wie auf Kommando ging das Blaulicht des Wagens an, und er stellte sich genau hinter uns auf den Seitenstreifen.
»Na toll, jetzt steigt meine Versicherung!«, jammerte Gil und suchte in seiner Geldbörse nach Führerschein und Versicherungskarte.
Ich blickte aus dem Fenster über den Highway hinweg und öffnete mich meinem sechsten Sinn. Als ich im Solarplexus ein leichtes Ziehen spürte, wusste ich, dass ein erster Kontakt zwischen mir und dem Geist hergestellt war. Er irrte orientierungslos im Kreis, und mich erreichte das vertraute Gefühl der Panik, das ich manchmal bei gestrandeten Seelen spüre. »Ich muss hin und ihm helfen.«
»M.J.«, knurrte Gilley. »Du bleibst gefälligst hier, bis wir das mit der Polizei geklärt haben.«
Ich reichte Gilley das Wärmebildgerät. »Aber er ist in Panik, Gil. Schau mal, wie er im Kreis läuft!«
Gil hielt das Gerät in die Höhe. Im nächsten Moment wurde mir klar, was für eine bodenlose Dummheit ich begangen hatte. »Waffe fallen lassen!«, brüllte der Cop, der direkt vor dem Van stand, und hob seinen großen silberglänzenden Revolver.
Gilley quiekte erschrocken und ließ das Gerät fallen. »Nicht schießen!«, jaulte er. »Nicht schießen!« Wir hoben alle drei die Hände.
»Raus aus dem Wagen, einer nach dem anderen, und lassen Sie die Hände oben, wo ich sie sehen kann!«, befahl der Cop.
»Der legt uns um!«, heulte Gilley.
»Mach einfach, was er sagt, Gil«, sagte ich ruhig. »Das wird sich schon regeln, sobald ihm klar wird, dass wir unbewaffnet sind.«
Zitternd wie Espenlaub öffnete Gilley langsam die Vantür und stieg aus. »Ich als Nächster«, sagte Steven, während der Polizist Gilley bereits unsanft mit dem Gesicht zum Van drehte. »Vielleicht findet der Officer ja das Kleingeld in meiner Hosentasche und lässt uns gehen?«
»Steven!«, zischte ich. »Denk nicht mal daran, ihn zu schmieren!«
»Warum nicht?«
»So läuft das hier nicht!«, zischte ich zurück, verstummte aber sofort, als der Polizist den Kopf in den Van steckte und mit dem Revolver auf Steven zielte. »Sie da – rauskommen!«
Steven stieg aus und ging mit erhobenen Händen um die Motorhaube herum. Da piepste wieder das Funkgerät, und Karen sagte: »Ich rufe meinen Anwalt an. Ihr drei bleibt erst mal ganz ruhig und kooperativ.«
Nicht, dass ich die Ermahnung brauchte. Der Cop drängte auch Steven gegen die Seite des Vans und klopfte ihn mit der freien Hand nach Waffen ab. Dann gab er mir ein Zeichen, und ich stieg ebenfalls aus. »Wir sind unbewaffnet«, sagte ich, während ich mit Gewalt umgedreht und mit der Brust gegen den Van gestoßen wurde.
»Ich hab’s doch gesehen«, knurrte der Cop und tastete auch mich ab, wobei er an einer gewissen Stelle ein bisschen länger verweilte.
Ich verzog angewidert das Gesicht, aber es gelang mir, meinen Ton ruhig zu halten. »Das Gerät, das Sie für eine Waffe gehalten haben, ist eine Wärmebildkamera. Die brauchen wir für unsere Arbeit.«
»Ach ja?«, fragte der Cop sarkastisch. »Oh, ich bitte um Verzeihung. Dann fahren Sie mal schön weiter und schönen Tag noch.«
»Wirklich?«, fragte Gilley voller Hoffnung.
»Träumen Sie weiter!«, gab der Cop zurück.
»Verzeihung, Officer«, sagte Steven. »Aber ich glaube, Sie haben etwas in meiner hinteren Hosentasche vergessen, als Sie mich gekämmt haben.«
»Gekämmt?«, wiederholte der Cop.
»Er meint gefilzt«, sagte ich und warf Steven einen warnenden Blick zu. »Und nein, Sie haben nichts in seiner Tasche vergessen. Er kommt aus Argentinien. Da geht man mit Situationen wie dieser hier anders um.«
Aber der Polizist hatte schon in Stevens Gesäßtasche gegriffen und hielt ein dickes Bündel Scheine in der Hand. Einen Moment lang sagte niemand ein Wort. Dann nahm der Cop die Handschellen vom Gürtel und legte sie Steven an. »Sie sind verhaftet, Freundchen.«
»Huu-huu«, ertönte eine zarte weibliche Stimme. Ich drehte den Kopf. Nicht weit von unserem Van stand Teeko. Ihr Mohairpullover war leicht zur Seite verrutscht, sodass eine Schulter zu sehen war, und die Haare hatte sie sich hochtoupiert.
Der Cop ließ die Handschellen fest einrasten und trat einen Schritt zurück. »Das ist nicht Ihre Angelegenheit, Ma’am«, sagte er, aber sein Ton war schon nicht mehr ganz so barsch.
Karen lachte kurz auf und warf ihre Haare zurück. »Oh, ich kann mir vorstellen, was Sie denken. Aber ich kann Ihnen versichern, dass das hier keine Kriminellen sind. Sie sind Geisterjäger, und ich habe sie für diese Woche angeheuert.«
Der Polizist schien das erst einmal verdauen zu müssen. »Sie kennen diese Leute?« Die Neigung seines Kopfes ließ mich ahnen, dass er mit ihrem Busen redete.
Karen lachte noch einmal und machte eine Bewegung mit den Schultern, die ihre Oberweite noch stärker betonte. »Ich fürchte, ja. Ich kann sie nirgendwohin mitnehmen, ohne Aufsehen zu erregen.«
Genau in diesem Moment spürte ich ein deutliches Ziehen in meinem Solarplexus und dicht neben mir eine Präsenz. »Kennt jemand hier einen Randy Donald oder Donaldson?«, fragte ich. Der Name war mir in den Kopf geschossen, und ich sprach ihn aus, ohne mir überhaupt bewusst zu machen, was ich da sagte.
Der Cop fuhr herum. »Was sagen Sie da?«
Ich schloss die Augen. Randy stand genau neben mir und schrie mich an, ich solle seinen Namen sagen. »Randy Donaldson«, wiederholte ich langsam. »Er sagt, es habe hier einen Unfall gegeben und er habe Verstärkung angefordert. Er meint, Sie seien spät dran.«
Als ich die Augen wieder öffnete, war der Cop blass geworden. Er blinzelte träge, dann schaute er sich um und schien zum ersten Mal wahrzunehmen, wo wir uns befanden. Schließlich schaute er über die Fahrbahn genau zu der Stelle, wo ich mit der Wärmebildkamera den Geist entdeckt hatte.
Randy schimpfte immer weiter und so laut, dass es allmählich lästig wurde. »Er sagt, er müsse nach Hause zu Sarah und dem Baby. Das Baby hat einen schlimmen Husten, und er macht sich Sorgen.«
Der Cop – MICHELSON stand auf dem Namensschild – drehte ruckartig den Kopf zu mir. Sein Mund stand leicht offen. »Woher wissen Sie das?«
Karen trat vorsichtig einen Schritt vor. »Das hier ist M.J. Holliday. Sie ist medial begabt. Ich glaube, sie spricht gerade mit dem verstorbenen Randy Donaldson.«
»Randy war Polizist«, sagte ich, weil in meinem Geist das vertraute Abzeichen aufblitzte. »Er sagt, eine Frau sei bei einem Unfall verletzt worden. Er hat Verstärkung und einen Rettungswagen angefordert, aber er kann die Frau und den Rettungswagen nicht mehr finden.«
»Okay«, sagte der Cop wütend, trat ein paar Schritte zurück und richtete wieder die Waffe auf uns. »Es reicht! Und das gilt für alle. Ich rufe jetzt Verstärkung, und bis sie kommt, drehen Sie sich gefälligst alle zum Wagen um und halten den Mund!«
Karen stellte sich gehorsam an den Van und legte die Hände darauf. »Das Wärmeding ist noch im Van, oder?«, fragte sie Gilley flüsternd.
»Auf dem Fahrersitz«, bestätigte er.
»Officer«, sagte Karen ruhig. »Auf dem Fahrersitz liegt die Wärmebildkamera. Nehmen Sie sie ruhig, und prüfen Sie nach, wovon M.J. spricht.«
Aus den Augenwinkeln sah ich den Cop zögern; er hatte schon das Mikrofon des Funkgeräts am Mund. Randy indessen stand immer noch dicht hinter meiner rechten Schulter, benommen, verwirrt und fuchsteufelswild, weil die Verstärkung so lange gebraucht hatte. »Randy sagt, er habe jetzt genug Zwangsüberstunden gemacht. Er sagt, es stinkt ihm gewaltig, dass er Weihnachten Dienst schieben muss.«
Der Cop keuchte verblüfft, dann spähte er in den Van. Er hob das Wärmebildgerät auf und nahm es in Augenschein. »Randy steht rechts hinter mir«, sagte ich. »Wenn Sie die Kamera hochhalten, sehen Sie unsere Umrisse. Schauen Sie sich erst mal zur Probe die drei anderen an, und richten Sie sie dann auf mich.«
Der Cop wich ein Stück zurück und betrachtete durch die Kamera unser Grüppchen vor dem Van. Als er zu mir schwenkte, erschrak er. Randy wurde immer aufgebrachter. Es regte ihn fürchterlich auf, dass er niemanden außer mir dazu bringen konnte, ihm zuzuhören. Er brüllte den Cop an, dann stapfte er auf ihn zu. Der Cop ließ das Gerät fallen und hob die Waffe. »Wie ist das möglich?«, fragte er, als er niemanden sah.
»Randy ist am Weihnachtsabend gestorben«, erklärte ich ruhig. »Er war zu einem Autounfall mit einer verletzten Frau gerufen worden. Die Straßen waren vereist, oder?«
Der Cop nickte perplex. »Es gab eine Menge Unfälle den ganzen Highway entlang.«
»Dann ist etwas passiert«, sagte ich und konzentrierte mich darauf, was Randy mir beschrieb. »Er sagt, er habe die Frau in dem Auto untersucht. Sie sei nicht lebensgefährlich verletzt gewesen, habe aber eine große Platzwunde an der Stirn gehabt. Er hat Verstärkung gerufen und war dabei, die Warnleuchten aufzustellen, als …« Ich stockte. Das Bild in meinem Kopf wurde überwältigend, und ich sah ein Paar Frontscheinwerfer auf mich zukommen.
»… ein anderes Auto ihn erfasst hat«, sagte der Cop.
»Er sitzt hier fest«, sagte ich. »Er glaubt, er wäre noch am Leben, Officer.«
Michelson senkte die Waffe und steckte sie zurück ins Halfter. Dann ging er zu Steven, löste dessen Handschellen und gab ihm die Geldscheine aus seiner Hosentasche zurück.
»Entschuldigung«, sagte Steven kleinlaut.
Michelson sah mich an. Er wirkte gepeinigt. »Sie müssen ihm helfen. Er war mein bester Freund, Ma’am.«
»Dann muss ich dorthin.« Ich zeigte auf die Stelle, wo der Unfall passiert war. »Darf ich die Hände runternehmen und hinübergehen?«
Er nickte. »Ja, sicher.«
Teeko schenkte mir ein erleichtertes Lächeln, aber Gilley hatte nicht aufgehört zu zittern. »Ist schon gut, Gilley«, sagte Steven. »Wir werden doch nicht erschossen.«
Ich wartete das nächste Auto ab und rannte über die Straße. Ein Stück links von mir sah ich noch eine Scherbe von einem Rücklicht liegen und vor mir ein rostiges Stück Blech. Randy war mir gefolgt. Ich warf einen Blick zurück und sah, dass Gilley die Kamera auf mich gerichtet hatte. Alle – auch der Polizist – sahen ihm über die Schulter und beobachteten mich gespannt.
Ich schloss die Augen und sagte in Gedanken: Randy, ich weiß, dass Sie mich hören können. Und Sie sollen wissen, dass ich Sie auch hören kann.
Steigen Sie zurück in Ihr Auto, Ma’am. Hier auf dem Seitenstreifen ist es heute verdammt gefährlich, gab Randy zurück.
Ja, Randy, da haben Sie recht. Auf dem Seitenstreifen war es verdammt gefährlich, stimmte ich ihm zu.
Ich muss ein paar Warnleuchten aufstellen. Wenn doch der Streudienst endlich käme!
»Randy«, sagte ich laut. »Hören Sie mir bitte zu. Weihnachten ist vorbei.«
Bin froh, dass wenigstens Bruce da ist. Er soll die Gaffer weiterwinken, während ich die Warnleuchten aufstelle …
»Randy!«, rief ich scharf und fühlte, dass er mit einem Schlag aufmerksam wurde. »Letzte Weihnachten, als Sie die Warnlichter aufgestellt haben, da ist doch etwas passiert, oder?«
Randy schien zu zögern. Eine Frau hatte einen Unfall. Sie hatte eine große Platzwunde.
»Nein, Randy«, sagte ich geduldig. »Das meine ich nicht. Ich meine das, was passiert ist, während Sie die Warnlichter aufgestellt haben. Erinnern Sie sich?«
Da war ein Auto …, sagte er langsam und zuckte zusammen, als seine Erinnerung ihn zurücktrug. Es ist auf derselben vereisten Stelle ins Schleudern gekommen und hat mich erfasst.
Ich lächelte. »Sehr gut. Sie erinnern sich. Aber was als Nächstes kam, wissen Sie nicht mehr.«
Die Frau ist nicht mehr im Auto. Randy wurde wieder erregter. Wo ist sie hin? Ich habe einen Rettungswagen gerufen. Sie muss einfach weggefahren sein, während ich die Warnlichter aufgestellt habe!
»Nein, Randy, so war das nicht. Sie wurden von einem anderen Auto überfahren und sind gestorben.«
Guter Witz, sagte er. Stehe ich hier und rede mit Ihnen oder nicht?
»Ja, das tun Sie«, räumte ich ein. »Aber die Sache ist die: Ihre Seele hat den Unfall überlebt, Ihr Körper nicht. Sarah und das Baby haben Ihren Körper vor einem halben Jahr beerdigt, Randy.«
Ein heftiger Schauder durchlief ihn. Das kann nicht sein, sagte er, aber ich spürte, dass er es allmählich begriff.
»Randy«, sagte ich sanft. »Ihren Körper gibt es nicht mehr. Hier können Sie nichts mehr ausrichten. Wenn Sie auf mich hören und tun, was ich sage, kann ich Sie dorthin führen, wo Sie sein sollten. Möchten Sie das?«
Ich spürte, wie er nickte. Also fuhr ich fort. »Über Ihnen müsste ein helles Licht zu sehen sein. Wollen Sie mal nach oben schauen?«
Er staunte hörbar. Ja, ich seh’s!
»Sehr gut! Randy, jetzt kommt etwas sehr Wichtiges: Wenn ich es Ihnen sage, müssen Sie versuchen, dieses Licht geistig zu sich herabzuziehen. Sie werden sich dann vorkommen wie in einem Tunnel, oder vielleicht können Sie sogar einen Weg vor sich sehen. Der führt Sie nach Hause. Sie brauchen sich nur von dem weißen Licht tragen zu lassen. Dann sind Sie in null Komma nichts zu Hause.«
Aber Sarah …, protestierte Randy.
»Sie kommt schon klar«, versicherte ich ihm. »Ich glaube, Bruce wird sich darum kümmern, dass es ihr und eurer Tochter gut geht. Und von dort, wo Sie sein werden, können Sie jederzeit sehen, wie es ihnen geht. Würden Sie sie gern sehen, Randy?«
Ja, natürlich.
»Es ist sechs Monate her, dass Sie sie zuletzt gesehen haben, lieber Freund. Aber dort, wo Sie sein werden, können Sie Ihre Tochter aufwachsen sehen und sie beschützen, damit sie nicht in Schwierigkeiten kommt.«
Okay, sagte er. Ich bin bereit.
Ich trat einen Schritt zurück und schloss die Augen. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie sich ein riesiger Lichtball über ihn stülpte und ihn verschluckte. Im nächsten Moment war Randy weg.
Auf der anderen Straßenseite gab es Applaus. Ich öffnete die Augen. Gilley, Steven und Teeko jubelten mir zu, während Officer Michelson starr die Wärmebildkamera umklammerte und aussah, als hätte er gerade einen Geist gesehen. Aber wen wundert’s?
2
Kurze Zeit später fuhren wir weiter. Officer Michelson blieb ein bisschen verstört zurück. Wahrscheinlich würde ihn sein Weg nach Dienstschluss diesmal in die Bar führen. Gilley war also um den Strafzettel und Steven sogar um die Verhaftung herumgekommen.
»In Zukunft behalte deinen Packen Scheine in der hinteren Tasche, wo er hingehört«, sagte ich noch ziemlich sauer, weil er uns fast in einen Riesenschlamassel gebracht hätte.
»Kann ich meine Rolle Münzen in der vorderen Tasche auch behalten?«, fragte er schlagfertig. Gilley lachte schallend, aber ich ließ mich nicht so leicht ablenken. »Du kannst von Glück reden, dass der Cop beide Augen zugedrückt hat«, schimpfte ich.
»Du hast da exzellente Arbeit geleistet, M.J.«, sagte Gil. »Ich meine, du hättest mal das Display der Kamera sehen sollen, als dieser Bulle ins Jenseits überwechselte. Das war atemberaubend!«
»Wie sah’s denn aus?«, erkundigte ich mich neugierig.
»Na ja, man sah dich und den Umriss von Randy – er war grünlich blau mit einem winzigen Hauch Gelb außen rum. Aber dann gab es um ihn plötzlich einen gelben Blitz, und – schwupp! – weg war er!«
»Jep.« Ich nickte ihm durch den Rückspiegel zu. »Kommt ziemlich nahe an das heran, was ich vor meinem geistigen Auge gesehen habe.«
»Diese Wärmebildgeräte sind gut, hm?«, meinte Steven und hielt eines in die Höhe.
»Die sind der Hammer«, sagte Gil. »Ich hab fast einen Herzschlag gekriegt, als der Cop es fallen ließ. Ich dachte, jetzt ist es garantiert kaputt.«
Steven drehte die Kamera nach allen Seiten und untersuchte sie genau. »Scheint noch in Ordnung zu sein.«
»Gut zu hören«, sagte ich. »Das Ding hat enorme Vorteile, ich hätte es bei diesem Auftrag wirklich gern dabei.« Da kam mir ein Gedanke. Ich klappte den Laptop auf und begann zu tippen.
Gil beobachtete mich durch den Rückspiegel. »Was machst’n?«
»Ich schaue, ob ich was über dieses Internat finde, das Evie besucht. Vielleicht gibt’s ja irgendwo einen Hinweis, wer der Kerl mit der Axt sein könnte.«
Ich tippte den Namen der Schule ein und klickte auf den Link. Das Internat Northelm lag an einem großen Weiher in einem Tal am Fuß der Adirondack Mountains. Es war im frühen 19. Jahrhundert gegründet worden, und auf der Homepage waren unter den ehemaligen Schülern einige namhafte Persönlichkeiten aufgelistet, darunter zwei Gouverneure von New York, einige Kongressmitglieder und Senatoren und ein halbes Dutzend Journalisten und Schriftsteller.
Die Schule sah, ganz im Stil ihrer Umgebung, ungefähr wie eine sehr lange Skihütte aus. Es gab ein Hauptgebäude, in dem die Unterrichtsräume für die neunte bis zwölfte Klasse untergebracht waren, flankiert von zwei Nebengebäuden. In einem davon wurde die sechste bis achte Klasse unterrichtet, das zweite, der ehemalige Grundschulflügel, sollte bis Ende des Jahres zu einem großen Wohnheim für die Internatsschüler umgebaut werden.
Der Homepage zufolge hatte die Schule derzeit achtundneunzig Schüler und zweiundvierzig Schülerinnen. Knapp über hundert Kinder wohnten vollzeitlich dort. Das Schulgeld betrug um die 40000 Dollar, nicht eingerechnet natürlich diverse Zusatzausgaben, die sich jährlich auf weitere viertausend Dollar summierten.
Eine der Hauptattraktionen der Schule schien das Sportangebot zu sein. Es gab ein kilometerlanges Netz von Skipisten und Loipen, eine Eishalle, Tennisplätze, ein Leichtathletikstadion, und Lake Placid war nur zwanzig Minuten entfernt. Das reinste Paradies für Sportskanonen.
»Und, was steht drin?«, fragte Gilley. Mir wurde bewusst, dass ich schon eine ganze Weile still vor mich hin las. »Das ist mehr oder weniger ein Nobel-Sportclub für Jugendliche«, sagte ich. »Hat ganze hundertvierzig Schüler, die meisten davon voll intern.«
»Steht auch was über die Geschichte der Schule da?«
Ich überflog die Seite. »Nicht viel. Nur, dass sie im frühen neunzehnten Jahrhundert von einer Familie Habbernathy gegründet wurde, und die leitet sie noch heute.«
»Nichts über unseren mysteriösen Freund mit der Axt, hm?«, fragte Gil.
»Nicht auf der Schulwebsite. Das würde sicher die Eltern abschrecken, die sich überlegen, ihr Kind dorthin zu schicken.«
»Guter Punkt. Gib doch mal den Namen der Schule und Geist in die Suchmaschine ein.«
Ich tat es, bekam aber nur ein paar Links auf die Schulhomepage und zwei, drei Artikel über Geister allgemein. »Nada, Gil«, sagte ich. »Kein Hinweis auf eine Geistererscheinung auf dem Schulgelände. Da wir aber schon wissen, dass wir’s mit einem ziemlich aktiven Geist zu tun haben, vermute ich mal, dass die Schulleitung sich mit aller Macht bemüht, den Vorfall unter dem Deckel zu halten.«
Gil seufzte. »Wir haben’s auch nie leicht.«
»Warum ist das so schlecht?«, wollte Steven wissen.
»Wenn es da Informationen über unseren mysteriösen Axtschwinger gäbe, hätten wir jetzt vielleicht einen Anhaltspunkt. Schon ein Name wäre nützlich. Manchmal ist es unmöglich, einen Geist auf sich aufmerksam zu machen, außer man ruft ihn beim Namen.«
»Es ist ganz schön kurios, dass der Kerl eine Axt hat«, sagte Gil. »Ich meine, wer läuft heutzutage schon noch mit einer Axt rum?«
»Es könnte jemand aus dem sechzehnten, siebzehnten Jahrhundert sein«, überlegte ich. »Vielleicht steht die Schule auf dem Grundstück eines der ersten Siedler dort, und er versucht die Leute von seinem Land zu verjagen, weil er sie für Eindringlinge hält.«
Steven drehte sich halb zu mir um und sah mich an. »Aber warum jetzt erst?«
»Könnte an den Renovierungsarbeiten liegen.« Ich klickte mich zurück auf die Schulhomepage. »Hier heißt es, dass der alte Grundschulflügel komplett umgebaut werden soll. Die Schüler bekommen einen besser gestalteten Wohnbereich und einen neuen Speisesaal.«
Steven sah Gilley stirnrunzelnd an. »Das verstehe ich nicht.«
»Baumaßnahmen sind ein rotes Tuch für die lieben Geisterchen«, sagte Gil. »Es ist schon schlimm genug, wenn man die Möbel umstellt, aber wenn man Wände einreißt, drehen sie völlig durch und laufen Amok. Dann geht’s los mit wildem Türenknallen und Wurfgeschossen. So ein gestrandeter Geist kann sich richtig in einen Wutanfall reinsteigern.«
Steven nickte verstehend. »Trotzdem ist es komisch, dass ein gewalttätiger Geist so lange mit seinem Auftritt wartet, oder?«
»Nicht unbedingt«, sagte ich, während ich weiterlas. »Oh, Leute, hört mal, was da gerade für ein Artikel in der Schülerzeitung erschienen ist: ›Hatchet Jack kehrt zurück‹.«
»Lies vor!«, rief Gil.
Ich räusperte mich und las: »›Der Geist von Hatchet Jack ist ins Northelm-Internat zurückgekehrt. Wie der Schreiber dieser Zeilen erfuhr, wurde die Neuntklässlerin Evie O’Neal heute Morgen von ihrem Vater abgeholt, nachdem sie im Grundschulflügel vom allseits beliebten Schwarzen Mann der Schule, Hatchet Jack, bedroht worden war.
Damit kehrt Jack nach zehn Jahren relativer Ruhe wieder in die Schule zurück. Die letzte denkwürdige Begegnung zwischen dem Hausgeist von Northelm und einem Schüler endete damit, dass Ricky Tamborne einen Nervenzusammenbruch erlitt und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden musste, nachdem er von dem dämonischen Geist bedrängt woden war. Der Schreiber dieser Zeilen ist überzeugt, dass der Grundschulflügel weniger dringend aufgemotzt als exorziert werden müsste.‹«
»Na«, sagte Gil, »jetzt haben wir zumindest einen Namen.«
Ich runzelte die Stirn und klappte den Laptop zu. »Irgendwie glaube ich nicht, dass ich mich friedlich mit diesem Mister Hackebeil einigen kann. Ich habe das dumpfe Gefühl, das wird kein leichter Auftrag.«
»Welcher Auftrag ist schon leicht?«, fragte Gil.
Schweigend fuhren wir weiter, bis Teeko gegen elf Uhr eine Ausfahrt nahm und uns zu einem wunderhübschen Hotel lotste. Wir checkten ein – wie abgesprochen. So müde ich war, das vergnügte Strahlen auf Gilleys Gesicht war nicht zu übersehen, als er den Schlüssel zu dem Zimmer entgegennahm, das er mit Doc Sahneschnitte teilen würde. Gil war bis über beide Ohren in den guten Doktor verknallt.
Am nächsten Morgen verloren wir keine Zeit und waren schon früh bei den Autos. Teeko fragte, ob ich mit ihr fahren wolle, um ihr Gesellschaft zu leisten. Ich war einverstanden, stieg zu ihr in den Mercedes und winkte Steven und Gilley zu. Steven war leicht vergrätzt, weil ich nicht mit ihm fuhr.
»Was geht zwischen euch eigentlich ab, hm?«, fragte Karen.
»Ach … nichts«, sagte ich ein bisschen verschämt.
Karens Blick verriet, dass sie mir das nicht abnahm.
»He, wirklich. Wir sind nur Kollegen.«
Das brachte mir noch einmal den gleichen Blick ein.
Ich setzte meine unschuldigste Miene auf. »Da läuft nichts, glaub mir!«
»Könntest du bitte mal in meinem Führerschein nachsehen?«, fragte sie. »Ich hab gerade das Gefühl, ich wäre erst seit gestern auf der Welt.«
Da musste ich lachen. »Na gut. Okay, ich mag ihn.«
»Aha.«
»Und ich glaube, er mag mich auch.«
»Verstehe.«
»Und die Chemie zwischen uns stimmt.«
Sie grinste. »Hatte ich noch gar nicht bemerkt.«
»Aber wir haben … äh … noch nichts Konkretes deswegen unternommen«, stotterte ich und spürte, wie mir der Schweiß ausbrach.
Sie warf mir einen kurzen, verwunderten Blick zu. »Warum nicht?«
»Erstens, weil wir zusammenarbeiten«, sagte ich. »Und da Steven außerdem sozusagen unser Investor ist, wäre eine Romanze vielleicht ein bisschen verfänglich.«
Karen lachte. »Ich hab in meinem Leben schon ein paar verfängliche Romanzen erlebt, und glaub mir, sie waren alle auf gute Art unvergesslich.«
Ich verdrehte die Augen und versuchte den Spieß umzudrehen. »Hast du denn was von John gehört?« John Dodge war Karens Exfreund. Er spielte ganz oben in der Finanzliga mit und war schon das zweite Jahr in Folge zu einem der Top-Junggesellen Bostons gekürt worden. Er und Karen waren drei Jahre lang fest liiert gewesen, dann hatte sie ihm ein Ultimatum gestellt. Entgegen allen Erwartungen hatte er ihr einen Antrag gemacht, aber zu jedermanns Überraschung hatte sie rundheraus abgelehnt.
Später behauptete Karen, in dem Augenblick, als John vor ihr auf die Knie gegangen sei, habe sie erkannt, dass er das nur tat, um es ihr recht zu machen. Und da sie keine mit Gewalt erzwungene Heirat wollte, hatte sie auf der Stelle Schluss gemacht.
Seitdem schwirrten die Gerüchte, dass John mit jedem blonden, blauäugigen Karen-Double anbandelte, das er finden konnte. Und als das seinem gebrochenen Herzen keine Linderung verschaffte, schickte er Karen waggonweise Blumen. Als das nichts half, kam der Schmuck, und damit meine ich Klunker, die man aus dem All schon glitzern sehen konnte. Sie hatte jedes einzelne Stück zurückgeschickt.
»Oh, ich höre jeden Tag von ihm.« Sie schüttelte den Kopf. »Der gibt nicht so leicht auf.«
»Würdest du das denn wirklich wollen?«, fragte ich.
Statt einer Antwort stellte Karen die Lautstärke des Radios höher. »Oh! Das Lied mag ich wahnsinnig gern!«
Da ließ ich das Thema ruhen, und eine Weile hörten wir Musik. Schließlich fragte sie: »Was wirst du denn jetzt als Erstes machen, M.J.?«
»Hmmm?« Es dauerte einen Moment, bis ich aus dem Tran auftauchte, in den ich versunken war, während ich stur die Straße entlangstarrte.
»Um den Geist aus der Schule zu vertreiben. Was ist dein erster Schritt?«
»Oh. Ich hatte schon fast vergessen, warum wir unterwegs sind. Also, mein erster Schritt wird sein, mit Evie zu reden, um aus ihrer Perspektive einen Eindruck zu bekommen. Normalerweise gibt es, kurz bevor ein Geist sich zeigt, einen Moment, wo das Opfer spürt, dass etwas nicht stimmt. Manchmal fühlt es sich beobachtet oder empfängt irgendwoher starke Emotionen wie Traurigkeit oder Wut oder lähmende Schwere.«
»Meine arme Nichte«, sagte Karen. »Ihr Vater ist so ein Blödmann. Ich weiß genau, dass er ihr die ganze Zeit einredet, sie habe sich das alles nur eingebildet.«
»Wenn das so ist, wie willst du ihn dann überzeugen, dass er mich mit Evie sprechen lässt?«
»Ich brauche ihn nicht zu überzeugen. Leanne wird uns mit Evie reden lassen.« Leanne war Karens Schwägerin. »Das Beste, was mein Bruder je gemacht hat, war, diese fantastische Frau zu heiraten. Ein Wunder, dass sie es bis jetzt mit ihm ausgehalten hat.«
Ich lächelte. Ich kannte Familienstreitigkeiten nur zu gut und wusste genau, wovon sie sprach. »Nachdem ich mit Evie geredet habe, will ich noch ein paar Lehrer der Schule befragen, ob die auch schon unerklärliche Vorfälle erlebt haben. Und ich würde gern den Schüler zu fassen bekommen, der den Artikel für die Schülerzeitung geschrieben hat.«
»Über den wir gestern Abend gesprochen haben?«, fragte sie. »Nicht zu glauben, dass er schon entfernt wurde.«