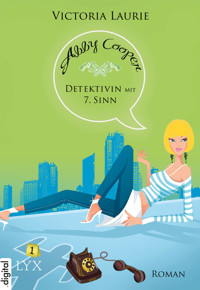9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
M. J. Holliday betreibt zusammen mit ihrem besten Freund, dem Computerspezialisten Gilley, und ihrem geschwätzigen Papagei Doc eine Geisterjägeragentur. Dabei nutzt sie ihre besonderen Fähigkeiten als Medium, um in den Häusern ihrer Klienten untote Seelen aufzuspüren und diese ins Jenseits zu befördern. Eines Tages betritt der gut aussehende Dr. Steven Sable die Agentur, um M. J. für einen Job anzuheuern. Ihm ist vor Kurzem der Geist seines verstorbenen Großvaters erschienen, und Sable ist überzeugt, dass dieser ihm etwas über die Umstände seines Todes mitteilen will. M. J. nimmt die Ermittlungen auf ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
VICTORIA LAURIE
M.J. Holliday:
Geisterjägerin
Rendezvous um Mitternacht
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Christine Blum
Zu diesem Buch
M. J. Holliday hat einen nicht ganz alltäglichen Beruf: Zusammen mit ihrem besten Freund Gilley und dem sprechenden Papagei Doc betreibt sie eine Geisterjägeragentur. Während der Computerexperte und begnadete Hacker Gilley für die Technik und die Beschaffung der Aufträge zuständig ist, nutzt M. J. ihre übersinnlichen Kräfte dazu, für ihre Klienten als Medium in alten Häusern Geister aufzuspüren und diese ins Jenseits zu befördern. Da taucht eines Tages der gut aussehende Dr. Steven Sable in M. J.s Agentur auf, um sie für einen Job anzuheuern. Sable hat vor Kurzem die Wochenendvilla seines Großvaters geerbt, nachdem dieser – angeblich durch Selbstmord – aus dem Leben geschieden ist. Bei einem Besuch der Villa ist ihm der Geist seines Großvaters erschienen, und Sable ist überzeugt davon, dass dieser ihm etwas über die genaueren Umstände seines Todes mitteilen will. Mit ihrer Ausrüstung aus Nachtsichtkameras, Bewegungsdetektoren und allerlei anderen Gerätschaften machen sich M. J. und Gilley auf den Weg, um gemeinsam mit Sable seinen Großvater aufzuspüren. Als im Keller der Villa ein Mordanschlag auf M. J. und Steven verübt wird, den diese nur knapp überleben, wird eines klar: Nicht nur die Geister haben es auf sie abgesehen. Und während die Ermittlungen immer brisanter werden, beginnen auch zwischen M. J. und dem charmanten Steven die Funken zu fliegen ...
Dieses Buch widme ich aus tiefstem Herzen
zwei Frauen von beeindruckender Anmut und Intelligenz:
Adell Chase, meiner Stimme der Wahrheit aus dem Süden
und der klügsten Frau der Erde,
und
Karen Ditmars, der Schönheit selbst und
coolsten Frau auf diesem Planeten.
1
»Guten Morgen, Miss Holliday«, begrüßte mich die Immobilienmaklerin erfreut vor dem Haus Dartmouth Street Nr. 84.
Ich schüttelte ihr die Hand. »Hi. Sie müssen Cassandra sein. Bitte nennen Sie mich doch M.J.«
»Sie sind jünger und hübscher, als ich gedacht hätte«, bemerkte sie und zupfte nervös an ihrer Perlenkette.
»Danke«, sagte ich und beeilte mich, zum Geschäftlichen überzugehen. »Sie haben mir zwar am Telefon schon ein bisschen erzählt, aber ich würde doch gern noch mal alles hören, was Sie über dieses Haus wissen.«
Cassandra verlor ein wenig Farbe und blickte an dem dreistöckigen Sandsteinbau hinauf, einem Juwel aus der Zeit um die Jahrhundertwende, das sich perfekt in das Gesamtbild von Bostons Prachtviertel Back Bay einfügte. »Ich habe es schon fast ein Jahr lang in Auftrag. Sie können sich vorstellen, dass das hier in der Back Bay eigentlich nie vorkommt. Ein historisches Stadthaus dieser Art verkauft sich normalerweise innerhalb von Wochen, nicht Monaten.«
»Liegt’s vielleicht am Preis?«
»Nein, auf keinen Fall. Für eine Million ist das ein absolutes Schnäppchen! Und wir hatten auch schon eine Menge Interessenten, trotz der Geschichte des Hauses. Aber jedes Mal, wenn wir kurz vorm Vertragsabschluss stehen, macht der Käufer plötzlich einen Rückzieher. Und alle sagen das Gleiche: Das Haus habe einfach eine schlechte Ausstrahlung.«
»Es wurde jemand darin umgebracht, sagten Sie?«
Cassandra nickte. »Ja, die Tochter der derzeitigen Eigentümer wurde hier vor etwas über einem Jahr vergewaltigt und ermordet.«
»Wie furchtbar.« Ich warf einen Blick über die Schulter auf das Gebäude. »Wurde der Mörder gefasst?«
»Er wurde beim Versuch, durch den Hinterausgang zu entkommen, von der Polizei erschossen. Leider kam für die junge Frau jede Rettung zu spät.«
»Also sind eigentlich zwei Leute in dem Haus gestorben.«
»Ja, sieht wohl so aus.«
»Und was ist seither passiert?«
»Na ja«, sagte sie und fing wieder an, mit ihrer Kette zu spielen. »Jedes Mal, wenn ich jemandem das Haus zeige, fühle ich mich irgendwie beobachtet. Manchmal fühle ich mich sogar verfolgt. Und viele Leute kommen rein und machen den Eindruck, als würden sie am liebsten gleich wieder gehen. Die meisten schauen sich nur ein, zwei Zimmer an, dann ergreifen sie mehr oder weniger die Flucht.«
»Verstehe.« Aber ich hatte das Gefühl, dass da noch mehr war. »Ist das alles?«
Sie schwieg einen Moment. »Nein«, sagte sie dann. »Vor ein paar Tagen habe ich es einem Ehepaar gezeigt, das sich an der Geschichte wirklich nicht zu stören schien. Sie sagten, für den Preis nähmen sie das gerne in Kauf. Aber als wir schon gehen wollten, hörten wir alle drei aus einem der Schlafzimmer im Obergeschoss den Schrei einer Frau. Ich dachte, jemand habe sich hereingeschlichen, während ich die Kunden herumgeführt hatte, also rannte ich nach oben und sah überall nach, aber es war niemand da. Und dann, schon wieder auf dem Weg nach unten, spürte ich plötzlich …« Sie verstummte.
»Was?«
»Ich spürte, wie mich jemand berührte.«
»So was wie eine Hand auf der Schulter?«
»Nein«, flüsterte sie mit schreckgeweiteten Augen. »Auf unanständige Weise.«
»Aha.« Ich nickte. Jetzt wusste ich, wer der Unruhestifter war. »Okay, wenn Sie mir aufschließen, mache ich mich an die Arbeit.«
»Können Sie uns wirklich helfen, M.J.?«
»Das ist mein Job, Cassandra. Ich bin Geisterjägerin. Geben Sie mir ein paar Stunden Zeit, dann schaue ich, was ich tun kann.«
Cassandra folgte mir die sechs Stufen zur Eingangstür hinauf und öffnete sie für mich. »Kommen Sie da drin allein zurecht?«, fragte sie, plötzlich voller Sorge.
»Kein Problem«, sagte ich zuversichtlich. Da hatte ich es schon mit furchteinflößenderen Dingen zu tun gehabt. Ich wartete, bis die Tür hinter mir ins Schloss gefallen war, dann trat ich ins Foyer, stellte meinen Matchsack in die Ecke neben der Treppe und sah mich um. Erst wollte ich mir einen Gesamteindruck verschaffen, ehe ich in die Trickkiste griff.
Ich ließ den Blick durch den Raum schweifen, um ein Gefühl für die Aufteilung des Hauses zu bekommen. Von dem Foyer führten mehrere Türen und Durchgänge in die übrigen Zimmer. Rechts von mir ging der Flur zur Küche ab. Geradeaus lag das Wohnzimmer und ganz links etwas, was wie ein Arbeitszimmer aussah. Ich holte mein Elektrofeldmeter aus der hinteren Hosentasche, um Spannungsdifferenzen der elektrostatischen Energie zu messen. Mit ausgestrecktem Arm zog ich damit einen Kreis durchs Foyer. Dabei fielen mir der verschwenderisch dicke Teppich, die hohen Decken mit den Stuckleisten und die teuren gemusterten Tapeten ins Auge. Der Kasten war wirklich feudal, selbst ohne Möbel merkte man sofort, dass hier drin eine Menge Geld steckte. Dem Elektrofeldmeter zufolge steckte hier allerdings auch noch etwas ganz anderes.
Ein Auge auf den Zeiger gerichtet, der auf der Anzeige hin und her hüpfte, schritt ich durchs Foyer ins Wohnzimmer. Als ich mich langsam der Glastür zur Terrasse näherte, schlug der Zeiger scharf aus. Ich steckte das Gerät zurück in die Tasche, schloss die Augen und konzentrierte mich.
Ausschlaggebend für meine Spitzen-Erfolgsquoten bei der Geisterjagd sind meine medialen Fähigkeiten, die ich schon vor meiner Zeit als Geisterjägerin beruflich genutzt habe. Das heißt, ich kann die Energie körperloser Seelen spüren, sowohl die, die es erfolgreich auf die andere Seite geschafft haben, als auch solche, die noch hier festsitzen oder, wie wir das gerne nennen, »gestrandet« sind. In der Dartmouth Street Nr. 84 konnte ich sofort zwei solcher gestrandeten Seelen ausmachen, eine weibliche und eine männliche. Ich beschloss, mich zuerst um die weibliche zu kümmern.
Ich folgte dem schwachen Ziehen in meinem Solarplexus, weg von der Terrassentür, wieder ins Foyer und die Treppe hinauf. Während ich der weiblichen Energie näher kam, passierte etwas leicht Beunruhigendes: Die männliche Energie, die vor Bösartigkeit nur so strotzte, begann mir zu folgen. »Halt dich zurück, Junge«, ermahnte ich ihn ruhig. »Du kommst gleich dran.«
Er stellte sich taub und blieb mir weiter auf den Fersen bis zum ersten Stock, wo ich auf dem Treppenabsatz innehielt, anstatt gleich weiter hinaufzusteigen. Da sah ich am Ende des Flurs einen dunklen Schatten in eines der Schlafzimmer huschen.
»Keine Angst«, rief ich ihm zu. »Ich will dir nichts tun.« Ich ging den Flur entlang und betrat das Schlafzimmer. Drinnen bemerkte ich sofort den krassen Temperaturabfall. Mit leichtem Frösteln schlang ich die Arme um den Oberkörper. Eiseskälte kroch mir durch die Kleidung und drang mir bis in die Knochen. An diesen heftigen Kälteschauer, der mit jeglicher Geisteraktivität einhergeht, habe ich mich nie gewöhnen können. Aber ich schob das Unbehagen beiseite und konzentrierte mich auf die bevorstehende Aufgabe. »Wie ist dein Name, Liebes?«, fragte ich sanft in das leere Schlafzimmer hinein.
Es kam keine Antwort, aber ich spürte die Angst, die von dem weiblichen Geist ausging. Schließlich lokalisierte ich ihn in einer Ecke des Raumes, und tatsächlich blitzte in meinen Gedanken flüchtig das Bild einer jungen Frau Anfang zwanzig auf, die am Fenster kauerte. Als ich mich auf sie zubewegte, wurde es noch kälter. Ich ging auf die Knie und schloss die Augen, um mich zu sammeln. »Ich bin hier, um dir zu helfen, Liebes«, sagte ich laut. »Er kann dir nicht mehr wehtun. Und ich werde dafür sorgen, dass er nicht ungestraft davonkommt. Bitte sprich mit mir. Sag mir deinen Namen.«
Erleichtert spürte ich den Namen Carolyn in mein Bewusstsein dringen. Armes Ding – sie war nicht nur von dem Monster hinter mir vergewaltigt und ermordet worden, sondern befand sich jetzt auch noch in einem seltsamen Zustand der Schwebe, den sie nicht begreifen konnte.
Wo sind meine Eltern?, fragte sie verzweifelt.
»Es geht ihnen gut, aber sie machen sich Sorgen um dich. Sie haben mich gebeten, dir zu helfen. Darf ich das, Carolyn?«
Ich öffnete die Augen und richtete den Blick vor mir ins Leere. Ich konnte Carolyn nicht sehen, wohl aber spüren und hören. Sie antwortete nicht gleich, also versuchte ich weiter, sie zu überzeugen. »Ich verspreche, dass dir nichts passieren wird, aber du musst mir vertrauen. Ich kann dich nach Hause führen, aber nur, wenn du auch den Willen dazu hast. Vertraust du mir?«
Er hat es mir versprochen!
»Was hat er dir versprochen, Liebes?« Ich wusste, sie sprach von ihrem Mörder.
Er hat versprochen, mir nichts zu tun, wenn ich mache, was er sagt!
Ich seufzte tief. Mieser Bastard. Langsam freute ich mich richtig darauf, ihn mir vorzunehmen. »Ich weiß, Liebes, ich weiß«, sagte ich ernst. »Das war gelogen. Aber es ist vorbei. Er kann dir nichts mehr tun. Ich hab’s ihm streng verboten.«
Wo sind meine Eltern? Die Frage kam noch flehentlicher als beim ersten Mal. Carolyn stand kurz davor, in Panik zu verfallen, und wenn sie das täte, würde ich den Kontakt zu ihr verlieren. Zweifellos würde sie sich in die Geborgenheit der Zwischenebene flüchten, die sich unmittelbar neben der befindet, auf der wir existieren. Dort treiben sich die verlorenen Seelen normalerweise herum und kommen nur in unsere Wirklichkeit, wenn sie stark genug sind, um sich mit dem auseinanderzusetzen, was mit ihnen passiert ist.
»Carolyn, hör mir zu«, sagte ich streng, in der Hoffnung, der Befehl werde ihrem Drang zur Flucht ein Ende setzen. »Bleib bei mir. Ich kann dich hier rausholen, aber nur wenn du genau das tust, was ich sage. Ich bringe dich in Sicherheit, aber wir müssen schnell –«
Er ist hier!, unterbrach sie mich. Wir müssen uns verstecken, sofort!
»Verdammt«, murmelte ich und drehte mich um. Tatsächlich, in der Türöffnung waberte drohend ein dunkler Schatten. Wenn ich nicht rasch etwas unternahm, würde ich Carolyn verlieren. »Bleib hier, Carolyn«, sagte ich und stand auf. »Ich sorge dafür, dass er verschwindet, aber du musst dich so lange versteckt halten. Danach helfe ich dir, deinen Weg zu finden, versprochen! Wartest du auf mich, bitte?«
Ein Gefühl, das ich nur als Nicken beschreiben kann, berührte meinen Geist. »Sehr gut«, sagte ich und ging auf den dunklen Schatten zu. Sowie ich in seine Nähe kam, kondensierte mein Atem, und fast hätte ich mit den Zähnen geklappert, so kalt war es. Ich unterdrückte ein Schaudern und trat zielstrebig auf die schwarze Silhouette zu.
Abrupt hielt ich an, weil der Schatten plötzlich verschwand. Rechts neben mir gab es einen dumpfen Schlag. Ich ließ den Blick in die Richtung schnellen, woher das Geräusch gekommen war, aber nur die kahle Wand starrte mich an.
»Ach, jetzt kommt diese Masche, was?«, flüsterte ich. Dann nahm ich all meinen Zorn zusammen und brüllte: »Hör mal, du stinkender Haufen Scheiße! Du Feigling! Du widerliche, hundsgemeine Missgeburt! Ich glaube, du hast Angst vor mir, und jede Wette, dass du nicht den Mumm hast, mir zu folgen, wenn ich jetzt rausgehe!« Damit flitzte ich durch die Tür und spürte sofort, wie der Geist die Verfolgung aufnahm.
Ich sprintete den Flur entlang und packte das Treppengeländer genau in der Biegung, um mit Schwung ein paar Stufen auf einmal zu nehmen. Die dunkle Energie hinter mir schien vor Erregung zu pulsieren, und auch in mir stieg das Adrenalin. Ich merkte, wie er seine Kräfte sammelte. Bestimmt kam jetzt gleich ein richtig mieser Trick. Ich achtete darauf, eine Hand am Geländer zu lassen, um das Gleichgewicht halten zu können. Das war auch gut so, denn im nächsten Augenblick bekam ich einen harten Schlag in den Rücken, und eine Mikrosekunde später zog etwas kräftig an meiner rechten Brust. »Dreckskerl!«, fluchte ich, schüttelte den Griff ab und jagte weiter die Treppe hinunter. »Das zahle ich dir heim!« Im Erdgeschoss schnappte ich mir meinen Matchsack, rannte ins Wohnzimmer und sah mich nach etwas um, wovon ich genau wusste, dass es dort war. Dabei hatte ich das Gefühl, als wände sich etwas langsam und kribbelnd um meinen Hals.
Mit finsterer Miene, die Augen unbeirrt auf die Wände geheftet, ging ich noch ein paar Schritte umher. »Heureka«, sagte ich einen Augenblick später. »Hab ich dich, du Schweinepriester!« Ich näherte mich dem kleinen schwarzen Loch, das ich direkt vor der Wand ausmachen konnte, und betrachtete es genau. Es war eine Stelle in der Luft von etwa dreißig Zentimeter Durchmesser, die dem bloßen Auge leicht neblig-grau vorkam. Ich spürte, wie dem Geist hinter mir alle Begierde verging. Er wurde nervös. »Hättest nicht gedacht, dass ich von deinem Durchschlupf hier weiß, was?«, fragte ich über die Schulter, während ich den Matchsack absetzte und mich hinhockte, um den Bohrer herauszuholen. »Schauen wir mal, wie großspurig du noch bist, wenn wir dich einsperren, du Schuft.«
Aus dem Matchsack kramte ich drei lange Stifte aus Magnetstahl und einen Hammer hervor. Der Geist warf sich mit aller Kraft gegen meinen Rücken, sodass ich nach vorn kippte und mit dem Kopf gegen die Wand knallte. »Arsch!«, sagte ich und drehte mich um. Vor mir schwebte der dunkle Schatten, und vor meinem geistigen Auge erschien ein niederträchtiges, wutverzerrtes Gesicht.
Aufhören!, schrie er mich an.
Ich lachte und drohte ihm mit dem Bohrer. »Höchste Zeit, das Portal zu schließen.« Damit drehte ich mich wieder zur Wand um. Der Bohrer war batteriebetrieben, damit mir Typen wie er nicht den Stecker rausziehen konnten. Ungehindert fing ich an zu bohren.
Nein!, schrie er, und dicht neben mir gab es einen ohrenbetäubenden Knall.
Ich lachte über seine Versuche, mich abzuschrecken. Nachdem ich mit den drei Löchern fertig war, sah ich ihn an. »Jetzt spuckst du keine großen Töne mehr, was?«
Die Aufmerksamkeit des schwarzen Schattens war vollständig auf die drei Stifte zu meinen Füßen gerichtet. Ich deutete auf das Stück Wand, in das ich die Löcher gebohrt hatte. »Das da ist dein kleines Schlupfloch, oder? Tja, ich sag dir was, Freundchen. So läuft das nicht weiter. Du hast zehn Sekunden, um dich zu entscheiden. Entweder du bleibst hier, dann helfe ich dir, auf die andere Seite zu kommen, wo du dich deinen Taten stellen musst und dafür zur Rechenschaft gezogen wirst. Oder du springst jetzt da rein und bleibst so lange da drinnen gefangen, bis du bereit bist, deinem inneren Schweinehund in die Augen zu sehen und von allein rüberzugehen.«
Der Schatten schwankte kurz, und einen Sekundenbruchteil lang dachte ich, ich hätte ihn überzeugt, sich von mir helfen zu lassen. Aber ich wurde schwer enttäuscht – dieser miserable Abschaum ging mir doch tatsächlich noch mal an die Titten. Knurrend fuhr ich herum, griff mir die Magnetstifte und steckte den ersten in eines der Löcher. Hinter mir hörte ich deutlich den Aufschrei einer Männerstimme, als ich den Hammer hob, um ihn auf den Stift sausen zu lassen. »Jetzt geht’s um die Wurst, Junge!«, rief ich und hieb zu. Eine Nanosekunde ehe der Hammer auftraf, fühlte ich den Geist durch das Portal sausen, das ich im Begriff war zu schließen. »Angsthase!«, brüllte ich ihm hinterher, während seine Energie in der Wand verschwand.
Ich hämmerte den Stift gründlich fest und ließ die anderen beiden folgen. Als ich fertig war, trat ich einen Schritt zurück und betrachtete mein Werk. Die Wand sah katastrophal aus, und der Boden war übersät mit Putz und Rigipssplittern, aber zumindest gab es das Portal nicht mehr – das heißt, solange die Stifte an Ort und Stelle blieben.
Ich steckte Hammer und Bohrer wieder in den Matchsack und eilte zurück in den ersten Stock. Zu meiner immensen Erleichterung schwebte Carolyn noch in der Ecke. »Na, Kleine«, sagte ich beruhigend, während ich behutsam eintrat. »Du hast sicher alles gehört, oder? Er ist weg, Carolyn. Den Kerl, der dir das angetan hat, gibt’s nicht mehr.«
Ich habe Angst, sagte sie.
»Ich weiß. Aber vertrau mir: Ich kann dir helfen, das zu ändern. Zuerst musst du mir zeigen, was passiert ist.«
Ich will nicht …
»Ich weiß, ich weiß. Aber, Mädel, ich muss es sehen. Wir müssen es beide sehen. Zeig mir nur das Ende, wenn der Anfang und die Mitte zu unerträglich sind. Gib mir Einblick in die letzten Sekunden, bevor dich diese Verlorenheit überkam.«
Von rechts spürte ich ein Ziehen und sah in die entsprechende Zimmerecke. Dort fand ein Kampf statt. Carolyn war nackt und blutete aus der Nase. Ihr Angreifer beugte sich über sie und drückte ihr die Kehle zu. Ihre Augen waren riesig vor Entsetzen, und sie versuchte, ihm das Gesicht zu zerkratzen. Schon vom Zusehen zog sich mir der Magen zusammen. Das war der unangenehmste Teil meiner Arbeit. Es war immer grässlich, mit ansehen zu müssen, was unschuldige Menschen in diesen letzten schrecklichen Augenblicken durchmachen mussten.
»Gut, Carolyn«, redete ich ihr zu. Dass ich ihr das nicht ersparen konnte, tat mir bitter leid, aber es war unumgänglich. »Jetzt noch ein bisschen weiter, Liebes. Geh zu dem Moment, nach dem du keine Luft mehr bekamst.«
Das Bild veränderte sich. Ich sah, wie Carolyns Mörder ihren schlaffen Körper zu Boden fallen ließ. Dann hob er ruckartig den Kopf, und ich hörte das schwache Heulen einer Sirene. Im nächsten Augenblick hetzte der Mann aus dem Zimmer und ließ Carolyn einfach liegen.
»Gut, Liebes«, sagte ich, als sein geisterhaftes Abbild den Raum verlassen hatte. »Das war ganz große Klasse. Jetzt konzentrier dich bitte auf deinen Körper. Siehst du?«
Ich muss aufstehen!, drängte sie. Ich muss weg!
»Aber du kannst nicht, oder?«, wandte ich ein. »Du kannst nicht, Carolyn, weil du nicht mehr atmest. Schau!« Ich deutete auf ihre leblose Gestalt. »Dein Körper ist tot, Liebes. Das musst du akzeptieren.«
Mit einem Mal überkam mich eine abgrundtiefe Traurigkeit, und ich wusste: Carolyn hatte endlich begriffen, dass sie tot war.
»Carolyn, hör mir zu«, bat ich. »Auch wenn dein Körper aufgehört hat zu funktionieren, muss deine Seele ihren Weg weitergehen. Ich kann dir dabei helfen, aber du musst tun, was ich sage. Hör mir gut zu und folge meinen Anweisungen. Dann kommst du hier raus. Okay?«
Erleichtert fühlte ich dieses mentale Nicken. »Sehr gut. Also, dann will ich, dass du jetzt das strahlend helle Licht spürst, das von oben herabscheint, durch die Decke hindurch genau auf dich. Spürst du es, Carolyn?«
Ein kurzes Schweigen. Dann: Ja.
»Super! Das machst du toll!«, lobte ich sie. »Und jetzt will ich, dass du spürst, wie sehr dieses Licht von Wärme erfüllt ist, von Güte, Reinheit und Liebe. Fühlst du das alles, Carolyn?«
Wieder Schweigen, dann ganz aufgeregt: Ja, ich fühle es!
»Genial! Also, jetzt sollte vor dir ein Weg sichtbar werden. Kann sein, dass er ein bisschen aussieht wie ein Tunnel; das ist aber von Person zu Person verschieden. Kannst du ihn sehen?«
Ja. Ich sehe ihn.
»Klasse. Jetzt will ich, dass du Mut fasst und den Weg betrittst. Er führt tiefer ins Licht, tiefer in die Liebe, die du jetzt schon spürst. Du kannst ihm bedenkenlos folgen, dann wird dir niemand je wieder wehtun.«
Mit angehaltenem Atem wartete ich, ob Carolyn den nächsten, entscheidenden Schritt tat. Falls sie davor zurückschreckte, würde ich ein andermal wiederkommen müssen, um einen zweiten Überredungsversuch zu starten. Falls sie ihn wagte, wäre alles gut, dann würde sie es problemlos auf die andere Seite schaffen. Schließlich spürte ich so etwas wie Zustimmung von ihr. Ehe sie sich in Bewegung setzte, hörte ich sie klar und deutlich sagen: Richten Sie meinen Eltern aus, dass ich sie liebe. Sagen Sie ihnen, ich kümmere mich um Midnight, und sie sollen sich keine Sorgen um mich machen. Mir geht es gut.
Ich lächelte erleichtert. »Ich richte es ihnen aus, das verspreche ich. Pass auf dich auf, ja?« Aber sie war schon verschwunden. Im nächsten Moment wurde mir bewusst, dass tiefe Stille herrschte. Ich öffnete die Augen. Das Zimmer war leer; keine Energie befand sich mehr darin außer meiner eigenen. Als ich es mit den Sensoren meiner Intuition abtastete, wirkte es warm und rein und heiter. Lächelnd stand ich auf. Dabei warf ich einen Blick auf meine Armbanduhr und sah, dass ich einen Zahn zulegen sollte. Mein nächster Kunde erwartete mich in etwa einer halben Stunde in meinem Büro.
Ich stieg die Treppe hinunter, holte den Matchsack und verließ das Haus. Cassandras Auto stand direkt vor dem Eingang. Sie kam mir bis an die Vortreppe entgegen und fragte: »Und? Wie ist es gelaufen?«
»Wir sind entgeistert!«, trällerte ich. Diesen Satz liebte ich.
»Sie sind das Problem losgeworden?« Etwas bang blickte sie die Stufen hinauf.
»Ja. Aber bevor ich fahre, muss ich Ihnen noch ein paar Sachen sagen.«
»Nur zu«, ermunterte sie mich, kramte in ihrer Handtasche und förderte nach kurzem Suchen ihr Scheckbuch zutage.
»Carolyn möchte ihren Eltern etwas ausrichten lassen. Sie sagt, sie werde sich um Midnight kümmern und sie sollen sich keine Sorgen machen, es gehe ihr gut.«
»Meine Güte!«, hauchte Cassandra.
»Können Sie damit etwas anfangen?«
»Ja, sicher! Midnight war die Katze der Kettlemans. Das habe ich mir gemerkt, weil ich selbst ein paar Katzen habe. Mrs Kettleman hat das Tier sehr geliebt. Letzte Woche, als ich sie anrief, um ihr zu sagen, dass es wieder einen Interessenten für das Haus gebe, klang sie so traurig. Ich fragte sie, warum, und sie erzählte mir, dass sie Midnight an diesem Morgen einschläfern lassen musste; bei dem armen Ding hatten die Nieren versagt.«
»Gut. Dann werden die Kettlemans ganz sicher glauben, dass die Nachricht von ihrer Tochter kommt.«
Während Cassandra etwas in das Scheckbuch kritzelte, machte ich mit den restlichen Anweisungen weiter. »Außerdem habe ich im Wohnzimmer drei Metallstifte in eine Wand geschlagen …«
»Sie haben drei waswohin geschlagen?!«, japste Cassandra. Ups. Da hatte ich wohl vergessen, ihr mitzuteilen, dass ich manchmal ein, zwei unabdingliche Änderungen an der Architektur vornehmen musste.
»Das war absolut notwendig, Cassandra. Wenn nicht, hätten Sie das Haus noch ein paar Jahre in Auftrag gehabt.«
»Aber warum?«, fragte sie.
Ich holte Atem und versuchte es zu erklären. »Der Mann, der Carolyn umgebracht hat, ist nach dem Tod auch nicht besser als im Leben. Solche Geister erschaffen sich oft ein Portal zu einer niederen Existenzebene, wo sie Kraft schöpfen und ihre Bösartigkeit weiter schüren können. Man kann ihnen nur beikommen, indem man ihnen den Zugang zu unserer Ebene versperrt, das heißt, man muss das Portal schließen.«
»Okay«, sagte Cassandra nickend. »Ich glaube, ich kann Ihnen folgen.«
»Und um es zu schließen, muss man mittels Magneten eine Barriere schaffen, denn die bringen das elektromagnetische Feld des Portals durcheinander. Die Stifte, die ich benutzt habe, sind stark magnetisch. Die sollten verhindern, dass dieser üble Kerl jemals wieder irgendwen belästigt.«
»Aber wie soll ich einem potenziellen Käufer erklären, dass da Stifte in der Wand stecken?«, fragte Cassandra.
»Sie holen einfach einen Handwerker, der sie überpinselt. Sie sind tief in der Wand drin; ein bisschen Gips und Farbe, und kein Mensch wird mehr ahnen, dass sie da sind.«
Cassandra wirkte erleichtert. »Gut, das lässt sich machen«, sagte sie schmunzelnd. »Noch was?«
»Nein. Das ist dann alles. Das Haus ist blitzblank und geisterfrei. Sie sollten jetzt keine Probleme mehr damit haben. Aber falls doch, hier ist meine Karte.« Ich reichte sie ihr. »Und wenn Sie hören sollten, dass jemand unsere Dienste brauchen kann, würde ich mich freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen würden.«
»Natürlich.« Mit strahlendem Lächeln nahm sie die Karte. »Vielen Dank, M.J., ich werde mich gleich um einen Handwerker kümmern.«
Ich verabschiedete mich von Cassandra und joggte zu meinem Auto, wobei ich noch einen Blick auf die Uhr warf. Langsam wurde es wirklich knapp.
Ein paar Meter vor dem Auto drückte ich auf den Türöffnerknopf. Das Auto begrüßte mich mit einem Hupsignal, und von drinnen kam das gleiche Geräusch noch mal, nur leiser. »Ich komme, Doc«, rief ich und spähte durch die Scheibe. Mein Graupapagei saß auf dem Lenkrad und nickte aufgeregt, als ich nach dem Türgriff fasste. Ich glitt auf den Fahrersitz. »Na, was ist, Doc?«
»Doc will Schokopops! Alles Banane!«, gab er zurück, schlug dabei mit dem roten Schwanz und nickte heftig.
»Du bist auch total banane«, sagte ich, strich ihm über das Köpfchen und startete den Motor.
Ich hatte Doc mit zwölf Jahren von meiner ziemlich exzentrischen Großmutter Pearl zu Weihnachten bekommen – drei Monate nachdem meine Mutter an Krebs gestorben war. Das sechs Monate alte Papageienjunge war ein schlauer Trick von Oma gewesen, um mich ein Stück aus meinem Schneckenhaus zu holen, denn ich hatte seit dem Tod meiner Mutter kein Wort mehr gesprochen.
Noch heute hallen die Worte in mir wider, mit denen Oma Pearl mir das kleine Plappermaul geschenkt hat. »Mary Jane«, sagte sie damals, während sie den Käfig öffnete und vor meinen staunenden Augen den Papagei herausholte, »das hier ist eine ganz besondere Papageienart. Die Tierchen können eine lebenslange Bindung mit einem Menschen eingehen, aber dazu muss man sie sehr, sehr respektvoll und freundschaftlich behandeln. Er wird bald anfangen zu sprechen, also musst du das mit ihm üben. Pass aber auf, dass du ihm nur anständige Wörter beibringst. Denn wenn ein Graupapagei ein Wort einmal gelernt hat, vergisst er es nie wieder.« Bei den letzten beiden Sätzen blinzelte sie mir zu, weil sie genau wusste, dass ich zu der Sorte Kinder gehörte, die sich nie im Leben freiwillig an solche Ermahnungen halten würden.
Ich nannte den Papagei nach einem alten Verwandten von mir, dem berüchtigten Dr. John Henry Holliday, der bei der Schießerei am O.K. Corral beteiligt und Wyatt Earps bester Freund gewesen war. Doc Holliday war mein Ururgroßonkel, und ich rede mir gern ein, dass ich meine rebellischen Gene von ihm geerbt habe.
Jenes Jahr war insgesamt eine sehr wichtige Zeit für mich gewesen, denn nicht nur hatte ich meine Mutter verloren und Doc bekommen, ich lernte damals auch Gilley Gillespie kennen, meinen besten Freund und Geschäftspartner. Am ersten Schultag, als ich mich auf dem Schulhof herumtrieb, bemerkte ich einen Jungen, der mit zwei G.I.-Joe-Figuren spielte. Und wie er das tat, faszinierte mich sofort. Ich beobachtete ihn eine Weile, und als er die Figuren aneinanderdrückte und dabei Kussgeräusche machte, wusste ich, dass ich ihn kennenlernen musste.
Innerhalb von fünf Minuten waren wir die besten Freunde. Gilley war es dann auch, der mich überredete, noch vor der Highschool-Abschlussparty dem Hinterland von Georgia, wo wir aufgewachsen waren, den Rücken zu kehren und uns den Lichtern der Stadt Boston zuzuwenden, wo Gilley ein Vollstipendium für das Massachusetts Institute of Technology bekommen hatte. Meine Perspektiven waren nicht ganz so glänzend.
Wir zogen zusammen in eine winzige Wohnung in der Cambridge Street. Während Gilley Informatik studierte, schlug ich mich als Kellnerin und mit anderen Gelegenheitsarbeiten durch. Dann, eines schicksalhaften Abends, kam Gilley nach Hause und verkündete: »Ich hab ein Engagement für dich.«
»Ein Engagement? Wofür?«, fragte ich.
»Da ist so ein Mädel in meinem HTML-Seminar. Ihr Vater ist gerade gestorben, und sie kann sich nicht aufs Studium konzentrieren. In drei Tagen haben wir Klausuren, und sie muss mir unbedingt da durchhelfen. Ich hab ihr gesagt, du könntest ihr bestätigen, dass es ihrem Dad gut geht. Sie kommt in einer Stunde vorbei.«
Schon als kleines Mädchen hatte ich mich mit Leuten unterhalten können, die nicht mehr am Leben waren. Anfangs nannte ich sie Gespenster, weil die meisten eben meiner kindlichen Vorstellung von einem Gespenst entsprachen. Ein paar erkannte ich allerdings, zum Beispiel meinen Großvater und meine Tante Carol. Gilley wusste von meiner Begabung und hat nie auch nur mit der Wimper gezuckt, wenn ich ihm Sachen erzählte wie: »Heute in der U-Bahn hat mir der tote Mann von so ’ner Frau erzählt, dass er schon immer den Verdacht hatte, dass sie eigentlich lesbisch ist. Jetzt weiß er’s sicher.«
Und so wütend ich war, weil Gilley einfach ungefragt über mich verfügte – als das Mädchen kam, war mir klar, dass ich ihr helfen musste. Ich nahm Verbindung zu ihrem Vater, ihren beiden Großeltern und einer Freundin von ihr auf, die bei einem Autounfall gestorben war. Als sich das Mädchen zutiefst dankbar verabschiedete, wollte sie wissen, wie viel ich dafür verlange.
Also, ich bin wirklich nicht blöd, aber mir wäre nie in den Sinn gekommen, für so etwas Geld zu nehmen. Ich glaube, ich nannte irgendeine lächerliche Summe, zwanzig Dollar oder so. Nach dieser Sitzung bekam ich sechs Anrufe von Leuten, die völlig wild darauf waren, etwas von ihren verstorbenen Verwandten zu erfahren.
Dann ging die Sache richtig los – als Gilley seinen Abschluss machte, blühte mein Geschäft bereits, und er war so nett, sich neben gelegentlichen Informatikjobs hauptsächlich um die Organisation meiner Termine zu kümmern. Die große Wende kam mit dem ungewöhnlichen Auftrag einer Frau, die Angst hatte, sich in ihrer eigenen Wohnung aufzuhalten. Ein Mitbewohner von ihr hatte sich dort erhängt, und seither gab es ständig unheimliche Vorfälle. Das war meine erste Geisteraustreibung, und ich war so berauscht davon, dass ich die Séancen sofort sein ließ und mich Hals über Kopf in die Geisterjagd stürzte. Und dabei ist es bis heute geblieben.
Mein Handy klingelte und schreckte mich aus meinen Gedanken auf. »Holliday«, sagte ich und setzte Doc vom Lenkrad auf meine Schulter.
»Wo bist du?«, fragte Gilley vorwurfsvoll.
»Ich bin unterwegs, Gil. Mach dich nicht verrückt.«
»M.J.«, fing er an (Gilley liebt Strafpredigten), »in knapp zwanzig Minuten hast du einen Termin!«
»Und ich bin in einer Viertelstunde da, mein Guter. He, außerdem solltest du stolz auf mich sein. Für den Kettleman-Fall hab ich schon kassiert.«
»Das war das Haus in der Back Bay?«
»Ja. Und bevor du jetzt damit kommst, wie recht du hattest, lass mich dir einfach zu deinem guten Riecher gratulieren.«
»Ich hab’s dir ja gesagt.« Das klang äußerst selbstzufrieden. Es war Gilleys Idee gewesen, es mal mit Werbung in der Immobilienbranche zu versuchen. Er war schon seit ein paar Wochen dabei, sich bei Maklern um Aufträge zu bemühen.
Ich kicherte. »Du kannst einfach nicht anders, als es mir unter die Nase zu reiben, was?«
»Tja, so bin ich halt. Okay, weiter zum nächsten Fall. Ich bin jetzt exklusiv über diesen Dr. Sable informiert.«
»Schon wieder Cyberspionage?«
»Wenn die Infos schon existieren, warum soll ich sie mir dann nicht anschauen? Jedenfalls ist der Kerl ein ganz schön dicker Fisch, das steht fest. Dr. Steven Sable ist der Sohn von Andrew Jackson Sable …«
Ich erinnerte mich an einen Zeitungsartikel, den ich vor ein paar Wochen gelesen hatte. »Diesem stinkreichen Großreeder, der sich selbst ins Jenseits befördert hat?«
»Genau der«, bestätigte Gilley triumphierend. »Was der für Verbindungen hat! M.J., wenn wir die Sache richtig schaukeln, könnten wir ausgesorgt haben. Vielleicht sind wir bald der letzte Schrei bei der gesamten High Society von Neuengland! Stell dir vor, die fragen sich bei ihren Cocktailparties gegenseitig, ob ihr Haus schon auf Geister untersucht worden ist. Wir könnten der Renner werden!«
Ich verdrehte die Augen und unterdrückte das Lachen, das mir in die Kehle stieg. Gilley wurde nicht müde, uns ständig den großen Durchbruch vorauszusagen. »Klar, bestimmt. Was gibt’s sonst noch über ihn zu erzählen?«
»Oh, nicht viel …«, beeilte sich Gilley zu versichern. Ich merkte, dass er etwas verschwieg.
»Gil.« Ich senkte meine Stimme um eine Oktave. »Raus damit. Was ist mit ihm?«
»Nichts Schlimmes«, meinte Gilley. »Er hatte nur vor Kurzem ein paar Probleme mit dem Finanzamt.«
»Steuerhinterziehung?«
»Ist noch nichts bewiesen. Ich meine, es ist noch keine Anklage erhoben worden …«
Ich stöhnte auf. »Ich will nicht für einen Kriminellen arbeiten, Gil.«
»M.J., solange nichts bewiesen ist, ist er nicht schuldig. Lass ihn uns doch erst mal anhören, ja?«
»Na gut.« Ich seufzte, teilweise wegen des Verkehrs. Ich saß hinter einem glänzend schwarzen Aston Martin fest, einem Auto, das in ungefähr drei Sekunden von null auf hundert beschleunigen konnte. Aber der Typ darin tuckerte vor mir her, fünfzehn Stundenkilometer unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. »Mist«, sagte ich ins Handy.
»Was ist?«, fragte Gilley.
»Ich schleiche hier hinterm Batmobil her und kann nicht überholen.« Stöhnend bemerkte ich, dass der Fahrer ein Handy zwischen Kopf und Schulter geklemmt hatte und ins Gespräch vertieft war. »Mann, ich hasse Leute, die beim Fahren telefonieren.«
»Gutes Argument. Dann mache ich mal Schluss«, sagte Gil.
»Uh … stimmt. Bis in einer Viertelstunde.« Ich legte auf. Genervt wartete ich auf eine Lücke auf der Gegenfahrbahn, aber momentan widersetzte die Welt sich meinen Wünschen. Immer wieder sah ich zu der Uhr am Armaturenbrett. »Komm schon, du Blödmann«, murmelte ich. »Fahr mal ein bisschen mehr rechts, damit ich um dich rumkomme.«
Vier Blocks weiter bekam ich endlich Gelegenheit zum Überholen. Während ich aufs Gas trat, fuhr ich das Fenster herunter und schrie: »Mach das Scheiß-Handy aus!«
Der Mann sah zu mir herüber. Sein ausdrucksloses Gesicht schien zu fragen: Was denn?
Ich fauchte wortlos, während Doc krächzte: »Mach das Scheiß-Handy aus! Alles Banane!«
Wir kamen keine Minute zu früh an, und ich preschte mit vollem Schwung ins Büro. »Irgendwann kriege ich deinetwegen noch einen Herzinfarkt«, begrüßte mich ein Mann von ungefähr meiner Größe, mit dichten braunen Locken, gerader Nase und kräftigem Kiefer, deutete auf die Uhr und reichte mir eine Akte.
»Ich weiß, ich weiß, Gil«, sagte ich und hastete in mein Zimmer. Gerade als ich Doc auf seine Stange gesetzt hatte, hörte ich, wie sich die Eingangstür öffnete und Gilley herzlich sagte: »Guten Morgen! Sie müssen Dr. Sable sein. Freut mich sehr.«
Leise schloss ich die Tür, warf meine Jacke über den Garderobenständer in der Ecke, setzte mich an den Schreibtisch und schlug die Akte auf. Ein gut aussehender Mann Mitte bis Ende fünfzig starrte mir entgegen, und mit gerunzelter Stirn las ich die Überschrift des Artikels: Erbe eines Millionenvermögens der Steuerhinterziehung verdächtigt. Ich seufzte abgrundtief. »Na super.«
Ehe ich eine Chance bekam, den Artikel durchzulesen, ging meine Tür auf, und Gilley trat mit ganz verzückter Miene ein. »Himmel, M.J., ist der Typ geil!«
»Der Doktor?« Ich war etwas verblüfft, denn Gilleys Vorlieben gingen bisher nie über sein eigenes Alter hinaus.
»Ja! Absolut umwerfend, allererste Sahne! Doc Sahneschnitte.«
»Doc Sahneschnitte! Doc Sahneschnitte!«, rief Doc begeistert von seiner Stange.
Ich sah zu dem Papagei hinüber. »Großartig. Das fehlt mir gerade noch.«
»Wie auch immer, er füllt gerade den Papierkram aus. Ich schicke ihn gleich zu dir rein. Denk dran: Sei höflich! Der Auftrag wäre echt eine Riesenchance!«
»Ja, ja …« Ich winkte ihm, zu verschwinden.
Den Rest des Artikels überflog ich nur und nahm mir den nächsten vor, der von Andrew Sables Tod handelte. Er beleuchtete hauptsächlich Sables wirtschaftliche Bedeutung als Schifffahrtsmagnat und kaum den Tod selbst. Offiziell hieß es, es sei Selbstmord gewesen und weitere Untersuchungen seien nicht geplant. Ich lenkte die Aufmerksamkeit auf die nächste Seite, wo in Stichworten das Telefongespräch notiert war, das Gilley vor drei Tagen mit Dr. Sable geführt hatte. Sable wollte gern mit Andrews Geist sprechen, der angeblich die Jagdhütte der Familie im Hinterland von Massachusetts heimsuchte.
Ich hatte es knapp geschafft, die Notizen durchzulesen, als die Tür sich wieder öffnete und Gilley eintrat. Mit breitem Grinsen und ausladender Geste sagte er: »M.J. Holliday, das ist Dr. Steven Sable.«
Während ich aufstand und um den Tisch herumging, trat ein hochgewachsener, breitschultriger Mann mit schwarzem Haar und dunkelbraunen Augen durch die Tür. Mit dem Mann aus dem Zeitungsartikel hatte er so gut wie keine Ähnlichkeit – er war viel jünger und hatte einen unverkennbar exotischen Einschlag. Ich streckte ihm die Hand hin. »Hallo, Dr. Sable. Entschuldigen Sie vielmals, ich dachte, Sie wären viel älter.« Ich warf Gilley einen fragenden Blick zu.
Der schielte in die Akte und erklärte dann rasch: »Dr. Steven Sable junior.«
»Ah.« Ich nickte und bedeutete Dr. Sable, sich zu setzen. Während er Platz nahm, sagte er: »Danke, dass Sie mich empfangen, Miss Holliday.« Sein tiefer Bariton hatte einen Akzent, den ich nicht so recht einordnen konnte.
Gilley entschuldigte sich und zwinkerte mir noch einmal zu, während er die Tür schloss. Ich widerstand dem Drang, die Augen zu verdrehen, weil ich deutlich sah, wie seine Füße vor dem Spalt unter der Tür stehen blieben. Mein Partner fand nichts dabei zu lauschen.
»Bitte nennen Sie mich M.J., Dr. Sable«, bat ich.
»Dann nennen Sie mich bitte Steven«, erwiderte er ungezwungen, mit dem Hauch eines Lächelns, das sein gutes Aussehen noch betonte.
Oh Mann, dachte ich. Einen so attraktiven Klienten kann ich überhaupt nicht brauchen … »Nun, erzählen Sie mir doch, was Sie hierher führt«, bat ich ohne Umschweife.
»Möglicherweise brauche ich Ihre Hilfe. Mein Großvater ist verstorben, und ich würde Sie gerne beauftragen, mit ihm zu sprechen und die Wahrheit darüber herauszufinden, was vor seinem Tod geschah.«
Während ich ihm zuhörte, konnte ich nicht anders als mich ganz in seine Stimme und diesen ungewöhnlichen Akzent zu vertiefen. Er klang leicht europäisch und zugleich südamerikanisch, und seine Stimme war so seidenweich, als ließe er ein Stück Schokolade hinten auf der Zunge zergehen. Er sprach in gemessenem Tonfall, als müsse er sich alles erst im Stillen übersetzen.
»Mein aufrichtiges Beileid. Ich habe gehört, dass der Tod Ihres Großvaters als Suizid gilt.«
Stevens Züge spannten sich. »Zu Unrecht!«
»Ich verstehe.« Ich betrachtete ihn genau. »Warum glauben Sie, dass es kein Selbstmord war?«
»Seine … wie sagt man das, die Frau, die das Haus macht?«
»Seine Haushälterin?«
»Ja, genau. Sie sagte, mein Großvater habe an dem Morgen, als er starb, Haferflocken gegessen.«
Man sollte ja meinen, ich hätte bei meinem Job schon eine Menge gehört. Aber ich gebe zu, ich musste mich zusammennehmen, um meine Verblüffung nicht zu zeigen. »Wie bitte?«, hakte ich nach, als keine weitere Erklärung kam.
»Am Abend vor seinem Tod hat mein Großvater mich angerufen und erzählt, dass er bei seinem Arzt war und der sagte, dass sein Cholesterinspiegel erhöht sei.«
»Aha.«
»Mein Großvater hat nicht gern Tabletten genommen, also hat er mich gefragt, ob ich ihm einen Rat geben könne. Ich habe ihm gesagt, er solle die Ernährung umwerfen und Haferflocken statt Rührei mit Speck zum Frühstück essen.«
»Umwerfen?« Ich verbarg mit Mühe ein Grinsen. »Sie meinen umstellen.«
Er machte eine ungeduldige Geste. »Ja, ja, umstellen.«
»Aha.« Ich verband die Punkte zu einem Ganzen. »Sie meinen, weil er Ihren Rat annahm und Haferflocken zum Frühstück wollte, kann er keine Selbstmordgedanken gehabt haben.«
Steven nickte ernst. »Das ist korrekt. Mein Großvater war nicht unglücklich. Er hat das Leben genossen und war bei bester Gesundheit. Er hatte keine Schmerzen, und sein Geisteszustand war sehr gut. Wie Sie sehen, er hatte keinen Grund, Selbstmord zu begehen.«
»Wie ist Ihr Großvater denn gestorben?«, fragte ich. Die grausigen Details hatte der Artikel ausgelassen.
»Ich glaube, dass man ihn gezwungen hat, vom Dach seiner Jagdhütte zu springen.«
»Ist das tief?« Ich stellte mir eine niedrige Blockhütte irgendwo im Wald vor.
»Drei Stockwerke.«
Ich verzog schaudernd das Gesicht. »Au. Sind Sie sicher, dass er nicht einfach aus dem Fenster gefallen ist oder so?«
»Die Fenster im zweiten Stock sind alle … wie kann man das sagen, zurückgeschoben?«
»Zurückgesetzt?«, bot ich an.
»Ja, hinter das Dach des ersten Stocks. Das ragt auf der Westseite weit nach vorn. Ein Pantoffel meines Großvaters wurde auf dem Dach gefunden.«
Ich nickte. »Das heißt, er hätte aus dem Fenster aufs Dach klettern und noch ein Stück nach vorn bis zum Rand gehen müssen.«
»Das ist korrekt«, sagte Steven.
»Wer hätte denn etwas vom Tod Ihres Großvaters?«
Steven runzelte die Stirn. »Es wäre einfacher zu sagen, wer nichts davon hätte.«
»Gilley hat mir erzählt, Sie hätten seinen Geist auf dem Grundstück gesehen?«
»Ja. Letztes Wochenende. Ich habe das Haus von meinem Großvater geerbt und wollte das Wochenende dort verbringen. Ich kam spät am Abend an und ging sofort zu Bett. Mitten in der Nacht hörte ich seine Stimme. Er rief mich.«
»Könnte auch ein Traum gewesen sein«, bemerkte ich. Eigentlich glaubte ich nicht, dass es einer gewesen war, aber ich beschloss, den Advocatus Diaboli zu spielen und zu prüfen, wie ernst es diesem jungen Doktor wirklich war.
»Es war kein Traum. Ich war wach. Und als ich in den Flur ging, wo ich seine Stimme hörte, flüsterte er meinen Namen in mein Ohr, und ich fühlte seine Hand auf meinem Rücken, aber als ich mich umdrehte, war er nicht da.«
»Was haben Sie da gemacht?«
Steven grinste verlegen. »Ich muss zugeben, ich habe meine Sachen gepackt und bin schnell aufgebrochen. Es hat mich sehr erschreckt.«
Ich holte tief Luft, setzte mich gerade hin und lehnte mich leicht über den Schreibtisch, die Unterarme auf der Tischplatte verschränkt. »Okay, Steven. Gilley und ich werden die Sache untersuchen. Sie sollten uns erklären, wie wir zu der Jagdhütte kommen, und uns einen Schlüssel geben. Soweit ich weiß, hat Gilley Ihnen schon gesagt, wie schwierig es sein kann, mit Geistern zu sprechen. Es gibt keine Garantie dafür, dass Ihr Großvater uns erzählen wird, was ihm zugestoßen ist.«
»Ich verstehe«, sagte Steven. »Aus diesem Grund werde ich mitkommen.«
Ich legte den Kopf schief. »Verzeihung?«
»Habe ich etwas nicht korrekt ausgedrückt?«, fragte er.
»Nein, das war völlig richtig. Wir möchten nur grundsätzlich nicht, dass unsere Kunden uns begleiten.«
»Warum nicht?«
Ich blinzelte ein paarmal, ehe ich antwortete. Tatsächlich gab es keinen triftigen Grund dafür, außer dass ich dachte, sie seien dann nur im Weg. »Bei allem Respekt, Sie wären uns wahrscheinlich im Weg. Gilley und ich müssen ungestört arbeiten können.«
Stevens Blick verriet, dass er mir das nicht so ganz abnahm. Nach einem Augenblick sagte er: »M.J., ich bin sicher, dass Sie und Ihr Partner meinen Fall allein bearbeiten können, aber ich bin … wie sagt man … bedenklich über das, was Sie tun.«
»Sie stehen unseren Fähigkeiten skeptisch gegenüber?«
»Ja, septisch. Ich bin sehr septisch.«
Ich zog eine Grimasse, um nicht loszukichern. Stevens Englisch war göttlich. »Verstehe«, sagte ich dann, während ich überlegte, wie ich ihn überzeugen könnte, dass er in Gottes Namen wegzubleiben hatte.
Steven fuhr fort. »Also, wenn ich Sie beauftrage, dann mit der … äh, Konditionierung?«
»Bedingung.«
»Ja, Bedingung, dass ich bei diesem Geisteraustrieb – wie heißt es auf Ihrer Website? –, Geisteraustreibung dabei sein kann.«
Ich hob eine Augenbraue und sagte fest: »Tut mir leid, Doc, aber Gilley und ich arbeiten allein.«
»Doc will Schokopops! Alles Banane!«, krächzte mein Papagei von seiner Stange.
Steven drehte sich nach ihm um. »Lustiger Vogel.«
»Er meint nicht Sie«, beeilte ich mich zu erklären und fluchte innerlich, dass ich Steven mit Doc angeredet hatte.
»Doc Sahneschnitte! Doc Sahneschnitte!«, krähte Doc, plusterte sich auf und hüpfte auf der Stange hin und her.
Steven schmunzelte. »Sehr eloquent.«
Doc nickte lebhaft. »Mach das Scheiß-Handy aus!«
Da musterte Steven mich scharf. »Welches Auto fahren Sie?«
»Einen Volvo«, antwortete ich vorsichtig.
»Welche Farbe?«
»Silber, warum?«
»Als ich hierher fuhr, rief mir eine Frau in einem silbernen Auto zu, ich solle mein Handy ausmachen, und dann … wie sagt man … ist sie vor mir im Zickzack gefahren?«
Ich schluckte. »Hat Sie ausgebremst?«
»Ja, ausgebremst.«
»Doc will Schokopops!«
Ich spürte, dass ich knallrot wurde. »Haha. Oh ja, tut mir leid.« Ich war nahe daran, vor Scham zu vergehen. »Ich wollte nicht zu spät zu dem Termin mit Ihnen kommen, und natürlich konnte ich nicht wissen, dass das Sie sind …«
»Ich habe mit dem Krankenhaus telefoniert. Es gab ein Problem bei einem Patienten.«
»Das tut mir wirklich sehr, sehr leid.« Ich hätte mir in den Arsch beißen können. »Wenn ich einen Termin habe und spät dran bin, werde ich grantig.«
»Ene mene meck, und du bist weg«, gurrte Doc.
Ich nahm mir ganz fest vor, Docs Stange so bald wie möglich in Gilleys Zimmer zu räumen.
»Wenn Sie nicht wollen, dass ich mitkomme, Miss Holliday, dann sehe ich keinen Grund, weiter mit Ihnen zu sprechen«, sagte Steven plötzlich sehr förmlich und schroff.
Einige Sekunden lang blickte ich ihn starr an. Es machte mich wütend, dass er versuchte, mich in die Enge zu treiben. Endlich streckte ich ihm über den Schreibtisch hinweg die Hand hin und sagte resolut: »Hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen, Dr. Sable. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie finden jemanden, der Ihnen weiterhelfen kann.«
2
Nachdem Sable weg war und ich mich erfolgreich um Gilley und den Tobsuchtsanfall herumgedrückt hatte, den er wegen des Verlusts so bedeutender Kundschaft im Begriff war zu kriegen, beschloss ich, dass ich erst mal dringend einen guten Kaffee brauchte. Das führte mich einen Block weiter zu Starbucks und von dort aus über die Straße zu Mama Dell’s, dem gemütlichsten Plätzchen, das ich kenne.
Theoretisch ist Mama Dell’s ein Café. Aber dass es immer brechend voll ist, liegt definitiv nicht an der Kaffeequalität. Keiner der Gäste weiß genau, warum Mamas Geheimrezept wie Teer schmeckt, aber die Tatsache, dass niemand es je wagen würde, ihr das ins Gesicht zu sagen, gibt einen der besten Insiderwitze in Arlington ab.
Mama Dell kommt aus South Carolina und hat einen reizenden Südstaaten-Akzent, in den ich auch verfalle, sobald ich sie höre. Sie kam vor über dreißig Jahren mit einem Vollstipendium für Harvard hierher, um Biotechnologie zu studieren, und traf dabei ihren Seelenfreund, einen hochgewachsenen, freundlichen Mann, der nur als der Captain bekannt ist.
Die beiden arbeiteten gemeinsam irgendein Biophysik-Projekt aus, das ein Patent und einen Haufen Geld zur Folge hatte. Darauf nahmen sie die ganze Kohle und investierten sie in ein Café. Im Mama Dell’s ist es superkuschelig. Es gibt viele einladende kleine Sitzgruppen aus üppigen Zweiersofas und weichen Sesseln, genau das Richtige, um nach einem Stadtbummel entspannt abzuhängen und zu schwatzen.
Auf einem Regal neben der Tür steht eine riesige Sammlung origineller, teils urkomischer Kaffeebecher aus den gesamten Vereinigten Staaten und einigen anderen Ländern. Wenn ein Stammgast reinkommt, schüttet er üblicherweise diskret seinen Starbucks-Kaffee in seinen Lieblingsbecher, holt sich an der Theke ein süßes Teilchen und macht es sich für den Nachmittag oder Abend gemütlich.
Ich hatte Dell und den Captain vor zwei Jahren kennengelernt. Sie gehörten zu meinen ersten Kunden – sie wandten sich damals an mich, um das Café von einem hyperaktiven Poltergeist zu befreien, der einfach nicht aufhörte, die Sammlerbecher in Stücke zu hauen. Ich brauchte fast eine Woche, aber schließlich bekam ich den Geist eines britischen Soldaten zu fassen, der hier seit dem Unabhängigkeitskrieg festsaß, und schickte ihn seiner trostlosen Wege. Und in einer Stadt, in der man sonst nur New-England-Platt hörte, war Dells Gesellschaft so was wie ein Stückchen Heimat für mich, sodass ich schnell zum Stammgast wurde.
Den Starbucks-Kaffee unter dem Mantel verborgen, trat ich schwungvoll durch die Tür, suchte meinen Becher im Regal und runzelte die Stirn, weil ich ihn nicht fand.
»Morgen, M.J.!«, rief Mama Dell fröhlich, als sie mich sah.
»Hi, Dell«, grüßte ich zurück, während ich weiter im Regal nach dem Halloween-Becher mit der schwarzen Katze und dem Gespensterhenkel fahndete. »Hast du meinen Becher gesehen?«
»Er ist in der Spülmaschine; vorhin war jemand da und hat ihn benutzt. Ist sicher gleich fertig. Setz dich doch, ich bringe ihn dir, wenn er sauber ist. Du trinkst den Kaffee schwarz, ja?«, fragte sie.
Verdammt! Ich hatte vergessen, im Starbucks die zusätzliche leere Tasse zu bestellen, die ich normalerweise vorsichtshalber mitnahm, für den Fall, dass Dell es schaffte, meinen Becher mit ihrer dicken schwarzen Brühe zu füllen, ehe ich die Chance hatte, meinen eigenen Kaffee hineinzuschütten. »Jep. Schwarz. Danke. Ich bin da drüben«, sagte ich und zeigte auf meinen üblichen Tisch und das vertraute Gesicht, das ich dort erspäht hatte.
Während Dell in die Küche eilte, schlängelte ich mich zu der blonden Frau durch, die sich an unseren Tisch am Kamin gesetzt hatte. »Morgen, M.J.«, grüßte sie, als ich näher kam.
»Hi, Teeko, schön, dich zu sehen«, gab ich zurück. Teeko ist meine beste Freundin, und nein, das ist nicht ihr Name, sondern nur die Kombination ihrer Initialen – K.O. – mit einem T davor, weil diese Frau einfach jeden total umhaut. Karen O’Neal besteht aus 168 Zentimetern vollkommener Makellosigkeit mit langen Beinen, goldblonden Haaren und unwahrscheinlich blauen Augen. Zudem hat sie diese Aura absoluten Selbstvertrauens, aber ohne auch nur eine Spur herablassend zu wirken.
Sie sah aus wie immer – atemberaubend –, in kniehohen Wildlederstiefeln, seidenen Marlene-Hosen und einer wunderschönen, tief ausgeschnittenen Stickereibluse, die ziemlich dramatische Einblicke gestattete. »Himmel, Karen«, sagte ich, während ich aufs Sofa rutschte. »Was hast du heute noch vor – der Männerwelt einen kollektiven Herzkasper verpassen?«
Teeko lachte und schob ihren Laptop beiseite, um mir Platz zu machen. »Was spricht dagegen, den Mädels ein bisschen Luft und Sonne zu gönnen?«, fragte sie. Im gleichen Moment stolperte ein Herr, der an unserem Tisch vorbeiging, über einen Stuhl und schüttete sich seinen ganzen Kaffee übers Hemd.
»Du bist ein öffentliches Risiko«, flüsterte ich grinsend, während wir zusahen, wie er den Schaden mit seiner Serviette zu beheben versuchte. »Man sollte dir Warnblinklichter und Absperrbänder anmontieren.«
»Hat Mama Dell es dir schon erzählt?«, wechselte sie das Thema.
»Was?«, fragte ich.
»Von dem Typen.«
»Was für ein Typ?«
»Mit dem sie dich verkuppeln will.«
Ich stöhnte. »Oh nee, bitte nicht. Teeko, du musst mir da raushelfen. Der letzte Kerl, den sie für mich ausgeguckt hatte, kaute mit offenem Mund, und das war noch das Attraktivste an ihm.«
Teeko kicherte. »So schlimm kann’s doch nicht gewesen sein.«