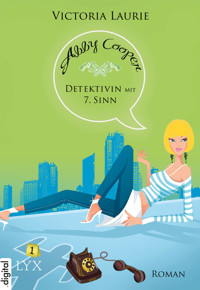
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit ABBY COOPER erwartet den Leser ein origineller und unglaublich witziger Chick-Lit-Krimi, der Einblicke in die Welt eines professionellen Mediums verschafft.
Als professionelles Medium kommuniziert Abby Cooper mit der Welt der Geister, um ihren Klienten die Zukunft vorherzusagen. Da wird eine ihrer Klientinnen tot aufgefunden, und der gut aussehende Kommissar Dutch stattet Abby einen Besuch ab, um sie zu dem Mordfall zu befragen. Zwischen beiden fliegen augenblicklich die Funken. Das einzige Problem dabei: Dutch glaubt nicht an Übersinnliches. Abby beschließt, auf eigene Faust die Ermittlungen aufzunehmen und gerät dadurch schon bald in höchste Lebensgefahr. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der sie immer wieder mit dem charmanten Dutch zusammenführt ...
Der Lesespaß ist vorprogrammiert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
VICTORIA LAURIE
Abby Cooper
Detektivin mit 7. Sinn
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Angela Koonen
Zu diesem Buch
In Royal Oak, einem Vorort von Detroit, lebt die einunddreißigjährige Abby Cooper. Sie führt ein ganz normales Leben und hat einen ganz normalen Job. Nun ja, einen fast normalen Job, denn Abby ist ein Medium und kann mit der Welt der Geister kommunizieren und die Zukunft voraussagen. Sie betreibt ein eigenes Büro: Abby Cooper P.I. (Private Intuitivberatung) und wird von Menschen engagiert, die ihrem Leben eine neue Richtung geben möchten. Genau das könnte Abby ihrer Meinung nach selbst auch gut gebrauchen, denn immer öfter beschleicht sie das ungute Gefühl, dass ihrem Alltag das gewisse Etwas fehlt …
Das ändert sich schlagartig, als eine ihrer Klientinnen ermordet wird und alle Indizien auf Abby deuten. Offenbar kennt sie mehr Einzelheiten dieser Tat, als gut für sie ist. Um dem Ganzen jedoch die Krone aufzusetzen, entpuppt sich der ermittelnde Beamte auch noch als der heiße Typ, mit dem sie gerade ein Blind Date hatte. Der gut aussehende Dutch Rivers ist allerdings fest davon überzeugt, dass Abby eine Betrügerin ist – wenn auch eine sehr attraktive. Denn der Cop glaubt überhaupt nicht an Übersinnliches – im Gegensatz zu dem wahren Mörder: Als dieser von Abbys Fähigkeiten erfährt, eröffnet er die Jagd auf sie …
Für meine Schwester, Sandy Upham Morrill.
Du bist mein Fels, mein Regenbogen und mein Testpublikum.
Ich bin außerordentlich glücklich, mit dir verwandt zu sein
– meiner allerbesten Freundin!
Prolog
Am 28. Mai dieses Jahres, nachmittags gegen halb fünf, wurde Officer Shawn Bennington aufgrund eines Notrufs zur 1865 Meadowlawn gerufen. Das Folgende ist ein Auszug aus seinem Bericht:
Opfer war eine achtundzwanzigjährige Weiße, Tod durch Schussverletzung an der linken Schläfe, aufgefunden in quasi fötaler Körperhaltung auf dem Bett in ihrem Zimmer. Ein Nachbar von der 1863 Meadowlawn gab an, gegen 15 Uhr einen »lauten Knall« gehört zu haben. Die Tote wurde gegen 16.20 Uhr vom Verlobten entdeckt, der nach ihr sehen wollte, da er sie telefonisch nicht erreicht hatte. Der Notruf erfolgte wenige Minuten nach der Entdeckung.
Die benutzte Handfeuerwaffe war eine Smith & Wesson, Kaliber 25, zugelassen auf das Opfer. Fingerabdrücke an der Waffe scheinen vom Opfer zu stammen. Auf der Frisierkommode wurde ein Abschiedsbrief gefunden (siehe Anlage in der Akte) sowie neben dem Bett ein zerrissenes, zusammengeknülltes Hochzeitskleid.
Von der Schwester des Opfers wurden Anzeichen einer Depression bemerkt. Sie gab an, das Opfer habe in den letzten paar Tagen angespannt und gereizt gewirkt und über Müdigkeit geklagt. Neuerdings habe das Opfer die Angewohnheit gehabt, nachmittags lange zu schlafen. Die Schwester war zur Tatzeit nicht zugegen.
Fall wird vorläufig als Selbstmord eingestuft, bis die kriminaltechnische Untersuchung der Schmauchspuren, Fingerabdrücke und Handschrift abgeschlossen ist.
S. Bennington
1
Meine grundlegende Philosophie ist ganz einfach: Die Menschen sind wie Eiscreme. Nehmen Sie zum Beispiel mich. Man könnte meinen, ich wäre schon aufgrund meines Berufs – ich bin ein professionelles Medium – wie Nutty Coconut. Tatsache ist aber, dass ich viel eher wie Vanille bin – gleichbleibend, ein bisschen langweilig, nicht mal mit heißer Karamellsoße.
Abgesehen natürlich von meiner ziemlich ungewöhnlichen Fähigkeit, die Zukunft vorauszusagen. Na gut, damit komme ich vielleicht an Bourbonvanille heran.
Doch im Großen und Ganzen ist mein Leben dermaßen langweilig. Ich bin Single ohne derzeitige Interessenten, gehe kaum aus (aufgrund der fehlenden Interessenten), bezahle meine Rechnungen immer pünktlich, habe sehr wenige Laster und nur zwei gute Freunde.
Sehen Sie, was ich meine? Vanille.
Na ja, ich will nicht sagen, dass mein Leben total schlecht ist. Immerhin nehme ich an den geschmacksintensiven Leben meiner Klienten Anteil. Sehen Sie sich nur mal das Früchtchen an, das gerade vor mir sitzt. Sharon ist eine junge, hübsche Frau Mitte dreißig mit kurzen blonden Haaren, zu viel Make-up, nagelneuen Brustimplantaten und ohne nennenswerten Grips. An ihrer linken Hand prangt ein opulenter Ehering mit einem Diamanten, und während der letzten zwanzig Minuten konnte ich nichts weiter als Mitleid mit dem armen Kerl empfinden, der ihn ihr geschenkt hat.
»Gut, ich bekomme den Eindruck, dass wir hier ein Dreiecksverhältnis haben … Da scheint sich jemand in Ihre Ehe hineinzudrängen«, sagte ich.
»Ja.«
»Jemand, für den Sie eine romantische Schwäche haben.«
»Ja.«
»Und ich höre, Sie halten das für wahre Liebe …«
»Ja, aber, äh, Abigail? Von wem hören Sie das?«, fragte sie und sah sich nervös um.
Diese Frage wird mir ständig gestellt, und man möchte meinen, ich hätte inzwischen gelernt, meine Klienten auf die Sitzungen vorzubereiten, aber ich konnte mich noch nie gut zu Veränderungen durchringen.
»Oh, Entschuldigung. Ich höre das von meiner Crew, genauer gesagt, von den Geistern, die mich leiten. Sie sprechen mit Ihren Geistern und erzählen mir dann alles.«
»Wirklich? Können die Ihnen sagen, wie sie heißen?«, flüsterte sie und blickte wieder mit großen Augen um sich.
Wir schweiften zu weit ab. Damit der Gedankenfluss nicht abriss, der mir durch den Kopf ging, korrigierte ich sachte unseren Kurs. »Nein, Sharon, normalerweise kommen mir keine Namen, sondern nur Bilder und Gedanken. Also, wie ich schon sagte, geht es hier um diese Dreiecksgeschichte, richtig?«
»Ja«, antwortete sie und beugte sich gespannt vor.
»Gut, ich gebe jetzt einfach nur weiter, was ich höre … Mir scheint, dieser andere Mann sagt genau die richtigen Dinge, etwa dass er Interesse an Ihnen hat und mit Ihnen zusammen sein möchte. Aber er sagt nicht die ganze Wahrheit.« Sharons große Augen wurden schmal; sie sah mich kritisch an. »Ist er blond?«, fragte ich.
»Ja.«
»Und er arbeitet nachts … Ist er Barkeeper?«
»Oh mein Gott … ja!«
»Und Ihr Mann ist der mit den braunen Haaren und dem Bart, ja?«
Sharon holte verblüfft Luft. »Kinnbart, ja.«
»Und Ihr Mann hat mit Computern zu tun … baut Computer.«
»Er ist Computeringenieur.«
»Gut, Sharon, die Geister sagen mir, dass der Blonde ein Lügner sei und dass Ihr Mann Sie liebe, auch wenn Sie ihn nicht für den geborenen Liebhaber halten. Sie sagen auch, dass es für Sie kein Zurück gebe, wenn Sie Ihren Mann wegen des Blonden verlassen. Das ließe sich nicht wieder einrenken. Und mir scheint, dass Sie erwischt werden, wenn Sie weiter etwas nebenher haben. Da gibt es wohl eine rothaarige Frau – ich glaube, sie ist älter als Sie –, die sehr neugierig ist und schon Verdacht geschöpft hat. Sie würde nicht zögern, Ihrem Mann alles auf die Nase zu binden. Offenbar ist sie eine Nachbarin oder …«
»Oh mein Gott! Meine Nachbarin, Mrs O’Connor, hat rote Haare, und sie würde es meinem Mann mit Sicherheit erzählen!«
»Sehen Sie? Die Frau ist jetzt schon sehr argwöhnisch, und wenn Sie sich die Sache nicht bald anders überlegen, sind Sie am Ende geschieden und allein. Der Barkeeper wird keine geschiedene Frau mit zwei Kindern heiraten. Sie haben doch zwei, nicht wahr? Einen Jungen und ein Mädchen?«
»Ja, aber …«, piepste sie.
»Nein, kein Aber«, unterbrach ich sie energisch. »Sie müssen darüber gründlich nachdenken, denn es wird kein Zurück geben, und wenn Sie so weitermachen, sehe ich in Ihrem Leben nur Unglück. Sie werden erst begreifen, was Sie verloren haben, wenn es zu spät ist.«
In dem Moment hörte ich den erlösenden Gong meiner Uhr, und der Kassettenrekorder schaltete sich ab. Ich war erleichtert. Diese Frau nahm gar nicht in sich auf, was ich ihr erklärte, und das fand ich reichlich frustrierend.
Ich stand auf und sagte freundlich, aber bestimmt: »Und damit ist unsere Zeit auch schon um.«
Ich ließ das Kassettenfach aufschnappen, nahm das Band heraus, steckte es in die Plastikhülle und gab es ihr zusammen mit einem Papiertaschentuch. Sharon folgte mir mit hängendem Kopf und gezwungen lächelnd zur Tür.
Sie dankte mir für meine Zeit und fragte, wann sie wiederkommen dürfe, aber ich sagte: »Eigentlich wäre es mir lieber, wenn Sie sich einen Termin bei einer Freundin von mir geben lassen.« Ich ging zum Sideboard zurück und zog eine Visitenkarte aus einem Stapel. »Lori Sellers. Sie ist Psychotherapeutin, hat ihre Praxis drüben an der Eleven Mile. Sie ist sehr gut, und ich glaube, es würde Ihnen guttun, mit ihr über Ihre bevorstehenden Entscheidungen zu sprechen.« Ich drückte ihr die Karte in die ausgestreckte Hand. »Was den nächsten Termin bei mir anbelangt: Aufgrund praktischer Erfahrungen erlaube ich nur zwei Sitzungen pro Jahr. Man sollte nicht von Zukunftsdeutern abhängig werden. Machen Sie sich klar, dass alle Lösungen bereits in Ihnen stecken. Sie müssen sich nur selbst vertrauen und auf sich hören.«
Sharon wirkte nicht überzeugt. Darum führte ich sie am Ellbogen behutsam zur Tür. »Jetzt sollten Sie nach Hause fahren, sich das Band anhören und über alles nachdenken, was ich gesagt habe. Sie sind mit einem freien Willen ausgestattet, und der ist eine gewaltige Kraft. Sie können Ihr Schicksal ändern, wenn Sie mit Verstand an die Sache herangehen. Seien Sie vorsichtig, okay? Ich meine, Sie sind wie lange verheiratet? Zehn Jahre?«
Wieder überraschtes Luftholen. »Ja. Woher wissen Sie das?«
Ich breitete lächelnd die Arme aus. »Ich bin ein Medium.«
Als ich ihr hinterhersah, dachte ich zum hunderttausendsten Mal, wie schwer es mir fiel, dieses Wort über die Lippen zu bringen. Es klang mir zu sehr nach »Spinner«. Wenn ich nach meinem Beruf gefragt wurde, verlegte ich mich meistens auf eine unverfänglichere Bezeichnung wie »intuitiver Berater«, um ein bisschen seriöser zu klingen. Ich hatte mir sogar Visitenkarten drucken lassen, auf denen stand ABIGAIL COOPER, P.I., und darunter in winzigen Buchstaben PRIVATE INTUITIVBERATUNG. Die meisten Leute halten das für ein Zeichen von Cleverness. In Wirklichkeit bin ich bloß feige.
Ich wollte nie ein Medium sein, weder hauptberuflich noch zum Vergnügen. Das wurde mir quasi aufgedrängt, und ich habe mich damit nie sonderlich wohlgefühlt. Nicht dass ich auf meine Tätigkeit nicht stolz wäre; mir ist nur ständig bewusst, dass ich anders bin.
Es gibt zum Beispiel viele Leute, die mit mir ein Gespräch anfangen und mich sogar amüsant finden – bis sie hören, womit ich meine Brötchen verdiene. Dann ziehen sie sich von mir zurück wie die Flut vom Strand, und ich liege im Sand mit dem Gefühl, ein großes rotes Kreuz auf der Stirn zu tragen. Seit vier Jahren gehe ich diesem Beruf jetzt nach und warte noch immer, ob die Flut nicht doch mal zurückkommt.
Gerade wollte ich hinter Sharon die Tür schließen, als eine meiner Stammkundinnen, Candice Fusco, mit einem großen braunen Umschlag den Flur entlangkam.
»Hallo, Candice«, rief ich ihr entgegen.
»Tag, Abby. Ich komme doch noch pünktlich, oder?« Sie sah auf die Uhr und beschleunigte ihren Schritt.
»Jep. Habe die vorige Klientin gerade verabschiedet.« Ich trat zur Seite und zog die Tür weit auf, um sie hereinzulassen. Candice war höchstens einen Zoll größer als ich, aber mit ihren High Heels – ich hatte sie noch nie ohne gesehen – ragte sie ein gutes Stück über mich hinaus. Sie war eine elegante Frau mit einer Vorliebe für teure Kostüme. Heute trug sie cremefarbene Seide, die jede Bewegung schmeichelhaft unterstrich und die braune Haut und die hellblonden Haare gut zur Geltung brachte. Angesichts ihrer Weiblichkeit werde ich immer ein bisschen unsicher, aber nach ein, zwei Minuten habe ich das überwunden, wahrscheinlich auch, weil sie dabei so natürlich bleibt. Anhand von Aufmachung und Benehmen würde man kaum vermuten, dass sie Privatdetektivin ist, noch dazu eine echt gute – wobei ihre jüngsten Erfolge auch ein bisschen durch meine Wenigkeit zustande gekommen sind.
»Möchten Sie hier Platz nehmen oder lieber in meinem Sitzungszimmer?«, fragte ich, während ich die Tür schloss.
»Hier ist mir recht, Abby. Es wird nicht lange dauern«, antwortete sie und streifte sich die Henkel ihrer Handtasche und einer Aktentasche von der Schulter.
»Und wie steht’s in Kalamazoo dieser Tage?«, fragte ich und deutete auf die beiden Stühle des Wartezimmers.
»Existiert noch«, sagte sie beim Hinsetzen. »Ich schwöre, die Fahrt dauert jedes Mal länger.«
»Bei Ihrem Fahrstil? Das bezweifle ich. Wie lange haben Sie diesmal gebraucht?«
»Eine Stunde und vierzig Minuten.«
»Ein neuer Rekord?«
»Nicht doch. Ich habe es schon mal in einer Stunde fünfunddreißig geschafft. Natürlich fuhr ich die ganze Zeit fünfundneunzig Meilen, aber ich bin heute ein bisschen langsamer gefahren, weil Sie mir dazu geraten haben.«
»Ja, so eine Warnung sollte man lieber nicht in den Wind schlagen.« Bei unserer vorigen Begegnung hatte ich Candice gesagt, sie solle auf ihren Bleifuß aufpassen, sonst würde sie ein deftiges Knöllchen bekommen. »Ist das das Material?«, fragte ich und deutete auf den braunen Umschlag.
»Ja, das sind die drei Angestellten, auf die wir den Kreis eingegrenzt haben«, sagte Candice und reichte ihn mir.
Ich hob die Lasche an und zog drei Fotos heraus – zwei Frauen und ein Mann, die für das Angestelltenschildchen posierten. Ich blätterte sie einmal schnell durch, dann noch einmal langsam und nahm mir bei jeder Person Zeit, meine Intuition sprechen zu lassen. Candice hatte mich am Abend wegen eines neuen Falles angerufen. Eine große Firma, die Anlagefonds verwaltete, hatte entdeckt, dass bei Kundenportfolios mehrere Tausend Dollar fehlten. Die Firma hatte von der Entdeckung noch nichts verlauten lassen und stattdessen Candice engagiert, um den Veruntreuer zu finden.
»Okay – diese beiden.« Ich hielt das Foto des Mannes hoch, ein Mittvierziger mit Hängebacken und gelben Zähnen, und das Foto einer Frau, Mitte bis Ende zwanzig mit hochtoupierter Ponyfrisur und Fischaugen mit zu viel Wimperntusche. »Sie machen gemeinsame Sache. Und meinem Gefühl nach haben sie etwas miteinander. Der Mann hat nichts Gutes im Sinn. Er ist hinterhältig, und damit meine ich nicht nur, dass er noch mit einer anderen Angestellten herumspielt, sondern da ist etwas Übleres im Gange. Hat er sich vor Kurzem ein Boot gekauft?«
»Er hat in letzter Zeit ziemlich viel gekauft; auch ein Grund, weshalb ihn die Firma verdächtigt. Und, ja, ein Boot war auch dabei.«
»Okay, das ist euer Mann. Aber das Boot spielt auch eine Rolle. Ich habe den Eindruck, dass er sehr unauffällig und geschickt vorgeht, aber auf dem Boot gibt es Beweise. Dort würde ich mit der Suche anfangen und sehen, was sich finden lässt.«
»Was ist mit der zweiten Frau?«, fragte Candice.
Ich betrachtete das Porträt. Sie war, grob geschätzt, Ende fünfzig, Anfang sechzig, die Haare verwaschen grau, die Nase spitz, die Augen trübe. Ich tastete anhand meines Radars. »Mir scheint, dass sie keine Ahnung hat, was da läuft. Sie wird nur als Schachfigur benutzt. Der Mann braucht sie vielleicht, um seine Spuren zu verwischen oder um ihr die Sache in die Schuhe zu schieben.«
»Das klingt einleuchtend«, sagte Candice. »Zurzeit deuten die meisten Indizien auf sie hin, dabei war sie dreißig Jahre lang eine vorbildliche Mitarbeiterin. Sie steht kurz vor der Rente, und wir konnten keinen Grund finden, warum sie ihren Arbeitgeber nach all der Zeit bestehlen sollte.«
»Ja, der Überlegung stimme ich zu. Ich spüre deutlich, dass sie in eine Falle laufen soll. Durchsuchen Sie das Boot, Candice. Da ist etwas versteckt.«
Candice schenkte mir ein strahlendes Lächeln, während ich die Fotos zurück in den Umschlag schob. »Danke, Abby. Sie haben mir wahrscheinlich eine Menge Lauferei erspart.«
»Nicht der Rede wert, Candice. Übrigens, was ist mit Irland?«
Sie lachte erschrocken auf. »Großer Gott! Entgeht Ihnen denn nie etwas? Nächsten Monat reise ich für sechs Wochen dorthin.«
»Wow«, sagte ich neidisch. »Na, Sie werden sich großartig amüsieren. Aber Sie müssen mehr warme Sachen einpacken, als Sie denken.«
»Danke. Das mache ich. Im September komme ich zurück. Und beim nächsten großen Fall rufe ich Sie bestimmt wieder an.«
»Jederzeit gern«, sagte ich, nahm ihren Scheck entgegen und stand auf, um mit ihr zur Tür zu gehen.
»Ach, übrigens«, meinte Candice, während sie sich nach Handtasche und Aktentasche bückte, »ich habe neulich nachts auf dem Discovery Channel eine Dokumentation über ein Medium gesehen, das für die Polizei arbeitet und die hartnäckigsten Fälle löst. Dabei musste ich gleich an Sie denken. Wissen Sie, ich glaube, Sie könnten bei der Polizei auch sehr erfolgreich sein.«
Ich riss die Augen auf. Das konnte sie nicht ernst meinen. »Auf keinen Fall!« Ich lachte, als wäre das superlustig.
»Warum denn nicht? Sie haben mir bei Wirtschaftsverbrechen schon alle möglichen Hinweise gegeben. Warum sollten Sie Ihre Begabung nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellen?«
Ich schaute sie an und suchte krampfhaft nach einer guten Begründung, warum ich mit der Polizei nichts zu tun haben wollte. Doch dabei spielte meine Intuition plötzlich verrückt, und mir schossen blitzartig ein paar Bilder durch den Kopf. Die Vision war so intensiv, dass ich abrupt zurückwich und beinahe das Gleichgewicht verloren hätte, wenn Candice nicht nach meinem Arm gegriffen und mich gestützt hätte.
»Abby?«, fragte sie besorgt. »Abby, ist alles in Ordnung?«
Aus meiner Trance gerissen, sah ich auf und sammelte mich. »Ja, ich hatte nur gerade ein echt unheimliches Déjà-vu.« Ich schüttelte den Kopf, um wieder klar zu sehen, und sagte zu ihrer Beruhigung: »Also, Sie fahren jetzt vorsichtig nach Hause, okay? Und rufen Sie mich an, sobald Sie wieder in der Stadt sind. Dann gehen wir zusammen essen.«
Candice machte noch immer ein besorgtes Gesicht, doch als erfahrene Detektivin merkte sie, dass ich nicht erzählen wollte, was ich gerade gesehen hatte. »Klasse Idee. Passen Sie auf sich auf, Abby«, sagte sie und drückte mir die Schulter.
Ich schloss die Tür hinter ihr und rieb mir seufzend die Schläfen. Das war ein anstrengender Morgen gewesen. Ich ging zu meinem Terminkalender, um nachzusehen, wie es um den Rest des Tages stand, und glitt mit dem Finger zum nächsten Eintrag. Der Elf-Uhr-Termin hatte abgesagt, und mein nächster Klient würde erst um eins kommen. Ich jubelte innerlich. Durch die Absage hatte ich zwei Stunden Zeit, um mittagessen zu gehen oder sonst was zu tun.
Um keine Minute länger zu vergeuden, blies ich alle Kerzen aus, griff nach meiner Handtasche und machte mich davon. Als ich auf den Flur des Bürohauses trat, umfing mich die kühle Luft der Klimaanlage und belebte mich augenblicklich.
Es gehört zu den Nachteilen meines Berufs, dass Luftdruck und Temperatur während der Sitzung mit einem Klienten häufig wechseln. Kalte Räume werden warm, in warmen Räumen wird es heiß, und manchmal bekomme ich einen schrillen Pfeifton in den Ohren. Während der vergangenen Jahre hatte ich gelernt, das zu ignorieren, aber Mitte Juli fiel mir das naturgemäß immer etwas schwerer. Meine Praxis befand sich in einem älteren Gebäude in der Innenstadt, und die Kaltluftzufuhr funktionierte im Hausflur zwar sagenhaft, in meinen Räumen aber nur dürftig.
Sowie ich an der Treppe war, griff ich das Geländer und stürmte hinunter, immer mehrere Stufen auf einmal nehmend. Was soll ich sagen? Ich bin immer als letztes Kind vom Klettergerüst gesprungen, wenn die große Pause zu Ende war.
Als ich mit beiden Füßen im Erdgeschoss aufschlug, blieb ich eine Minute lang zwischen den Marmorwänden stehen und atmete die kalte Luft ein, bevor ich mich tapfer der Hitze und dem Gewühl draußen auf der Straße stellte.
Ich wohne und arbeite in einer Vorstadt von Detroit namens Royal Oak, die als eine der letzten großen Bastionen der Mittelklasse einen Puffer zu den nördlich gelegenen reichen Vororten bildet und Detroit dadurch vor der Geldaristokratie bewahrt.
Die Innenstadt platzt inzwischen aus allen Nähten, da sie zwischen der Ten Mile und der Fourteen Mile Road eingezwängt ist. Im Südosten Michigans geben die Mile Roads grob an, wie weit man von Detroit entfernt ist – je weiter etwas im Norden liegt, desto größer ist die Meilenzahl und die Zahl auf dem Preisschild der Immobilien. Eine einzige Meile kann schon eine coole Viertelmillion ausmachen.
Während der letzten paar Jahre hat sich Royal Oak von einem meidenswerten Ort zu einer begehrten Gegend gemausert. Inzwischen verbringen viele Anwohner ihre Zeit im Zentrum, bummeln durch die Geschäftsstraßen oder sitzen auf Bänken und begaffen ihre Umgebung. Hier sind alle möglichen Typen vertreten und willkommen: Alte und Junge, Homos und Heteros, Säufer und Gauner, Hippies und Kinderlose mit doppeltem Einkommen. Bunt gemischt wie bei den Vereinten Nationen.
Meine Praxis befindet sich im Washington Square Building am nördlichen Zipfel der Innenstadt kurz vor der Eleven Mile. Ich teile mir die vier Räume mit meiner besten Freundin Theresa, die ebenfalls medial veranlagt ist. Wir haben uns dieses Haus ausgesucht, weil es nicht nur das größte, sondern auch das sonderbarste Bauwerk in Royal Oak ist. Es ist ein Wunderwerk architektonischer Unentschlossenheit: Ein Mischmasch aus Ziegel und Mörtel in kreidigem Braun, bei dem die kastenförmige Flächenaufteilung einen drastischen Kontrast zu den spitzwinkligen Verzierungen bildet und die Fenster je nach Stockwerk von eckig bis bogenförmig rangieren. Ein riesiger Neonschriftzug, der für ein lokales Blatt Reklame macht, läuft am Dachsims entlang wie ein Halsband und ist meilenweit zu erkennen, was Theresa und mir die Wegbeschreibung für neue Klienten erleichtert.
Im Erdgeschoss sind kleine Läden, Galerien und Restaurants untergebracht, in den oberen Stockwerken Büros und Geschäftsräume. Theresa und ich sitzen auf der Nordseite zwischen einer Steuerberaterkanzlei und einer Computergrafikfirma. Die Miete ist erträglich, das Gebäude gepflegt, und von den Nachbarbüros sind nie Klagen wegen unseres großzügigen Einsatzes von Kerzen und Räucherstäbchen gekommen. Seit vier Jahren schon ist dies der perfekte Standort.
Nachdem ich die kühle Luft der Eingangshalle ausreichend genossen hatte, ging ich tapfer nach draußen in die Gluthitze des Julitages. Ich schwenkte nach rechts in Richtung Zentrum und holte mein Handy aus der Tasche. Nachdem ich es aufgeklappt hatte, rief ich die Mailbox ab und hörte konzentriert hin, während ich drei Blocks weit die Washington entlang zu dem Pic-A-Deli-Restaurant lief, um mir ein Thunfischsandwich mit Honigsoße und extrascharfen Peperoni zu holen. Ich hatte eine Nachricht von Theresa.
Theresa und ich hatten uns vor viereinhalb Jahren unter sehr ungewöhnlichen Umständen kennengelernt, und bis heute staune ich über die Stärke ihrer Gabe, die sie zu mir geführt hat.
Ich arbeitete damals in einer Bank und gab mir alle Mühe, mich in eine Welt einzufügen, die mich nie so richtig akzeptieren wollte. In meiner Kindheit hatte es eine Reihe ungewöhnlicher Vorkommnisse gegeben, die meine Familie und ich jedoch leicht ignorieren konnten, da sie im Abstand von etlichen Jahren und nur vereinzelt auftraten: meine Ankündigung eines Brandes in unserem Keller, eine Woche bevor die Rauchmelder uns aus dem Tiefschlaf rissen; meine Vorahnung vom Tod meines Großvaters, zehn Minuten bevor der Anruf meiner Tante kam; und schließlich, zum Verdruss meiner aufstrebenden Eltern, meine Erklärung, dass die hoch bezahlte Stelle meines Vaters der Firmenverkleinerung zum Opfer fallen werde, einen Monat vor seinem Entlassungsschreiben.
Für Eltern, die alles Übernatürliche beargwöhnen, war das, als ob ich mit meinen Vorhersagen das Unglück erst herbeiführte und als hätte es uns erspart bleiben können, wenn ich bloß den Mund gehalten hätte. Ich begriff ziemlich schnell, dass es besser war, meine Vorahnungen für mich zu behalten.
Als ich älter wurde, kam es viel häufiger zu solchen »Episoden«, wie ich sie schließlich nannte, und sie wurden auch eindrücklicher. Eines Tages im College überfiel mich ein Gefühl, das mich zwang, wider besseres Wissen kurz vor dem Unterricht meinen Statistikprofessor anzusprechen. Ich stand hinter ihm, trat nervös von einem Fuß auf den anderen, und als er sich schließlich zu mir herumdrehte, platzte ich überstürzt damit heraus, dass er sofort zum Arzt gehen müsse, weil ich bei ihm ein Herzproblem sähe.
Einen Moment lang blickte er mich sonderbar an und forderte mich dann auf, zu meinem Platz zu gehen, damit er mit der Vorlesung beginnen könne. Eine Woche später fiel der Unterricht aus, weil unser Professor gestorben war. Sie können es sich denken – an einem Herzinfarkt.
Dieser Vorfall überzeugte mich weit mehr als die Unterstellungen meiner Eltern, dass ich diese schreckliche Geschichte irgendwie verursacht hatte. Indem ich es laut aussprach, führte ich das vorzeitige Ableben meines Professors herbei, so glaubte ich. Ich wusste damals nichts über mediale Intuition und wie sie funktionierte oder wie sie sich anfühlte. Ich kannte nur das Verhältnis von Ursache und Wirkung: Ich sah Dinge vor meinem geistigen Auge, ich sprach sie laut aus, sie passierten – folglich löste ich sie aus.
Während der restlichen Collegezeit und meiner anfänglichen Laufbahn bei der Bank weigerte ich mich, meine Ahnungen mitzuteilen. Wenn mir ein Bild durch den Kopf schoss, konzentrierte ich mich hastig auf etwas anderes und fing an zu summen. Als ich sechsundzwanzig war, summte ich konstant.
Dann eines Morgens, als ich in der Bankfiliale an meinem Schreibtisch saß, hatte ich plötzlich das Gefühl, als blickte mich jemand an. Ich sah mich in der Schalterhalle um und entdeckte eine junge Frau mit kastanienbraunen Locken und großen braunen Augen, die mich auf eine eigentümliche, scheinbar abwesende Art anstarrte. Ich lächelte sie an und überlegte, ob ich sie irgendwoher kannte. Sie lächelte zurück und starrte mich weiter an. Als ich darauf fragend die Achseln zuckte, nickte sie mir nur zu und verließ die Bank. Ich wunderte mich über ihr seltsames Benehmen, wurde aber das Gefühl nicht los, dass ich sie wiedersehen würde.
Am nächsten Tag, als ich gerade aus dem Lager kam, beladen mit Flyern und Plakaten für den Eingangsbereich, sah ich dieselbe Frau vor meinem Schreibtisch sitzen. Ich befreite mich von dem ganzen Papier und eilte zu ihr, gespannt, woher wir uns wohl kannten.
»Hallo«, sagte ich und setzte mich an meinen Platz. »Kann ich etwas für Sie tun?«
Sie blickte mich kurz an, aber so, als ob sie durch mich hindurchsähe. »Sie sind Abigail, ja?«
»Und?«, fragte ich und schob das Namensschild auf meinem Schreibtisch ein bisschen näher zu ihr hin.
»Ich heiße Theresa, und in Ihren Ohren wird das sicher verrückt klingen, aber ich bin ein Medium und habe eine Botschaft für Sie.«
Ich bin sicher, mein Gesichtsausdruck wechselte von höflicher Neugier zu Vorsicht. Ich wusste nicht, was ein »Medium« ist, und rechnete mit einem manipulativen Bibelvortrag, in dessen Verlauf ich den Sicherheitsdienst rufen würde.
Da ich nichts sagte, redete Theresa weiter. »Kennen Sie jemanden namens Carl?«
Ich sperrte verblüfft den Mund auf. »Mein Großvater hieß so.« Ich hatte sehr an ihm gehangen; er war gestorben, als ich zwölf war.
»Und wer ist Sum… Summer?«, fragte sie stammelnd, bis sie den Namen richtig heraushatte.
»Sumner«, korrigierte ich. »So hieß mein anderer Großvater.«
Mir war bewusst, dass ich plötzlich die Luft anhielt, so als könnte das Atemgeräusch sie ablenken und am Weitersprechen hindern.
»Und Margaret?«
Mir schossen die Tränen in die Augen; niemand, mit dem ich Kontakt hatte, kannte die Vornamen meiner Großeltern. »Meine Großmutter – sie war mit Carl verheiratet und starb, als ich sechs war.«
»Aha, nun, Ihre Großeltern reden seit zwei Tagen mit mir, und ich soll Ihnen etwas ausrichten. Sie wissen, dass Sie Dinge vorhersehen können. Sie wissen, dass Sie die Gabe haben, und wollen, dass ich Ihnen helfe, sie zu entwickeln. Diese Gabe sollten Sie nutzen, um Geld zu verdienen, und nicht solche Dinge hier tun.« Sie deutete mit einer Geste auf meinen Schreibtisch.
Ein paar Augenblicke lang sahen wir uns nur an. Ich musste Theresa zugutehalten, dass sie genauso unsicher wirkte, wie ich mich fühlte. Ich überlegte, ob das ein Scherz sein könnte, ob irgendein abartiger Kerl das für lustig hielt und eine Schauspielerin auf mich angesetzt hatte. Oder ob diese Frau verrückt war und einfach nur gut geraten hatte. Allerdings ließ sich nicht abtun, dass sie ausgesprochen hatte, was ich eigentlich schon mein Leben lang wusste: Ich hatte »die Gabe«.
Wie ein Gewinn war sie mir bis dahin nicht vorgekommen, doch als ich sah, welche Emotionen durch den Kontakt mit diesem Medium wachgerufen wurden, fand ich die Bezeichnung mehr als passend.
Ich würde Ihnen gern berichten, ich habe einen Jerry-Maguire-Moment erlebt, sei aufgesprungen, um allen zu verkünden, ich werde meinen langweiligen Bankjob an den Nagel hängen und als Medium arbeiten. Die Wahrheit ist, dass es sehr lange dauerte, bis ich mich mit der Idee anfreunden konnte.
Theresa ließ mir ihre Karte da – sie hielt ihre Sitzungen damals in einem kleinen Café ab – und sagte, ich solle sie anrufen, wenn ich mich entschlossen hätte, meiner Intuition zu vertrauen und dem Weg zu folgen, der mir bestimmt sei.
Drei Monate lang dachte ich darüber nach und drückte mich um eine Entscheidung; dann griff das Schicksal ein, die Entscheidung wurde für mich gefällt. Ein größerer Konzern kaufte die Bank, und ich wurde entlassen. Da ich arbeitslos war und ein bisschen verzweifelt, suchte ich Theresa auf, die in den folgenden Jahren meine Tutorin, beste Freundin und Geschäftspartnerin wurde.
Zusammen haben wir uns ein Geschäft aufgebaut, bei dem sich unsere Talente ergänzen: Sie bringt Leute mit ihren verstorbenen Freunden und Verwandten zusammen, und ich bringe die Klienten mit ihrer Zukunft in Kontakt. Das ist eine großartige Kombination, da wir nicht miteinander konkurrieren und sehr gerne Erfahrungen austauschen. Ja, das tun wir – wir Intuitiven sprechen äußerst gern über die Botschaften, die zu uns durchdringen. Dadurch können wir unsere Fähigkeiten genauer einschätzen und die Vorgänge besser begreifen.
Die Leute stellen sich vor, dass wir unsichtbare Wesen hören oder dass sich ein kompletter Farbfilm in uns abspielt und wir dadurch die Zukunft voraussagen. Aber die Wirklichkeit ist viel langweiliger.
Tatsächlich schießt uns ein Gedanke oder ein Bild durch den Kopf, das einem wie eine Erinnerung vorkommt, und das geht einher mit dem starken Drang, es hinauszuposaunen. Das ist ein bisschen wie beim Tourettesyndrom. Plötzlich stoße ich unabsichtlich Sätze aus, und gerade die enthalten exakte Details.
Am besten lässt sich das beschreiben, indem man es mit dem Spiel Cluedo vergleicht. Vor meinem geistigen Auge sehe ich einen Leoparden, einen Billardtisch und Kerzen. Dabei überkommt mich der starke Drang zu fragen: »Wer ist der Billardspieler, der Leomuster trägt und gern bei Kerzenlicht spielt?« So etwa würde mein Verstand interpretieren, was ich sehe. Dann ist es die Aufgabe des Klienten, darauf zu kommen, dass Mrs Leo es im Billardzimmer mit dem Kerzenleuchter getan hat. Dadurch sind meine Deutungen interaktiv, und je mehr der Klient mitarbeitet, desto genauer ist am Ende das Ergebnis.
Unterwegs zum Deli lauschte ich lächelnd Theresas Stimme. Sie hatte aus Kalifornien angerufen, wo sie sich seit drei Wochen aufhielt, um mit Filmproduzenten und anderen Hollywoodtypen über einen Pilotfilm zu verhandeln, der sich um ihre Fähigkeit, Kontakt zu Verstorbenen herzustellen, drehen sollte. Theresas medialer Schwerpunkt liegt woanders als meiner. Er richtet sich fast ausschließlich darauf, die Kluft zwischen den Lebenden und den Toten zu überbrücken, und darin ist sie nicht bloß gut, sie ist fantastisch. Ihre Sitzungen sind am eindrucksvollsten mit großen Gruppen, wo reichlich Tränen fließen und es zu dramatischen Überraschungsmomenten kommt, da sie mit unglaublicher Genauigkeit Namen, Orte und Daten intuitiv erfasst und recht gezielt mit Verstorbenen verbindet, also auch den Beweis antritt, dass das Leben über den Grabstein hinaus weitergeht.
Ihr bei der Arbeit zuzusehen ist wirklich faszinierend, und darum hatte nun Hollywood an ihre Tür geklopft und sie um ein Gespräch gebeten. Wenn man heutzutage mit einem sechsten Sinn berühmt werden will, muss man mit den Toten reden können, und da ich gar nicht gern im Zentrum der Aufmerksamkeit stehe, bin ich froh, dieses spezielle Talent nicht zu besitzen. Außerdem ist Theresa viel eher dafür geschaffen, in der Öffentlichkeit größere Beachtung zu finden. Von uns beiden ist sie die Selbstbewusstere und – obwohl ein paar Jahre jünger als ich – auch die Erwachsenere.
Ihre Nachricht auf der Mailbox war kurz und aufgeregt. »Hallo meine Liebe! Es gibt Neuigkeiten! Ruf mich an!« Ich drückte sofort die Kurzwahltaste und wartete auf den Klang ihrer Stimme. Beim vierten Klingeln nahm sie ab.
»He, was ist los?«
»Oh, hallo Abby! Ich wollte dich gerade anrufen. Ich habe nicht viel Zeit – unser Flug wird gleich aufgerufen. Aber ich musste dir unbedingt sagen, dass wir heute Morgen unterschrieben haben!«
»Hab ich ja gesagt«, meinte ich lächelnd. Es gibt keine größere Befriedigung für mich, als recht zu behalten. Ich hatte mit Theresa eine Sitzung abgehalten, bevor sie nach Kalifornien geflogen war, und es war Musik in meinen Ohren, dass meine Vorhersage eingetroffen war.
»Und du hattest auch recht mit dem Haus. Wir haben das entzückende Häuschen in Santa Monica gefunden und gerade der Besitzerin zugesagt, dass wir es zum nächsten Ersten mieten!«
Natürlich freute ich mich riesig, aber nachdem ich in meiner Freizeit so viel mit Theresa und ihrem Mann Brett zusammen gewesen war, fühlte ich mich auch allein gelassen. »Du willst mich also tatsächlich verlassen, hm?«
»Fürchte ja. Aber ich komme heute zurück, und wir haben noch den ganzen Monat für uns. Und schließlich gehen Hunderte Flüge pro Tag zwischen Detroit und L.A. Du kannst mich besuchen und ich dich … wirklich, das wird halb so wild.«
Ich war vor dem Pic-A-Deli angelangt, aber mein Appetit war verflogen. Ich ging trotzdem rein und stellte mich an, schmollend wie eine Dreijährige. Mir war immer klar gewesen, dass dieser Tag kommen würde, aber der Gedanke half mir nicht – ich fand es trotzdem blöd. Während ich mir anhörte, wie Theresa von ihrer aufregenden Fernsehkarriere erzählte, tat ich interessiert und zwang meine Stimme in die Oktaven der Begeisterung.
Ich glaube, meine schauspielerische Leistung war nicht besonders, denn am Ende sagte sie: »He, ich bin heute Abend zu Hause – ich rufe dich an, dann besprechen wir alles. Du könntest ja auch nach L.A. ziehen, weißt du.«
Da Intuition eine Aktivität der rechten Hirnhälfte ist, stellte ich meine Frage dort – meine Technik, wenn ich eine Ja/Nein-Antwort brauchte: Soll ich nach Kalifornien ziehen? Ja und Nein kann ich unterscheiden, weil sich bei einem Ja ein Gefühl der Leichtigkeit in der rechten, bei einem Nein eine gewisse Schwere in der linken Körperhälfte einstellt. Auf meine Frage bekam ich links ein Schweregefühl.
Ich schaltete wieder meine Schauspielstimme ein und sagte: »Klar, ruf mich heute Abend an, Theresa. Dann reden wir weiter.«
Ich war die Nächste in der Schlange, und Theresa musste an Bord gehen, darum legten wir auf. Ich trat vor, sah den korpulenten weißhaarigen Mann hinter der Theke an und setzte ein Lächeln auf, das ich nicht empfand.
»Abigail! Das Gleiche wie immer?«
»Sicher, Mike, aber mit einer doppelten Portion Peperoni. Ich bin heute mal waghalsig.«
Mike nickte lachend. Als er nach dem Brotmesser griff, huschte mir ein Gedanke durch den Kopf. Die meisten Leute glauben, als Medium sei man immer »eingeschaltet«, sodass wir unterwegs auf der Straße gute Menschen von schlechten unterscheiden können und über einen Wildfremden sofort alles wissen. In Wirklichkeit sind wir nur »eingeschaltet«, wenn wir das wollen. Das ist quasi wie ein fernes Telefonklingeln: Es läutet ständig, manchmal lauter, manchmal leiser. Wenn wir rangehen, erfahren wir etwas, und wenn wir nicht rangehen, erfahren wir nichts.
Als Mike anfing, das Brot zu schneiden, klingelte mein intuitives Telefon sehr laut. Gereizt ging ich ran und bekam ein Bild und ein Gefühl übermittelt. Ich sah Mike an. Er wusste, womit ich mein Geld verdiente. Er schien sich nicht allzu sehr daran zu stören und ließ mich sogar meine Karte an seinem schwarzen Brett aushängen. Darum entschied ich mich, den Gedanken auszuplaudern, der mir durch den Kopf schwirrte.
»Äh, Mike?«
»Ja, Abby?«
»Du fährst einen silbernen Wagen?«
»Ja! Woher weißt du?«
Ich tippte mir lächelnd an die Schläfe und zwinkerte verschwörerisch. »Ich glaube, dein Wagen verliert Öl oder Kühlwasser oder so etwas. Vielleicht überprüfst du das mal.«
Mike starrte mich mit leicht geöffnetem Mund einen Moment lang an, dann breitete sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus. »Abby, du bist gut! Mir ist heute Morgen in der Garage ein kleiner Fleck aufgefallen, und ich dachte, ich fahre am Wochenende deswegen mal zur Tankstelle. He, kannst du mir auch die Lottozahlen vorhersagen?«
Wenn ich von jedem, der mir diese Frage stellt, ein Fünfcentstück bekäme, bräuchte ich nicht mehr zu arbeiten. Ich wäre reich, reich, reich!
»Junge, wenn ich die wüsste, würde ich einen Tippschein abgeben!«, sagte ich, als er mir mein Mittagessen eingewickelt über die Theke reichte. Ich bezahlte, ließ mir noch eine Cola und eine Tüte Chips geben und lief zurück zur Praxis.
Als ich von der Treppe auf den Flur einbog, sah ich eine Frau ungeduldig vor meiner Tür auf und ab schreiten. Erschrocken schaute ich auf die Uhr. Es war kurz nach halb zwölf. Hatte ich im Terminbuch am falschen Tag nachgesehen? Hatte ich einen Termin nicht eingetragen?
Ehrlich gesagt, war ich nicht die Beste, was den ganzen organisatorischen Bürokram anging. Der war für mich das Nervige an dem Job. Manchmal kam ich auch ein bisschen zu spät zu Terminen, oder ich vergaß sie sogar ganz.
Mit schamrotem Gesicht ging ich rasch auf die Frau zu und setzte mein gewinnendstes Lächeln auf. »Hallo«, sagte ich. »Entschuldigen Sie – ich kann mich an keinen Termin für diese Uhrzeit erinnern. Habe ich etwas verschlampt?«
Die Frau war groß und schlank, hatte schulterlange rotbraune Haare, eine Hornbrille und große braune Augen, die erschöpft und zugleich ängstlich guckten. »Sind Sie Abigail Cooper?«, fragte sie mit lieblicher Minnie-Maus-Stimme.
»Ja.«
»Oh, Gott sei Dank. Ich bin Allison Pierce. Meine Freundin Connie hat ihren Elf-Uhr-Termin bei Ihnen abgesagt, und da dachte ich, vielleicht könnten Sie mich stattdessen drannehmen, falls Sie ihn nicht anderweitig vergeben haben.«
Ich sah noch einmal auf die Uhr und dann auf meine Lunchtüte. Meine übliche Reaktion wäre gewesen: Nein, ich halte keine eingeschobenen Bitte-bitte-nur-ausnahmsweise-dieses-eine-Mal-Sitzungen ab. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass in dem Moment, wo man eine Ausnahme macht, schon feststeht, dass sie zur Regel wird.
Doch bei ihrem ängstlichen Gesichtsausdruck und der Art, wie sie die Hände rang, wurde ich weich. Seufzend wandte ich mich an meine »Crew« in der Hoffnung auf Unterstützung. Stattdessen hörte ich ein sehr entschiedenes Ja. Mist.
Na ja, ich hatte sowieso keinen großen Hunger mehr. »Also gut«, sagte ich. »Bis der nächste Klient kommt, ist noch etwas Zeit. Kommen Sie.«
Ich schloss auf, ließ uns beide herein und stellte mein Sandwich in den kleinen Kühlschrank im Wartezimmer, schloss die Eingangstür ab und führte Allison ins Sitzungszimmer.
Unsere Praxis hat einen T-förmigen Grundriss. Man gelangt zunächst in das winzige Wartezimmer, wo zwei Stühle der Tür zugewandt stehen und auf einem Tischchen ein paar Zeitschriften liegen. Gleich dahinter befindet sich unser Büro, in der Mitte der kleine Schreibtisch mit Telefon und Computer und an der Wand zwei große Aktenschränke, in denen wir Adressen und die Einverständniserklärungen der Klienten aufbewahren. Vom Wartezimmer gehen die beiden Sitzungsräume ab: rechts Theresas und links meiner.
Dieses winzige Räumchen – es ist nur elf mal neun Fuß groß – ist mir echt ans Herz gewachsen. Ich habe die Wände azurblau gestrichen, was mich an diese Fotokalender mit griechischen Inseln im Meer erinnert. Es hat üppige Zierleisten, die ich als Ergänzung zu dem Blau in einem satten Sahnegelb gestrichen habe. Die zwei hohen, schmalen Fenster, die eine ganze Wand einnehmen, machen es schön hell. Neben der Fensterseite steht ein Sideboard und darauf eine bunte Glasvase, aus der sieben Bambustriebe wachsen.
Auf allen verfügbaren Flächen habe ich dezent duftende Kerzen gruppiert. In der Mitte des Zimmers stehen zwei cremefarbene Polstersessel einander gegenüber, dazwischen ein Tischchen mit einem Kassettenrekorder. An der Wand hängen mein Lieblingsfoto von Hawaii und ein schöner Mosaikglasspiegel. Ein hoher, schmaler Wasserfall in einer Ecke verleiht dem Raum Rhythmus.
Ich deutete auf einen Sessel, und als Allison Platz genommen hatte, ging ich herum und zündete die Kerzen an. Dann nahm ich ein leeres Band vom Stapel auf dem Sideboard, legte es in das Gerät, stellte die Uhr und machte es mir im Sessel bequem.
Bei den meisten Menschen ist die Intuition nicht mehr als ein Flüstern, eine Schwankung in dem Grundrauschen, das sie gewohnheitsmäßig ignorieren. Bei mir ist sie eine körperliche Empfindung, mit der aufblitzende Bilder, wechselnde Druckgefühle, Klingeln in den Ohren und Ziehen an diversen Körperstellen verbunden sind. Manchmal drängt es mich so stark, jemandem etwas mitzuteilen, dass ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann, bis ich es losgeworden bin. Es gab sogar Momente, in denen ich einen Tunnelblick bekam, die Welt am Blickfeldrand verschwand und die Botschaft, die ich weitergeben sollte, sich immerfort in meinem Kopf wiederholte.
Im Lauf der Jahre habe ich entdeckt, wie sich die Bestie quasi bezwingen lässt. Am besten ist es, wenn ich vor jeder Sitzung ein Ritual einhalte. Ich beginne, indem ich die Augen schließe und mir vorstelle, dass mich ein weißes Licht umgibt und den Raum füllt. Dann bitte ich meine Crew dazu.
Sie besteht aus fünf Geistern, und ich spüre bei jedem Einzelnen, wie er sich mit seiner Energie rechts neben mir aufstellt. Sie werden das auch schon erlebt haben: Sie spüren, dass jemand da ist, obwohl Sie niemanden sehen. Denn jeder strahlt etwas aus, das man wahrnimmt, obwohl man nicht so ganz begreift, wie. Genauso ist das bei mir, wenn ich meine Geister rufe.
Sobald sie da sind, frage ich meinen Klienten nach dem vollen Namen und dem Geburtsdatum, was für mich wie der rote Punkt auf der Zielscheibe ist. Sowie ich Namen und Datum weiß, schalte ich meine Intuition ein und richte sie direkt auf den Klienten wie einen Pfeil aufs Ziel. Wenn ich eine intuitive Verbindung hergestellt habe, kann ich anfangen zu sprechen.
Schon nach den wenigen Augenblicken, die ich Allison gegenübersaß, spürte ich eine starke Verbindung zu ihr und erhielt sofort mehrere Bilder.
»Gut, das Erste, was ich erkenne, ist eine Töpferei. Die Geister zeigen mir eine Töpferscheibe und die Szene aus Ghost, Sie wissen schon, wo Demi Moore Tontöpfe macht.«
»Ich gebe einen Keramikkurs im Kunstmuseum«, hauchte Allison überrascht.
»Cool! Also gut, weiterhin vermitteln sie mir den Eindruck, dass Sie in letzter Zeit sehr traurig gewesen sind. Jemand, der Ihnen nahestand, eine Frau, ist aus Ihrem Leben verschwunden, und das hat Sie sehr deprimiert; darunter leidet Ihre Töpferei, oder Sie vernachlässigen die Klasse.«
»Ja«, bestätigte sie, als ich zwischen zwei Sätzen Luft holte.
»Ich habe den Eindruck, dass Sie früher sehr gern an der frischen Luft waren, zum Beispiel gern Blumen gepflanzt, sich um den Garten gekümmert haben, und jetzt bleiben Sie nur noch im Haus hinter herabgelassenen Rouleaus.«
»Ja.«
»Ihre Geister sagen, dass Sie Ihr Leben wiederaufnehmen sollten, dass die Traurigkeit aufhören muss und die große, weite Welt darauf wartet, von Ihnen entdeckt zu werden. Sie müssen sich nur hinauswagen.«
Schweigen.
Ich sehe meine Klienten während einer Sitzung selten an, weil ich festgestellt habe, dass mich deren wechselnder Gesichtsausdruck ablenkt. Gewöhnlich richte ich den Blick in eine Zimmerecke oder mache die Augen zu. Ich sehe den Klienten nur an, wenn er nicht bestätigt, was ich gesagt habe.
Allison hatte noch nicht geantwortet, und da ich dachte, ich könnte die letzte Botschaft falsch verstanden haben, machte ich die Augen auf, um ihre Körpersprache zu begutachten. Ihr Mund bildete eine grimmige, dünne Linie, ihre Hände umklammerten krampfhaft die Sessellehnen, sodass sich die Knöchel weiß abhoben.
Durch diesen Anblick ein bisschen verwirrt, wandte ich mich an meine Geister, um mich zu vergewissern. Sie wiederholten alles, was ich gerade gesagt hatte. Also hatte ich richtig verstanden. Als ich Allison wieder anblickte, bemerkte ich eine winzige Veränderung in ihrer Ausstrahlung. Sie verschloss sich. Meiner Erfahrung nach hieß das, dass ich entweder weit danebenlag oder einen Nerv getroffen hatte. Ich bat meine Crew um ein anderes Thema.
»Gut, jetzt zeigen mir die Geister ein Schild mit der Aufschrift ›Zu verkaufen‹ … Wollen Sie Ihr Haus verkaufen?«
»Ja.«
»Gut. Sie bestärken Sie darin. Ich spüre, dass das eine wirklich gute Entscheidung ist; die Geister scheinen regelrecht glücklich darüber zu sein. Mein Eindruck ist, dass es hier zu viel Vergangenheit gibt und Sie durch einen Umzug Dinge loslassen werden, die Sie niedergedrückt haben.«
Wieder Schweigen. Ich beschloss, diesmal die Augen geschlossen zu halten. Ich wollte mich auf die Botschaften konzentrieren. Allisons Reaktionen brachten mich aus dem Konzept. Sie akzeptierte zwar, was ich sagte, ließ es aber gleichzeitig nicht an sich heran. Das machte mich ratlos. Ein bisschen frustriert bat ich meine Crew wieder um ein anderes Thema.
»Gut, es gibt einen dunkelhaarigen Mann in Ihrer Nähe, und meine Geister warnen vor ihm. Sie dürfen sich nicht mit ihm abgeben, sagen sie. Es besteht eine Verbindung zu diesem Mann, er ist vielleicht ein Familienmitglied, aber kein Bruder, nicht einmal ein Blutsverwandter. Sie haben seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm, und dabei sollte es bleiben – er ist einer dieser Typen, die nur Ärger machen. Die Geister bringen ihn auch mit Ihrer Trauer in Verbindung, als hätte es an ihm gelegen, dass die Frau, um die Sie trauern, nicht mehr da ist. Und ich höre, Sie geben ihm die Schuld daran, und das sollten Sie auch, aber Sie dürfen es ihm nicht ins Gesicht sagen. Mir scheint, er hat wirklich getan, was Sie vermuten, aber was das betrifft, müssen Sie sehr vorsichtig sein. Die Geister sagen immer wieder: ›Lassen Sie es bleiben!‹, und ich habe den Eindruck, dass Sie Ihre Nase in eine Sache stecken, die größer ist, als Sie dachten, und durch die Sie mit dem dunkelhaarigen Mann aneinandergeraten. Sie sagen, dass Sie wirklich nichts tun können und die Sache ruhen lassen sollen.«
Schweigen.
Ab und zu kommt es vor, dass mich ein echt »ekliges« Gefühl überfällt, das sich auf ein zukünftiges Ereignis bezieht. So ein Gefühl hat mich damals getrieben, den Professor auf seine Herzkrankheit hinzuweisen.
Das gleiche Gefühl bekam ich jetzt bei Allison und diesem dunkelhaarigen Mann. Da ich keinerlei Bestätigung von ihr hörte, machte ich schließlich doch die Augen auf und sah sie an. Sie war kreidebleich und starr, und ihre Augen schwammen in Tränen, die jeden Moment zu fließen drohten.
Ich hörte die Warnung in mir in einem fort, sodass ich sie noch einmal unterstrich: »Allison, die Geister sagen mir unmissverständlich, dass Sie sich von dem Mann fernhalten müssen, wer immer er ist. Sie haben die Macht, Ihr Schicksal zu ändern. Man nennt das den freien Willen. Sie können diesen Rat ignorieren und eine bestimmte Zukunft herbeiführen, oder Sie nehmen ihn an und gehen Schwierigkeiten aus dem Weg. Verstehen Sie?«
»Ja«, flüsterte sie und nickte.
Rückblickend muss ich sagen, dass ich wohl glauben wollte, ich wäre zu ihr durchgedrungen. Ich wollte glauben, dass sie auf die Warnung hören, meinen Rat befolgen würde. Warum ich die Gelegenheit nicht genutzt und ein wenig nachgehakt habe, werde ich nie begreifen. Ich weiß aber noch ganz genau, dass mein ekliges Gefühl nicht weggehen wollte und ich trotzdem um ein neues Thema bat. Die restliche Sitzung war dann ziemlich langweilig. Außer dieser Warnung kam nichts Besonderes mehr heraus. Seitdem habe ich die Erinnerung immer wieder abgespult und mich gefragt, ob ich den Lauf des Schicksals hätte ändern können. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Druck ausgeübt, ein bisschen tiefer gebohrt hätte, hätte ich Allison schließlich das Leben retten und dadurch verhindern können, dass der Mörder auch mich aufs Korn nahm.
Aber das Vertrackte am Schicksal ist, dass alles vom richtigen Timing abhängt.
2
»Theresa?!«, rief ich die Treppe hoch.
»Ja?«, rief sie zurück, und ich hörte Papiergeraschel aus ihrem Schlafzimmer.
»Ich bin gleich mit dem Wohnzimmer fertig. Soll ich in der Küche weitermachen oder lieber im Arbeitszimmer?«
»Äh, in der Küche, denke ich. Brett hat versprochen, das Arbeitszimmer zu übernehmen. Also lass das für ihn übrig. Ich komme in einer Minute runter und helfe dir. Ich bin hier oben fast durch.«
»Okay«, sagte ich, schlenderte in die Küche und streichelte unterwegs Mystery, ihre Katze.
Bei mir hatte sich ein Dauerstirnrunzeln festgesetzt, und ich seufzte dermaßen oft, dass es praktisch einem Hyperventilieren gleichkam und mir schon zweimal schwindlig geworden war. Gleich am nächsten Tag, nachdem Theresa und Brett zurückgekehrt waren, hatten sie mit dem Packen angefangen, und die ganze Woche über gab es jede Menge zu tun. Ich hatte nach der Arbeit so viel wie möglich mit angefasst, und als ich jetzt auf den Küchentisch blickte, an dem Theresa und ich so oft bis spät in die Nacht geredet und Pizza gegessen hatten, bekam ich plötzlich nasse Augen und einen Kloß im Hals – wieder mal.
Seufzend klebte ich einen Umzugskarton zusammen, holte das Einschlagpapier aus dem Nebenraum und machte mich daran, die Küchenschränke auszuräumen. Zehn Minuten später gesellte Theresa sich dazu, die braunen Locken zum Pferdeschwanz gebunden, die Augen groß vor Tatendrang. Eine ganze Weile redeten wir gar nicht. Dann brach sie das Schweigen, sah mich ein bisschen skeptisch von der Seite an und fragte: »Abby? Verschweigst du mir etwas?«
»Äh, wie bitte?« Die Frage überraschte mich komplett.





























