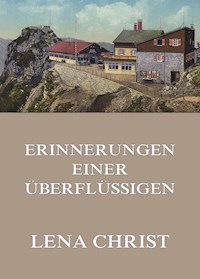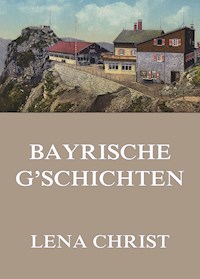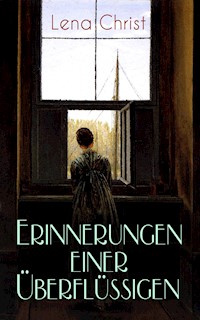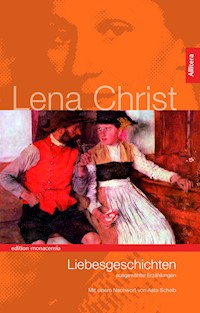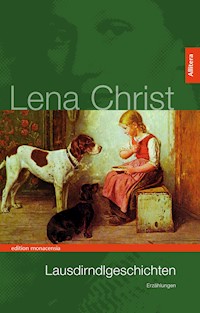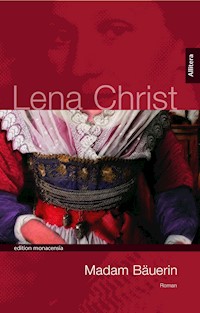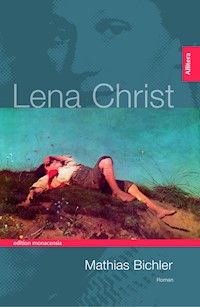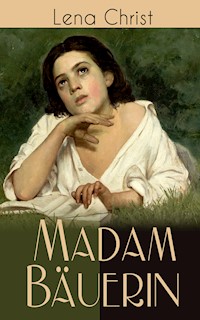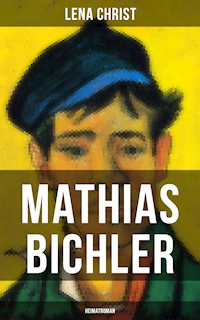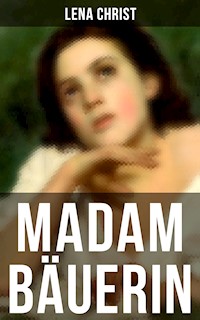
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In 'Madam Bäuerin' führt Lena Christ die Leser in die ländliche Welt des späten 19. Jahrhunderts ein, in der die titelgebende Protagonistin unerwartet in die Rolle einer mächtigen Bäuerin schlüpft. Durch ihren präzisen und realistischen Schreibstil zeichnet die Autorin ein lebendiges Bild des bäuerlichen Lebens und thematisiert dabei die Stellung der Frau in dieser Zeit. Der Roman ist von einer starken sozialen Kritik durchdrungen, die sowohl Unterdrückung als auch Solidarität innerhalb der Dorfgemeinschaft beleuchtet. Lena Christ's Werk wird oft mit den Schriften von Annette von Droste-Hülshoff verglichen, da sie ähnliche Themen mit derselben Authentizität behandeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Madam Bäuerin
Books
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Die Geschichte hebt an um die Zeit, da unser lieber Herr bereits seine Himmelfahrt getan, den Heiligen Geist gesendet und das Heu auf den Wiesen gut und dürr genug gemacht hat zum Heimführen.
Um diese Zeit haben die Weibsleute draußen auf dem Lande gemeiniglich ihre großen Wasch- und Putztage; denn nach altem Brauch und Herkommen räumt man noch vor Beginn der großen Ernte mit dem ganzen rußigen Nachlaß des Winters gründlich auf. Da weißelt und tüncht man Stuben und Kammern, Kuchel und Speis, Hausflöz und Stall, verschönt den ganzen Bauernhof und putzt ihn säuberlich heraus, auf daß der Segen Gottes um so lieber Einkehr darin halten möcht.
Und die Vürhänge und Polsterziechen, das Linnen und Bettzeug wird gewaschen und gebleicht, damit es wieder frisch und sauber ist und seine Schuldigkeit tut so lange, bis die Bäuerin das Kirchweihmehl in die Truhe siebt und das Schmalz ausgängt und siedet für Krapfen und Küchl.
Beim Schiermoser zu Berganger aber haben sie heut noch einen besonderen Grund zu solcher Stöberei und Arbeit: ihre langjährige Sommerfrischlerin, die verwitwete Frau Rechtsrätin Scheuflein, hat für die nächsten Tage ihre Ankunft gemeldet.
Nun sind ja im allgemeinen die Stadtleut keine absonderlich willkommenen Gäste auf dem Land. Aber so im besonderen macht doch manche Bäuerin eine Ausnahme und läßt ein paar von den Städtischen in ihren üppigen Flaumbetten schlafen. Freilich nur gegen gutes Entgelt. Denn umsonst ist der Tod, und der kostet das Leben. Und wenn sie auch darüber brummt, daß ihr die »verhungerten Stadterer den Schmalzhafen, die Mehltruhen und die Eierschüssel leer fressen«, so ist ihr das Geld, welches die Sommergäste bei ihr sitzen lassen, doch eine so willkommene Nebeneinnahme, daß sie willig für etliche Wochen auf ihren angestammten Groll gegen sie vergißt.
Denn der Hunger nach Profit ist bei jeder Bäuerin so groß, daß sie gern auf weiß Gott was alles verzichtet, wenn nur ihr Geldbeutel Nutzen davon hat.
Und dann ist doch auch noch die Nachbarin da; wenn die hörte, daß drüben beim Nachbarn Sommergäste abgewiesen wurden, so liefe sie ihnen sicherlich nach und böte ihnen die beste Stube des Hauses an, bloß um die andere zu ärgern! Darum schränkt man sich über Sommer ein, so gut man nur kann.
Das eheliche Schlafgemach wird zur Rumpelkammer, in der man alles aufstapelt, was sonst in den verschiedenen Kammern hing, lag und stand. Da türmen sich Pappschachteln mit Strohhüten, Pelzen, Atlaskränzen und Brautkronen; Totenkränze hängen neben Flachszöpfen und Kümmelbüscheln, Honighäfen stehen neben Schnapskrügeln und Spinnradeln, und zwischen Schüsseln mit Bienenwaben liegen Berge von Flickwäsche. Darunter aber sind die Schätze an Eiern und Schmalz verborgen, die man nicht jedem zeigen will, der ins Haus kommt.
Hat die Bäuerin Kinder, so liegen sie während dieser Zeit droben im Gret, auf dem Vorplatz neben der Stiege, immer zwei in einer mageren Betthaut. Und die alte Großmutter muß es sich auch noch gefallen lassen, daß man ihr eine zweite oder dritte Bettstelle in das Austragstüblein rückt, darin noch ein paar Söhne oder Töchter des Hauses ihre Schlafstatt einrichten.
Und dann werden die guten Stuben und Kammern gekehrt und geschruppt, von Spinnweben gesäubert und mit Rupfenplachen belegt.
Aber nur ein paar Monate lang hält die Bäuerin dies Leben aus.
Nur während der Zeit der Ernte, da sie selber entweder viel mit ihren Leuten auf dem Felde ist oder aber den ganzen Tag in Stall und Küche werkt und den Hof versorgt, indes die andern Weizen, Korn und Grummet einernten. In diesen Tagen hat sie nicht Derweil, die Stadtleut viel zu betrachten und sich über ihr Tun zu ärgern; im Herbst aber oder gar im Frühjahr, da ist sie anders. Da kann ihr kein Sterbensmensch auf Gottes Erdboden ungelegener ins Haus kommen, als so ein Stadtfrack! Und es kann kein Städter etwas Ungeschickteres tun, als sich in einem Bauernhof einzuquartieren, ehe die Erde und die Sonne ins Zeichen der Hundstage tritt.
Darum findet man auch heute die Schiermoserin greinend und brummend über den Unverstand der Stadtleut, die mitten unterm Heuen und Ausweißeln daherrumpeln, an dem endsgroßen Waschzuber stehend und eine Bettzieche um die andere reibend und schwenkend.
»Naa, naa. Wia i halt sag: lange Haar, kurzer Verstand, hoaßts. Und d' Stadtleut ham überhaupts koan, wähn i. Sinst kunntens oan net scho im Auswärts aufm Gnack hocka. Daß s' net glei scho auf Liachtmeß oder z' Weihnachtn in d' Sommerfrisch gehn! Jetz', kaam daß der Schnee weg is. Mitten unterm Heuen und Ausweißeln!«
Sie werkt und hantiert wütend weiter und kann nicht aufhören, über die Städter im allgemeinen und die Rechtsrätin Scheuflein im besonderen zu wettern.
Daneben an der Waschbank steht ihre jüngste Tochter, die Barbara, seift und bürstet grobe Hemden und singt dazu mit weinerlicher Stimme ein rührseliges Lied vom Herzverbittern und Vonmirgehn.
Und dazu schleppt eine Magd in zwei Eimern bald kaltes, bald heißes Wasser herbei und läßt geduldig ein Donnerwetter ums andere über sich ergehen, weil sie der Schiermoserin zu langsam, der Barbara aber zu schnell werkt, der einen das kalte und der anderen das heiße Wasser über die Füße gießt und endlich gar noch der alten Großmutter, die strickend und nörgelnd auf der Hausbank sitzt, den knallroten Wollknäuel mit ihrem klappernden Holzschuh mitten in eine trübe Wasserlache stößt.
Drinnen in der Wohnstube aber werkt der alte, taube Großvater, taucht den langgestielten, altmodischen Malerpinsel in die himmelblaue Kalkbrühe und streicht bedächtig Fleck um Fleck, bis zu guter Letzt die ganze Stube gleich dem sommerlichen Himmel draußen im schönsten Blau erstrahlt.
Danach trägt er seinen Farbkübel hinaus in die Kuchel, mischt ein Päcklein helles Gelb unter den blauen Kalk und beginnt sodann auch hier das Werk der Verschönerung.
Des Schiermosers zweite Tochter, die Mariedl, hantiert derweil in den fertigen Räumen frisch mit Schrubber und Besen, und der Ochsenbub zieht bedächtig rings an den getünchten Wänden mit dunkelbrauner Farbe breite Striche als Zierde und Abschluß und pfeift dazu den neuesten Gassenhauer.
So hat ein jedes im Haus seine Arbeit.
Draußen auf den Wiesen aber werkt der Schiermoser mit den Knechten und Dirnen. Die einen mähen, die andern wenden, und die dritten wiederum häufeln das trockene Heu und führen es heim.
Des Schiermosers einziger Sohn aber, der Franz, war zu Holzkirchen auf dem Viehmarkt und fährt nun gemächlich heimzu.
Langsam läßt er den Braunen über die bergige Straße hinauftraben und pfeift dazu die Melodie eines derben Landlers.
An der Wegkreuzung zwischen Straß und Au steht der Hof des Straßlerbauern.
Und hinter der Streuschupfe des Hofes steht die Nanndl, des Straßlerbauern Tochter, und schaut auf das herankommende Fuhrwerk des Schiermoserfranzl.
Denn die Nanndl wär in ihrer Seel nicht abgeneigt, einmal Schiermoserin zu werden.
Als daher der Franzl in ihre Nähe kommt, begrüßt sie ihn mit breitem Lachen und fragt: »He, du! Wo aus denn?«
»Hoamzua«, erwiderte der Franzl und will weiterfahren.
Aber die Nanndl fragt weiter: »Wo kimmst denn her?«
»Vo Holzkirch. Am Viehmarkt bin i gwen.«
Nun hält er doch sein Fuhrwerk an. Denn die Nanndl wird anzüglich.
»Hast dir nachher a saubers Stuck außagschaut?«
»Balst eppa a zwoahaxats moanst, nachher muaß i naa sagn!« erwidert er ihr schmunzelnd und steigt vom Wagen: »D' Holzkirchner Kaibeln san gar net darnach, daß oana an Fiduz drauf kriagn kunnt!«
»Ja no«, meint die Nanndl, »du bist aber aa glei a so a hoaklicher! Bis dir amal epps taugt...«
Sie lacht kokett.
Der Franzl faßt sie um die Hüften.
»Moanst, daß d' mir du net taugen tätst?« fragt er halblaut und sucht ihren Mund. Die Nanndl lacht laut und geziert auf.
»Du bist aber a Schlankl, du!«
Sie entwendet sich seinem Arm. »Ja ja. Zum Fürn-Narrn-Halten tät dir wohl jede taugn, gell! Aber zum Heiratn...«
»Geh, brummel net, Dirndl!« unterbricht der Tropf ihre Betrachtung und verschließt ihr den Mund auf eine Weis', daß sie das Weiterschwatzen von selber vergißt.
Dann lacht er belustigt auf, steigt auf sein Fuhrwerk und ruft: »Zum Fürn-Narrn-Haltn hast gsagt, gell! Zu epps andern taugts aa net, ös Weiberkittel übereinand! Hüa, Alter! Fahr zua!«
Und er fährt davon, indes die Nanndl dasteht und ihm mit einem Gemisch von Zorn und Sehnsucht nachschaut, bis er hinter den ersten Bäumen des nahen Waldes verschwunden ist.
Mit der Erkenntnis, daß alle Mannsbilder, besonders aber der Schiermoserfranzl lose Rüppel seien, geht sie endlich aufseufzend wieder zurück ins Haus zu ihrer Arbeit.
Der Franzl aber versetzt seinen Braunen in einen frischen Trab, rückt das Plüschhütl keck aufs linke Ohr und singt:
»Aber gell, du Blauaugete, Gell, für di tauget i, Gell, für di waar i recht, Wann i di möcht!«
Kapitel 2
Des Schiermosers Franz ist gerade am Tage des heiligen Antonius fünfundzwanzig Jährlein alt geworden, hat außer seinem körperlichen Ebenmaß und seinem strohgelben Schnurrbart auch noch einen ebenso blonden Lockenkopf und dazu ganz dunkelbraune Augen.
Dies alles schätzen die Weiberleut der Umgegend an ihm.
Seine Kameraden aber und die Burschen der Gemeinde achten sein manniges Wesen und seine bäuerische Schlauheit, zählen auf sein gegebenes Wort und fürchten ihn in seinem Zorn. Was ihn aber besonders seinem Vater lieb und wert macht, ist seine Brauchbarkeit zu allem, was den Schiermoserhof und sein Gedeihen betrifft.
Soll ein Roß vertauscht oder eine Kuh gehandelt, ein Stadel gebaut oder Geld auf die Bank gelegt werden, der Franzl wird zuerst darüber gehört. Und hat er einmal eine Sache als gut und recht befunden, so dürfte der ganze übrige Schiermoserhof und ganz Berganger dazu dagegen sein; es würde doch nur so gemacht, wie der Franzl meinte, und nicht anders.
Denn erstlich hatte er die drei Jahre drinnen in der Residenz bei den schweren Reitern gedient und sich dabei so ausgezeichnet, daß man ihm die goldenen Borten des Unteroffiziers auf die königsblaue Reitermontur setzte, und dann war er ein ganzes Jahr auf einem wirklichen königlichen Gutshof gewesen als Oberschweizer.
Ein naher Verwandter hatte nämlich daselbst eine Verwalterstelle, und der gute Vetter wollte nun auch dem Franzl einen Einblick in den Betrieb einer solchen Wirtschaft geben, auf daß es ihm einmal droben in seinem Schiermoserhof zu Nutz und Frommen gereichen möchte.
Also hatte Franz doch allerhand gesehen, gehört und gelernt und konnte wohl ein Wörtlein mitreden, wenn es sein mußte.
Er tat dies auch zur rechten Zeit und brachte allmählich einen ziemlich neumodischen Zug in die väterliche Wirtschaft; allerdings sehr zum Verdruß seiner Mutter, die alles, was neu oder aus der Stadt war, haßte und verwarf, und nicht minder zum Ärger seiner Großeltern, der alten Schiermoserleut, die in allem Neumodischen eine Quelle von Unkosten, Verdruß und Unbehagen sahen und viel lieber an dem Althergebrachten und Gewohnten hingen.
Aber, wie gesagt, es half nichts, daß die drei anderer Meinung waren. Franzl hatte recht, auch wenn er einmal nicht ganz recht hatte, und sein Vater, der selber schon immer ein wenig zu den modischen Bauern und ihren Maschinen hielt, stand fest auf seiten seines Sohnes.
Wie war's doch gewesen damals, als der neue Motorpflug auf den Schiermoserhof kam und die Dreschmaschine?
Natürlich, der Franz hatte das Zeug beim Herrn Vetter droben im königlichen Gutshof gesehen, und sofort hieß es: »So a Motor muaß her und so a Maschin. Da hat ma grad mehr die halbate Arbat und dabei den doppelten Nutzen. Dees langweilige Drischeldreschen paßt mir eh scho lang nimmer. Den ganzen Winter wieder aufn Dreschbodn außegfriern! Mir waars recht!«
Wohl fuhr die Schiermoserin mit Himmel Kreuz und Laudon dazwischen und plärrte: »Nix da! So viel Geld außeschmeißen! Sinst nix mehr! Ös mit enkern neumodischen Graffel. So lang i no a offens Aug' hab, werd mit der Drischei 'droschen, daß ihrs wißt! Bal i amal gstorbn bin, könnts vo mir aus mit den Dreschflegl toa was's mögts. Und an Motorpflug! Zu was mir an Motorpflug brauchen, möcht i wissen! Für was mir an Stall voll Roß' haben, möcht i wissen!...«
Was half s?
Umsonst war ihr Greinen.
Der Franzl hatte geredet, und der Alte reiste sofort zum Herrn Vetter, ließ sich die Neuheit zeigen und kam heim mit der Botschaft: »Auf d'Woch müaßts den neuen Motorpflug von der Bahn holn und die neue Dreschmaschin.«
Jawohl. So war's.
Und so ging's mit dem elektrischen Licht und mit der Gsottmaschine, mit der Zentrifuge und mit der Wasserleitung. Alles Neue, was irgendwo den Kopf in die Höhe streckte, mußte her.
Denn der Herr Sohn hatte geredet.
So war's, und so ist es auch heute noch; und gerade am Tag, da der Schreibebrief von der Frau Rechtsrätin Scheuflein mit der Botschaft kommt, daß sie, ihre Frau Schwägerin Adele und ihre Tochter Rosalie die Absicht hätten, nächsten Samstag wieder in Berganger und auf dem Schiermoserhof zu landen und daselbst den Sommer über zu verbleiben – gerade an dem Tag zeigt es sich wieder, daß Franz Schiermosers Wille der allein maßgebende ist und daß der ganze Hof nach seiner Pfeife zu tanzen hat, gehe es, wie es wolle.
Grad um die Abendessenszeit ist es.
Die Schiermoserin steht greinend und brummend in der Kuchel und kann erst die Nudelpfanne nicht finden und dann das Backschäuferl, darauf die Schmarrenschüssel nicht und zuletzt den Dreihax.
»Mit enkana Ausweißlerei und Umanandräumerei!« wettert sie, »dee Kuchl hätts leicht no to bis zum Kirta! Aber naa, ausg'weißelt muaß werd'n! Zwegn dene Stadtscheesen da! Mir moanat scho, der Kini kaam oder der Kaiser! Mir woaß's ja do, daß nix dahinter is hinter dera Rechtsrätin und ihrane Töchter! Und hinter der andern alten Schachtel aa net! Was aus der Stadt kemma is, hat no nia eppas taugt! No gar nia net!«
Und da ihr Mann, der Schiermoser, in die Kuchel kommt und sich dreinmischt, indem er meint: »No, grad gar so unrecht sans net, insane Sommerfrischler! Mir muaß scho d'Kirch beim Dorf lassen – sie ham alleweil schee zahlt!«, da fährt sie ihn giftig an: »Natürli! Er, der ganz G'scheite! Dees glaab i! Soll's net vielleicht no schuldi bleib'n aa! Is's no net Sach gnua, daß ma's geduldt, die Stadtg'sellschaft! Daß mir net amal mehr Herr is über sei Sach! Derf ma sich sei Haus voll anräuma lassen – und d' Betta z'sammliegn – und's Gras zertreten – und d'Sach ausschnüffeln...«
In diesem Augenblick treten der Großvater und die Großmutter in die Kuchel und die Alte weiß sogleich, um was es geht: »Und da hat's aa ganz recht, d' Wabn!« unterbricht sie ihre Tochter, die immer noch Wabn von ihr genannt wird. »I habs aa gar net mit deene Sommerfrischler! Daß s' guat zahln... no ja, dees is wahr. Aber Gaude hat mir aa grad gnua damit! Grad gnua, sag' i. Und alle Daama lang fragns di epps anders – und möchtns epps anders – und wissens epps anders! – Is 's eppa net wahr, Vata?« Sie schreit die letzten Worte ihrem tauben Eheherrn ins Ohr.
Und der Alte lacht mit seinem zahnlosen Mund, lacht übers ganze Gesicht und meint: »Ja, ja. Recht warm is gwen. Recht scheene Täg ham mir. Da trückert d' Sach guat!«
Und vergnügt zündet er seine Pfeife an.
Der Schiermoser aber wiederholt eigensinnig: »Mir muaß d' Kirch beim Dorf lassen! Gar so zwider is 's net, d' Frau Rechtsrat. Und wenn die andern Sommerfrischler hab'n, kinnan mir aa oa habn. Dees is koa Schand net. Dees g'hört zum Verschönerungsverein.«
Damit hat er's aber ganz und gar verdorben bei den zwei Weibsbildern, und er muß sich ein schönes Donnerwetter gefallen lassen.
»Zum Verschönerungsverein!« ruft die Schiermoserin giftig aus, und die Alte meint: »Weil's scho so schee san die Stadterer! Hint mager und vorn dürr! Und z'sammgricht wia d' Spatzenscheuchan! Da balst mir net gehst mit dera Verschönerung!«
»Und mit enkan neumodischem Glump überhaupts!« fängt die Wabn wieder an, »mit enkane Genossenschaften und Verein überanand! An Raifeisenverein ließ i mir ja no g'falln... aber...«
Franz Schiermoser tritt im selben Augenblick ein. »Was is's mit'n Raifeisen?« fragt er.
»Ah nixen.«
Die Schiermoserin stößt wütend in dem Mehlschmarren herum, während sie es sagt.
Und die Alte geht schnell hinaus. Aber sie kommt sogleich wieder, denn die Neugier plagt sie doch zu stark.
Der Schiermoser aber sagt grad in dem Augenblick zu seinem Sohn: »A Kreiz is's halt mit dee Weiberleut. Auf amal paßt eahna d' Rechtsrätin nimmer.«
Worauf die Schiermoserin heftig erwidert: »Dee hat mir no nia net paßt! Daß ihr's wißt's!«
Da hält die Alte ihre Zeit für gekommen, auch dreinzureden. »No ja«, meinte sie, »mir tuat eahna ja nix wega. Aber mir hätt aa ohne Sommerfrischler auskemma kinna. Mir hätten durchaus gar koa braucht. Gar koa. Dessell sag' i.«
Und ihre Tochter fährt abermals giftig dazwischen: »I hab's no gar nia net mögn, die Stadtfrackn. I hab' mi alleweil gespreizt dagegen. Aber no, insaroana is ja der Garneamd! Insaroana hat ja daherin nix mehr zum Redn, seitdem daß der Herr Bua 's Mäu offa hat!...«
Bis hierher hat sie ihr Sohn ruhig reden lassen. Jetzt aber fährt er ihr doch wild ins Wort.
»Und jetzt glangt's nachher, sag' i! Und an Ruah möcht' i hab'n! Und insane Sommerfrischler bleib'n da, solang sie's g'freut und bals da san, sans da. Verstanden! Und bals net a so g'macht werd da herin, wias recht und richti is, nachher geh' i! Auf der Stell geh' i! Nachher kinnts mit fremde Leut wirtschaften. Daß d'es woaßt.«
Das hilft.
Die Schiermoserin werkt mit brennrotem Kopf und klappert mit Tellern und Tiegeln, aber sie erwidert kein Wort mehr.
Und die Alte läuft eilends davon.
Der Schiermoser aber pfeift gellend durchs Haus und ruft die Leut zum Essen, indes der Franz ruhig, als wäre nichts gewesen, fragt: »Gibts a Milli oder an Tauch zum Schmarrn, Muatta?«
Darauf ihm die Schiermoserin bockig erwidert: »An Tauch. – Zweschbn.«
Und also ist es bestimmt, daß die Frau Rechtsrätin Scheuflein, ihre Tochter Rosalie und ihre Schwägerin Adele am nächsten Samstag zu Schiermosers aufs Land gehen.
Kapitel 3
Als der nun in Gott ruhende Rechtsrat Scheuflein dies zeitliche Dasein segnete, beweinten ihn eine trostlose Gattin, drei Töchter und eine Schwester; so konnte man es wenigstens am nächsten Tag im Abendblatt lesen.
Leider war dies aber auch schier alles, was er den kommenden Tagen als Vermächtnis hinterließ, obgleich es ganz anders hätte sein können.
Denn er stammte von Eltern her, die ihrerseits alle Vorbedingungen späterer Wohlhabenheit mit auf diese Erdenwelt brachten.
Seine Mutter war die einzige Tochter eines reichen Kauf- und Schiffsherrn zu Hamburg gewesen. Aber, wie es schon so geht im Leben: eines Tages sanken bei einem heftigen Seesturm drei seiner Frachtschiffe, als sie, beladen mit reichen Schätzen, dem heimatlichen Hafen zusegelten. Damit versank dem Alten leider der größte Teil seines Vermögens, und er nahm sich den Verlust so zu Herzen, daß er in ein hitziges Fieber fiel und kurze Zeit darauf starb.
Nach seinem Hinscheiden führte die kaum zwanzigjährige Tochter noch eine Weile die Geschäfte; allein sie wurde von den sogenannten Freunden des Hauses bald so sehr übervorteilt und betrogen, daß der Ruin unausbleiblich schien.
So blieb ihr nur die Wahl: entweder dienen oder heiraten. Dies letztere erschien ihr noch als das Glücklichere, um so mehr, als sich gerade in jenen Tagen ein tüchtiger, junger Rechtsanwalt aus Bayern um sie bewarb.
Dieser brachte den Rest der Schiffe und Waren vorteilhaft unter den Hammer und verlegte darnach seine Praxis in das alte Patrizierhaus seines Vaters zu München.
Bald hatte er sich einen glänzenden Namen gemacht und besaß nun ein so hohes Einkommen, daß nach seinem Abscheiden alle seine Kinder, acht an der Zahl, lachende Erben hätten werden können.
Aber leider: wenn einen der Teufel reitet, geht's ins Verderben.
Der kaum fünfzigjährige Mann wurde plötzlich von der fixen Idee gepackt, er müsse sich unbedingt um eine Staatsstellung bewerben; denn wenn er nun heut oder morgen stürbe, hätte ja seine Wittib mitsamt den Kindern nicht einen Pfennig Pension. Das Vermögen, welches er ihnen hinterließ, dachte er, würde bei einer Teilung durch neun sicherlich nicht ausreichend sein, um alle so zufrieden zu machen, wie er dies wünschte.
Diese närrische Idee nun brachte ihn dazu, daß er seine glänzende Praxis aufgab und Amtsrichter wurde. Sein Einkommen verminderte sich allerdings dadurch auf ein Viertel des früheren; aber bei seinem Ehrgeiz konnte er es bald zum Gerichtsrat bringen.
Leider half auch dies nicht viel, denn das Unglück wollte, daß er noch dreißig Jahre lebte und also nach und nach alles zusetzte, was er als Rechtsanwalt verdient hatte.
So kam es, daß nach seinem Hingang die Witwe samt ihren Kindern in Verhältnissen dastand, die nicht gerade rosig genannt werden konnten.
Und als bald danach auch sie das Zeitliche gesegnet hatte, machte die Teilung des Erbgutes dem Rechtsrat Scheuflein und seinen sieben Geschwistern zwar viel Arbeit, aber wenig Freude.
Der Rechtsrat, als der Jüngste, heiratete sofort nach dem Heimgang seiner Eltern die Tochter eines gänzlich verarmten adligen Majors um ihrer schönen Augen willen.
Und da ihm das hübsche Mädchen außer einem Herzen voll warmer Zuneigung und einen Kopf voll überspannter Ideen nicht viel in die junge Ehe einbrachte, so wurde auch durch sie der Geldsäckel der Scheufleins nicht voller.