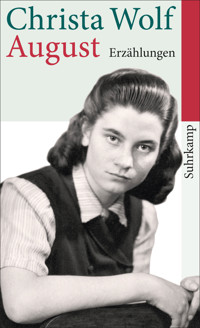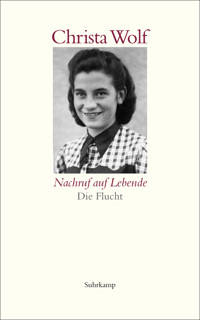39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Post, Post, Post«. Dieser Stoßseufzer, notiert im Kalender unter dem Datum vom Sonntag, dem 4. März 1990, kommt nicht von ungefähr: Christa Wolf war eine ungeheuer produktive Korrespondentin. Ihre Briefe an Verwandte und Freunde, Kollegen, Lektoren, Politiker, Journalisten geben faszinierende Einblicke in ihre Gedankenwelt, ihre Schreibwerkstatt, ihr gesellschaftliches Engagement. Ob sie an Günter Grass oder Max Frisch schreibt, von Joachim Gauck Einsicht in ihre Stasi-Akte fordert oder sich mit Freundinnen wie Sarah Kirsch und Maxie Wander austauscht, wir sind Zeuge von Freundschaften und Zerwürfnissen, Auseinandersetzungen und von Bestätigung, von der Selbstfindung einer der wichtigsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Nicht zuletzt beeindruckt ihr Umgang mit der Flut von Leserbriefen, die sie mit zunehmendem schriftstellerischen Erfolg erreicht und auf die sie geduldig und kundig – und manchmal auch mit der gebotenen Direktheit – eingeht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1688
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Abb. 1
»Post, Post, Post«. Dieser Stoßseufzer, notiert im Kalender unter dem Datum vom Sonntag, dem 4. März 1990, kommt nicht von ungefähr: Christa Wolf war eine ungeheuer produktive Korrespondentin. Ihre Briefe an Verwandte und Freunde, Kollegen, Lektoren, Politiker, Journalisten geben faszinierende Einblicke in ihre Gedankenwelt, ihre Schreibwerkstatt, ihr gesellschaftliches Engagement. Ob sie an Günter Grass oder Max Frisch schreibt, von Joachim Gauck Einsicht in ihre Stasi-Akte fordert oder sich mit Freundinnen wie Sarah Kirsch und Maxie Wander austauscht, wir sind Zeuge von Freundschaften und Zerwürfnissen, von Auseinandersetzungen und Bestätigung, von der Selbstfindung einer der wichtigsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts.
Mit zunehmendem schriftstellerischem Erfolg wächst auch die Flut der Leserbriefe, auf die Christa Wolf eingeht, kundig und zugewandt. Ihre knappe Antwort auf die Anfrage eines Lesers aus dem Jahr 1974 spricht für sich: »[…] ich habe noch nie gehört, daß jemand die Entscheidung, ob er Schriftsteller werden solle oder nicht, vermittels einer Art Rundbrief von anderen erbat. Meine Antwort ist kurz und bündig: Wenn Sie es aushalten, zu leben ohne zu schreiben, dann werden Sie lieber Lehrer. Besten Gruß, Christa Wolf«
Christa Wolf, geboren am 18. März 1929 in Landsberg an der Warthe (heute Gorzów Wielkopolski), wurde für ihr Werk mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Georg-Büchner-Preis sowie dem Thomas-Mann- und dem Uwe-Johnson-Preis. Sie starb am 1. Dezember 2011 in Berlin. Zuletzt erschienen 2014 aus dem Nachlass Moskauer Tagebücher. Wer wir sind und wer wir waren und Nachruf auf Lebende. Die Flucht.
Sabine Wolf leitet das Literaturarchiv in der Berliner Akademie der Künste, das Christa Wolfs literarischen Nachlass beherbergt. Zuletzt edierte sie den Band Kunst und Leben. Georg Kaiser (1878-1945) (2011).
Christa Wolf
Man steht sehr bequem zwischen allen Fronten
Briefe 1952-2011
Herausgegebenvon Sabine Wolf
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2016.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Roger Melis
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-74796-4
Inhalt
Briefe
Anhang
Nachwort
Editorische Notiz
Danksagung
Literatur
Abkürzungs- und Siglenverzeichnis
Quellennachweise der Briefe
1 An die Redaktion Neues Deutschland, Berlin (Ost)
Leipzig, d. 17. 4. 52
Werte Genossen!
Angeregt durch Eure wiederholten Forderungen nach einer gruendlichen Kritik unserer zeitgenössischen Literatur, sende ich Euch eine Besprechung von Greulichs Roman »Das geheime Tagebuch«, über den meines wissens nach bei Euch noch nichts erschienen ist. Natürlich erhebt meine Kritik so wenig Anspruch auf Vollkommenheit wie das Werk, dem sie gilt, und dessen Autor ich eine Abschrift dieser Kritik schicken werde. Ich bin noch kein Literaturkritiker, sondern studiere noch und will erst einer werden. Ich würde mich freuen, wenn Ihr trotzdem etwas von meiner Besprechung verwenden könntet.1
Ausserdem möchte ich anfragen, ob Ihr gerade jetzt im Monat der deutsch-polnischen Freundschaft auf eine Würdigung des ausgezeichneten polnischen Romans »Kohle« von Aleksander Scibor-Rylski2 wert legen würdet.
Mit sozialistischem Gruss!
1
Der Roman von E. R. Greulich kommt 1951 im Verlag Neues Leben, Berlin (Ost), heraus. Christa Wolfs Kritik, unter dem Titel Um den neuen Unterhaltungsroman. Zu E. R. Greulichs Roman »Geheimes Tagebuch« im Neuen Deutschland vom 20. 7. 1952 erschienen, ist ihr erster publizierter Text.
2
Eine derartige Rezension von Christa Wolf ist nicht nachweisbar. Scibor-Rylskis Roman erscheint 1950 in Warschau, in deutscher Übersetzung 1952 im Verlag Volk und Welt, Berlin (Ost). Der polnische Schriftsteller wird später auch bekannt als Drehbuchautor u. a. in der Zusammenarbeit mit Andrzej Wajda (Der Mann aus Marmor, 1976; Der Mann aus Eisen, 1981).
2 An Emil Rudolf Greulich, Berlin (Ost)
Leipzig, d. 17. 4. 52
Lieber Genosse Greulich!
Die Kollegin Wasser vom Verlag »Neues Leben« schrieb meinem Mann, dass Du gerade an der zweiten Auflage Deines Romans »Das geheime Tagebuch« arbeitest und sehr an kritischen Aeusserungen zu diesem Werk interessiert bist. Da mein Mann wenig Zeit hat, schreibe ich Dir also, obwohl meine Kritik natürlich keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit oder Vollkommenheit erheben kann. Ich stehe noch mitten im Lernen, d. h. im Studium.
Ebenfalls aus Mangel an Zeit sende ich Dir die Abschrift einer Besprechung, die ich an das »Neue Deutschland« geschickt habe, um dadurch vielleicht einmal zu einer Diskussion über den leichteren Roman überhaupt und Deinen im besonderen anzuregen. Ich finde nämlich, dass dieser Typ des Romans, wie Du ihn anscheinend entwickeln willst, für uns sehr notwendig ist, und habe deshalb Dein »Geheimes Tagebuch« als ersten Versuch in dieser Richtung wirklich begrüsst. /Uebrigens finde ich, dass der Titel irreführend ist, da er ein ziemlich nebensächliches Requisit zu stark hervorhebt./
Ich habe literarisch unbefangenen Menschen, die zwar fortschrittlich, aber doch mit starken kleinbürgerlichen Vorurteilen behaftet sind, Dein Buch zu lesen gegeben, weil ich glaube, dass gerade diese Kreise sich nach Unterhaltungslektüre sehnen und es von unschätzbarem Wert wäre, wenn sie da nicht mehr zu Ganghofer u. s. w. greifen müssten. Sie fanden es zwar spannend, aber zu »tendenziös«. Da gab ich ihnen »Kohle« von Aleksander Scibor-Rylski, und sie waren gepackt und begeistert. Dabei kann es kein tendenziöseres Buch geben als dieses!
Woran liegt das? Eben daran, dass man den Menschen bei Scibor-Rylski alles glaubt, weil sie echt sind. Deine aber sind psychologisch nicht immer glaubhaft, sie müssen zuviel aussprechen, ohne es mit ihrem ganzen Wesen auch wirklich auszudrücken. Schlecht sind vor allem die zwar sehr frischen, aber oft überflüssigen Dialoge /z. B. S. 303 unten/. Meiner Meinung nach müsste alles verschwinden, was nicht zur Charakteristik der Personen dient, und dann müsste man sich auf wirklich typische Gespraeche beschränken. Das würde dazu beitragen, die Gefahr der naturalistischen Zustandsschilderung zu vermeiden, die hier und da auftaucht. Wenn das Buch dadurch an Umfang abnimmt, so schadet ihm das nichts. Nur keine Personen einführen, die man überhaupt nicht kennenlernt, bloss weil sie Referate halten müssen!
Ich glaube, Du merkst, worauf es mir ankommt. Gerne würde ich noch manches über Einzelheiten sagen – was auch noch geschehen kann, wenn es Dich interessiert – doch heute muss ich aufhören.
Ich würde mich freuen, Deine Meinung über meine Kritik zu erfahren.1
Mit freundlichem Gruss
//Christa Wolf//
1
Greulich beklagt in seinem Antwortbrief vom 28. 7. 1952 die »apodiktisch[e]« Form der Kritik Wolfs. »Das Negative erdrückt das Positive […]« (in: CWA 447). Tatsächlich wird die Rezension als Verriss aufgefasst und führt u. a. dazu, dass die BZ am Abend trotz Ankündigung Abstand davon nimmt, den Roman in Fortsetzungen zu veröffentlichen (vgl. Brief der BZ am Abend an ihren Leser Alfons Nicke, 19. 8. 1952, Abschrift in: CWA 447).
3 An Edith Braemer, Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
//Leipzig, d. 12. 5. 52
Liebe Genossin Braemer!
Ich möchte mich heute mit einer persönlichen Bitte an Dich wenden; ich weiß nicht, ob Du Dich noch auf mich entsinnen kannst: Wir lernten uns vor 1½ Jahren in Jena kennen, als Du Dein erstes Seminar über die Gesellschaftsgeschichte des »Sturm und Drang« hieltest. Ich hieß damals noch Ihlenfeld und war im 3. Semester. Wir waren auch in den Parteiaktivsitzungen unserer Fachschaft öfter zusammen.
Ich habe nun folgendes Anliegen an Dich: Ich war in diesem Semester vom Studium beurlaubt, da ich ein Kind habe,1 und erfuhr daher erst zu spät, daß es möglich ist, das Praktikum bei Euch im Goethe-Schiller-Archiv abzulegen. Die Einzeichnung dafür ist leider schon beendet. Mir würde aber viel daran liegen, bei Euch mein Praktikum zu machen, weil ich mich auf dem Gebiet der Klassik gern spezialisieren möchte. Ist das wohl doch noch möglich? Wahrscheinlich fällt sowieso eine Kommilitonin, die zu Euch kommen wollte, wegen Krankheit aus, aber das ist nicht sicher.
Ich sah keine andere Möglichkeit, evtl. doch noch zum Ziel zu gelangen, als Dir zu schreiben, und wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir umgehend – vielleicht telegrafisch auf meine Kosten – mitteilen würdest, ob ich kommen kann oder nicht.
Ich hoffe, Du nimmst es mir nicht übel, daß ich Dich mit dieser Bitte belaste! Wie gesagt, ich würde mich sehr über eine zustimmende Antwort freuen, besonders, weil auch alle anderen Plätze schon vergeben sind und ich dann nur noch 6 Wochen lang im Dt. Institut Bücher sortieren könnte!2
Im voraus vielen Dank und herzliche Grüße!
Christa Wolf.//
1
Die Tochter Annette ist am 29. 1. 1952 geboren.
2
Wolf absolviert vom 3.6 bis 5. 7. 1952 das Praktikum im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar. Dabei erarbeitet sie sich Führungen durch die Ausstellung »Gesellschaft und Kultur der Goethe-Zeit« im Weimarer Schloss und gestaltet eine eigene Vitrine zum »Kampf der deutschen Aufklärungsbewegung gegen die französisch-höfische Kultur« (vgl. Praktikumsbericht, Leipzig, 8. 7. 1952, in: CWA N 273).
4 An Emil Rudolf Greulich, Berlin (Ost)
Leipzig, d. 2. 9. 52
Lieber Genosse Greulich!
Endlich kann ich Dir den lange versprochenen Brief schreiben. Sicher wirst Du es gutheissen, wenn ich die verschiedenen Einzelheiten Deiner Kritik nicht gesondert, sondern summarisch behandle und dann etwas über das Hauptproblem sage, über das ich mir seit Beginn der Diskussion mit dir oft den Kopf zerbrochen habe.
Zunächst also zu den Einzelheiten. Ich meine Deine Einwände, die sich gegen verschiedene Formulierungen in meiner Kritik wenden. Du findest sie zu scharf und glaubst, sie würden den Leser von einem »verunglückten Buch« abschrecken. Verschiedene Leser des Neuen Deutschland, die ich sprach, waren nicht der Meinung. Sie haben durchaus das Positive mitgehört, das ja wirklich in meiner Kritik drinsteht. /Dass ich Dein Buch als einen »erfreulichen Vorstoss in ein wenig betretenes Gebiet« betrachte, ist ausdrücklich gesagt./ Sie fanden es auch in der Ordnung, dass eine Kritik gerade im ND schonungslos ist und nichts verschleiert. Und sie hielten Dein Buch nicht für »vernichtet« – trotz meines wirklich dürftigen Schlusssatzes. Trotzdem aber haben mir Deine Bemerkungen noch einmal gezeigt, wie sorgfältig ein Kritiker vorgehen muss.
Noch etwas anderes, am Rande bemerkt: Meiner Meinung nach bekam Claudius den Nationalpreis nicht in erster Linie wegen des »Durchbruchs«, sondern deshalb, weil es ihm als erstem gelang, diesen Durchbruch auch künstlerisch relativ gut zu gestalten.1 Denn das ist es ja, was wir augenblicklich am nötigsten brauchen. Die Themenwahl bei den meisten Autoren ist ja jetzt schon gut. – Uebrigens würde ich es zum Beispiel nicht ganz richtig finden, wenn Maria Langner für »Stahl« den Nationalpreis bekäme. Sie hat noch grosse Schwächen.2
Du magst mir vorwerfen, ich urteile zu streng. Ich finde, dass ein grosser Teil unserer Literaturkritik zu nachsichtig ist. Da gefiel mir gut der Artikel von Wolfgang Joho in der Augustnr. von »Heute u. Morgen«.3 Lies ihn doch bitte, falls Du ihn noch nicht kennst.
Uebrigens – ein Irrtum ist Dir da unterlaufen. Du meinst, ich wende mich gegen den »Fall Ingrid« an sich, anstatt mich gegen die ungenügende Gestaltung durch Greulich zu wenden. Das stimmt nicht. Alles, was ich in meiner Besprechung Deines Romans sage, bezieht sich nicht auf die »Dinge an sich«, sondern auf die in Deinem Roman. An sich natürlich verkörpert Ingrid einen Teil der westdeutschen Jugend, die unter ausserordentlichen Umständen sogar im Selbstmord Zuflucht suchen wird, wenn auch nur zu einem sehr kleinen Teil. Nur in der Gestaltung durch Dich glaube ich es ihr nicht ganz. Die »marx.-len. Analyse des Selbstmordes« kann sie sich gerne sparen. Sie kann sogar ein kitschiges Zettelchen hinterlassen. Doch der Autor muss dem Leser zeigen, wie dieses Zettelchen das Resultat ihrer ganzen verpfuschten Entwicklung und nicht etwa erschütternd ist.
Doch nun zur Hauptsache. Zur »Unterhaltungsliteratur« und dem Massstab, mit dem man sie messen muss. Die Ueberschrift im ND, die nicht von mir stammt, ist zu anspruchsvoll. Die Kritik hält nicht, was die Ueberschrift verspricht. Ich habe auch sofort beim Lesen gemerkt, dass ich im Verlaufe der Kritik nicht wieder auf die in den ersten drei Abschnitten aufgeworfenen Probleme zurückgekommen bin und sie auf Deinen Roman angewendet habe. Das wäre aber unbedingt nötig gewesen, um den Eindruck zu vermeiden, den Du als den Grundfehler meiner Kritik bezeichnest: dass ich nämlich die von mir selbst geschaffene Basis wieder verlasse. Du meinst, ich legte an die Unterhaltungsliteratur allgemein und Deinen Roman besonders einen falschen Massstab an, Du nennst ihn den der »grossen Literatur«. Das stimmt – ich ging aus vom Massstab des Realismus. Durch Deinen Einwand kamen mir nun viele Fragen: Was ist das überhaupt – ein Unterhaltungsroman? Gehört er zu einer von der »grossen Literatur« streng getrennten Gattung, die man nicht mit dem Massstab des Realismus messen darf? Wird es in Zukunft überhaupt noch einen ausgesprochenen Unterhaltungsroman mit Anspruch auf eine eigene Bewertungsskala geben?
Ich stelle als vorläufiges Ergebnis meiner Ueberlegungen folgendes zur Diskussion: Eine ausgeprägte Trennung zwischen unterhaltender und »grosser« Literatur ist das Ergebnis der kapitalistischen Literaturentwicklung. Sie wies dem »Normalleser« sein Feld zu: »Hier bitte, lies das, amüsiere dich, reg dich auf – nur lenke dich ab! Es ist ja gerade kein Kunstwerk, aber du willst dich ja auch nur unterhalten.« Dieses Beduerfnis ist dem Leser durch die ganzen Lebensumstände aufgedrängt worden, er kommt auch jetzt noch nicht davon los, wo das Leben sich ändert. Nun gut, wir nehmen darauf Rücksicht und geben Romane heraus, die man – wie Du ja selbst in Deinem Brief an meinen Mann sagst, – als Uebergangsliteratur bezeichnen könnte. Allerdings muss diese Literatur sehr gut geschrieben sein, sonst lockt sie keinen Kleinbürger von seinem kitschigen Liebesroman weg und auch vorläufig vielleicht noch nicht alle unsere Jungen von ihren Kriminalschmökern.
Das Ziel unserer Literaturentwicklung und die Forderung schon heute an jeden Roman, den man ernsthaft analysieren soll, bleibt: die bestmögliche Menschengestaltung, ganz gleich, ob der Autor leichtere oder schwere Probleme in ihrer Art behandelt. Keine Klassifizierung in »Unterhaltungs«- und »grosse« Literatur! Unsere Menschen werden bald so weit sein, dass auch die grosse Literatur sie unterhält. Und wie unterhaltend ist doch Rollands »Meister Breugnon«4 – und ist doch grosse Literatur! Oder »Die Antwort« von Tibor Dery! Knisternd vor inneren Spannungen, sodass wahrscheinlich schon heute die meisten Menschen sich in so einem Buch festlesen können.5 Ich erinnere auch an Hans Fallada, der ein Unterhaltungsschriftsteller war und schreiben konnte, nur kranken seine Bücher an seiner fehlenden gesellschaftlichen Einsicht. Wir müssen anspruchsvoller werden gegenüber unserer Unterhaltungsliteratur, da die grosse Literatur so interessant und spannend wird, dass sie die ganz kleine überflüssig macht. Wir dürfen unglaubwürdige Chararaktere auch dann nicht durchgehen lassen, wenn der Autor ausdrücklich vorher gesagt hat, dass er ja nur einen Unterhaltungsroman schreiben wollte. Daher mein strenger Massstab. Natürlich gibt es auch Bücher, die so schlecht sind, dass es überhaupt keinen Zweck hat, irgendeinen ernsthaften Massstab anzuwenden. Deins gehört nicht dazu.
Ich habe bewusst in meiner Kritik im ND das Schwergewicht nicht auf die Information des Lesers, sondern auf die Gestaltungsprobleme gelegt, weil ich weiss, dass gerade sie bei vielen Autoren noch nicht genügend bekannt sind. Ich sehe eine grosse Aufgabe unserer Kritik darin, die Autoren anzuleiten bei der intensiven Beschäftigung mit der marxistischen Literaturtheorie.
Mir ist es aber offenbar nicht gelungen, diese Aufgabe in meiner Besprechung zufriedenstellend zu lösen. Ich war [mir] auch tatsächlich selbst über einige Fragen noch nicht ganz klar und stellte mehr instinktiv die Basis her, die ich allerdings auch heute aufrecht erhalten würde: es ist und bleibt die des Realismus – auch für unseren neuen Unterhaltungsroman!
Hoffentlich habe ich meinen Gedankengang verständlich und klar genug dargelegt! Findet er Deine Zustimmung? Oder glaubst Du auch jetzt noch, ich hätte Dein Buch falsch behandelt? Die eben angeschnittenen Probleme beschäftigen mich augenblicklich sehr, ich würde mich freuen, Deine Meinung zu hören.
Bitte entschuldige die Verzögerung meiner Antwort. Viel lieber würde ich mich über all das mit Dir unterhalten, da würde man eher zueinander finden und Missverständnisse vermeiden.
Für heute Schluss und herzliche Grüsse!
//Christa Wolf.//
1
Eduard Claudius, der Greulich zufolge mit seinem Werk einen »Durchbruch auf dem Gebiet des ›Großen Romans‹« erzielt hat, ist 1951 mit dem Nationalpreis der DDR für Kunst und Literatur, 3. Klasse, für seinen Aktivisten-Roman Menschen an unserer Seite ausgezeichnet worden.
2
Langner erhält tatsächlich für ihren thematisch mit Claudius' Werk verwandten Roman Stahl im Oktober 1952 den Nationalpreis der DDR für Kunst und Literatur, 3. Klasse. In einer Rundfunkbesprechung des Romans (Sendung am 11. 6. 1952, vermutlich im Deutschlandsender, Manuskript in: CWA 443) bemängelt Wolf schematische Figurengestaltung und kompositorische Schwächen.
3
Wolfgang Joho kritisiert in seinem Beitrag Über einige Schwächen unserer Literatur (in: Heute und morgen, 8/1952, S. 512-516) die teils schematische, naturalistische Formensprache der »neuen« Literatur in der DDR.
4
Romain Rollands historischer Roman Meister Breugnon (1919, deutsch 1920) ist in die Form eines fiktiven Tagebuchs aus den Jahren 1616/17 gekleidet. Die erste deutschsprachige Ausgabe nach 1945 erscheint bei Rütten & Loening, Potsdam 1947, 1950 gibt es bereits die dritte Auflage. Bei Hans Mayer in Leipzig hatte Wolf ein Referat über Rollands Künstler- und Bildungsroman Jean-Christophe gehalten. (Vgl. Christa Wolfs Rede Zum 80. Geburtstag von Hans Mayer, gehalten am 14. 3. 1987 in der Akademie der Künste, Berlin (West), EV in: Christa Wolf, Ansprachen, Darmstadt 1988, S. 37-51, hier S. 37.)
5
Der Roman (EV Budapest 1950, deutsch im Verlag Volk und Welt 1952) gerät in Ungarn ins Kreuzfeuer ideologischer Kritik. Déry gilt als einer der geistigen Wegbereiter des Aufstands von 1956, er wird zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Bis 1962 sind seine Bücher in Ungarn verboten.
5 An den Deutschen Schriftstellerverband, Cheflektorat, Berlin (Ost)
Leipzig, d. 13. 10. 52
Sehr geehrte Kollegen!
Ich danke Ihnen für Ihren Brief und die Anfrage, ob ich zur Mitarbeit in Ihrem Aussenlektorat bereit bin.1
Grundsätzlich möchte ich Ihre Frage bejahen. Allerdings muss ich hinzufügen, dass ich noch nicht sehr viel Erfahrungen als Lektorin habe. Meine bisherige Tätigkeit auf diesem Gebiet erstreckte sich auf wissenschaftliche Analysen von Romanen im Rahmen germanistischer Seminare (ich studiere nämlich noch und stehe kurz vor dem Staatsexamen), auf literaturkritische Arbeit beim Rundfunk und im »Neuen Deutschland«.
Ihr Angebot interessiert mich deshalb so sehr, weil ich voraussichtlich meine Staatsexamensarbeit über Probleme der neuesten deutschen Literatur schreiben werde2 und mir natürlich daran liegt, mit dieser Literatur in lebendige Beziehungen zu kommen. Aus demselben Grunde wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich von Veranstaltungen des Schriftstellerverbandes benachrichtigen würden, die sich mit theoretischen und praktischen Fragen unserer neuen Literatur befassen.
Ich würde also gern bei Ihnen mitarbeiten in dem Masse, das mir meine Examensvorbereitungen gestatten. Besonders interessiert bin ich an Prosa – Roman und Novelle – gleich, ob sie historische oder aktuelle Stoffe behandelt.
Falls Sie auf eine Besprechung mit mir wert legen, teilen Sie mir das doch bitte mit. Ich bin vom 24. -27. Okt. in Bln.
Mit freundlichen Grüssen
//Christa Wolf//
1
Im Brief vom 11. 10. 1952 (in: Archiv SV 14) bittet der Cheflektor Georg Rahm um Unterstützung bei der »Analyse und Bewertung von Manuskripten«. Wolf arbeitet ab Ende Oktober 1952 als Außenlektorin für den Deutschen Schriftstellerverband.
2
Hans Mayer, bei dem Wolf ihr Staatsexamen mit einer Arbeit über Prosaliteratur der DDR ablegen will, lehnt dies mit der Begründung ab, da handele es sich um »rotangestrichene Gartenlauben« (Zum 80. Geburtstag von Hans Mayer, in: Ansprachen, S. 49).
6 An Johannes R. Becher, Berlin (Ost)
Leipzig, d. I. März 1953
Sehr geehrter Genosse Becher!
Verzeihen Sie bitte, wenn ich Ihre Zeit durch eine Anfrage in Anspruch nehme, deren Beantwortung mir sehr wesentlich wäre. – Ich arbeite augenblicklich an meinem Staatsexamensthema über »Das Problem des Realismus in Hans Falladas Erzählungen und Romanen« bei Herrn Professor Hans Mayer, Universität Leipzig.1 Herr Professor Mayer veranlasste mich auch, mich mit meinen Fragen an Sie oder Ihre Frau zu wenden, deren Artikel über den »Kronzeugen des kleinen Mannes« im »Neuen Deutschland« vom 5. 2. 52 für mich sehr nützlich war.2 Ich entnehme auch diesem Artikel, dass Ihre Frau eine wissenschaftliche Bearbeitung des Themas »Hans Fallada« für notwendig hält und erbitte daher ihre Hilfe in einigen Fragen, über die ich mich sonst nur schwer informieren könnte.
Vor allem benötige ich Informationen über den äusseren Lebensablauf Falladas, u. a. um feststellen zu können, inwieweit einzelne Episoden und Gestalten aus seinem Werk autobiografische Züge tragen. Ich vermute wohl mit Recht, dass der Dr. Granzow im »Alpdruck« auf Grund von Falladas Bekanntschaft mit Ihnen entstanden ist? –
Natürlich wüsste ich gern Näheres über Falladas ästhetische Ansichten – beispielsweise, ob es Briefe gibt, in denen er sich darüber ausspricht – aber wahrscheinlich hat gerade Fallada sich über seine Kunsttheorie nicht allzu viele Gedanken gemacht. – Interessant wäre mir aber, etwas über die Verbreitung seiner Romane in der Sowjet-Union zu erfahren: Welche Bücher sind dort beliebt und warum?
Ich fand den Hinweis, Fallada habe nach 1945 für eine Berliner Zeitung Artikel geschrieben. Können Sie mir sagen, um welche Zeitung es sich handelt? – Ist Ihnen bekannt, in welchen Jahren der »Trinker« geschrieben wurde?
Das wären meine wichtigsten Fragen. Natürlich interessiert mich auch alles andere, was mit meinem Thema zusammenhängt – beispielsweise die Beurteilung Falladas in Westdeutschland u. s. w.
Ich bitte Sie, mir zu antworten, wenn es Ihnen möglich ist.3
Gestatten Sie mir, Ihnen gleichzeitig nachträglich meinen herzlichen Glückwunsch für die Verleihung des Stalin-Friedenspreises auszusprechen.
Mit sozialistischem Gruss
//Christa Wolf.//
1
Das Manuskript der Examensarbeit sowie Entwürfe, Notizen und Materialien befinden sich in: CWA 827-829.
2
Lilly Becher würdigt in ihrem Beitrag den »Reichtum der Menschengestaltung« und die gesellschaftskritischen Tendenzen in den Romanen Falladas, bemängelt aber das Fehlen »ordnenden Verstandes und eines festen Standorts« des Autors. Da ihm »die Zukunftsgewißheit der kämpfenden Arbeiterklasse […] unverständlich« geblieben sei, habe er keinen Weg gefunden, »um weltanschaulich und künstlerisch auf die Höhen seiner Zeit zu gelangen«. »In seinem Talent und seinem Versagen, seiner Kraft und seiner Schwächlichkeit« sei er ein »Beispiel der deutschen Misere«.
3
J. R. Bechers Antwort vom 28. 3. 1953 (in: Johannes-R.-Becher-Archiv K 5194) fällt denkbar knapp aus. Da er Fallada erst 1945 kennengelernt habe, könne er ihr mit solchen Angaben wenig dienen und wisse auch nicht, welche Bücher ins Russische übersetzt worden seien.
Die Figur des Kulturfunktionärs Dr. Granzow in Der Alpdruck (1947) trägt Züge Bechers. Auf dessen Vermittlung veröffentlichte Fallada im November/Dezember 1945 in der Täglichen Rundschau den autobiographischen Text Osterfest 1933 mit der SA in sechs Fortsetzungen (vgl. Hans Fallada, In meinem fremden Land. Gefängnistagebuch 1944, Berlin 2009) sowie die Kurzgeschichte Oma überdauert den Krieg. In der kulturpolitischen Monatsschrift Aufbau erschien von Fallada der Beitrag Über den doch vorhandenen Widerstand der Deutschen gegen den Hitlerterror (3/1945, S. 211-218), in dem er sein Romanvorhaben Jeder stirbt für sich allein ankündigte. Am Roman Der Trinker arbeitete Fallada 1944 während einer Haft; das Werk erschien postum 1950.
7 An Kurt Barthel, Berlin (Ost)
[Leipzig, Frühjahr 1953]
Lieber Kuba!
Beiliegendes Gutachten von Gotsche empfinde ich als ein Verreissen des Romans, aber nicht als eine Literaturkritik gegenüber einem Schriftsteller, der sehr begabt ist und sich ehrlich bemüht, für uns zu schreiben. Wenn ich auch nicht zu den »jammernden Ästheten« gehöre, von denen Gotsche auf Seite 6 spricht, so sehe ich doch die »Gefährlichkeit« des Buches von Ehm Welk nicht ein, wohl aber seine starken ideologischen Schwächen. Wie ist Deine Meinung? – Urteile ich zu sanft? (s. mein beiliegendes Gutachten).1
//Wo//
1
Ein Typoskript mit Fassungen und Entwürfen befindet sich in: CWA 845. In erweiterter Form publiziert Wolf ihre Einschätzung unter dem Titel Probleme des zeitgenössischen Gesellschaftsromans. Bemerkungen zu dem Roman »Im Morgennebel« von Ehm Welk (in: NDL, 1/1954, S. 142-150). Damit beteiligt sie sich an einer Kontroverse, die nicht nur im Feuilleton, sondern auch im Schriftstellerverband geführt wird. Im Kern gelten Wolfs Vorwürfe »ideologischen Schwächen« des Autors bei der Schilderung der Revolutionsereignisse vom November 1918. Im Gegensatz zur differenzierten Polemik Wolfs verdammt Otto Gotsche (neunseitiges Typoskript ohne Angabe des Verfassers in: CWA 845) das Buch als »zynische Verächtlichmachung der revolutionären Arbeiterschaft«, sieht darin seine eigene Generation angegriffen in denjenigen, die »heute in verantwortlichen Stellungen verwirklichen, was sie damals vergeblich zu erkämpfen suchten«. Gotsche, persönlicher Referent Walter Ulbrichts, hat zuvor durch Intervention beim Ministerpräsidenten Grotewohl das Erscheinen des Romans zu verhindern gesucht und verlangt nun Konsequenzen bei der Leitung und im Lektorat des Verlages Volk und Welt. Welk wehrt sich mit der Replik Probleme der zeitgenössischen Buchkritik (in: NDL, 6/1954, S. 154-161).
8 An Georg Maurer, Leipzig
Deutscher Schriftsteller-Verband,1 Berlin, 23. September 1954
Lieber Herr Maurer!
Ich höre, daß Sie bald für vier Wochen in die CSR fahren. Das freut mich sehr für Sie. Ich nehme an, daß Sie Ihre Reise irgendwie literarisch auswerten wollen oder sonst an einer größeren Arbeit sitzen. Wir wissen ja, daß die Lyriker unter unseren Schriftstellern oft von einer Arbeit, die viel Zeit und Kraft in Anspruch nahm, nachher nur einen oder zwei Monate lang leben können. Trotzdem wollen wir aber nicht gern auf gute Gedichte verzichten, gerade von Ihnen nicht. Überlegen Sie sich doch bitte einmal folgenden Vorschlag, den ich Ihnen ganz offiziell als Mitglied unserer Auftragskommission machen kann:
Der Verband hat beim Kulturfonds der Regierung eine bestimmte, gar nicht sehr kleine Summe zur Auftragserteilung zur Verfügung. Wenn ein Schriftsteller für eine größere Arbeit finanzielle Unterstützung braucht, kann er sich an uns wenden. Die Kommission kann zum Beispiel entscheiden, daß er für ein halbes Jahr monatlich 600 DM bekommt. Diese Summe gilt zwar im allgemeinen als Darlehen, wird aber erst zurückgezahlt, wenn die Auflage des fertigen Buches 20 000 überschreitet. Das Geld ist wirklich dazu gedacht, den Schriftstellern leichtere Arbeitsbedingungen zu verschaffen und damit der neuen Literatur zu helfen.
Wir möchten nicht mehr so viel von diesem Geld an Schriftsteller geben, die noch nicht genügende Proben ihres Talents abgelegt haben und bei denen der Ausgang ihrer Arbeit höchst zweifelhaft ist. Deshalb versuchen wir immer mehr, Aufträge solchen Schriftstellern anzutragen, bei denen eine finanzielle Hilfe einen wirklich wertvollen Plan sehr fördern könnte.
Bitte, lassen Sie sich doch diesen Vorschlag einmal durch den Kopf gehen. Ich kenne ja Ihre Pläne für die nächsten Monate nicht, aber es könnte doch nicht schaden, wenn Sie, was Sie auch immer tun, dabei frei atmen könnten.2
Noch ein anderes Anliegen habe ich. Sie wissen ja auch, daß unser Schriftstellerkongreß bevorsteht (obwohl wir das genaue Datum immer noch nicht wissen).3 Wir hier im Sekretariat sind einigermaßen unglücklich darüber, daß die Schriftsteller selbst sich jetzt in diesen Monaten vor dem Kongreß nicht über die Fragen äußern, die ihnen am Herzen liegen. Wollen Sie uns nicht einen Artikel zur Vorbereitung des Kongresses schreiben? Wir würden uns bemühen, ihn in der Presse unterzubringen. Vielleicht liegen Ihnen Fragen der Lyrik am nächsten oder allgemeine Fragen des künstlerischen Schaffens oder auch Bemerkungen zum Verbandsleben. Wenn es nur mutig und offen Ihre Meinung ausdrückt und nicht im Ton dieser allgemeinen Artikel gehalten ist, die man hier und da in Zeitungen »Zur Vorbereitung des IV. Schriftstellerkongresses« liest und über die man sich die Haare ausreißen möchte.
Jetzt werden Sie wahrscheinlich keine Zeit mehr haben, aber im November geht's ja auch noch.4
Mein Mann läßt Sie und Ihre Frau grüßen. Fühlt sie sich gesundheitlich wohl?
Alles Gute für Ihre Reise wünscht Ihnen Ihre
//Christa Wolf//
1
Wolf ist seit September 1953 wissenschaftliche Mitarbeiterin des Schriftstellerverbandes, der u. a. die Zeitschrift NDL herausgibt, und lebt in Berlin (Ost).
2
Maurer nimmt das Angebot mit Brief vom 11. 10. 1954 an (in: Georg-Maurer-Archiv 1043). Er hat vor, sich poetisch mit der jüngsten chinesischen Geschichte auseinanderzusetzen. Während einer China-Reise 1956/57 entsteht der Gedichtzyklus Chinesische Landschaft.
3
Der IV. Schriftstellerkongress des DSV ist seit dem Frühjahr 1954 insgesamt fünfmal vertagt worden, er findet erst vom 9. bis 14. 1. 1956 in Berlin (Ost) statt.
4
Maurer hält auf dem IV. Schriftstellerkongress vor der Sektion Lyrik ein großes Referat Zur deutschen Lyrik der Gegenwart (EV in: Georg Maurer, Der Dichter und seine Zeit. Essays und Kritiken, Berlin (Ost) 1956, S. 32-67).
9 An Louis Fürnberg, Weimar
//Berlin, d. 16. Okt. 1955.
Lieber Louis!
Ich hatte draußen in Petzow – im Schriftstellerheim1 – schon einen etwas elegischen Brief an Dich angefangen; den habe ich nun weggeworfen. Ich bin immer sehr gerne am Schwielowsee, die ganze Atmosphäre der Landschaft tut mir gut. Diesmal waren etwa zwanzig junge Autoren aus Potsdam dort und unterhielten sich über Gott und die Welt, über Kunst und Künstler, über Probleme und Werke. Auch ich mußte »referieren«: »Entwicklungsprobleme unserer Gegenwartsliteratur«.2 Es fällt mir immer schwerer, zu sprechen oder zu schreiben, ich finde, das Wichtigste ist alles schon gesagt, man kann nur platt werden; in meinem Kopf jedenfalls suche ich zur Zeit vergebens nach originellen Gedanken. Ich half mir, indem ich ein Stück aus Thomas Wolfe: »Es führt kein Weg zurück« vorlas. Das Buch hat mich sehr aufgeregt, es ist ein mächtiger, zwar unfertiger, aber in sich bis zum Bersten mit Dynamik erfüllter Koloß.3 Wenn doch unsere Bücher ein bißchen davon hätten: Lebensfülle, Freude am Dasein in seinen vielen Formen, Lust am Entdecken. Mein Gott, wenn dann auch mal die Fabel nicht genau stimmt oder sowas! Aber dieses traurige Gebetsmühlengeklapper ist das schlimmste. Immer nur illustrieren wollen, was als richtig schon erkannt und sanktioniert ist. Welcher Leser soll denn das aushalten? Ich jedenfalls breche aus zur wirklichen Literatur.
Glaubst Du wirklich, daß der Girnus den Victor »klug festgenagelt« hat?4 Mir schien es so, als redete er (Girnus) an Victor vorbei. Victor setzt doch weitgehend voraus, was Girnus dann noch einmal – ganz richtig – ausspricht, und was Anna Seghers dann in ihrem Artikel »ideologische Klarheit« nennt.5 Freilich macht Victor dann ein bißchen viel Wind um seinen Geniebegriff, und natürlich ist es Unsinn, daß man keinen Artikel schreiben könne unter der Überschrift: Was für Schriftsteller brauchen wir? Aber irgendwo hat er doch was Gutes gewollt, was in unserer Situation auszusprechen nicht ganz unnützlich ist: Himmelherrgottsakra, Eure ganze »ideologische Klarheit« hilft euch nischt, wenn Ihr kein Talent habt! … was ja nun wahrhaftig keine umwälzende Entdeckung ist, das stimmt schon. Am fragwürdigsten scheint mir sein Begriff von »künstlerischer Meisterschaft«, wo er ihn mit »Talent« gleichsetzt und nicht bedenkt, daß die künstlerische Meisterschaft, dieses schreckliche Wort, das Ergebnis eines langen, nie aufhörenden Prozesses ist, der zwar das Talent voraussetzt, aber doch überhaupt nicht ohne dauerndes Ringen um – na ja, sagen wir: ideologische Klarheit zu denken ist. Bloß wird eben dieser Begriff allgemein viel zu statisch aufgefaßt, als könne man sich »ideologische Klarheit« ein für allemal, z. B. durch das Studium bestimmter Werke, »aneignen«. Sowas kann allerdings wirklich sterilisierend auf Künstler wirken. Aber auf richtige Künstler ja wohl auch wieder nicht …
Genug davon. Draußen in Petzow fanden sich die jungen Künstler immer abends in einem Kellergelaß, der Trinkstube, zusammen und frischten Talent und Diskutierfreudigkeit durch reichlichen Alkoholgenuß auf. In vorgerückter Stunde kehrten sie dann das Innerste ihrer Seele nach außen, und das war nicht bei allen schön. Wie kann man nur schreiben, wenn man sich dauernd gehemmt fühlt und nicht zu sagen traut, was man wirklich denkt? Aber rede mal mit Betrunkenen! Übrigens nicht untalentierte Burschen darunter, um die sich's lohnt. Einmal mehr wurde mir klar, wie wichtig die Frage ist: Was für Schriftsteller brauchen wir?
In der nächsten Zeit werde ich mich wohl in verschiedene Teile spalten müssen. Der NDL soll ich in der Redaktion helfen, in der Abteilung muß ich aber auch mit einspringen, weil Schellenberger abgesetzt ist.6 Ich habe mich breitschlagen lassen, erst im Januar in den Verlag zu gehen.7 Aber es wird hohe Zeit für mich, vom Verband wegzukommen; allzu leicht gerät man in die Cliquenwirtschaft hinein oder berücksichtigt sie, wenn man sie kennt. Wenn Du den Leuten zu nahe auf dem Pelz sitzt und mit ihnen zusammenarbeiten mußt, kannst Du sie schlecht kritisieren. Da hältst Du – oder vielmehr, da halte ich manchmal schon zuviel den Mund, wo ich ihn auftun möchte und müßte.
Unsere Annette dankt für den Handkuß; sie gehört allerdings noch nicht zu der Sorte Damen, die solche zarten Komplimente gebührend zu schätzen weiß. Vorläufig hat sie es drauf angelegt, mich möglichst oft in aller Öffentlichkeit in Verlegenheit zu bringen. Z. B. eine Scene aus der S-Bahn: Ein älteres Ehepaar setzt sich uns gegenüber; meine Tochter betrachtet sie interessiert und trompetet dann los: »Mutti, der Onkel und die Tante stinken aber!« Ich bedeute ihr, ähnliche Mitteilungen solle sie mir zukünftig leise ins Ohr machen. Nach einer Weile: »Mutti, komm mal her, ich will dir mal was ins Ohr sagen.« Voll böser Ahnungen neige ich mich zu ihr. Und sie in voller Lautstärke: »Mutti, der Onkel da hat ein Gesicht wie ein Klohndolli!« Vorhang zu! (Das Kind ist in Freiheit erzogen!)
Gerd rebelliert inzwischen. So einen langen Brief würde kein Mensch lesen, am wenigsten einer, der noch nicht ganz gesund sei. Ich nehm's ihm nicht übel (denn natürlich wirst Du den Brief sicher lesen, ja?), der arme Kerl hungert und dürstet seit drei Tagen und dekliniert begehrlich das Wort »Ananas«: Ananas, Ananässer, Ana am nässesten. Seine große Zehe guckt trübselig unter der Bettdecke hervor, und er behauptet, sogar diese große Zehe habe Durst.
Ich freue mich sehr, daß Du schon wieder so lange und schöne Briefe schreiben kannst. Es muß ein schönes Gefühl für Dich sein: Wieder im Leben, wieder auf der Erde.8 Ich entsinne mich, daß ich nach schweren Krankheiten immer sehr leicht und froh war und dachte, ich würde schon alles schaffen.
Viele herzliche Grüße an Lotte und Dich!
Eure
Christa.//
1
Von 1955 bis 1990 betreibt der Deutsche Schriftstellerverband, ab 1973 Schriftstellerverband der DDR, in der »Villa Berglas« in Petzow am Schwielowsee das Schriftstellerheim »Friedrich Wolf«. Die Eltern Christa Wolfs, Herta und Otto Ihlenfeld, sind dort bis Ende Juni 1960 Heimleiter.
2
Stichpunkte zu dem am 11. 10. 1955 gehaltenen Referat finden sich in: CWA N 105.
3
Als Lizenz des Rowohlt-Verlags erscheint 1955 im Mitteldeutschen Verlag Halle (Saale) eine deutsche Übersetzung des Romans durch Susanna Rademacher.
4
So äußert sich Fürnberg im Brief vom 6. 10. 1955 an Christa und Gerhard Wolf (vgl. Louis Fürnberg, Briefe 1932-1957, Berlin (Ost) 1986, Bd. II, S. 171).
5
Walther Victor setzt sich in seinem Aufsatz Zur Frage der Meisterschaft (in: Neues Deutschland, 23. 9. 1955) polemisch mit einem Bericht von Paul Wandel über eine Parteiaktivtagung mit Schriftstellern und Künstlern (Für Festigkeit und ideologische Klarheit in der Literatur und der bildenden Kunst, in: Neues Deutschland, 26. 7. 1955) und einem Aufsatz von Fürnberg (Was für Schriftsteller brauchen wir?, in: Einheit, 7/1955) auseinander. Victor stellt die künstlerische Meisterschaft über die »ideologische Klarheit«. Wilhelm Girnus, damals Funktionär im ZK der SED, bezieht gegen diese Auffassung in sehr scharfer Form Stellung (Über künstlerische Meisterschaft und ideologische Klarheit, in: Neues Deutschland, 2. 10. 1955). Anna Seghers versucht zwischen den Positionen zu vermitteln (Der Künstler braucht die Hilfe der Partei. Zu einer Diskussion im Schriftsteller-Verband, in: Neues Deutschland, 12. 10. 1955).
6
Die Personalakte im Archiv des Schriftstellerverbandes (Archiv SV 1601) legt den Eindruck nahe, dass Johannes Schellenberger nicht aus politischen Gründen Aufgabenbereiche entzogen wurden. Bis 1963 ist er noch beim DSV angestellt, danach freischaffend.
7
Vom 1. 1. bis 30. 4. 1956 arbeitet Wolf als Cheflektorin im Verlag Neues Leben. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter betätigt sie sich für den Verlag bis Ende 1957 noch als freie Lektorin und Beraterin.
8
Fürnberg ist am 31. 7. 1955 mit Herzinfarkt in eine Prager Klinik eingeliefert worden, wo er über acht Wochen zubringt, Mitte Oktober hält er sich zu einer Kur in Poděbrady auf (vgl. Fürnberg, BriefeII, S. 532).
10 An Ursula Pfahl, Naumburg
Berlin, den 29. 10. 1955
Sehr geehrte Frau Pfahl,
Ich danke für Ihren Brief an die Redaktion der NDL und möchte versuchen, zu einigen zentralen Fragen meine Gedanken zu äußern. Daß wir beide über das Buch von Hildegard Maria Rauchfuß verschiedener Ansicht sind, sehen wir aus meiner Kritik und Ihrem Brief, das brauche ich alles nicht zu wiederholen. Und warum sollte es über Bücher nicht verschiedene Meinungen geben?1
»Bösartig« bin ich allerdings nicht, wenn bösartig einer ist, der Freude daran hat, einem anderen eins auszuwischen. Wenn man öfter Literaturkritiken schreibt, weiß man ganz genau, daß man mit einer sogenannten »negativen Kritik« eine ganze Menge persönlichen Ärger hat oder haben kann. Außerdem weiß man sehr gut – was viel wichtiger ist – wieviele Menschen bei uns, auch solche unter ihnen, die verantwortliche Kulturfunktionäre sind, sich noch kein sicheres Urteil über ein Buch selbst bilden können und daher begierig angelesene Urteile zu ihren eigenen machen und wird sich in einigen Jahren geändert haben [sic]. Heute aber drückt dieses Bewußtsein der Verantwortung einen Literaturkritiker häufig sehr. Was aber sollte ich tun, da ich – weil ich unsere Buchproduktion gut verfolge – eine ganz bestimmte Gefahr immer größer werden sehe? Diese Gefahr ist eine Überflutung unseres Büchermarktes mit solchen Büchern, wie es die von H. M. Rauchfuß nach meiner Ansicht nun einmal sind. Was hilft es mir, daß die Autorin mir persönlich sympathisch ist und mich nun vielleicht, wenn sie meine Kritik so auffaßt wie Sie es taten, [[mich]] nicht mehr ansehen wird? Konnte ich deshalb etwas anderes schreiben? Ich konnte es nicht.
Übrigens – das sei nur am Rande vermerkt – wie kommen Sie auf die Idee, ich sei vom Ministerium oder vom DSV zu meiner Kritik »bevollmächtigt«? Weil ich ein paar mal »wir« statt »ich« schreibe? Gibt es nicht einen »Plural der Bescheidenheit«? Ich vermeide diese Form selbst meistens, glaube aber nicht, daß eine Kritik dadurch weniger »sauber« und »sachlich« wird.
Der Kern Ihres Briefes und der Grund, weshalb Sie ihn geschrieben haben, liegt wohl in anderen Fragen. Sie behaupten, man helfe nicht, wenn man kitschige Bücher, Sätze oder Partien in Büchern »kitschig« nennt. Sie finden die von mir zitierten Sätze nicht kitschig, sondern offenbar ganz normal. Ich nicht. (Es handelt sich nicht nur um zwei Stellen, die ich zitiert haben soll …)
In wesentlichen Fragen haben Sie mich anscheinend vollständig mißverstanden; so bin ich z. B. ganz und gar nicht dafür, im Hinblick auf die Zustände in unseren Krankenhäusern eine »rosarote Brille« aufzuhaben, sondern wünsche im Gegenteil, das Übel an der Wurzel zu packen und beim Namen zu nennen; das eben, scheint mir, hat H. M. Rauchfuß in ihrem Buch nicht getan, sie hat im wesentlichen Randerscheinungen geschildert. Ich wüßte nicht, wo sie wirklich »ein heißes Eisen angefaßt« hätte – und zwar so, wie speziell ein Roman es tun müßte.
Noch ein Wort zu Ihrem Vorwurf, ich habe die »vielen hunderttausend« Werktätigen beleidigt, die H. M. Rauchfuß' Bücher lesen. – Wahrscheinlich haben Sie – da Sie eine regelmäßige Leserin der NDL zu sein scheinen – auch in der Nr. 2/55 meinen Artikel »Achtung, Rauschgifthandel!« gelesen.2 Danach werden Sie verstehen, daß mir die Masse von übelster Kitschliteratur, die gerade unter den Werktätigen noch häufig kursiert, sehr zu denken gibt. Ich schrieb davon, auf welchen Schund tüchtige und fortschrittliche Menschen, die ich ganz gewiß nicht beleidigen will, heute noch bei uns hereinfallen. Die Verbildung des künstlerischen Geschmacks ist ein bitteres Erbe der Vergangenheit. In dem Artikel über H. M. Rauchfuß frage ich mich, wie man dieser Geschmacksverbildung durch unsere Literatur begegnet. Nach reiflicher Überlegung komme ich zu dem Schluß, daß ein Buch wie »Besiegte Schatten«, wenn es unkritisch gelesen wird, nicht den besten Geschmack fördert. Auch heute noch kann ich darüber nicht anders denken.
Etwas anderes ist es, daß Sie Lesungen mit der Autorin des Romans »Besiegte Schatten« organisieren. Ich finde es richtig, daß alle bei uns erscheinenden Bücher einem großen Leserkreis bekannt werden, damit sie sich damit auseinandersetzen können. Das Niveau dieser Auseinandersetzung wird sich mit dem Niveau unserer Bücher heben.
Sicher werden Sie nicht nur Hildegard Maria Rauchfuß, sondern auch Bücher unserer großen realistischen Schriftsteller, an denen wir ja nicht arm sind, im richtigen Verhältnis bekanntmachen. Sie wissen natürlich genau so gut wie ich, daß in unserer Übergangsgesellschaft in allen Zweigen des Überbaus, auch auf dem Gebiet der Literatur, ein ideologischer Kampf tobt. In der Literatur ist es der Kampf um die Durchsetzung des sozialistischen Realismus. Man muß ihn führen – auch wenn man mehr als einen »Anflug von Achtung vor der Menschenwürde eines Autors« hat …
Vielleicht habe ich mit dem Brief ein paar Mißverständnisse beseitigen können. Ich danke für Ihren Brief und für Ihr Interesse.
Mit freundlichem Gruß
(Christa Wolf)
1
Der Roman von Hildegard Maria Rauchfuß, Besiegte Schatten (Halle (Saale) 1954), spielt in einem Tuberkulose-Krankenhaus einer Industriestadt. In ihrer Kritik Besiegte Schatten? Hildegard Maria Rauchfuß, »Besiegte Schatten« (in: NDL, 9/1955, S. 137-141) prangert Wolf nicht nur Stilblüten an, sondern auch »fehlende Intensität bei der Durchdringung des Stoffes«, unglaubwürdige Motivierung von Figuren und deren Handlungen, vor allem aber das Fehlen von »echte[n] gesellschaftliche[n] Konflikte[n]«. Der Brief Ursula Pfahls vom 24. 9. 1955 enthält eine Gegenkritik unter dem Titel Warum so bösartig? (in: CWA 75 vorl. Sign.). Es gibt noch weitere kritische Leserbriefe zu Wolfs Rezension.
2
Wolf polemisiert in ihrem Beitrag (in: NDL, 2/1955, S. 136-140) gegen Trivialliteratur v. a. westlicher Provenienz und plädiert dafür, »interessante, menschliche Bücher« zu schreiben, »die im Thema an die Interessen vieler Leser anknüpfen« (S. 140). Sie zielt auf eine persönlichkeitsbildende Funktion der Literatur: »Durch wertvolle Bücher wird ein Mensch uns nicht nur politisch immer näher kommen, sondern vor allem wird sich sein Gesichtskreis erweitern, seine Gedanken- und Gefühlswelt reicher werden, sein Schönheitsempfinden sich entwickeln, sein moralisches Urteil sich schärfen; die ganze Persönlichkeit wird reicher, ausgeprägter, differenzierter.« (S. 139)
11 An Lotte und Louis Fürnberg, Weimar
Berlin, d. 13. 5. 56.
Liebe Lotte, lieber Louis!
Halleluja, es wird Frühling! Die Sonne scheint endlich mal wieder ins Fenster, alle Blätter sind in vier Tagen groß geworden. Freut Ihr Euch auch so wie wir darüber? Annettchen galoppiert wie ein junges Fohlen durchs Gelände und ist außer sich über jede Blume und jeden Käfer (in denen sie immer eine »Biene« vermutet).
Gerd natürlich legt sich mit einer Angina ins Bett und läßt sich von seinen zwei Frauen genießerisch verwöhnen – jetzt allerdings ist er schon ein paar Tage wieder auf, kann aber noch nicht so richtig zu sich kommen. Der Urlaub wird ihm, hoffe ich, sehr gut tun. Er hat sich jetzt mächtig mit einer großen Becher-Geburtstagssendung abgequält,1 ich denke, das wird ihn seelisch so mitgenommen haben. Wundert mich auch nicht.
Mir geht's gut. Ich entwickle ungeahnte hausfrauliche Talente, und nebenbei arbeite ich auch noch ein bißchen was für Verlage und so. Ich komme mir zwar so ein ganz kleines bißchen als überflüssiger Wurmfortsatz des Weltalls vor, aber ich tröste mich mit dem kleinen Wesen, das munter wächst und strampelt – und ein wenig, Louis, tröste ich mich auch mit Hans Castorp, in den ich mich gerade wieder einmal versenkt habe. Gerd sagt, Du hast ihn kritisch unter die Lupe genommen? Das wird mich sehr interessieren, denn der Kerl fasziniert mich doch immer wieder. Wenn ich auch oft lächeln muß, das gebe ich zu, über seine Nabel-der-Welt-Existenz. Aber bedenke, er ist doch auch noch schrecklich jung, dreiundzwanzig ganze Lenze alt!2
Manchmal denk ich mir auch selber Geschichten aus. Meist nur im Kopf, auf dem Papier verdreht sich ja leider immer alles auf so enttäuschende Weise … Das ist wohl dem Thomas Mann doch anders gegangen, nicht wahr? Ich glaube, der hat alles genau so hinschreiben können, wie er es sich in seinem Kopf vorgestellt hat. Zum Unterschied von den meisten unserer Bücher, wo alles immer nur andeutungsweise dasteht, provisorisch.
Aber was schwätze ich da herum, ich muß wirklich und wahrhaftig Gulasch machen. Liebe Fürnbergs, wir fahren ja nun nächste Woche in die Ferien nach Friedrichroda und kommen da laut Fahrplan der Deutschen Reichsbahn ganz zwanglos über Weimar. Da würden wir Euch dann ganz hemmungslos mit der ganzen Familie überfallen, wenn es nicht gerade der vierundzwanzigste Mai wäre, ein Tag also, an dem Ihr unter Umständen das Haus sowieso voll haben werdet. Deshalb frag ich an: Glaubt Ihr, daß wir Euch nachmittags zu dritt mal auf ein Stündchen besuchen sollten, oder seid Ihr nicht da, oder habt Ihr viel Besuch? Schreibt es uns bitte ganz offen auf einer Postkarte; wir wollten nur nicht ungefragt bei Euch vorbeirauschen. (Ist es nicht sinnig, daß der 24. Mai »Tag der Poesie« geworden ist?)3
Laßt Euch für heute herzlich grüßen und einen schönen Sommer wünschen.
//Eure Christa//
1
Das Manuskript des Rundfunkfeatures zum 65. Geburtstag von Johannes R. Becher ist unter dem Titel Johannes R. Becher – Ein Mensch unserer Zeit in seinem Gedicht überliefert (Gerhard-Wolf-Archiv 226).
2
Thomas Manns Roman Zauberberg ist Wolf wohl der Wertmaßstab bei ihrer Kritik des Buches von Rauchfuß (vgl. Brief 10 an Ursula Pfahl). Fürnberg setzt sich in einem »Krankenbericht« u. a. mit Thomas Mann auseinander (EV unter dem Titel Krankengeschichte, in: NDL, 6/1958, S. 24-53. Vgl. auch Brief von Fürnberg an Karl Siegler, 18. 2. 1957, in: Fürnberg, BriefeII, S. 438).
3
Der »Tag der Poesie« während der »Woche des Buches«, eigentlich auf den 22. Mai, den Geburtstag Johannes R. Bechers, terminiert, wird im Jahr 1956 wegen der vorhergehenden Pfingstfeiertage auf den 24. Mai verschoben. Am 24. Mai 1909 wurde Louis Fürnberg in Iglau geboren.
12 An Erwin Strittmatter, [Schulzenhof]
Berlin, d. 27. 6. 56
Lieber Erwin!
Schon seit Monaten eigentlich will ich Dich anrufen oder Dir schreiben, aber zuerst war ich immerzu krank und sehr miespetrig gestimmt, dann hatte ich Urlaub, dann keine Zeit und was dergleichen Ausreden mehr sind. Du wirst vielleicht wissen, daß ich inzwischen nicht mehr beim Verlag bin, weil ich es gesundheitlich nicht durchhielt (im September kommt bei uns ein neues Kind an). – Neulich erzählte mir nun Erwin Kohn, daß Du krank gewesen seist oder noch seist, und da tat es mir doch leid, Dir nicht eher mal geschrieben zu haben. Über viele Sachen hätten wir uns gern mal mit Euch unterhalten, und wahrscheinlich ist es dumm, immer zu denken, der andere würde das als aufdringlich empfinden. – Kurz und gut, wenn Ihr mal wieder in Berlin seid und etwas Zeit habt, ruft doch mal an, ja?
Aber eigentlich ist dieser Brief ja ein Geschäftsbrief. Ich bin gerade dabei, für den Reclam-Verlag eine Anthologie »Neue deutsche Prosa« zusammenzustellen, in der so etwa Deine Generation, soweit sie literarisch etwas verspricht, vertreten sein soll: Hermlin, Claudius, Brezan, Gorrisch, St. Heym usw., jeder mit einem Beitrag von etwa 40 Seiten. (Die Aufnahme in die Anthologie schließt, wie mir der Verlag versicherte, nicht aus, daß der betreffende Autor außerdem für eine größere Arbeit ein Einzelbändchen in der Reclam-Reihe zugestanden bekommt).
Ich möchte nun bei Dir anfragen: Hast Du etwas Neues, wenn möglich abgeschlossenes, das Du selbst für geeignet hältst. Oder könnte es vielleicht eine Episode aus dem neuen Roman sein? Sonst müßte ich etwas aus »Eine Mauer fällt« nehmen. Laß Dich doch bitte einmal darüber vernehmen!1
Jetzt müßte eigentlich kommen: »Sonst geht es uns gut, was ich von Euch auch hoffe.« Aber es kommt nicht. – Ich habe in den letzten Monaten Vorzüge und Nachteile eines selbständigen Hausfrauendaseins studieren können und bete zum lieben Gott, er möge mir Kraft geben, ein wenig disziplinierter an meiner eigentlichen Arbeit, von der ich auch noch genug habe, zu sitzen. Gerd ist 1½ Wochen nach dem Urlaub schon wieder überarbeitet, nur Annette erfreut sich bester Gesundheit und guter Laune.
Was macht Euer Film? Und Dein Buch?2 Wir müßten uns doch wirklich wieder einmal ein wenig zusammensetzen. Mit diesem frommen Wunsch und vielen Grüßen an Eva und Dich schließe ich für heute.
1
In diesen Jahren. Ausgewählte deutsche Prosa von Jurij Brězan, Eduard Claudius, Boris Djacenko, Rudolf Fischer, Franz Fühmann, Walter Gorrish, Theo Harych, Stephan Hermlin, Stefan Heym, Karl Mundstock und Erwin Strittmatter, hg. und mit einem Vorwort von Christa Wolf, erscheint 1957 bei Reclam, Leipzig. Strittmatter steuert das Kapitel Stanislaus und die Heilige aus dem Wundertäter bei. Erzählungen aus dem Band Eine Mauer fällt (Berlin (Ost) 1953) hat Strittmatter nicht wiederauflegen lassen.
2
Erwin und Eva Strittmatter arbeiten am Szenarium zur Verfilmung des Romans Tinko (1954) von Erwin Strittmatter. Der Film in der Regie von Herbert Ballmann wird am 29. 3. 1957 im Berliner Kino »Babylon« uraufgeführt. Im selben Jahr publiziert Erwin Strittmatter den ersten Band der Trilogie Der Wundertäter.
13 An Louis Fürnberg, Weimar
[Berlin,] den 22. 8. 56
Lieber Louis!
Ich habe diesen Brief an Dich schon seit Tagen immer wieder aufgeschoben, weil sich immer wieder vor alle anderen Gedanken der Tod von Brecht schob – und was soll man dazu sagen? Einer nach dem anderen verläßt uns, man fühlt sich mit der Zeit ganz verwaist, und die Verantwortung wird immer größer. Ihr habt eben alle Eure Herzen in den letzten Jahrzehnten zu sehr strapazieren müssen, Ihr müßt und müßt sie nun schonen, gegen alle innere Unruhe und äußere Anforderung.
Es ist mir eine große Beruhigung, daß wir Dich gerade kurz vorher sehen konnten, wohl und lebendig und, wie uns schien, recht gesund. Lotte wird jetzt ja wohl noch an der See sein, und Du befolgst hoffentlich pünktlich alle ihre hinterlassenen Mahnungen und Befehle?
Seit Du hier warst, schreibe ich jeden Tag. Du hast mir den Anstoß gegeben,1 und nun zwingt es mich von alleine weiter. Weißt Du, es soll die Geschichte eines Mädchens werden, das, in einem kleinbürgerlichen Elternhaus aufgewachsen, ohne jeden Widerstand völlig der Nazi-Ideologie ausgeliefert war und sie auch kritiklos, ja begeistert aufgenommen hat. Die Kriegsereignisse zwingen sie zur Flucht aus ihrem behüteten Zuhause und reißen die Familie auseinander, trennen sie vor allem von ihrem Vater, den sie vergötterte und der ein scharfer Nazi war. Die Flucht auf den Landstraßen, der Aufenthalt auf einem Gut, das Leben in einem kleinen mecklenburgischen Dorf, wo sie als Schreibhilfe des Bürgermeisters arbeitet – das alles bietet sehr viel Gelegenheit, mit allen möglichen Sorten von Menschen zusammenzukommen, die sie sonst nie gesehen hätte. Nach und nach beginnt sie sich unter dem Einfluß neuer Bekannter aus dem Bannkreis der alten »Freunde«, die sie noch umgeben, zu lösen. Ihr schwerster Konflikt ist, daß sie die Wahrheit über ihren Vater erfahren und verarbeiten muß, der als Kommandant eines sowjetischen Gefangenenlagers, das er nach Nazi-Manier verwaltete, verurteilt und erschossen wurde. Am Schluß muß sie sich gegen eine bisher sehr verehrte Lehrerin, die mit ihr gemeinsam auf der Flucht war und, die Gelegenheit ausnützend, daß sie hier niemand kennt, wieder ihr braunes Schäfchen scheren will, zur Wehr setzen und diese Lehrerin zur Strecke bringen. Sie findet zu ihrer Mutter zurück, von der sie sich, ihrem Vater zuliebe, völlig entfremdet hatte.
Die ganze Geschichte wird geschrieben, um zu zeigen, was die anderen aus den Menschen machen, wenn sie Einfluß gewinnen, und was wir aus ihnen machen können. Mir scheint nämlich, daß man in der Literatur nicht so sehr beweisen muß, daß die sozialistische Produktionsweise besser ist als die kapitalistische, sondern daß sie zeigen sollte, wie der Faschismus – Kapitalismus das Unmenschliche im Menschen züchtet, daß aber der Sozialismus nicht bestehen kann, ohne auf das Menschlichste im Menschen zu bauen.
Die innere Geschichte habe ich selbst erlebt, vom äußeren Ablauf der Handlung einiges, die Fabel und eine ganze Menge von Personen sind erfunden. – Man müßte es so schreiben können, daß für heute noch etwas dabei herausspringt. Eine der Schwierigkeiten ist, daß ich begonnen habe, alles mit den Augen des Mädchens zu sehen und auf meine Distanz als Erzähler weitgehend zu verzichten. Das bringt, besonders im ersten Teil, die Gefahr, daß sich etwa auch der Leser, wenn er sehr naiv ist, mit dem noch schrecklich verbohrten, arroganten, aber doch nicht unsympathischen Mädchen identifiziert, und daß man sehr aufpassen muß, mit der allmählichen Wandlung des Mädchens auch ihn selbst zu wandeln. Ob mir das gelingt, ist – neben allem anderen, was bisher noch sehr unbefriedigend ist – äußerst zweifelhaft.2
Lieber Louis, nun noch eine Bitte: Ich bin in Druck mit meiner Reclam-Anthologie, wenn Du mir nicht möglichst schnell Deinen versprochenen Beitrag dazu schickst.3 Sei doch bitte so gut, ja? Ich muß nämlich noch ein kleines Vorwort dazu schreiben und kann das nicht gut, ohne alle Beiträge zu kennen.
Gerd läßt Dich herzlich grüßen, er will demnächst einmal schreiben. In den letzten Tagen, da es auch noch das KPD-Verbot zu verdauen gab, hat ihn der Funk wieder einmal völlig aufgefressen. Meinst Du nicht auch, daß sie mit diesem Verbot, so schwer es die Genossen im Augenblick drüben auch haben, eine große Dummheit begangen haben? Mir ist diese blinde Wut und Ungeschicklichkeit fast unverständlich …4
//Für heute genug und der ganzen Familie viele, viele Grüße!
Deine Christa.//
1
Louis Fürnberg ermutigt Wolf zum literarischen Schreiben, u. a. in einem Brief vom 15. 6. 1956 (in: Fürnberg, BriefeII, S. 291-293).
2
Den Stoff verarbeitet Wolf später in Kindheitsmuster (1976). Entwürfe finden sich bereits in ihren Tagebuchaufzeichnungen von 1954/55 (CWA 100) unter dem Titel Weinen ist leicht (die »Hanna-Geschichte«, vgl. Kommentar zur Entstehungsgeschichte von Kindheitsmuster, in: Christa Wolf, Werke 5, hg. und kommentiert von Sonja Hilzinger, München 2000, S. 647).
3
Fürnberg hat eine Novelle über den englischen Dichter Aubrey Beardsley verfasst. Den Text bezeichnet er selbst als für die Anthologie ungeeignet (vgl. Brief an Wolf vom 8. 9. 1956, in: CWA 1278). Ein Beitrag Fürnbergs erscheint darin auch nicht (vgl. Anm. 1 zu Brief 12 an Erwin Strittmatter).
4
Gerhard Wolf ist bis 1957 Leiter der Abteilung Kulturpolitik beim Deutschlandsender. Durch Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird die KPD am 17. 8. 1956 in der BRD verboten.
14 An Lotte und Louis Fürnberg, Weimar
Petzow, d. 16. 1. 57
Liebste Lotte, liebster Louis!
Seid vielmals bedankt für Euern Brief, den ich heute als Morgengruß bekam und auch gleich in der ersten Freude beantworten will.
Gerd ist für zwei Tage in Berlin, gestern war ich auch dort, bei der ganz schrecklichen Bezirkskonferenz des Berliner Verbandes. Die Partei hatte sie in stunden- und tagelangen Sitzungen vorher totorganisiert, nun ging alles unter in Afferei und Undiszipliniertheit. Manche stellten sich an, als machten sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine demokratische Wahl mit. Ich habe mich halb krank geärgert. Werden wir uns, Louis, auf der Delegierten-Konferenz Anfang Februar sehen? Ich kann es Dir nicht reinen Herzens wünschen, aber mich würde es sehr freuen.
Ich kann Euch gar nicht sagen, wie unfrei und gehemmt ich mich immer unter Schriftstellern fühle. Was soll ich überhaupt dort? Viele da sind zwar nicht mehr Schriftsteller als ich, aber der liebe Gott hat sie wenigstens mit einem gesunden Selbstbewußtsein gesegnet. Ich dagegen bin in den letzten Monaten vor Minderwertigkeitskomplexen bald eingegangen, besonders weil ich so sehr wenig zum arbeiten kam. Meine Frau, die mir manchmal hilft, wurde krank, die Kinder waren beide krank, ein Besuch reichte dem anderen die Tür, mich drängten einige Termine – kurz und schlecht, ich wurde unleidlich und mir selbst ein Scheusal. Nun haben wir unsere Koffer und unsere – inzwischen wieder plumps gesunden – Kinder gepackt und an den Schwielowsee verfrachtet. Und hier geht's uns gut.
Bald schick ich Euch mal ein selbstgemachtes Bild von unserer ganzen Familie. Gerd hat mir einen schönen Knipskasten zu Weihnachten geschenkt, und ich entwickle mich nun zum leidenschaftlichen Fotoamateur. Leider kann ich Euch auf so einem Bild den ganzen Liebreiz unserer Kleinsten nicht mitschicken, die sich bei jeder menschlichen Annäherung ausschütten möchte vor Lachen und durch Juchzen und laute Selbstgespräche ihre Zufriedenheit äußert. Stolz, aber ungern frißt sie Möhrenbrei und säuft überdimensionale Milchflaschen aus. Nein, man kann es nicht beschreiben. Gerd wirbt um ihre Gunst, wie er um die meine zu werben nie nötig hatte und erzielt erstaunliche Erfolge.1
Ihr Lieben, erinnert mich nicht mehr an mein Geschreibsel, bis ich es Euch selbst einmal (vielleicht) gebe. Es ist, so wie es ist, sehr schlecht, und ich konnte es Euch nicht schicken. Nie hätte ich mich auf so etwas einlassen sollen, aber nun ist es zu spät.
Ich will nach langer Zeit einmal wieder etwas Kritisches für die NDL schreiben, was mich reizt: Eine Betrachtung über die beiden Bücher von Hans Erich Nossack, die bei Suhrkamp erschienen sind. N. ist ein aufgeschlossener, ehrlicher Mann, der aber, wie ich fürchte, eine Entwicklung immer mehr ins Verinnerlichte nimmt und so nach und nach alle Realität aus seinen Gedanken und seinen Werken eliminiert.2 Das ist die eine Möglichkeit, Weisenborn mit seinem »Auf Sand gebaut« ist die andere.3 Dazwischen liegt der gute realistische Roman.
Gerd ertrinkt in Lyrikbänden und entdeckt jeden Tag etwas Neues. Es macht ihm Spaß und er hat eine Menge Pläne. Der Funk hat die Leine, die er ihm um den Hals geschnürt hatte, auf sehr anständige Weise gelockert, und Gerd kann sich nun ohne Gewissensbisse seiner Arbeit widmen und trotzdem dem Funk noch nützen. Dabei wird er zum ersten Mal in seinem Leben dick und fett (relativ gesehen)!
Ich wurde sehr neidisch, als ich las, daß Ihr mit Kubas zusammenwart und Euch wunderschön streiten konntet.4 Ich hatte in den letzten Wochen auch manchmal so viel in mir, das ich mir unbedingt auf gute Art hätte herausstreiten müssen; aber vieles wird sich, das hoffe ich wenigstens, im Laufe der Zeit von selbst erledigen und sich wieder mal als intellektuelle Spinnerei erweisen. Vielleicht hält man sich selbst und was man denkt und meint immer noch zu sehr für den Nabel der Welt, und vielleicht ist diese ethische Grundidee, die man doch zu gerne hinter allem sehen möchte, in unserer Zeit eine völlige Utopie. Und trotzdem, wenn man sie nicht hat und nicht zu verbreiten versteht, werden wir nie zum Sozialismus kommen. Oder doch?
Ich hoffe, Ihr seid inzwischen frisch und erholt aus dem Ozon der Berge wieder in den Mief der Täler heruntergestiegen. Ich hoffe, keiner von Euch hat ein Herz- oder sonstiges Wehwehchen. Was macht der schwarze Teufel Alena? Grüßt sie recht schön von mir, und auch den Mischa, falls er sich dadurch nicht beleidigt fühlen sollte.5
Und seid vor allem Ihr beiden recht, recht sehr gegrüßt
von Eurer
Christa
1
Katrin Wolf, genannt Tinka, ist am 28. 9. 1956 geboren.
2
In ihrer Kritik »Freiheit« oder Auflösung der Persönlichkeit? (in: NDL, 4/1957, S. 135-142) geht Wolf auf Nossacks Publikationen Spätestens im November (1955) und Spirale. Roman einer schlaflosen Nacht (1956) ein.
3
Günther Weisenborns Roman über die »Bonner Republik«, Auf Sand gebaut (1956), ist ein Plädoyer gegen die Wiederaufrüstung und den Lobbyismus in der Politik.
4
Mit Ruth und Kurt Barthel (Kuba) sind Fürnbergs eng befreundet.
5
Gemeint sind die Kinder der Fürnbergs, Alena und Miša.
15 An Gerhard Wolf, [Berlin (Ost)]
//Moskau, d. 2. Juni 1957, 830
Liebster Mann!
Du liegst nun also noch süß in Deinem Schlummerbettchen, denn bei Euch ist es ja erst ½ 7 Uhr. Moskau aber ist schon lange wach: Gestern abend (bzw. heute Morgen) ging ich schlafen um 2 Uhr, da sah ich unten auf den Straßen und Plätzen: Licht, Menschen, Autos. Der Lärm drang bis zu mir herauf, d. h. bis in die 19. Etage des Leningradskaja-Hochhaushotels, eben jenes Gebäudes, das man seit einiger Zeit immer als besonders markantes Beispiel für unrentables Bauen hingestellt hat. Und die Eingangshalle ist ja denn auch wirklich eine Kreuzung zwischen einer Kathedrale und einer Bahnhofshalle. Aber die Zimmer sind hübsch, und hoch über Moskau wohnt sich's gut. Und heute früh um 7 weckte mich der Lärm: Autos, Menschen, Menschen.
Wie Du siehst, ist mein Füller durch sechsstündigen Aufenthalt in 2400 m. Höhe nicht ausgelaufen – aber mir wäre es beinahe passiert, bei der ersten Landung in Wilna. Lieber Gott – war mir schlecht! Ich schwor mir, nie wieder zu fliegen, während Helmut Hauptmann neben mir sich quietschvergnügt die Stadt von oben beguckte. Aber die Frauen stiegen alle ganz grün aus dem Flugzeug, und einige der Männer auch: Wir hatten Gegenwind und Luftlöcher. In Moskau ging's viel besser.1
Am Flughafen empfingen uns: Aschajew, Michalkow, und noch einige Menschen, deren Namen ich in der Aufregung nicht verstand. Wir aßen zusammen Abendbrot. Ahnungslos, wie ich bin, aß ich mich an den Vorspeisen satt: Kaviar (wunderbar, wird aber bald aussterben, da die Fische durch die Sperren und Kraftwerke nicht mehr ins Meer zum Laichen können und die Fahrstühle für Fische mit konstanter Bosheit nicht benutzen), diverse Salate, Fisch, sehr schönes Brot. Dazu Wodka und Wein. Schön und gut, aber plötzlich bringen sie mit Unschuldsmiene noch ein »kleines Kiewer Kotelettchen«. Das war ja nun wirklich ein Gedicht und ist nichts von allem, was Du Dir vielleicht unter einem Kotelett vorstellen magst. Ich werd's Dir zu Hause beschreiben. Zum Nachtisch dann »Мороженое«: Das berühmte Eis. Ich kann nur hoffen, daß der wenige Schlaf das viele Essen aufhebt.
Ich frage mich ernsthaft: Was wollen bloß all die Menschen in aller Herrgottsfrühe auf der Straße? – Gestern abend zog ich nach dem Abendessen mit Helmut noch los. Wir hatten es uns in den Kopf gesetzt, daß man am ersten Abend in Moskau den Roten Platz besuchen muß: Ohne einen Rubel in der Tasche, mit nur einer ungefähren Ahnung von Richtung und Entfernung. Als wir uns verlaufen hatten, faßten wir uns ein Herz und fragten zwei Mädchen. Die sagten uns, wie wir mit der Metro hinkommen würden. Sollten wir ihnen erzählen, daß wir kein Geld hatten? – Schließlich landeten wir am Kursker Bahnhof: Nachts um 12, ein faszinierendes Bild: Menschen, Menschen, Autos. Leben ist hier. Ein Taxi nach dem anderen, dem sehr einfach, öfter bäuerlich gekleidete Menschen entstiegen.
Geschäfte sahen wir kaum. Wo die Leute ihre Sachen kaufen, weiß ich nicht. Sie sind sehr einfach gekleidet. – Moskau ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe: Viel flacher und breiter. Bei blauem Himmel ist seine Hauptfarbe: gelb bis rosa. Viele alte abbröckelnde Häuser. Aber augenblicklich wird viel gebaut. Gestern abend sahen wir hinter allen Gardinen nur die alten Fransenhängelampen. Alles ist, wir würden sagen: altmodisch. Und vieles hat seinen russischen Charakter noch unverkennbar bewahrt.
Aber mir gefällt's sehr. Es ist lebendig, es atmet, es lenkt nicht so sehr ab vom Wesentlichen wie westdeutsche Großstädte. Es gibt nichts Hektisches, bei aller Eile keine Hast, sondern ruhige, selbstbewußte Zielstrebigkeit.
Heute morgen machen wir eine Stadtrundfahrt. Es regnet bis jetzt zwar, aber das schadet nichts.