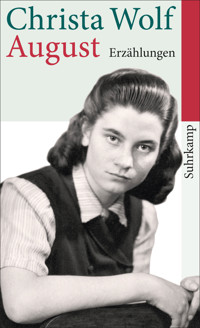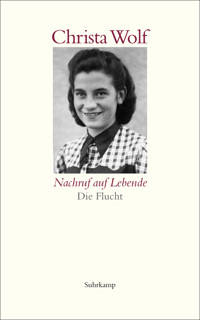18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rede, daß ich dich sehe – die sokratische Aufforderung deutet an, welches Ziel Christa Wolf mit ihren Büchern verfolgt: sich zu erkennen zu geben, »an die Wurzeln unserer Existenz vorzudringen«. In diesem Band sind es die Werke von Schriftstellerkollegen und bildenden Künstlern, denen sie sich zuwendet. Sie schreibt über Doktor Faustus und Thomas Manns Exil in Los Angeles, Schauplatz ihres großen Romans »Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud«. Sie erzählt von den Kassandra-Radierungen der Malerin Nuria Quevedo, von den Aschebildern Günther Ueckers zu Tschernobyl und vom legendären Carl friedrich Claus, der seine Sprachblätter in einer Aktentasche mit sich herumtrug. Sie zeichnet ein liebevolles Porträt von Uwe Johnson, ist streitbar für Günter Grass und entwirft beim Nachdenken über den »blinden Fleck« eine kurze Mentalitätsgeschichte der Deutschen und ihres Verhältnisses zur Literatur. In den Essays, Reden und Gesprächen der letzten Jahre, von Christa Wolf selbst ausgewählt, viele davon hier erstmals veröffentlicht, webt eine große Autorin unserer Zeit ein dichtes Netz des künstlerischen Dialogs, in dessen Zentrum wir ihr eigenes Werk sehen. Und wie nebenbei entsteht über den Weg der Kunst ein Bild unserer Verhältnisse, wie sie sind und wie sie auch sein könnten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Christa Wolf
Rede, daß ich dich sehe
Essays, Reden, Gespräche
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung,
des öffentlichen Vortrags
sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen,
auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Satz: Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
eISBN 978-3-518-78370-2
Rede, daß ich dich sehe
Inhalt
1.
Zeitschichten
Zu Thomas Mann
Begegnungen mit Uwe Johnson
C Gespräch im Hause Wolf über den in Vers und Prosa G sowohl als auch stückweis anwesenden Volker Braun
Autobiographisch schreiben
Zu Günter Grass' Beim Häuten der Zwiebel
Der Tod als Gegenüber
Zu Überlebnis von Ulla Berkéwicz
2.
Rede, daß wir dich sehen
Versuch zu dem gegebenen Thema »Reden ist Führung«
Nachdenken über den blinden Fleck
3.
Mit Realitäten umgehen, auch wenn sie einem nicht gefallen
Egon Bahr zum achtzigsten Geburtstag
Ein besonderes, unvergeßliches Licht
Paul Parin zum neunzigsten Geburtstag
Zu Rummelplatz von Werner Bräunig
»Jetzt mußt du sprechen«
Zum 11. Plenum der SED
In Zürich und Berlin
Zum fünfundsiebzigsten Geburtstag von Adolf Muschg
O Dichtung, herrlich, streng und sanft
Begegnungen mit Spanien und seiner Literatur
Kuckucksrufe
Kleine Rede zu einem günstigen Augenblick
4.
An Carlfriedrich Claus erinnern
Ein Ring für Nuria Quevedo
Angela Hampels Gestalten im Spannungsfeld
Entwürfe in Farbe – Radierungen der Helga Schröder
Köpfe – Ein Gespräch mit Martin Hoffmann
Zwiegespräch mit Bildern von Ruth Tesmar
Günther Ueckers Bilder aus Asche
5.
»Wir haben die Mephisto-Frage nicht einmal gestellt«
Gespräch mit Arno Widmann
»Bei mir dauert alles sehr lange«
Gespräch mit Hanns-Bruno Kammertöns und Stephan Lebert
»Wir haben dieses Land geliebt«
Gespräch mit Susanne Beyer und Volker Hage
»Bücher helfen uns auch nicht weiter«
Gespräch mit Evelyn Finger
Textnachweise
Bildnachweis
1.
Zeitschichten
Zu Thomas Mann
Die Nachricht, daß Sie mir den Thomas-Mann-Preis zuerkannt haben, für den ich mich herzlich bedanke, hat mir einen Thomas-Mann-Sommer beschert. Aber auch eine ausschweifende Lektüre ließ mir die Aufgabe nicht leichter erscheinen, hier zu Ihnen über ihn zu sprechen. Zu Thomas Mann ist alles gesagt. Ich versuche, mich ihm über Erinnerungen zu nähern.
Schwere Stunde hieß die kleine Erzählung, die im Herbst 1950 uns Studenten des dritten Semesters für Germanistik an der Universität Jena im Seminar für Sprecherziehung als Übungstext aufgegeben war. Ihr Autor war Thomas Mann, ihr Gegenstand Friedrich Schiller. Wir saßen, etwa zwanzig Studenten, in einem der kleineren Seminarräume, der auf eine Straße und jenseits davon auf den botanischen Garten hinausblickte. Dort sind, meine Damen und Herren, sagte unsere Sprecherzieherin, vor hundertfünfzig Jahren unsere Klassiker, Goethe und Schiller, spazierengegangen, und es ist nicht ausgeschlossen, daß sie genau über diesen Text gesprochen haben, um den Schiller sich in dieser Novelle von Thomas Mann bis zur Erschöpfung bemüht: über sein Drama Wallenstein. – Das Haus, in dem Schillers Familie wohnte, war nicht sehr weit entfernt.
Uns allerdings ging es in dieser Übungsreihe nicht um den Inhalt der Novelle; es ging darum, kleinere und größere Sprachfehler an uns Probanden zu korrigieren. Ich erinnere mich an den Kommilitonen, der den ersten Part des Textes zu lesen hatte und nur langsam damit vorankam, weil unsere Lehrerin ihm sein Lispeln nicht durchgehen lassen wollte: »Das war ein besonderer und unheimlicher Schnupfen, der ihn fast nie völlig verließ.« Allzu viele S-Laute in einem Satz. Bei anderen war die stark thüringische oder sächsische Lautfärbung zu beanstanden, die sie als spätere Lehrer doch nicht auf ihre Schüler übertragen wollten. Wieder andere sollten es lernen, das »i« in »Milch« nicht berlinerisch »Mülch« auszusprechen.
Das hatte ich deutlicher behalten als Einzelheiten der Novelle, die ich lange nicht mehr gelesen hatte. Was mir davon in Erinnerung blieb, war eine Atmosphäre von Qual, die sie ausstrahlte, von quälender Mühe mit der Schreibarbeit. Jetzt, als ich dieses Stück Prosa wieder vor mir hatte, sah ich, daß es »in der Nußschale« die wichtigsten Probleme anriß, die seinen Autor über die Jahrzehnte hin begleiten sollten – über ein halbes Jahrhundert hin, in dem ein kolossales Werk entstand.
Und »begleiten« ist ein schwaches Wort. Die »schwere Stunde«, die er dem Friedrich Schiller auferlegt – er, der gerade glücklich verheiratete, nicht mehr ganz junge Autor, der sich als Fünfundzwanzigjähriger mit den Buddenbrooks einen Namen gemacht, danach neben kleineren Arbeiten die Novelle Tonio Kröger geschrieben hat, der sich also wohl hätte erfolgreich nennen und Zutrauen zu seinem Talent hätte haben können –, diese schwere Stunde durchlebt er selbst immer wieder. Seinem Bruder Heinrich schreibt er von »Depressionen wirklich arger Art mit vollkommen ernstgemeinten Selbstabschaffungsplänen«, und er muß sich eingestehen, daß auch die endlich geglückte Heirat mit der hartnäckig umworbenen Katia Pringsheim ihm nicht jene Art Dauerglück gebracht hat, nach der er sich sehnt.
Schiller jedenfalls ist, so sieht er ihn, nächtlich allein in seinem kalten Arbeitszimmer, heimgesucht von einem »heillosen Gram der Seele«. Der Wallenstein scheint gescheitert – das Werk, »an das seine kranke Ungenügsamkeit ihn nicht glauben ließ … Versagen und verzagen – das war's, was übrigblieb.«
»Ichsüchtig« habe man ihn genannt, schreibt Thomas Mann. Wen? Friedrich Schiller? Aber: »Ichsüchtig ist alles Außerordentliche, sofern es leidet.« So früh also schon sein Sich-Aufbäumen gegen den häufig gegen ihn erhobenen Vorwurf der Kälte, der Liebesleere, dem er zur Rechtfertigung, als Preis, den das unerbittliche Gesetz der Kunst ihm abfordert, immer wieder den Schmerz entgegenhalten wird, der sein unabweisbarer Begleiter ist. (»Das Talent selbst – war es nicht Schmerz?«) Und doch: »Das Gewissen … wie laut sein Gewissen schrie!« Er spürt wohl – wer? Friedrich Schiller? –, daß er den Menschen, die ihm nahe sind, etwas schuldig bleibt. Er steht am Bett seiner Frau. »Bei Gott, bei Gott, ich liebe dich sehr! Ich kann mein Gefühl nur zuweilen nicht finden, weil ich oft sehr müde vom Leiden bin und vom Ringen mit jener Aufgabe, welche mein Selbst mir stellt. Und ich darf nicht allzusehr dein, nie ganz in dir glücklich sein, um dessentwillen, was meine Sendung ist.«
Den Doktor Faustus von Thomas Mann habe ich zum ersten Mal früh gelesen, ich könnte nicht mehr genau sagen, wann. Aber er gehörte zu den Büchern, die mir halfen, in das Wesen, vielmehr Unwesen des deutschen Faschismus einzudringen und mich, die ich zu der Generation gehörte, die als Kinder und Jugendliche nicht einmal den Namen eines Thomas Mann kennen sollten, gegen dieses Unwesen zu immunisieren. Benennen hätte ich diese Wirkung damals wohl nicht können, aber ich spürte, »welche Unmenschlichkeit das Buch des Endes kalt durchweht«. Das nicht! dachte ich. So nicht.
Die Jüngeren mögen es sich nicht vorstellen können, »Gesittung«, »Humanität« waren Wörter, die wir mit sechzehn, siebzehn Jahren zum ersten Mal im positiven Sinne hörten. Die Geschichte vom Verhängnis dieses deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn hat mich erschüttert. Konnte ich mir verhehlen, welch anderem Teufelspakt wir beinahe verfallen wären? Ich las das Buch wieder. Es wuchs mit meinen Einsichten. Meine Einsichten wuchsen mit diesem Buch.
Eine merkwürdige Fügung in meinem Leben erlaubte, nein: zwang mir noch einmal eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Autor auf, mit diesem Buch, mit seiner Entstehungsgeschichte, mit dem gefahrvollen, turbulenten Zeitgeschehen, in das es gestellt war, und mit der innigsten Verquickung all dieser Faktoren, die Gehalt und Gestalt des Werkes bestimmte. 1992/93 lebte ich für ein Dreivierteljahr ganz nah bei dem Ort, an dem der Doktor Faustus entstand: »Pacif. Palis.«, das heißt: »Pacific Palisades« steht über den Tagebucheintragungen Thomas Manns jener Jahre zwischen Mai 1943 und Januar 1947, der Entstehungszeit dieses großen Romans. Meine Adresse war »Santa Monica«, in enger Nachbarschaft also zu 1550 San Remo Drive, wo die Manns sich ein Haus hatten bauen lassen, in dem sie ab Februar 1942 wohnten. Dort bin ich oft gewesen. Vom Haus sieht man nicht viel, hochgewachsene Hecken verbergen es dem Blick. Keine Tafel erinnert an seinen berühmten ersten Bewohner (das habe ich auch an den anderen Wohnungen und Häusern der damaligen Emigranten festgestellt: Ihrer wird nicht gedacht). Ich habe vor dem Eingang des Grundstücks gestanden und meine Phantasie spielen lassen, bin auch den Weg nachgegangen, den Thomas Mann nach seiner Morgenarbeit oft genommen hat, den Amalfi Drive hinunter in Richtung Küste, bis zum Hotel Miramar an der Pacific Promenade, wo er wohl einen Wermut trank und seine Frau Katia ihn mit dem Auto abholte.
In diesem Hotel habe ich bei einem Frühstück mit einem Freund, der aus Europa herübergekommen war, ausführlich über die Beschaffenheit der deutschen intellektuellen Emigration in Kalifornien gesprochen, auf deren Spuren ich mich fasziniert bewegte. Ich liebe es, die Orte aufzusuchen, an denen Schriftsteller, Künstler gewohnt und gearbeitet haben. In Leningrad hat uns vor vielen Jahren der Urenkel Dostojewskis zu dem Haus geführt, in dem Raskolnikow die Wucherin erschlug. In Moskau waren wir in der Wohnung Majakowskis. In London sind wir durch das Bloomsbury der Virginia Woolf gegangen. In Marseille habe ich das Hotel und das Café gefunden, in denen die Figuren von Anna Seghers' Transit sich bewegen. In Prag sahen wir Kafkas Umfeld und die Kneipen, in denen der gute Soldat Schwejk zu Hause war. In Rom standen wir vor dem Haus, in dem die Bachmann ihr Franca-Fragment geschrieben hat.
Und nun also Kalifornien, Los Angeles, in dem in den dreißiger, vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sich Größen aus Literatur, Theater, Film versammelten, die aus Deutschland vertrieben waren, so daß es auch das »Weimar unter Palmen« genannt wurde. Ein alter Schauspieler, der an der Galilei-Aufführung von Brecht mitgewirkt hatte, hat sich während einer Party im Hause Schönberg bei mir bedankt, daß wir ihnen in den dreißiger Jahren »alle diese wunderbaren Menschen« herübergeschickt hätten. O madam, what a seed! rief er aus und zählte Namen auf: Brecht, Thomas und Heinrich Mann, Marta und Lion Feuchtwanger, Hanns Eisler, Bruno Frank, Franz Werfel, Berthold und Salka Viertel, Adorno. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt die Wohnstätten aller dieser Emigranten schon aufgesucht.
Nach einem original Wiener Essen mit Fleckerlsuppe, Tafelspitz und Sachertorte, das die Schwiegertochter von Arnold Schönberg uns bereitet hatte, brachte ich die Sprache auf Thomas Mann, was ja in diesem Hause nahelag: Im Anhang zu Manns Tagebüchern hatte ich unter dem 20. April 1952 einen Brief zitiert gefunden, den er an Adorno geschrieben hatte: »Mit Schönberg war es so: Er hatte in einem englischen Blatt noch einmal etwas völlig Insipides von sich gegeben, und ich schrieb ihm, bevor ich unter seinen Schlägen endgültig zusammenbräche, müsse er mir erlauben, den Brief zu veröffentlichen, worin er mir seine volle Genugtuung über mein bereitwilliges Eingehen auf seine Wünsche ausgedrückt habe. Die Antwort lautete: Ich hätte ihn bezwungen und versöhnt, wir wollten das Kriegsbeil begraben und gute Freunde sein.« Und? fragte ich in die Tischrunde. War es so? Waren sie am Ende »gute Freunde«?
Man schwieg. Die Söhne von Schönberg schwiegen. Zögernd sagte die Schwiegertochter: Sie haben sich ja dann gar nicht mehr gesehen. Schönberg ist ja auch bald gestorben. – Die deutsche und die englische Ausgabe des Doktor Faustus wurden herbeigeholt, die jeweiligen Nachbemerkungen verglichen, in denen Thomas Mann feststellt, »daß die … Zwölfton- oder Reihentechnik … in Wahrheit das geistige Eigentum eines zeitgenössischen Komponisten und Theoretikers, Arnold Schönbergs, ist«.
Thomas Mann hatte kein Unrechtsbewußtsein, wenn er Teile aus der Realität, auch aus schon zu Kunst verarbeiteter Realität, in sein Werk hereinholte und sie mit ihm verschmolz. Arnold Schönberg soll bemerkt haben, hätte er – Thomas Mann – ihm etwas von dem Buch gesagt, an dem er schrieb, er hätte ihm extra dafür ein Stück komponiert.
In demselben Brief an Adorno, 1952 also, äußert Thomas Mann sich auch ausführlich zu seinen großen Bedenken über die Richtung, in die die USA sich politisch entwickeln (»… daß ein McCarthy nicht zu beseitigen ist …«), und deutet seine Sehnsucht nach Europa an.
Aber so weit bin ich noch nicht, oder schon weiter. Herbst 1992, ich bin gerade erst angekommen in Santa Monica und ahne noch nicht, wie Zeitschollen aus verschiedenen Schichten der Jahrhundertchronik hier in Bewegung geraten, sich gegen- und übereinander verschieben werden, so daß mir oft schwindlig wird.
Da wäre die Gegenwart, in der ich lebe, Herbst 1992 bis Frühsommer 1993 – die Zeit, in der ich auch die Geschichte des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn wieder lese, die ihrerseits das erste Viertel des Jahrhunderts umfaßt, aber viel später erst, nämlich in den vierziger Jahren, als Deutschland in dem von ihm angezettelten Krieg zugrunde geht, erzählt wird von seinem treuen Freund Serenus Zeitblom, dessen Schilderungen der Katastrophe des Kriegsendes ich bewegt folge, denn diese Katastrophe habe ich, anders als er freilich, miterlebt.
Zugleich aber, vierte Zeitebene, lese ich in den Tagebüchern des Thomas Mann, was ihm die Jahre abverlangen, in denen er sein Faustbuch schreibt: nämlich eine Fülle von Schreibverpflichtungen aus persönlichen und öffentlichen Anlässen, eine kaum vorstellbare Postlawine, die er gewissenhaft bearbeitet, seine regelmäßigen Rundfunkreden an die Deutschen Hörer, wochenlange Lesereisen in andere Teile der Vereinigten Staaten, eine schwere Operation nach einer Krankheit, deren wirklichen Charakter man ihm klugerweise verbirgt, und ein erstaunlich lebhaftes gesellschaftliches Leben in der Emigrantenkolonie in Kalifornien, dabei beginnende Auseinandersetzungen über die Zukunft Deutschlands nach dem Ende des Krieges. Als er das Buch abschließt, ist der Autor in seinem dreiundsiebzigsten Jahr.
Fehlt die fünfte Zeitebene, auf der wir uns treffen: die Jetztzeit, heute, der Tag, an dem ich vor Ihnen stehe und, nicht ohne Aufregung, dies alles erörtere. Die Tiefe der Zeit, hier tritt sie uns einmal anschaulich entgegen.
Mit neuer Erregung habe ich mich damals in den Doktor Faustus vergraben; ich las natürlich viele Bücher der Emigranten, die in dieser Region gelebt und geschrieben hatten, noch einmal oder zum ersten Mal. Der Faustus nahm mich auf besondere Art gefangen. Ich sah in ihm eine der radikalsten Selbstauseinandersetzungen der deutschen Intelligenz vor dem Nationalsozialismus, und ihr Kern war und ist mir des Teufels schauderhaftes Gebot an Adrian Leverkühn: Du sollst nicht lieben. Eine »Aura von Lebensgefühl, eine Lufthülle biographischer Stimmung« habe von Anfang an um den »thematischen Kern« dieses Buches gelegen, sagt Thomas Mann.
Nicht geliebt werden, nicht lieben können ist das Leid des Kleinen Herrn Friedemann, auch des Tonio Kröger, mit seinem traurigen Befund: »das Menschliche darzustellen, ohne am Menschlichen teilzuhaben«. Dieses Leid wird auch dem Gustav Aschenbach zuteil, und es wird in den großen Romanen bei einigen der Protagonisten als tiefste Seelenregung beschrieben. Das Thema Liebe kann man als eine der wichtigsten, vielleicht die wichtigste Erzählachse in Thomas Manns Werk sehen: Es rührt an die innerste Wesensebene des Autors, wo jenes Konfliktmaterial sich gleichzeitig verbirgt und unermüdlich arbeitet, das ihn zum Schreiben zwingt. Als sein persönlichstes Werk wird Thomas Mann den Faustus bezeichnen. Die persönliche Sphäre hat mich bei der neuerlichen Lektüre besonders gereizt, vielleicht weil ich mir, selbst in einer Lebenskrise, von diesem Werk der Krise irgendeine Art von Aufklärung und Beistand erhoffte.
»Herzpochendes Mitteilungsbedürfnis« habe ihn, Serenus Zeitblom, den schlichteren Lebensfreund des genialen, doch hoch gefährdeten Künstlers bewogen, sich an eine Biographie des Freundes zu wagen. Und er könnte dieses Wagnis nicht gültiger rechtfertigen als mit dem Bekenntnis: »Ich habe ihn geliebt – mit Entsetzen und Zärtlichkeit, mit Erbarmen und hingebender Bewunderung.«
Das habe der andere nicht getan, o nein. »Wen hätte dieser Mann geliebt? Einst eine Frau – vielleicht. Ein Kind zuletzt – es mag sein. … Wem hätte er sein Herz eröffnet, wen jemals in sein Leben eingelassen? … Seine Gleichgültigkeit war so groß, daß er kaum jemals gewahr wurde, was um ihn her vorging. … Ich möchte seine Einsamkeit einem Abgrund vergleichen, in welchem Gefühle, die man ihm entgegenbrachte, lautlos und spurlos untergingen. Um ihn war Kälte.« Dies steht nun auf der Seite fünf eines Romans, der sechshundertachtzig Seiten haben wird. Und noch immer in einem frühen Kapitel – es gibt schon erste Anzeichen, daß Leverkühn, wenn er das auch bestreitet, von der Musik besessen ist – mokiert er sich über die »Stallwärme« in der Musik, worauf Zeitblom sie ein »Gottesgeschenk« nennt und schlichtweg verlangt: »Man soll sie lieben.« Darauf Adrian: »Hältst du die Liebe für den stärksten Affekt?« – »Weißt du einen stärkeren?« – »Ja, das Interesse.« – »Darunter verstehst du wohl eine Liebe, der man die animalische Wärme entzogen hat?« – »Einigen wir uns auf die Bestimmung!«
Nun hat ja Thomas Mann fünf Jahre, ehe er diese Zeilen schrieb, nämlich überraschender- und bezeichnenderweise in seinem Beitrag Bruder Hitler, schon einmal in einem bedeutsamen Sinn von »Interesse« gesprochen. Er fühlt, daß es »nicht seine besten Stunden« sind, in denen er das »arme, wenn auch verhängnisvolle Geschöpf« haßt. Liebe und Haß seien große Affekte. Aber eben als Affekt unterschätze man gewöhnlich jenes Verhalten, in dem »beide sich aufs eigentümlichste vereinen, nämlich das Interesse«. Man unterschätze damit zugleich seine Moralität.
Widerstrebend, doch mit Interesse verfolgte ich die Fäden, die sich in den Texten von Thomas Mann zwischen zwei scheinbar einander ausschließenden Persönlichkeiten ziehen. Nicht einmal das Genie, in seinem Verständnis eine hoch problematische Anlage, will Thomas Mann diesem Hitler, diesem »duckmäuserischen Sadisten«, absprechen: »Wenn Verrücktheit zusammen mit Besonnenheit Genie ist (und das ist eine Definition!), so ist der Mann ein Genie.« Und er ist des Teufels.
Der andere aber, sein äußerster Gegenpart, besessen von seinem Werk, ein einziges Mal in seinem Leben von der Berührung einer Frau, die ihm ins Blut gegangen ist, tief verstört, muß diese Berührung wieder suchen, findet die Frau, Hetera Esmeralda, den durchsichtigen Schmetterling, meidet ihren Körper nicht, vor dem sie ihn warnt, genießt die Lust, die ihn vergiftet.
Das Gespräch mit dem Teufel führt – aber »führt« ist das falsche Wort – Adrian in Italien, 1913, vor dem ersten großen Krieg. Aufgeschrieben hat Thomas Mann es über die Jahreswende 1944/45 in Pacific Palisades, während die Nachrichten aus Deutschland das nahe Ende des Dritten Reiches signalisieren, dem der braven Serenus Zeitblom in der deutschen Kleinstadt Kaisersaschern mit Entsetzen und Trauer entgegensieht. Der Autor beendet die Aufzeichnung dieses Gesprächs im Februar 1945, drei Monate, ehe Deutschland kapituliert – eine unheimliche Parallelität. Im Tagebuch, das neben dem Teufelsgespräch herläuft, notiert er den Einfluß des Tagesgeschehens auf seine Schreibarbeit: »Im Ohr die hysterischen Deklamationen der deutschen Ansager über den ›heiligen Freiheitskampf gegen die seelenlose Masse‹ schrieb ich die Seiten über die Hölle, die wohl die eindringlichste Episode des Kapitels sind«, wobei er für die Hölle das Stichwort »Gestapokeller« im Kopf hat. Und immer dringlicher: »Kriegsmeldungen des Sinnes, daß es mit dem Reich zu Ende geht.« Er kennzeichnet den Abgrund von Schande, in den die Deutschen nun blicken müssen, den Abscheu und das Entsetzen, mit denen die Welt auf Deutschland blickt. Überlegungen zur Zukunft Deutschlands, heftig umstritten in den verschiedenen Emigrantengruppen. Thomas Mann gehört, schwer kritisiert von Brecht, zu denen, die es für unerläßlich halten, Deutschland zu »züchtigen«. »Ist es krankhafte Zerknirschung«, schreibt Zeitblom, »die Frage sich vorzulegen, wie überhaupt noch in Zukunft ›Deutschland‹ in irgendeiner seiner Erscheinungen es sich soll herausnehmen dürfen, in menschlichen Angelegenheiten den Mund aufzutun?« Das Jahr 1945, schreibt Thomas Mann, habe ihm »einen Hagel von Erschütterungen« gebracht. Und später, schon nach der Katastrophe des Adrian Leverkühn, läßt er dessen Biographen schreiben: »Deutschland selbst, das unselige, ist mir fremd, wildfremd geworden« … Thomas Mann ist nicht nach Deutschland zurückgegangen.
Die letzten Seiten des Buches lese ich zu Anfang des Jahres 1993, unter Palmen im warmen Kalifornien. Das wüste Untergangsszenarium, das Serenus Zeitblom nun schildert (das sein Autor nicht gesehen haben kann), hat sich mir eingebrannt, Erinnerungsbilder begleiten die Lektüre. Und, als wäre das nicht genug: Wieder einmal ist ein deutscher Teilstaat, derjenige, in dem ich gelebt habe, dabei, unterzugehen, wenn auch unter nicht vergleichbaren Bedingungen; doch kann ich mich der Frage nicht entziehen, inwiefern und inwieweit dieser frühere Untergang mit dem jetzigen zu tun hat und inwieweit das Trauma jener frühen Jahre das Erleben und Handeln meiner Generation in der späteren Lebenszeit mit geprägt hat.
Ein Erinnerungsstrom überschwemmt mich, eine Art Phantomschmerz breitet sich aus. Abstoßende Meldungen in den Zeitungen, die mich erreichen. Und wieder diese prüfenden Blicke: Die Amerikaner, die ich treffe, stellen mir irgendwann die unvermeidliche Frage: What about Germany? Ja: Was ist los mit Deutschland, wo Asylbewerberheime brennen, ein Präsident bei einer Friedenskundgebung mit Eiern beworfen wird? Ich muß plötzlich für das ganze Land sprechen, in dem ich ja nicht gelebt habe, und ich sehe, daß sie mir nicht glauben, wenn ich sage: Nein. Es ist nicht dasselbe wie damals und wird nie dasselbe werden. Wir werden verhindern, daß Demagogen nennenswerte Unterstützung bei der Mehrheit bekommen. – Aber wer ist »wir«? –
Zeit, von seinem genialen Werk durchglühte, »illuminierte« Zeit verspricht der Teufel dem Adrian Leverkühn, volle vierundzwanzig Jahre. Wenn er nur eine Kleinigkeit beachtet, eine nebensächliche Klausel: »Wenn du nur absagst allen, die da leben.« Leverkühn: »(äußerst kalt angeweht): Wie? Das ist neu. Was will die Klausel sagen?« Der Teufel: »Uns bist du, feine, erschaffene Creatur, versprochen und verlobt. Du darfst nicht lieben. … Liebe ist dir verboten, insofern sie wärmt. Dein Leben soll kalt sein – darum darfst du keinen Menschen lieben.«
Wir wissen es: Leverkühn in seiner Einsamkeit auf dem Hof der Schweigestills ringt sich geniale, neuartige, nur wenigen eingängige Werke ab. Und, soll man sagen: dafür muß er sein Liebstes sterben sehen, den kleinen elfenhaften Schwestersohn Echo. Der Teufel holt ihn, so ist der Vertrag. Dieses Kind hat es wirklich gegeben, Frido, Thomas Manns Enkel, den er zärtlich und innig liebt. Wie er sein Sterben beschreiben konnte, habe ich nie verstanden. »Mit Leide« – nun ja, mit Leide. Einen erschütternderen Beweis für die Wirkungsmacht des Teufelspaktes hätte er nicht finden können, das muß man dem Autor zugestehen. Und doch: Heißt dies nicht, das Werk über das Leben stellen? Es weht mich jedesmal kalt an, wenn ich im Buch an diese Stelle komme, und ich beeile mich, sie zu überschlagen.
Die Zeiten sind härter geworden, seit der andere, Größere, Goethe, den Thomas Mann sein Leben lang schmerzlich verehrt, seinen Faust schuf. Der sollte dem Teufel verfallen sein, wenn er sich »aufs Faulbett« legte, Genüge fände am Augenblick des leeren Genusses. Dieser Faust aber, der am Ende skrupellos Untaten begeht, der sich, in blinder Selbsttäuschung, das Verdienst zuschreibt, einen riesigen Landgewinn für ein »freies Volk auf freiem Grund« geschaffen zu haben, während doch in Wirklichkeit die Lemuren im Hintergrund schon sein Grab schaufeln – dieser Faust kann »gerettet« werden – und zwar, in unserem Zusammenhang ist es wichtig, im Namen der Liebe: Von Liebe singt der Chor der Engel, der »Faustens Unsterbliches entführt«.
Die Zeiten sind schärfer, gnadenloser, hoffnungsloser und liebeleerer geworden. Ein »redlich Hineinpassen« ist der Kunst nicht mehr gegeben. Leverkühn versucht, das Uralte, Archaische, Nichtzivilisierte zu verknüpfen mit der Moderne: zu einem neuen Humanum. Es kann ihm nicht gelingen. »Humanismus, aus dem Barbarei hervorging«, heißt es schon im Zauberberg, und im Faustus: »Daß alles zu schwer geworden ist und Gottes armer Mensch nicht mehr aus und ein weiß in seiner Not, das ist wohl Schuld der Zeit.« Er aber, Leverkühn, hat »den Teufel zu Gast« geladen, das Gift der Hetera Esmeralda kreist in seinem Blut. »Messerschmerzen« hat er zu leiden wie die kleine Seejungfrau des Hans Christian Andersen bei jedem Schritt, wenn sie auf Menschenbeinen läuft, um der Liebe willen, die er nicht erfahren darf.
Was ihm bleibt, ist die Klage. Und die Zurücknahme: »Es soll nicht sein.« »Das Gute und Edle, was man das Menschliche nennt, obwohl es gut ist und edel. … Es wird zurückgenommen. Ich will es zurücknehmen.« – »Was willst du zurücknehmen?« – »Die Neunte Symphonie.« In »Dr. Fausti Weheklag«, diesem »Lied an die Trauer«, ist es zurückgenommen, das Lied an die Freude: »Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund! …« Es gibt sie nicht, diese Seele. Für den Künstler Adrian Leverkühn soll es sie nicht geben: »Da seht ihr, daß ich verdammt bin, und ist kein Erbarmen für mich.«
Manchmal will mir scheinen, das Verdikt: Du sollst nicht lieben! sei nicht über einen einzelnen Menschen, sondern über eine ganze heraufziehende Epoche ausgesprochen, deren Liebesfähigkeit verkümmert, der Liebeserfüllung versagt ist und deren unterdrückte Sehnsucht in Massenexzessen wie der »Love-Parade« zum Ausbruch kommt.
Wie Sie wissen, verläßt Thomas Mann 1952 die USA, voll tiefer Sorge um die Zukunft ihrer Demokratie, die unter den Folgen des kalten Krieges leidet und schwer angeschlagen ist.
Eine erschütternde Eintragung findet sich am 20. Dezember 1952 in seinem Schweizer Tagebuch: »Mein Abnehmen, das Alter, zeigt sich darin, daß die Liebe von mir gewichen scheint und ich seit langem kein Menschenantlitz mehr sah, um das ich trauern könnte.« »And my ending is despair!« Diesen Klageruf des Prospero zitiert er wieder und wieder.
Worum hätten wir tiefer zu trauern als um den Verlust der Liebe? Wo aber Trauer ist, ist Hoffnung. Ich erlaube mir, noch einmal einen Zeitsprung zu machen, zurück diesmal in das Jahr 1914, als der Zauberberg endet, mit dem Beginn des ersten großen Krieges, in den Hans Castorp, »des Lebens treuherziges Sorgenkind«, sofort auf das Übelste hineingerissen wird. Seine »Aussichten sind schlecht«. Sein Autor aber beendet dieses Buch mit einer Frage, die, wie ich glaube, die Zeit, auch unser Atomzeitalter, überdauert: »Wird auch aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen?«
2010
Begegnungen mit Uwe Johnson
Ich stelle mir vor, Uwe Johnson, der Mann, an den wir heute hier erinnern wollen, wäre unter uns. Er säße zum Beispiel, wie es ihm zukäme, in der ersten Reihe unserer Versammlung und wunderte sich, daß jemand und wer in seinem Namen einen Preis bekommen soll. Das wäre doch möglich. Das wäre doch normal, er war ja fünf Jahre jünger als ich, er könnte doch leben. Es müssen besondere Begleitumstände gewesen sein, die ihn mit knapp fünfzig Jahren sterben ließen.
Ich versuche, vorsichtig, einige dieser Umstände anzudeuten, indem ich schildere, wie ich ihn erlebt habe.
Soll ich sein Leben tragisch nennen? Ich halte das Wort zurück. Eine Versuchung, es zu verwenden, geht von dem Land aus, in dem wir uns befinden, in dem manche von uns leben, in dem er nicht bleiben konnte und nach dem er sich immer gesehnt hat. Mecklenburg. Es war Johnsons Land. »Aber wohin ich in Wahrheit gehöre, das ist die dicht umwaldete Seenplatte Mecklenburgs von Plau bis Templin, entlang der Elde und der Havel …« Ich glaube, es gab zu seinen Lebzeiten kaum einen Menschen, der umfassender und genauer über Mecklenburg Bescheid wußte als er. Es gibt ein Verzeichnis der mecklenburgischen Orte, die in seinen Büchern, insbesondere in den Jahrestagen, vorkommen: Es sind über hundert. Sechshundert Bücher über Mecklenburg fanden sich in seiner Bibliothek.
Auf Johnsons letzter Reise durch Mecklenburg, von der noch die Rede sein wird, berührt er auch Neubrandenburg, und natürlich Güstrow – jene Stadt, in der er sieben Jahre gelebt hat, in der er auf die John-Brinckman-Schule gegangen ist, vor der heute seine von Wieland Förster geschaffene Stele steht. Ich war dabei, als sie enthüllt wurde, ich sah sie zuerst von schräg hinten und fand, der Bildhauer hatte die Haltung des Rückens gut getroffen, der sich, etwas gebückt, vom Betrachter wegbewegt. Und ich war mir bewußt, daß dieser Schriftsteller nun – als Denkmal – zurückgekehrt war in jene Stadt, die er, zusammen mit Grevesmühlen, zu seinem fiktiven Ort Gneez verwandelt hat, der für die Personen seiner Jahrestage, in der Mehrzahl Mecklenburger, eine so große Rolle spielt.
Ich streiche auf seiner Mecklenburger Liste die Namen der Orte an, in denen auch ich gewesen bin, ich komme auf knapp dreißig. Wie er sind wir ja im Frühjahr 1945 als Flüchtlinge in dieses Land gekommen, weiter westlich allerdings. Später kam dieser Teil Mecklenburgs mir aus den Augen. Heute biegen wir, aus Berlin kommend, bei der Abfahrt Malchow von der Autobahn ab – ein Ort, in dem Heinrich Cresspahl gelebt hat, den wir aber rechts liegen lassen, um in Richtung Sternberg über Goldberg und Dobbertin zu unserem kleinen Dorf am Rande der Mecklenburgischen Seenplatte zu fahren. Mancherorts hätten wir, Johnson und ich, uns damals begegnen können. Die Zeitverschiebung in unserem Leben hat das verhindert. Sie hat auch verhindert, daß wir in den gleichen Jahren im Hörsaal 40 an der Leipziger Universität die Vorlesungen von Hans Mayer hörten – jenem Professor, der das außergewöhnliche Talent seines Studenten Johnson erkannte und ihn ideell und materiell förderte.
Verfehlt haben wir uns auch, als Johnson im August 1982 zum letzten Mal in Güstrow war, als ein »Mr. Johnson«, Mitglied einer englischen Reisegruppe. Ein, zwei Jahre später begannen wir, nicht mehr als zwanzig Kilometer südlich von Güstrow, unsere Sommer in einem alten mecklenburgischen Pfarrhaus zu verbringen. Wie oft sind wir seitdem in Güstrow gewesen, haben Freunde von der Bahn abgeholt, haben ihnen die Stadt gezeigt, mit ihnen vor den Barlach-Skulpturen gestanden, den Schwebenden Engel im Dom besucht. Wie oft habe ich dabei an Uwe Johnson gedacht. Da war er schon tot. Da war er 1984 in einem entfernten Ort an der englischen Themsemündung gestorben. Sein Herz hatte »versagt«. Es war ihm zuviel zugemutet worden.