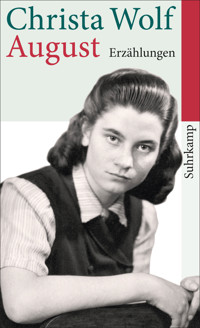11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1973 erklärte Christa Wolf, dass für sie kein grundsätzlicher Unterschied bestehe zwischen ihrer Prosa und ihrer Essayistik, denn deren gemeinsame Wurzel sei »Erfahrung, die zu bewältigen ist: Erfahrung mit dem ›Leben‹, mit mir selbst, mit dem Schreiben, das ein wichtiger Teil meines Lebens ist, mit anderer Literatur und Kunst. Prosa und Essay sind unterschiedliche Instrumente, um unterschiedlichem Material beizukommen«. Das sind auch die Themen ihrer Essays und Reden, die in der chronologischen Reihenfolge ihres Entstehens in dieser Ausgabe versammelt sind. Christa Wolf bezieht als kritische Zeitgenossin Position, setzt sich mit poetologischen Reflexionen über ihr Selbstverständnis als Autorin auseinander und nähert sich über wesentliche Berührungspunkte Gefährt:innen und Kolleg:innen an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Christa Wolf
Sämtliche Essays und Reden
Band 3: 1991-2010 Nachdenken über den blinden Fleck
Herausgegeben von Sonja Hilzinger
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Brief anläßlich der Ausstellung »Zensur in der
DDR
«
Ein Posten ist vakant. Zum Tod von Max Frisch
»Die Wahrheit unserer Zungen«. Zu Grace Paleys Geschichten
Wo ist euer Lächeln geblieben? Brachland Berlin 1990
Ein Brief
Krebs und Gesellschaft
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
Der Gastfreund
Schreibexistenz Friederike Mayröcker
Auf dem Weg nach Tabou. Versuch über Paul Parin
Im Gespräch getroffen. otl aicher
Gesichter der Anna Seghers. Zu einem Bildband
»Frei, geordnet, untröstlich«. Heinrich Böll zum 75. Geburtstag
Eine Auskunft
Rückäußerung. Auf den Brief eines Freundes
Die Zeichen der Nuria Quevedo
Selbstanzeige
Abschied von Phantomen. Zur Sache: Deutschland
Was tut die strenge Feder?
Zur Person: Günter Gaus
»Winterreise«. Wolfgang Heise zum Gedenken
Nirgends sein o Nirgends du mein Land
Einen Verlust benennen
Gang durch Martin Hoffmanns Räume
Gegen die Kälte der Herzen. Charlotte Wolff – »internationale Jüdin mit britischem Paß«
Der Worte Wunden bluten heute nur nach innen
Von Kassandra zu Medea. Impulse und Motive für die Arbeit an zwei mythologischen Gestalten
Mit dem absoluten Sinn für Toleranz. Totenrede für Lew Kopelew
Eine Seite für Günter Grass
»Mitleidend bleibt das ewige Herz doch fest«. Zum 80. Geburtstag von Heinrich Böll
Der geschändete Stein
Dünn ist die Decke der Zivilisation. Musikalische Meditation Joseph Haydn, »Missa in Tempore Belli«
Heroischer Entwurf
Plusquamfutur 2. Erinnerte Zukunft bei Volker Braun
Ein Versuch über Nachbarschaft und Unvereinbarkeit. Anmerkungen zu Elisabeth Langgässer
Zeichen. Dankesworte zur Verleihung des Samuel-Bogumil-Linde-Preises
»… der Worte Adernetz«. Nelly Sachs heute lesen
Gegen das Vergessen arbeiten
Rede, daß wir dich sehen. Versuch zu dem gegebenen Thema: »Reden ist Führung«
Im Widerspruch. Zum hundertsten Geburtstag von Anna Seghers
Ein Ring für Nuria Quevedo
Angela Hampels Gestalten im Spannungsfeld
In memoriam
Am Grab
Ehrenbürger von Leipzig
Mit Realitäten umgehen, auch wenn sie einem nicht gefallen. Egon Bahr zum achtzigsten Geburtstag
»Der ganze menschliche Entwurf«. Inge Müller, Maxie Wander, Brigitte Reimann und Irmtraud Morgner
C Gespräch im Hause Wolf über den in Vers und Prosa G sowohl als auch stückweis anwesenden Volker Braun
Ein Abschied
Kurt Sterns Tagebücher
Vom freien Willen gegen Verführung. Hermann Sinsheimer/»Deutscher und Jude«
An Carlfriedrich Claus erinnern
Ein besonderes, unvergeßliches Licht. Paul Parin zum neunzigsten Geburtstag
Kenntlich werden
Entwürfe in Farbe – Radierungen der Helga Schröder
Zu »Rummelplatz« von Werner Bräunig
Autobiographisch schreiben. Zu Günter Grass' »Beim Häuten der Zwiebel«
Nachdenken über den blinden Fleck
Der Tod als Gegenüber. Zu »Überlebnis« von Ulla Berkéwicz
Köpfe – Ein Gespräch mit Martin Hoffmann
In Zürich und Berlin. Zum fünfundsiebzigsten Geburtstag von Adolf Muschg
Kuckucksrufe. Kleine Rede zu einem günstigen Augenblick
Begegnungen mit Uwe Johnson
Zeitschichten. Zu Thomas Mann
O Dichtung, herrlich, streng und sanft. Begegnungen mit Spanien und seiner Literatur
Zwiegespräch mit Bildern von Ruth Tesmar
Günther Ueckers Bilder aus Asche
Anhang
Nachwort
Editorische Notiz
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Brief anläßlich der Ausstellung »Zensur in der DDR«
Berlin 8. 2. 1991
Lieber Herbert Wiesner,
in einer Ausstellung über die Zensur in der DDR sehe ich eine Gefahr, die sicher auch Ihnen bewußt ist: Die Belegstücke, die man zeigen kann, verdecken womöglich den Vorgang, der in dem Wort »Zensur« steckt. Zensur ist ein kompliziertes, konfliktreiches Handeln zwischen Personen, nicht nur der anonyme Eingriff einer staatlichen Institution in Publikationsmöglichkeiten. Um den interessierten Besucher einer solchen Ausstellung – besonders den, der die Verhältnisse in der DDR nicht kennt – wirklich zu informieren und ihn nicht nur mit spektakulären Einzeldaten zu füttern, müßte man von Fall zu Fall erzählen; dabei müßte man Namen verschiedener Protagonisten nennen, es könnten Entwicklungen einzelner zutage treten. Das ist hier nicht möglich. Ich scheue mich, bestimmte Namen in einen unrühmlichen Zusammenhang zu stellen, der mehr als zwanzig Jahre zurückliegt. Daher will ich versuchen, Methode und Auswirkungen der Zensur an einem meiner Bücher möglichst schematisch zu skizzieren.
Nachdenken über Christa T.
Beendigung des Manuskripts im März 1967
Juni 1967 liegen dem Mitteldeutschen Verlag, Halle, zwei Arbeitsgutachten vor, die nötig waren, um das Druckgenehmigungsverfahren bei der Zensurstelle, der Hauptverwaltung Verlage im Ministerium für Kultur, zu beantragen. Das erste war im ganzen wohlwollend, sah aber doch die »Gefahr einer ideologischen Desorientierung« und schlug Änderungen vor, das zweite warnt vor einer Veröffentlichung dieses Manuskripts: »Die berechtigten Einwände würden sehr leicht zu wenig wünschenswerten Verallgemeinerungen führen, ohne daß man ihnen von gefestigten Positionen aus begegnen könnte. Obwohl die Autorin wahrscheinlich nach dem Scheitern ihres dritten Werkes kaum wieder produktiv sein wird, können wir das Manuskript nicht akzeptieren.«
Der damalige Cheflektor des Mitteldeutschen Verlags übergibt das Manuskript privat dem Leiter des Fachgebiets Deutsche Gegenwartsliteratur und bittet ihn um eine private Stellungnahme. Die lautet: Dieses Manuskript könnte er offiziell nicht befürworten.
Ich verlange ein Gespräch mit ihm. Er legt meinem Mann und mir eine längere Liste von Einwänden gegen das Buch vor, die wir nicht akzeptieren. Nach einer scharfen Auseinandersetzung erklärt er sich bereit, das Manuskript noch einmal zu prüfen.
Ich schreibe noch ein Kapitel – das Kapitel 19 – und füge es dem Manuskript bei. In dieser Form wird es vom Mitteldeutschen Verlag bei der Hauptabteilung Literatur »eingereicht«. Inzwischen schreiben wir das Jahr 1968.
Zwei weitere Gutachten – »Außengutachten« – werden vom Verlag beigegeben: Eines davon schreibt Günter Caspar, der, die ihm bekannten Einwände aufgreifend, den Druck des Manuskripts befürwortet.
Die Druckgenehmigung wird nun erteilt. Für das Frühjahr 1969 ist die Auslieferung der ersten Auflage von 15 000 Exemplaren vorgesehen. Termin soll der 31. März sein.
Im Dezember 68 wird der Fertigungsprozeß des Buches unterbrochen, für drei Wochen. Von Personen aus dem Parteiapparat, die sich Kenntnis von dem Buch verschaffen konnten, wird öffentlich und nichtöffentlich eine Polemik gegen das Buch begonnen, vor Gremien, die es nicht kennen können. In einer Parteigruppensitzung des Vorstands des Schriftstellerverbands, an der ich nicht teilnehmen kann, steht eine Diskussion über das Buch auf der Tagesordnung, das fast niemand dort kennt. Eine Teilauflage des Buches wird trotzdem ausgeliefert.
Am 14. 5. 1969 erscheint im »Neuen Deutschland« ein Artikel vom Leiter des Mitteldeutschen Verlags: »Verleger sein heißt ideologisch kämpfen«, in dem er sich auf Veranlassung übergeordneter Partei- und Ministeriumsstellen von »Nachdenken über Christa T.« distanziert.
Am 23. Mai 1969, wenige Tage vor Beginn des Schriftstellerkongresses in der DDR, erscheint in der »Zeit« eine Rezension des Buches von Marcel Reich-Ranicki unter der Überschrift »Christa Wolfs unruhige Elegie«.
Diese Rezension wird mir in der Kulturabteilung des Zentralkomitees der SED vorgehalten. Der Leiter der Abteilung sieht durch die Rezension seine eigenen scharfen Vorbehalte bestätigt und fordert mich auf, meine Kandidatur für den Vorstand des Schriftstellerverbandes zurückzuziehen. Ich lehne ab und verlange, daß über meine Kandidatur im Vorstand abgestimmt wird. Daraufhin wird die Forderung, zurückzutreten, fallengelassen.
Die weitere Auslieferung des inzwischen gedruckten Buches wird untersagt. – Im Luchterhand Verlag erscheint »Nachdenken über Christa T.« vertrags- und fristgemäß.
Auf dem Schriftstellerkongreß im Mai 1969 werden absurderweise einige hundert Exemplare des Buches verkauft, während ich im Hauptreferat und in einigen Diskussionsbeiträgen scharf kritisiert werde.
Während des Kongresses gibt der Kulturminister dem Leiter des Mitteldeutschen Verlags die Erlaubnis, das Buch nun auszuliefern. In einigen Bezirken wird die Auslieferung restriktiv gehandhabt.
Eine zweite Auflage kann erst 1972 erscheinen. Sie ist auf das Jahr 1968 zurückdatiert.
Da mir der Mitteldeutsche Verlag die Auslandsrechte für »Nachdenken über Christa T.« 1969 zurückgegeben hatte, war es möglich, daß das Buch überhaupt im Ausland erscheinen konnte. Sämtliche Auslandsverträge schloß ich selber ab.
Die Auseinandersetzung mit mir ging noch das ganze Jahr 1969 über weiter, zum Beispiel im Präsidium des Schriftstellerverbandes. Aber auch in anderen Institutionen wurden von Mitarbeitern Stellungnahmen verlangt. Im Germanistischen Institut der Humboldt-Universität Berlin waren zwei Dozentinnen, Dr. Inge Diersen und Sigrid Töpelmann, nicht bereit, ihre eigene positive Einschätzung des Buches aufzugeben. Sie wurden gemaßregelt. Die eine wurde für einige Jahre zur Kulturarbeit an das Kulturhaus Bitterfeld geschickt, die andere verließ die Universität und wurde meine Lektorin im Aufbau-Verlag.
»Nachdenken über Christa T.« durfte in der DDR nur in den beiden Literaturzeitschriften »Sinn und Form« und »Neue Deutsche Literatur« besprochen werden.
Dies ist ein Muster für einen möglichen Verlauf. Ähnlich könnte ich über andere meiner Titel schreiben. Allerdings ist die Zensur in der DDR seit Ende der sechziger Jahre sich selbst nicht immer gleich geblieben, sie war nicht immer gleich streng, borniert und folgenreich für die Autoren, Verlagsmitarbeiter, Kritiker, Germanisten.
»Nachdenken über Christa T.« wurde seit 1972 in der DDR immer wieder aufgelegt und erreichte bis heute eine sehr hohe Auflagenziffer.
Ein Posten ist vakant
Zum Tod von Max Frisch
Mit dieser Nachricht mußten wir rechnen, aber doch, wie immer in solchen Fällen, nicht gerade jetzt. Seit über einem Jahr wußte Max Frisch, und mit ihm wußten es seine Freunde, wie es um ihn stand. Er hat dieses Jahr genutzt, um auf seine Weise Abschied zu nehmen. Er hat manche Begegnung herbeigeführt, manches ausgesprochen, worüber er sonst schwieg. Er hatte eine unvergeßliche Art zu sprechen. Ich blättere in seinen Büchern, den sieben blauen Bänden des Suhrkamp-Verlags. Wieder fällt mir auf, wie häufig seine Prosa-Texte in der Gegenwartsform stehen: Eine Stimme spricht. Ich höre, während ich mich in einem seiner Texte festlese, die Stimme von Max Frisch, als sei der »Herr Geiser«, durch weltuntergangsähnliche Unwetter festgehalten in jenem Tessiner Tal, das Frisch selbst nur zu gut kannte, auch sonst das alter ego seines Autors. Aber so ist es ja nicht. »Der Mensch erscheint im Holozän.« Wie alle seine Figuren, selbst die, die ihm am nächsten, ja: scheinbar mit ihm identisch waren, ist auch diese ihm entfremdet, ferngerückt durch die Schrift, um eine gewisse, manchmal winzige Drehung, die allerdings entscheidend ist, der platten Gleichsetzung entzogen und in jene andere Wirklichkeit der Literatur versetzt.
»Keine Nacht ohne Gewitter und Wolkenbruch« – reihenweise hätten wir im vorigen Mai solche Sätze zitieren können, aber wir haben uns gehütet, nur immer wieder an sie denken müssen, als wir zu dritt eine Gewitternacht im Haus von Max Frisch in Berzona erlebten, eine von jenen, die selbst hier ungewöhnlich sind, wie Frisch halb irritiert, halb anerkennend einräumte. »Was heißt Holozän«, denkt »Herr Geiser« gegen Ende seines Katastrophenberichts. »Die Natur braucht keine Namen. … Die Gesteine brauchen sein Gedächtnis nicht.«
Schreiben bedeutet, Gedächtnis zu bewahren, zu bilden. Auf einmalige Weise umkreist das Werk von Max Frisch den Menschen unserer Zeit, seine Spiel-Arten, seine Möglichkeiten, seine Verstrickungen, sein Versagen. Merkwürdig ist, wie er jene Werte, ohne die er sich Menschlichkeit nicht denken kann, befestigt, indem er zugleich die »Persönlichkeit« in eine Menge austauschbarer Rollen aufzulösen scheint. Noch den feinsten Verästelungen der Heuchelei spürt er nach, jener geläufigen Abspaltung unserer Rede und unserer Handlungen von der Wahrheit, mit deren Hilfe der moderne Mensch sich angewöhnt hat, sein Leben zu fristen.
Max Frisch hat auffallend häufig über den Tod nachgedacht und geschrieben. Auch auffallend früh, und sehr persönlich. Es kann nicht ausbleiben, daß manches gerade aus diesen Äußerungen heute wie eine Vorausschau auf seinen eigenen Tod erscheinen muß. Man lese in diesen Tagen die Rede nach, die er 1984 an »junge Ärztinnen und Ärzte« richtete: »Vom Tod war hier die Rede, weil nur aus unserem Todesbewußtsein sich das Leben als Wunder offenbart. Ich brauche kein anderes Wunder.«
Man wird Sätze, ganze Passagen aus seinen Arbeiten zitieren. Aber ein Schriftsteller wie Max Frisch, der keine Sprüche machte, hinterläßt als Vermächtnis eben die Gesamtgestalt seines mehrtausendseitigen Werkes, dessen lebendige Widersprüchlichkeit, wenn wir uns auf sie einlassen, uns tiefer und nachhaltiger betrifft, als jedes einzelne Zitat es könnte.
Der Zufall will es – aber hat Max Frisch an den »Zufall« geglaubt?, daß zwei eminent politische Texte nun seine letzten sind: Das Palaver zwischen einem Großvater und seinem Enkelsohn über die Frage, ob die Schweiz eine Armee brauche. Mit Stolz sprach er mit mir über die Aufführung dieses seines letzten Stückes im Zürcher Schauspielhaus. Und die Rede aus Anlaß der Goethe-Preisverleihung 1989 in Frankfurt am Main, in der er sich auch der deutschen Problematik annimmt, wie immer als kritischer, verläßlicher Freund.
Wer soll, wer könnte diese Stelle einnehmen? In dem Netz europäischer Gesittung ist ein wichtiger Verknüpfungspunkt ausgefallen. Ein Mensch, auf den auch ich gewöhnt war zu blicken, mich zu beziehen, lebt nicht mehr. Ein Posten ist vakant.
April 1991
»Die Wahrheit unserer Zungen«
Zu Grace Paleys Geschichten
»Ich weiß nicht. Früher wußte ich's«, sagt Grace Paley, befragt nach dem »zentralen Anliegen« ihrer Erzählungen. Koketterie? Kaum ein unpassenderes Wort könnte es geben, auf sie bezogen – wenn ich schon über sie und ihre Geschichten reden soll, anstatt ihr einfach einen Gruß von Mecklenburg nach Vermont zu schicken, wo sie jetzt im Sommer lebt. Hallo, Grace, jetzt soll ich also Lesern und Leserinnen, die dich noch nicht kennen, deine Geschichten nahebringen. Ich sehe, sie glaubt nicht an »Nahebringen«, sie zuckt die Achseln und schweigt. Unnachahmliche, nicht nacherzählbare Geschichten, sage ich, aber wenn Grace irgend etwas über sie weiß, so ist es ja das. Ihr Vater schon hat es ihr unter die Nase gerieben: »Wie ich sehe, bist du nicht imstande, einfache Geschichten zu erzählen. Also, verschwende keine Zeit darauf.« Scharfsinnig und zugleich resigniert, dieser Vater, während die Tochter geduldig und ein kleines bißchen hinterhältig ist, alles zuzugeben scheint, gerade indem sie ihm einzureden sucht, jene unglückliche Frau und Mutter, über deren himmelschreiend ungerechtes Schicksal er sich derartig aufregt (»ich kenne sie und habe sie erfunden«), könne sich letzten Endes doch ändern und damit ihrem Leben eine andere Wendung geben. Anderswo aber bekennt sie, ohne sich um auftretende Widersprüche zu kümmern: »Möglicherweise schulde ich meiner eigenen Familie und den Familien meiner Freunde etwas. Nämlich, ihre Geschichten so einfach wie möglich zu erzählen, um, wie man es ausdrücken könnte, wenigstens ein paar Leben zu retten.« Dies meint sie nicht nur metaphorisch, glaube ich, sondern auch ganz wörtlich. Sie denkt nicht sehr optimistisch über die Zukunft unserer Erde. »Natürlich bin ich wegen dieses Planeten, der in giftigem Ekel von uns abfällt, kaum je zu Hause.« Was, zum Teil, meint sie, erklärt, warum sie nur kurze und, wie sie denkt, zu wenige Geschichten geschrieben hat, und keine Romane. Statt dessen dieses eigentümliche Gewebe von Erzähltem, von Stimmen, Berichten, Beobachtungen, die im Grunde alle miteinander zusammenhängen.
Da ich deutlich spüre, man kann ihr nicht beikommen, greife ich doch immer wieder nach ihrem Buch, komme ins Blättern, lese mich fest, gerate in den gleichen Sog. Ihre Wörter und Sätze erzeugen eine andere Art von Bewunderung und Begeisterung in mir als jede andere Prosa, und zugleich spüre ich diesen Stachel: Wie macht sie das! »Die Form ist eine Sache der Gnade« – eine ihrer bündigen Behauptungen. Gut, gut. Aber trotzdem: Etwas muß doch herauszufinden sein. Ich schrecke nicht mehr davor zurück, mit einem Stift an die Texte heranzugehen. Die Ausbeute ist mager, wie erwartet. Was habe ich letzten Endes vermerkt? In der ersten Geschichte, »Adieu und viel Glück«, steht ein einziges Wort am Rand: »Dialoge!« Ein fast ärgerlicher Anerkennungsruf. Gemeint ist folgendes: Der Schauspieler Vlashkin sagt zu Rosie, die immerhin ein Leben lang mehr oder weniger seine Geliebte ist: »Du verlierst deine Zeit. Verstehst du das? Eine Frau sollte ihre Zeit nicht verlieren.« Darauf Rosie: »Oi, Vlashkin, wenn du mein Freund bist, was heißt dann Zeit?«
Wie wahr, und was heißt schließlich das germanistisch-buchhalterische »Dialoge«? »Geht es dir gut? Wirklich, Rose? Du bist gesund? Du arbeitest?« – »Meine Gesundheit ist erstklassig, für das Gewicht, das sie tragen muß.« Aber so reden die Leute, sagt Grace Paley. »Sie sollten mal hören, wie die Menschen hier sprechen. Ich bin tief erstaunt.«
New York also, Lower-East-Side-Kultur, das einmalige Gemisch der verschiedenen Einwanderersprachen im Schmelztiegel des Amerikanischen. Grace Paleys Eltern, jüdische Immigranten, sprachen zu Hause russisch, sie selbst lebte mit ihren kleinen Kindern in einem Viertel mit jüdischen Familien verschiedener Herkunft, mit Puertoricanern, Polen. Sie, »ganz aus Ohren bestehend«, hat jede denkbare Gelegenheit, die Leute reden zu hören, im Park mit den anderen Müttern, im Supermarkt, zu Hause mit den Nachbarinnen, bei Demonstrationen und Sit-ins, beim Flugblattverteilen, in Cafés und den billigeren Restaurants. Und sie hört, hört, hört. Die Sprache des Ortes. Die »Wahrheit unserer Zungen«. Wie sprühend, phantasievoll, aggressiv, irrational, unlogisch und treffend sie sich die Meinung sagen. Grace Paley schafft ganze surrealistische Porträts nur aus Sprache. Sie weiß, wovon sie redet. Einmal ist sie mit mir durch Straßen gegangen, die an ihr unmittelbares Wohnviertel angrenzten – die Amerikaner sagen »neighbourhood« –, Straßen mit verwahrlosten Häusern, mit arbeitslosen, den Drogen und der Kriminalität preisgegebenen jungen Leuten, von denen manche auf Grace zukamen, sie zu begrüßen, ihr von sich zu erzählen. Sie kannte sie; sie und ihr Mann kümmerten sich um sie.
Zurück zu den Texten. Mir scheint, diese Geschichten, die ja sehr oft Kompositionen für eine Stimme sind, brauchen keinen anderen Kommentar als den entzückten Seufzer: So sind die Menschen. Und ist vielleicht alles, was diese menschenfreundliche Erzählerin schafft, daß wir am Ende von 487 Seiten diesen Seufzer verwandeln in: So sind wir Menschen? Und wäre das nicht viel? Mehr, als die meisten Erzähler erreichen, die sich so viel mehr vornehmen? Sie aber will ja nichts anderes als »wissen, wie Menschen in eben diesem Augenblick in Zeit und Geschichte leben«. Ich sage ja nicht, dies sei ein bescheidenes Programm für eine Schreiberin, aber jedenfalls ist es eines, das sie freihält von Absichten, die nicht aufs Papier gehören; das ihr die Möglichkeit gibt, zu warten, manchmal jahrelang zu warten, bis ein Material reif ist, um es aufzuschreiben. »In mir geht es lange, bis ich, was ich weiß, niederschreibe.«
Soviel ich sehe, kümmert sie sich nicht um irgendeinen Begriff von Kunst, ob »hoch« oder »nieder«. Sie weiß, »die wirklichen Experimente geschehen im Inhalt«. Das ist wahr, seit es Kunst gibt, nur wird es immer einmal wieder vergessen. »Eigentlich ist das eine klassenspezifische Überlegung«, fügt sie nachdenklich hinzu; so ist es wohl, jedoch auch das wird bestritten werden, wenn man leugnen möchte, daß es Klassen gibt. Zugleich aber mit diesem inhaltlichen Experiment, ganz und gar mit ihm verschmolzen, bereitet Grace Paley ihren Stoffen eine auffallend weibliche Form: »Dann plötzlich merkt man, daß man eine Art Behälter geflochten oder erschaffen hat, in den die Geschichte zu liegen kommt, oder eine Tasse, einen Teller, einen Bottich … oder die Wanne.« Wer sähe da nicht Frauen bei uralten weiblichen Tätigkeiten vor sich, beim Korbflechten, Töpfern, beim Herstellen von Fasern. Sie bittet ihre Geschichten, fürsorglich, behutsam, um sie nur ja nicht zu verletzen. Die Form als Geschenk. Ein Geschenk allerdings, das nicht von außen komme; für das man hart arbeiten müsse.
Während ich dies schreibe, rumort in mir ein Satz von Virginia Woolf, den ich kürzlich las, nicht ohne Widerstreben, so sehr ich sonst geneigt bin, ihren Sätzen mein Vertrauen zu schenken: »Und wenn man sein (des Schriftstellers) Geschlecht gänzlich vergessen kann, wird er sagen, um so besser; ein Schriftsteller hat keins.« Gewiß, kein Satz in der Ich-Form, sondern mit einem »Er«, das den »Kunden, den wir brauchen«, meint; doch kann ich mir nicht verhehlen, daß sie die Ansichten dieses idealen Bücherkunden, den ja auch wir uns heute gerne wieder erschaffen würden, weitgehend teilt. Nicht so Grace Paley. Fraglos ist sie ein »Schriftsteller« – beinahe durch Zufall, meint sie; leicht hätte sie eine unpublizierte Schreiberin bleiben können –, aber sie hat ein Geschlecht und verleugnet es nicht. Man konnte sogar sagen, es sei die Quelle ihrer Inspiration, was ja nicht heißen würde: die Summe aller positiven Antriebe; auch die aus vielen einzelnen schmerzhaften Posten bestehende Summe allen Kummers, aller Ängste, aller Verletzungen, aller absichtlich zugefügten Beleidigungen, aller Verkennung, Nichtbeachtung und Mißdeutung, denen eine Frau heute ausgesetzt ist; aber auch die Summe aus allen eigenen Versäumnissen, Irrtümern und Verschuldungen, zu denen wiederum besonders Frauen so häufig und tiefgreifend Gelegenheit gegeben wird, in diesen Gesellschaften, die sie zwingen, in kinderfeindlicher Umwelt Kinder aufzuziehen und ihnen vieles schuldig zu bleiben, wofür ihnen dann diverse Institutionen der gleichen Gesellschaft gehörige Schuldgefühle beizubringen wissen. Kein Wunder, daß eine ganze Reihe von Schreiberinnen auf Kinder verzichtet, sogar, wie Simone de Beauvoir, eine Theorie daraus macht: Nur ohne Kinder könne eine Frau sich ihre geistige Unabhängigkeit bewahren. Dagegen Grace Paley: »Ich könnte nicht schreiben, ohne zu leben, aber ich könnte auch ohne meine Kinder nicht leben.«
Eine Frau mit kleinen Kindern wird auf andere Art schreiben müssen als ein Mann oder als eine Frau ohne Kinder. Ihre Zeit wird zerhackt sein, ihre Konzentrationsfähigkeit, derer sie sich früher, vor den Kindern, sicher gewesen sein mag, wird zerfasern, vielleicht niemals wiederkehren. Sie wird sich daran gewöhnen müssen, die Intensität und Zeit, die sie an das Schreiben wendet, als von ihren Kindern abgezogene Intensität und Zeit zu begreifen, und die andauernde Versuchung, aufzugeben, abwehren, das andauernde Schuldgefühl aushalten müssen. Sie wird erfahren, wie schwer es einer Frau wird, sich selbst Gerechtigkeit angedeihen zu lassen – denn das ist Schreiben ja auch. »Wer könnte sich denn für den Dreck interessieren? Ich interessierte mich sehr dafür, aber ich hatte nicht genug soziales Ego, um es niederzuschreiben. Ich mußte es entwickeln bis zum Punkt, wo ich sagte: ›egal‹.« Egal, was andere, egal, was die Medien sagen mögen, denen der Hohn über »Selbstmitleid« bei Frauen locker sitzt. Da können sie nun bei Grace Paley nicht fündig werden. »Hart und fröhlich, wie ich immer gewesen bin«, sagt sie, genau die Mischung, die ihre Prosa explosiv macht. Keine Larmoyanz, keine Beschwichtigung, nicht die Spur von Selbstmitleid, eher Schonungslosigkeit, auch gegen sich selbst. Vitalität und vor allem: Humor als eine einmalige Legierung von Lebensfreude und Hoffnungslosigkeit. »Leben ist tragisch. Die Welt könnte am Ende sein«, das entbindet sie doch nicht von ihren Versuchen, zu verstehen.
Bei ihr kann man sehen, was Kinder für eine Schreiberin sein können: innigste Verbindung mit dem lebendigsten Kern des Lebens. Eine Fülle unerfindbarer Einzelheiten, die ihr aus dem Zusammenleben mit Kindern zufließen, das niemals zum bloßen Beobachten entarten kann. Eine Quelle für Unmittelbarkeit, Sprachwitz, Originalität, für Zartheit und Zärtlichkeit, die sehr wohl ästhetische Kategorien sein können, wenn man die denn unbedingt brauchen sollte. Mitgefühl, ja, auch das. Ich kenne nichts, was einen Menschen tiefer und dauerhafter sensibilisieren kann als der Umgang mit Kindern. Sensibilisieren im weitesten Sinn, denn Kinder, besonders die eigenen, zwingen eine Frau ja, den Zustand der Welt persönlich zu nehmen. »Ich hatte meinen Kindern versprochen, den Krieg zu beenden, bevor sie erwachsen wurden.« Seit dem Vietnam-Krieg geht Grace Paley protestierend auf die Straße.
Frauen, Freundinnen, Familie – ihre beliebtesten Themen, sie wird nicht fertig damit. Das »dunkle Leben von Frauen« habe sie »am Anfang zum Schreiben gebracht«. Frauen erscheinen ihr bemerkenswert: Wie stark sie sind. Es schwer zu haben heiße doch nicht, Opfer zu sein. Sie forciert nichts. Sie erlaubt es ihren Figuren nicht, sich umzubringen. Schriftsteller, die das zulassen, sagt sie, und meint ausdrücklich auch Tolstoi und den Tod der Anna Karenina, hätten »keine richtige Ahnung davon, ein wie entsetzliches Leben Menschen ertragen können«. In den Familien der Frauen, fast alle ohne Männer, Freundinnen seit ihrer Jugend, Spielplatzmütter wie sie selbst, findet sie genau das heillose Durcheinander, das dem Chaos in jeder normalen Familie aufs Haar gleicht, das also, wenn auch die äußeren Umstände stark voneinander abweichen mögen, ein jeder wiedererkennen müßte, der nicht mit Illusionen durch sein eigenes Familienleben läuft. Wenn auch eine Familie, in deren Zentrum eine Frau namens Faith wirtschaftet, kocht, sich abplagt, sich mit den Kindern streitet, »mit einer Hand hinter dem Rücken Maschine schreibt«, lange Diskussionen mit ihren Freundinnen über das Leben führt, ihre Ex-Ehemänner und ihre Liebhaber in spe abfertigt, an ihren Eltern im Altersheim verzweifelt und sich mit unstillbarem Hunger ihr Stück aus dem großen Kuchen Leben herausreißt – wenn auch eine solche Familie ihre eigene Art von Verrücktheit hat; ein Binnenklima, das dem Angehörigen eines anderen Clans als überhitzt, unzuträglich, aufreibend erscheinen muß.
Faith ist eine herrliche Erfindung, der Klang ihres Namens erinnert an »Grace«. »Faith«: »Treue«, »Vertrauen«. Eine Projektion ihrer selbst an den Horizont der Literatur, der solche Projektionen zugleich schärft und vergrößert. Faith selbst ist eine Figur, die wie ein Verstärker wirkt auf alles, was durch sie hindurchgeht: Schicksalsschläge, Ungerechtigkeiten, Alltagsunbill, Liebe und Liebesenttäuschung, innige Frauenfreundschaften; alltägliche Grobheiten, Gemeinheiten, Unbedachtheiten, denen eine Frau ausgeliefert ist; der häufige Mangel; all die Widerfahrungen, die sie ohne Ironie und Selbstironie kaum bestehen könnte.
Grace »ist« nicht Faith. Mal ist sie es mehr, mal weniger. Am nächsten kommt sie ihr in den Texten aus dem Friedenskalender auf das Jahr 1989, »Midrash und Glücklichsein«, »Conversation ii«, da spricht Faith mit Grace' Mund. Sie spielt mit der Figur, die zugleich scharf konturiert und etwas wie ein Medium für sie ist. »Faith ist tatsächlich Amerikanerin«, sagt sie, »und wie jede ist sie zur aufrichtigen Annahme ihres Glücks erzogen worden. … Faith erlaubt mir, für meine Leute zu sprechen, das heißt, für meine Freundinnen. … Mein Leben und das ihre sind austauschbar.« Was wie hochgradige Bescheidenheit, ja Selbstverleugnung klingen mag angesichts eines Kunstbetriebs, in dem fast jeder sich aufzustylen, zu profilieren und von fast jedem anderen abzusetzen sucht, das mag einfach Realitätssinn sein. Grace Paley fühlt sich nicht erschreckt oder beleidigt von der Vorstellung, ihr einzelnes Leben sei Teil einer gemeinschaftlichen Biographie, ganz besonders einer gemeinschaftlichen Biographie von Frauen. Interessant ist ihr das Gleiten von echten Erinnerungen zu erfundenen Figuren, das Sich-Herausbilden prägnanter individueller Gestalten aus dem unerschöpflichen Reservoir einer vielgestaltigen Gruppe. Es ist offensichtlich, daß Grace Paley diese Gruppe – »meine Leute« – braucht, nicht etwa als Stofflieferant, sondern zum Leben und Überleben. Ellen, eine ihrer Freundinnen, ruft »zwei Wochen vor Weihnachten« bei ihr an: »Faith, ich sterbe.« Faith selber denkt, daß sie sterben muß. »Was verlieren wir schon groß? Noch ein paar Jahre leben. Zugucken, wie die Kinder und der ganze Scheißkram und jedes Käseloch in dieser Welt draufgeht in Hitze, Druckwelle, Feuersturm …« Darauf sagt Ellen: »Ich will das alles sehen.« Zur Essenz des Glückes gehört für Grace Paley die intime Freundschaft mit Frauen.
Ein zentrales Motto. Im »Ertrinken« noch »sieht« sie: »Ich würde hinaufschauen zum Himmel.« Ihre Gedichte, die hier zum erstenmal in deutsch erscheinen (kongenial übertragen von ihrer Freundin Marianne Frisch), sind Stenogramme, mit aufgerissenen Augen notiert. Berichte über politische Aktionen aus dem »Peace Calendar 1989« geraten ihr zu Teilstücken der menschlichen Tragikomödie, an der sie teilhat.
Sie ist unbestechlich. Scheinbar mühelos durchstößt sie die Konvention, ignoriert das Urteil der »Welt«. Ihre Menschlichkeit ist das Maß für die Beziehungen der Gestalten, die so amoralisch sein können, wie sie wollen (und müssen), ohne je aus diesem Maß herauszufallen. Dieser Hintergrund von Werten (ohne den jede Menschenansammlung ein marodierender Haufen wäre), der in mancher Hinsicht unerhört dauerhaft, in anderer wechselhaft erscheint, wird durch das, was sie alle zusammen tun oder lassen, durch ihr Gerede, durch die Geschichten, die Grace Paley über sie schreibt, befestigt und verändert, jedenfalls aufgefrischt. »Ich will Ihnen sagen, was los ist: das Leben. Sie haben eine Meinung. Ich habe eine Meinung. Das Leben, das hat keine Meinung.«
Wo ist euer Lächeln geblieben?
Brachland Berlin 1990
Der Wahnsinn kann auch von außen kommen, auf die einzelnen zu, ist also schon viel früher von dem Innen der einzelnen nach außen gegangen …
ingeborg bachmann,
Ein Ort für Zufälle
Lieber Dieter Bachmann, ist Berlin »Brachland«? Die Frage steckt mir im Kopf, seit Sie mir – das ist mehr als eine Woche her und war nach der Trauerfeier für Max Frisch – den Titel Ihres nächsten Heftes genannt und mich moralisch unter Druck gesetzt haben, einen Beitrag dafür zu liefern. Nun ist es eine Binsenweisheit, daß man um so schwerer über einen Gegenstand schreiben kann, je näher er einem ist; aber, so dachte ich leichtsinnig am nächsten Vormittag, vielleicht ist es nun an der Zeit, auszuprobieren, wie weit ich dieses vermaledeite Berlin schreibend schon von mir wegrücken kann, und es kam mir gar nicht so schwierig vor, während wir bei heller Sonne durch Zürich gingen, durch die schmalen Gassen der Altstadt, über die Limmat, die Bahnhofstraße entlangschlenderten, am Ufer des Zürcher Sees saßen, der wahrhaftig »blinkte«, und, fast schon klischeehaft, in der »Kronenhalle« zu Mittag aßen, gegrillten Lachs. Ach, wie mir diese schöne saubere reiche Stadt auf einmal gefiel, so sehr, daß ich außer einer unbestimmten Sehnsucht eine Art Neid in mir wahrnahm, Neid auf eine jedenfalls äußerlich heile Welt, Neid vielleicht auch auf jene Glücklichen, die von Geburt und Schicksal dazu bestimmt sind und denen es auch gelingt, auf Dauer unangefochten in ihr zu leben und sie in vollen Zügen zu genießen. Ich aber weiß, daß ich für beides verdorben bin. Denn wo ich auch sein mag – es dauert nicht lange, dann spüre ich, wie meine innere Kompaßnadel anfängt, sich zu rühren, sich immer energischer nach ihrem Magnetpol auszurichten, bis am Ende die nachzitternde Spitze der Nadel nach Berlin zeigt. Etwas in mir zieht sich schmerz- und lustvoll zusammen, wenn, am Abend unseres Zürcher Tages, die Maschine der Swissair zur Landung ansetzt, die westlichen Vororte Berlins auftauchen und dann – flach, sehr flach – die ganze Stadt überschaubar unter mir liegt, von Tegel bis zum Fernsehturm am Alexanderplatz. Dieses kaputte Berlin, nach dem ich süchtig bin, das merke ich eben, während ich diese Sätze schreibe – im tiefsten Mecklenburg übrigens, in der Naturstille der Entziehungsstation. Denn in Berlin zu arbeiten ist fast unmöglich geworden. Es zerfetzt einen.
Wenn ich Sie recht verstanden habe, legen Sie Wert auf Lokalkolorit und Momentaufnahmen. Nun, der Taxifahrer, der uns nach Hause fuhr, kam aus dem Osten und war sehr gesprächig, auch aus Freude darüber, daß er wider Erwarten Fahrgäste gefunden hatte. Ein seltener Fall, sagte er; die kurze Erholungspause für sein Gewerbe nach dem Totaleinbruch durch die Währungsunion voriges Jahr sei vorbei. Haben Sie die neuen Arbeitslosenzahlen gehört? Na, dann wissen Sie ja, warum bei uns keiner Taxi fährt. Auch nicht am Wochenende, bei Nacht, wo früher Hochkonjunktur war. Wie abgeschnitten, sage ich Ihnen. Und die Straßen leer. Kein Mensch geht mehr in die Kneipen … Wem wir jetzt gehören? VEBTaxi ist lange perdu, uns hat ein Taxiunternehmer von drüben gekauft, mit Mann und Maus, aber ohne Wagen: Da hat er uns neue geliefert, in unsere Wartburgs und Ladas stieg ja kein Kunde mehr ein. Aber sonst … Das erste war: Alle Vergünstigungen gestrichen. Natürlich keine Kantinenverpflegung mehr – war ja spottbillig, früher –, auch nachts kein belegtes Brot mehr, oder einen Kaffee, wenn man todmüde auf den Hof kommt. Dafür wird knallhart gerechnet. Wenn's einen Monat mal nicht so spurt, wirst du vermahnt, wenn's dann im zweiten nicht besser wird, kannst du gehn. Ein einziger Streß, das Ganze, und die Solidarität unter den Kollegen geht langsam, aber sicher den Bach runter, und das alles für tausend Mark im Monat. – Meine Frau? Nee, die ist arbeitslos. Das Lokal, in dem sie Serviererin war, hat zugemacht. Jetzt läuft sie sich die Hacken ab. Im Westen gucken die sie bloß an: Wie alt sind Sie? Sechsundvierzig? Bedaure. Sie ist sogar auf Annonce zu einer Schokoladenfabrik hin, aber da waren Himmel und Menschen, die konnten sich ja die zehn Jüngsten aussuchen. Da hatte sie gar keine Chance.
Das waren wir ja alles nicht gewöhnt.
Warum ich nicht mehr im Westen fahre? Hab' ich auch erst gedacht, wo wir doch nun endlich eins sein sollen. Aber ich bin da eigen: Ich lass' mir nicht gerne dumm kommen. Da gibt es Fahrgäste, die rasten gleich aus, wenn man nicht weiß, wo eine Straße ist, aber wie soll ich den Stadtplan von West-Berlin schon im Kopf haben? Und die Kollegen – für die sind wir doch nur Konkurrenz. Neulich hab' ich mal einen nach dem Weg gefragt, sagt der doch glatt: Hast du keinen Stadtplan? Na danke schön, Kollege, hab' ich ihm geantwortet. Vielleicht kann ich dir auch mal im Osten behilflich sein.
Nee, das läuft nicht gut, das läuft ganz und gar nicht gut. Wir sind doch für die bloß die Doofen. Oder sehen Sie das anders?
»Brachland Berlin?« Brachland im Wortsinn ist ja in dieser dichtbesiedelten »Stadtlandschaft« (was für ein Euphemismus!) nur der breite Nord-Süd-Streifen, einst (»einst?« Vor anderthalb Jahren!) mit den Grenzanlagen besetzt, deren symbolträchtiges Kernstück die Mauer war; ihr Umland, unbetretbar für normale Sterbliche, entwickelte sich zu einem Biotop, das nach Plänen von Umwelt- und Künstlergruppen mitten in der täglich vom Verkehrsinfarkt heimgesuchten Großstadt zu einer Parklandschaft werden könnte, »ein Band, das sich als ein üppiges, wachbleibendes Grün durch die Stadt zieht. Ein Band gegen Erfolgsjagd, Statussymbol, Profit, Karriere und Konsum.« Da sehen Sie es, was für wirklichkeitsfremde Träume hier und da in dieser Stadt immer noch ausgebrütet werden. »Es scheint«, schreibt ein Kollege dazu in einer der neu gegründeten und noch nicht wieder eingegangenen (Ost-)Berliner Zeitschriften, »als wäre Berlins weltstädtischer Anspruch zu hoch, um sich einen breiten wilden Grünstreifen ohne kommerzielles Fieber quer durch die Stadt leisten zu können. Wer die hier brachliegenden Kapitalanlagemöglichkeiten ignoriert, wird zwar geachtet: als Exot.«
WO IST EUER LÄCHELN GEBLIEBEN? hat vor gut einem Jahr einer der damals noch zahlreichen Vertreter der Volkspoesie an eine zentral gelegene Hauswand in Pankow gesprüht. Die Leute, die gerade hier aus der von Stadtmitte kommenden Straßenbahnlinie 46 steigen, mit ihren seit langem wieder verschlossenen Gesichtern, müssen unwillkürlich lächeln, wenn sie die Inschrift lesen. Aber es ist kein Originallächeln. Es ist ein etwas mattes Erinnerungslächeln, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja aber, wenden Sie mit Recht ein, ist vielleicht Lächeln irgendwo auf der Welt ein Normalzustand, den man einfordern könnte?
Nicht doch. Alles, was ich behaupte, ist: Hier, in dieser Stadt, die in der uns überschaubaren Geschichte nicht allzuviel zu lachen hatte, wurde einige Wochen lang auf den Straßen und Plätzen, in den Schuhgeschäften und Verkehrsmitteln, in den Parks und sogar auf Krankenstationen gelächelt. Die zumeist jungen Leute, die mit ihren Kerzen um die Gethsemanekirche herumstanden und -saßen, hatten im September 89 damit angefangen. Lächeln und skandieren: Keine Gewalt! Das stört eine jede Staatsmacht, die verlangen kann, daß diejenigen, die ihr Widerstand leisten wollen, das wenigstens ernsthaft und gewalttätig tun: Darauf ist der Staat eingerichtet, in diesem günstigen Fall passen die Formen des Widerstands in die Formen seiner Bekämpfung. Aber ein Staat, der Tausende martialisch ausgerüsteter Sicherheitskräfte, der Wasserwerfer und schwere Technik gegen ein paar hundert kerzentragende Keine-Gewalt-Rufer einsetzt, der macht sich schon ein bißchen lächerlich. Zwar hören die auf zu lächeln, die eine Nacht lang in einer Garage an der Wand stehen müssen oder auf einem Polizeirevier zusammengeschlagen werden, aber es gibt, wenn auch sehr selten, historische Momente, in denen höchst unwahrscheinliche Komponenten derart zusammentreffen, daß auch den Befehlshabern und Ausführenden solcher Exzesse später das Lachen vergeht. Ich habe sie alle dasitzen sehen, im Großen Sitzungssaal des Roten Rathauses, Generale und Oberste und Majore und Hauptleute, wie sie der Untersuchungskommission, der ich angehörte, Rede und Antwort standen, nicht viel begriffen und oft die Unwahrheit sagten, aber gelacht hat keiner. Auch wir haben allerdings nicht lachen können, doch gab es das aufmunternde Lächeln über den Tisch, das freundschaftliche Lächeln in einer Pause in der Kantine, es gab auch das Lächeln der Angestellten des Magistrats auf den Gängen des Rathauses: Laßt euch nicht entmutigen, macht nur weiter. (Neulich aber, das muß ich doch als Fortschritt hier wenigstens am Rande vermelden, vor wenigen Tagen, da saßen sie ganz dicht beieinander vor der Fernsehkamera, vier ehemalige Stasigenerale, sie kamen direkt in unser Wohnzimmer, sie trugen gut sitzende Zivilanzüge und wirkten kaum verkleidet, sie hatten passende Krawatten um, sie waren konziliant und auf ihre Weise verschmitzt, und sie boten unverhohlen ihre Mitarbeit an, ganz besonders ihr Schweigen über gewisse heute vielleicht peinliche Vorfälle, will sagen Verflechtungen auf der Ebene der Geheimdienste, aber derart undelikate Worte gebrauchten sie natürlich nicht: ihr kooperatives Schweigen also gegen eine Amnestie und pflegliche Behandlung ihrer ehemaligen Mitarbeiter, mit deren wachsender Unruhe sie zugleich ein ganz kleines bißchen drohen konnten, und sie beteuerten, daß ihnen nichts so sehr am Herzen liege, wie Schaden von »unserem Staat« abzuwenden, und befragt, welchen Staat sie denn um Himmels willen meinten, sagten sie unisono: die Bundesrepublik Deutschland selbstverständlich, mit der sie sich voll und ganz identifizierten.)
O ja: die haben ein gut Teil dazu beigetragen, uns das Lächeln aus dem Gesicht zu nehmen. Darauf komme ich noch. Vorher erlauben Sie mir aber, noch einmal auf dieses Lächeln zurückzukommen, vielleicht ist es ja ein Tick von mir, aber ich denke, gerade weil es so zerbrechlich und flüchtig war, ist es wert, beschrieben zu werden. Wie sollten wir, die wir es gesehen haben, das keineswegs arglose, durchaus wachsame, selbstbewußte, entwaffnende Lächeln jener freiwilligen Ordner vergessen, die am Morgen des 4. November 1989 rund um den Alexanderplatz zugange waren, mit ihren auffallenden orangefarbenen Schärpen, auf denen wiederum stand: KEINE GEWALT, während der endlose Demonstrationszug sich in Bewegung setzte – lächelnd! ich schwöre es! – und die gutgelaunten Massen sich auf dem Alexanderplatz zu sammeln begannen. Ganz zwanglos fiel einem da das kleine Wörtchen »souverän« ein, eines der fremdesten Fremdwörter in unserem lieben Deutsch. Das Volk als Souverän. FREIHEIT, GLEICHHEIT, BRÜDERLICHKEIT. Mein Gott, werden vielleicht nicht Sie sagen, haben aber viele Ihrer Journalistenkollegen im Laufe der nächsten Monate gesagt. Welche Naivität! Welche Realitätsverkennung!
Gewiß. Die Transparente und Plakate dieser Leute, die sich da wenigstens diesen einen Tag lang als Sieger fühlten – ihr Lächeln war auch ein ungläubiges, ungeübtes Siegeslächeln –, verstauben inzwischen in einem Raum des ehemaligen Zeughauses, verriegelt und verrammelt, und als genau ein Jahr später ein viel kleinerer, wenn auch immer noch beachtlicher Teil von ihnen sich wieder auf dem Alex versammelte, da hatten sie begriffen, daß sie die Verlierer waren, und auf einem ihrer Transparente mit den Losungen der Französischen Revolution war FREIHEIT abgehakt, mit Fragezeichen, aber GLEICHHEIT und BRÜDERLICHKEIT standen da als weithin offene Forderungen.
Schnee von gestern! schrieben viele der Journalisten, die in hellen Scharen in Berlin einfielen, um eine gewaltlose Revolution zu betrachten. Manche kamen von weit her und, erstaunlich uninformiert, zum allerersten Mal in diese Weltgegend, von der sie sich ein paar Wochen lang begeistert zeigten, dann aber doch bald ein bißchen gelangweilt und enttäuscht. Wo war denn nun diese behauptete Identität dieser Eingeborenen? mußten sie sich doch nach einiger Zeit ein bißchen naserümpfend fragen. Berechtigte Frage, zweifellos, nur erlaube ich mir an dieser Stelle eine grimmige Gegenfrage: Meinen Sie, daß Sie das Allergewisseste über die Lebensweise eines – sagen wir: Ameisenvolkes – erfahren können, wenn Sie den Stein umdrehen, unter dem es so lange recht und schlecht sein Leben gefristet hat, und nun weitreichende Schlüsse aus der Art und Weise ziehen wollen, wie es unter den leicht angewiderten Blicken der Beobachter nach allen Seiten auseinanderspritzt, ruchlos seine Identität verleugnend? Ein ungehöriger Vergleich? Der kühle Blick der Voyeure hat ihn mir aufgedrängt …
In dem Jahr, das hinter uns lag, war ja kein Stein auf dem anderen geblieben. Ein fieberhaftes, höchst irreales Jahr, in dem der gesellschaftliche Körper vor unseren Augen, teilweise unter unserer Mitwirkung, merkwürdige, neue, dabei sehr flüchtige Daseinsformen angenommen, eine Zeitlang festgehalten und ausprobiert, die meisten von ihnen aber wie in einem Zeitrafferfilm schnell wieder aufgegeben hatte: Kommissionen, Runde Tische, Vereine, alle möglichen Arten von Gründungen und Zusammenschlüssen, oft skurril und phantasievoll, manchmal unter dem amüsierten, homerischen Gelächter der Beteiligten. Szenen, Bilder, wie man sie sonst höchstens im Traum erlebt. Mir aber, das ist merkwürdig, kommt jene Traum-Zeit vor wie die schärfste, genaueste Realität, die ich erfahren habe, eine Schneise von Wirklichkeit zwischen zwei matten Vortäuschungen von Realität. Die Blumenfrau in der Ossietzkystraße, die so redete wie der Namenspatron ihrer Straße; die Verkäuferinnen von der Spätverkaufsstelle an der Ecke, die sich benahmen, als seien sie eben aus Brechts Stück von der Pariser Kommune gestiegen, und die Interessen ihres Geschäfts mit ihren eigenen in Einklang bringen wollten – einige Wochen lang waren sie wirklich die, die sie sein könnten. Inzwischen ist die Blumenfrau längst verstummt, die Verkäuferinnen sind alle entlassen bis auf eine, die sitzt an der Kasse und flüstert alten Kundinnen zu: So haben wir uns das alles aber nicht vorgestellt.
Wie sonst? werden Sie gegenfragen. Darauf kann man heute nur noch verlegen antworten, weil man sich kaum noch in frühere Gedankengänge hineinversetzen kann. Eine Zeitlang redeten nämlich Oppositionelle, Bürgerbewegungen darüber, wie man die Bürger der DDR wirklich an den volkseigenen Betrieben beteiligen könnte – zum Beispiel durch Volksaktien, durch Mitspracherecht; es sei doch, hörte und las man, unvorstellbar ungerecht, wenn sie, die schon den Krieg für alle Deutschen als Reparationen an die UdSSR bezahlt hätten, nun zum dritten Mal die Verlierer (und die Besitzlosen) würden …
Ich bitte Sie. Schnee von gestern. In dem Haus am Alexanderplatz, aus dem in jenen unruhigen Zeiten ein Mitarbeiter jenes legendären Herrn Schalck-Golodkowski sich mit einem Geldköfferchen von hinnen machen wollte, sitzt heute die Treuhandanstalt, »die wichtigste, mächtigste und gleichzeitig am wenigsten kontrollierte Wirtschaftsinstanz in Nachkriegsdeutschland«, und privatisiert 8000 ehemals volkseigene Betriebe, die vergegenständlichte Arbeit von Millionen Menschen. Ist es nicht ein bißchen unheimlich, wie diese Arbeit von zwei, drei Generationen einfach ins Nichts verschwinden kann, nicht durch Zerstörung, Krieg, Bomben – nein, mitten im Frieden, durch einen Federstrich, durch die eherne Zauberformel: Privatisieren. Aber auf Zauberei komme ich noch.
Entfremdung folgt auf Entfremdung. Wer fragt noch, wo unser Lächeln geblieben ist? Es wurde zwischen der heillosen Vergangenheit und der für viele perspektivlosen Zukunft zerquetscht.
Heillos? Es gibt ein Buch mit dem Titel »Geschützte Quelle«, einer der jungen Verlage (Basis-Druck) hat es herausgebracht. Falls dieser Titel ein idyllisches Naturbild in Ihnen wachruft, gehen Sie ganz fehl. »Geschützte Quelle« ist eine Metapher aus dem Arsenal der Stasi-Poesie und bezeichnet Informanten, die in die oppositionellen Zirkel und Gruppen eingeschleust wurden und sich dort als zuverlässige Verbündete und häufig als Initiatoren riskanter Aktionen hervortaten. Von den Personen, die im Herbst 89, aus dem Nichts auftauchend, plötzlich hell angestrahlt auf der politischen Tribüne erschienen, sind eine ganze Reihe wieder untergetaucht: Ihre Stasi-Akte hat sie eingeholt, und ihre engen Freunde, die ihnen bedingungslos vertraut hatten, mußten lernen, ihrem Vertrauen zu mißtrauen und mit der Kälte fertig zu werden, die nun, im nachhinein, nach ihnen griff. Mitten in dieser Halbstadt liegt, einem immer noch strahlenden Sarkophag vergleichbar, das monströse Gelände der Staatssicherheitszentrale mit ihren Hunderten von Kilometern radioaktiver Akten. Ist es verwunderlich, daß viele Menschen – gerade diejenigen, die sich vorher nicht gewehrt hatten; die immer noch als Jubelspalier bei Staatsfeiertagen an den Straßen gestanden hatten – nun, unter dem Eindruck der Enthüllungen, den schweren Weg von Entmündigung zu Mündigkeit nicht einschlagen konnten und sich, aus der Euphorie herausfallend, der Enttäuschung, der Depression, dem Haß und Selbsthaß hingaben, bis hin zur Selbstzerstörung? Es wurde und wird viel verraten in dieser Stadt. Überzeugungen sowieso – ich bitte Sie, was soll ein Mensch, der um sein Überleben kämpft, mit einer Überzeugung anfangen? Aber auch Menschen, noch und noch. Vorsorglich verrät ein Kollege den anderen, dann sich selbst. Vorsorglich bringen Verantwortliche Materialien an sich – Akten, Faszikel, Briefe, Dokumente –, die sind vielseitig verwendbar: um zu erpressen, um sich selbst freizukaufen, um sie den Meistbietenden anzutragen: Geheimdiensten, Nachrichtenmagazinen, Zeitungen. Das ist ja selbstverständlich in solchen Zeiten, in denen eine Epoche abgeräumt wird; ich will nur sagen: Sie dürfen sich nicht auf das verlassen, was Sie sehen können, am wenigsten in dieser Stadt. Unter der Oberfläche herrscht ein geschäftiges, angstvolles, skrupelloses Leben und Treiben, jeder verkauft, was er kann, auch sich selbst. Wie harmlos dagegen der sichtbare Ausverkauf von Devotionalien der alten DDR am Brandenburger Tor, Orden, Ehrenzeichen, Uniformstücke, Fahnen, Medaillen, der Handel blüht. Gestern las ich allerdings eine mir unverständliche Meldung: In einer Fahnenfabrik wachse unaufhaltsam die Nachfrage nach DDR-Fahnen mit Hammer und Zirkel im Ährenkranz. Was ist da los? Da finde ich es verständlicher, daß auf einmal wieder hiesige Lebensmittel gekauft werden, die, übrigens auf Anweisung der neuen Besitzer, so gut wie vollständig von den Regalen der Kaufhallen – jetzt Supermärkte – verschwunden waren und die die früheren Käufer in ihrem selbstzerstörerischen Drang auch längere Zeit mißachteten. Nun ist man anscheinend wieder offen für die Botschaft, daß Gurken aus dem Spreewald und Butter aus Mecklenburg ebenso wie der Lauchstädter Tafelbrunnen genießbar sind, nun finden sich vereinzelt Läden, die nur diese Waren aus einheimischer Produktion anzubieten wagen. Und auch am Brandenburger Tor hat die Szene wieder gewechselt: Am vorigen Sonnabend demonstrierten dort 35 000 Gewerkschafter: »Wir wollen keine soziale Spaltung!«
Was ist passiert? Ein etwas vorwitziger Kollege von mir schreibt: »Von der Einheit bin ich begeistert. Die Welt ist jetzt klein, und Berlin ist groß. Die Anarchie ist untergegangen. Die Freiheit hat sich durchgesetzt. Die D-Mark ist frei. Ich bin der Herr dein Gott, sagt die D-Mark. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Es empfiehlt sich nicht.«
Es rechnet sich übrigens auch nicht, und daß es sich rechnen muß, ist ja nun mal das oberste Gebot im Dekalog des neuen Gottes. Im Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm tritt der jetzt sogar in Dreierformation auf, und ich möchte schon wissen, was der arme b. b. dazu sagen würde, daß die Suche nach dem guten Menschen von Sezuan hierzulande noch einmal höchst aktuell geworden ist. »Die Welt kann bleiben, wie sie ist«, meinen die blinden, selbstverliebten Götter, »wenn genügend gute Menschen gefunden werden, die ein menschenwürdiges Dasein leben können.« Aber das ist es ja eben, daß die gute Shen Te nicht zugleich »gut« und erfolgreiche Besitzerin eines Tabakladens sein kann; daß gut leben und gut sein einander so radikal ausschließen, daß ihr nichts anderes übrigbleibt, als sich, wenigstens zeitweilig, in den bösen Vetter Shui Ta zu verwandeln: »Euer einstiger Befehl / Gut zu sein und doch zu leben / Zerriß mich wie ein Blitz in zwei Hälften.« Primitiv, sagen Sie? Schwarzweiß-Malerei? Die paar Ostberliner im Zuschauerraum, die die teuren Theaterkarten noch bezahlen können, reagieren jedenfalls verständnisinnig auf die verzweifelten Drehungen und Wendungen der guten armen Shen Te, gegeben von der Antoni, die den darwinistischen Kampf ums Dasein härter, auch ratloser darstellen muß als damals, in den fünfziger Jahren, Käthe Reichel. Sie konnte als Shen Te ein wenig weicher, anmutiger, zarter sein, und als Shui Ta ein bißchen komischer und lächerlicher und ungefährlicher. Was überwunden schien, hat gesiegt und prägt den Figuren, die es aufs Theater bringen, die Konturen auf. Und nicht zu vergessen: Brechts Frage: »Wer wär nicht lieber gut als roh?« betraf, obwohl sie nicht auf sie gemünzt war, auch die Verhältnisse in diesem Land.
Die Reichel übrigens, inzwischen grell und scharf und hart, so viel Sie wollen, zog in der Zeit des Golfkriegs mit einer Gruppe von Kriegsgegnern jeden Abend um sechs vom Alexanderplatz zur Mahnwache der Studenten vor der Humboldt-Universität Unter den Linden, die Karl-Liebknecht-Straße hoch – sie heißt in Berlin noch so, andernorts ist sie im Eifer der Wende-Wut schon umbenannt –, vorbei am toten Palast der Republik, dem Volker Braun einst die Losung anhängen wollte: Friede den Hütten!, und der nun, stillgelegt, rechtzeitig als asbestverseucht entlarvt, einen zweiten strahlungsintensiven Sarkophag abgibt, mitten im sogenannten Herzen Berlins. Aber wir haben genug von symbolträchtigen Bildern. Irgendwann sehnen wir uns nach Gegenwart. Also nähern wir uns kühn dem magischen Datum.
Phantastische Vorgänge muß man auf phantastische Weise schildern. In der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 1990 erschien, von vielen herbeigesehnt, der Große Zauberer in der Stadt, hob seinen Stab und ließ, buchstäblich über Nacht, eine andere Welt erstehen. Nicht daß das neue Geld vom Himmel regnete, aber es hatte von Anfang an eine wohltätige Wirkung, insofern es die vorher etwas zügellosen Massen in endlose gesittete Schlangen vor den Sparkassen kanalisierte, und zwar wieder und wieder, denn natürlich erfolgte diese wichtigste aller Umstellungen überstürzt, doch in Etappen. Geldinstitute schossen endlich auch bei uns aus dem Boden, ich muß zugeben, der erste Container mit der Aufschrift DRESDNER BANK war eine Sensation und schloß uns an die Welt an, aber der Zauberer, einmal im Zug, ließ sich nicht lumpen, mit Windeseile schaffte er auch die COMMERZBANK herbei, die HYPOBANK und natürlich die DEUTSCHE BANK. (Bei der Gelegenheit: Die WEBERBANK, ihr Sitz ist West-Berlin, dachte damit zu reüssieren, daß sie in einer großen Annonce in Anlehnung an Ludwig Erhards Intellektuellenschelte noch einmal den Begriff PINSCHER ins Spiel brachte gegen »Intellektualismus«: »Literatur, Ideologie, Rhetorik, Realitätsferne und, auf der Grenzlinie, Schriftstellerei.«)
Wieder hob der Zauberer sein Stöckchen, und über den grauen Geschäften erblühten die Schilder neuer Firmen. Lange gehegte Wünsche konnten endlich in Erfüllung gehen. Und jetzt? Jetzt, sagte der Zauberer den Leuten, wird alles leicht und schnell gehen. Sie würden es fast nicht merken, nur eine winzige Bedingung müßten sie erfüllen: Sie sollten sich ein bißchen Mühe geben und werden wollen wie all die erfolgreichen jungen Männer mit den Aktenköfferchen, die er ihnen mitgebracht hatte, zur Unterstützung und als Vorbild, und die sich alles Mögliche auf dieser weiten schönen Welt vorstellen mochten, nur nicht, daß es jemanden geben könnte, der auf andere Art zu leben wünschte als sie selbst.
Aber gerne, sagten viele. Nur scheint es da geringfügige Schwierigkeiten zu geben. Selbst die Wendigsten und Geschicktesten, die sich so sehr anstrengen wie nie vorher in ihrem Leben und die wirklich schon recht gut sind – selbst die wirken, an den Originalen gemessen, immer noch wie leicht talmihafte Nachahmungen. Versuchen Sie sich auszumalen, daß die breite, vielfältige Palette menschlicher Typen, aus der die freie Marktwirtschaft schöpfen kann, in der sozialistischen Kommandowirtschaft nicht benötigt und daher einfach nicht hervorgebracht wurde. Dies hier war ein Staat der Funktionäre und der kleinen arbeitenden Leute. Wer sich profilieren wollte, mußte schon Phantasie entwickeln, auch Mut – je nachdem, worauf es ihm ankam. Woher also aus diesem eher gleichförmigen Menschenpool zum Beispiel den Banker nehmen, der jetzt so dringend benötigt wird? Da ist es doch ein Glücks- und Ausnahmefall, wenn Herr X. von unserer Bank, die jetzt auch anders heißt als früher, zu seinem unaussprechlichen Stolz von seinem neuen Vorgesetzten zu hören kriegt, Mitarbeiter wie ihn finde man auch im Westen nicht alle Tage. Er sei also weiterverwendungsfähig. – Oder der versierte, von der Logistik und den Interessen und dem Ethos seiner Gesellschaft durchdrungene Versicherungsagent: Woher soll der so plötzlich kommen? Von drüben, natürlich (wir sagen immer noch »drüben«, in beiden Teilen der Stadt, aber es ist uns wenigstens bewußt, daß wir das abstellen müssen!). Er wird als Pionier in die unerschlossenen Gebiete entsandt. Wie aber kann er verhindern, daß seine neuen Mitarbeiter – Einheimische, studierte und entlassene Soziologen beispielsweise – angesichts potentieller Kunden nervös in dem Stapel von Papieren und Tabellen herumfingern und schließlich zugeben, daß auch sie dieses ganze Versicherungswesen »undurchschaubar«, »kompliziert« und ein ganz kleines bißchen »übertrieben« finden? Von dem Steuersystem gar nicht zu reden. Peinlich, es einzugestehen, aber früher, in unseren gleichmacherisch unentwickelten Verhältnissen, hat mein Mann einen Vormittag für unsere beiden Steuererklärungen gebraucht. Heute – nein; kein Wort weiter. Nur so viel: Da vor den unerfahrenen östlichen Steuerberatern öffentlich gewarnt wird, nehmen wir also die Dienste der westlichen in Anspruch. – Und die Manager für die vielen ehemals volkseigenen Betriebe, die nun privatisiert werden – wer liefert uns die? Ganz zu schweigen von den kleinen Unternehmern und Geschäftsleuten, die nicht nur das Know-how, sondern vor allem das Kapital haben, die vielen Gaststätten, Buchhandlungen, Druckereien, Lederfabriken und Verlage, die die großen Konzerne am Rand haben liegen lassen, unter ihre Obhut zu nehmen. Ja, denken Sie vielleicht, viele Ostbürger hätten sich so viel auf die hohe Kante legen können, daß sie nun imstande sind mitzubieten, wenn ihr Geschäft oder ihre Firma versteigert wird? Ja, aber dann entsteht doch hier eine ganz neue Oberschicht aus Zugereisten! Freilich. Und die Einheimischen werden in ihrer großen Masse wieder die Angestellten und Arbeiter sein? Aber selbstverständlich, und da können sie noch von Glück sagen. Und sehen Sie: Für die vergleichsweise geringe Zahl von Ankömmlingen aus der besitzenden Klasse wandern die Beweglichsten unter den jungen Leuten von hier weiterhin in hellen Scharen ab. Dies zu verhindern war ja, Sie erinnern sich vielleicht noch dunkel, einer der erklärten Gründe für die schnelle Währungsunion. – »Brachland Berlin«? O ja.
Ich spreche von Übergangsschwierigkeiten. Sehen Sie mal: Sogar die Verkäuferinnen eines früheren Intershops, der marktgerecht in einen Sex-Shop umgerüstet wurde, tun sich etwas schwer mit ihrem neuen Sortiment. Ich habe es erlebt, wie eine öffentlich von ihrer Geschäftsführerin gerügt werden mußte, weil sie ein gewisses Animiergerät, nach dem ein Herr verlangte, nicht zu kennen vorgab, obwohl sie von der leitenden Dame persönlich in seinem Gebrauch unterwiesen worden war.
Provinz war das doch hier, finsterste Provinz! Jetzt endlich kommt Zug in den Laden, auch in den neuen McPapers-Papierladen, in dem Sie an einem gewöhnlichen Vormittag bühnenreife Szenen erleben können. Fällt doch ein Vierertrupp in dunkle Anzüge und Krawatten gekleideter Herren in die nagelneue Filiale ein, von der Zentrale ausgeschickt, um das Geschäftsgebaren der ebenfalls nagelneuen Filialleiterin zu überprüfen. Sehens- und hörenswert, wie diese Frau, der man die Herkunft aus einer schlichten Konsum-Verkaufsstelle ansieht, sich abmüht, versiert, kompetent, kooperativ und ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit in jeder Hinsicht gewachsen zu erscheinen; wie dabei ihre Gesichtshaut ins Zittern kommt und ihr Kopf zu jedem der sanft belehrenden und mild kritisierenden Sätze des Oberkontrolleurs zwanghaft nickt. Und wie sie dann, nachdem die vier, nicht ohne sich Beanstandungen zu notieren, ihr Geschäft in Formation wieder verlassen haben, mit verändertem Gesichtsausdruck zu ihrer Kollegin an der Kasse stürzt, um in guter alter DDR-Manier ihrem Herzen gegen die Obrigkeit Luft zu machen.
JETZT HILFT NUR NOCH MUSIK! steht in großen Buchstaben an einem Rolladen in der unteren Brunnenstraße.
Aber: Auf keinen Fall möchte ich den Eindruck erwecken, in dieser Halbstadt werde nicht mehr gelacht. Im Gegenteil! Erzählt mir doch neulich ein Kollege aus meinem Verlag – der natürlich wie zwei Drittel der Belegschaft längst entlassen ist –, daß nun auch seine Frau, langjährige Redakteurin einer Illustrierten, mitsamt der ganzen Redaktion gerade gekündigt sei: Die Zeitschrift werde eingestellt. Warum wir da so lachen mußten? Als im Jahr vor der »Wende« die zuständige ZK-Abteilung sich dieser Zeitschrift entledigen wollte, weil sie, auf Berichterstattung aus der Sowjetunion spezialisiert, sich als zu anfällig erwiesen hatte gegenüber Gorbatschows Perestroika, da hatten der Widerstand der Redaktion und die Solidarität vieler anderer Journalisten das Blatt retten können. Nun aber, da die »Presselandschaft« der ehemaligen DDR, der »fünf neuen Bundesländer«, oder, wie der Bundesfinanzminister realitätsgerecht sagt: »des Beitrittsgebiets«, unter die vier großen westdeutschen Zeitungskonzerne aufgeteilt ist, weht ein schärferer Wind. Da wird kalkuliert und, wenn nötig, emotionslos amputiert. Wie auch die Lyrik meines Verlages, auf die er sich bisher viel zugute hielt: Sie rechnet sich nicht und mußte aus dem Verlagsprogramm gestrichen werden. Mann, sage ich. Das hätte sich aber die Zensur früher nicht erlauben dürfen! – Das hätten wir uns von der auch nicht gefallen lassen, sagt eine Verlagsmitarbeiterin.
Wo sie recht hat, hat sie recht.
Es ist doch so: Innerhalb der erfolgreichsten Säugerart, dem homo sapiens, ist der Mensch der freien Marktwirtschaft ganz zweifellos die erfolgreichste Unterspezies. Und zwar in allen seinen Erscheinungsformen. Ob er nun als der inzwischen zum legendären Phänomen erhobene Investor (hoffentlich bald) in die maroden Betriebe kommt. Ob er als Medienbevollmächtigter kommt, um Funk und Fernsehen zu übernehmen. Ob als Medienstar zum Anfassen, endlich live! Ob als Mitglied einer der zahlreichen Evaluierungskommissionen, welche die Art der Abwicklung der allzu zahlreichen wissenschaftlichen Institute zu verfügen haben. Oder auch nur als Kassenberater, der den immer noch nicht niedergelassenen Ärzten zu erklären hat, worum es geht: daß an einem Patienten möglichst viele verdienen können. Oder als Feuilletonist, um den Intellektuellen mitzuteilen, wie sie gelebt haben und wie sie statt dessen hätten leben sollen, um sich den Beifall eben jener Feuilletonisten auch über deren Kulturschock hinaus zu sichern und ihren Unmut darüber zu besänftigen, daß sie sich früher über den wahren, nämlich inferioren! Zustand der hiesigen, mit Verlaub gesagt: »Kultur« hatten täuschen lassen. Daher vor allem und auf lange: Utopieverbot! Aber das wäre schon ein anderer Artikel. Den würde ich überschreiben: Die Welt soll bleiben, wie sie ist.
Was bleibt? Ach ja. Die Hausbesitzer, die, von den Mietern der Kommunalen Wohnungsverwaltung schon fast vergessen, nun wieder auf der Matte stehen. Und, last not least, der (Westberliner) Polizist, der neulich, just zum Jahrestag der Ostberliner Prügelszenen vom 7. und 8. Oktober 1989, angerückt kam, natürlich nicht allein, gut ausgerüstet, und von traumhafter Technik unterstützt, den Ostberliner Kollegen vorzuführen, wie man eine Hausbesetzerszene ausräumt: schlagkräftig, effektiv. Mainzer Straße. Überflüssig zu betonen, daß ein geordnetes Staatswesen keine Untersuchungskommission gegen Polizeiwillkür braucht. Aber ein Dutzend Straßen im Prenzlauer Berg trugen noch wochenlang danach Schilder mit dem Namen: Mainzer Straße. Typisch Prenzlauer Berg!
Da wuchert sowieso zusammen, was zusammengehört. Da hocken sie wieder, immer noch, zusammen, Ost- und Westuntergrund, in den Hinterhofwohnungen, in den neuen Verlagen und Editionen (auch Hinterhöfe), die jene Dokumente herausgeben, die unsere Vergangenheit wenn nicht »bewältigen«, so doch jedenfalls erst mal beschreiben. Da werden Zeitungen und Zeitschriften gedruckt, gehen ein, erstehen auf andere Weise neu – eine von ihnen veröffentlichte kürzlich die Gehaltsliste von 2000 führenden Stasi-Mitarbeitern. Da disputieren sie und trinken (zu viel) und streiten sich in den neuen Cafés, entdecken ihre Nähe zu Kreuzberg, da halten sie Häuser besetzt und entfalten in ihnen ganz unbefangen kulturelles Leben, da entstehen Galerien, da kämpfen Keramik-, Schneider-, Korbflechterwerkstätten ums Überleben. Nehmen sie überhaupt keine Notiz von jenem Zauberer, den sie wohl nicht gerufen haben und den auch ich jetzt entlassen will? Mir scheint, sie passen sich ihm nur so weit an, wie sie unbedingt müssen, und sie haben keine Not, sich der Zauberlehrlinge und der Flut ihrer Mitbringsel zu erwehren oder zu enthalten.
Ja, aber all die anderen, sagen Sie: Jedes Kind kennt doch die Gesetze des freien Marktes. Nicht bei uns, Verehrtester. Bei uns will jedes Kind sich erst mal an Coca-Cola satt trinken und an Donald-Duck-Heften satt lesen. Und, vergessen Sie nicht: Auch die Erwachsenen haben nicht mit der Muttermilch die Ihnen selbstverständliche Überzeugung einsaugen können, daß das Privateigentum das heiligste aller Güter ist, und sie haben vielleicht immer noch ein gestörtes Verhältnis zum Geld. Das Bedenklichste aber: Sie sind noch nicht immun gegen jene Erscheinungen der freien Marktwirtschaft, gegen die ihre Brüder und Schwestern im Westen in einem vierzigjährigen intensiven Lernprozeß Antikörper entwickeln konnten. Horribile dictu: Sie sind – oder waren – gutgläubig. Sie glaubten den Politikerversprechungen, den Anpreisungen der Werbung, sie glaubten dem Lotteriebesitzer, daß sie mit der Losnummer, die er ihnen in ihren Briefkasten steckte, ihr Glück machen würden, sie glaubten den Medien, daß sie unabhängig seien, und dem kleinen Gauner auf der Straße, daß er sie mit seinem Kästchenspiel nicht betrügen werde.
Hier breche ich ab, nicht ohne einzuräumen, daß ich weder auf Vollständigkeit noch auf Ausgewogenheit Anspruch erheben kann. Ich bin einseitig geblieben – wie man es vielleicht noch nicht anders sein kann in dieser vereinten Stadt mit ihren zwei Gesellschaften. In der man einsehen mußte, daß wir einander nicht kennen, daß die gegenseitige Fremdheit jetzt tiefer einschneidet als vorher, als die Mauer stand, die uns auf Abstand hielt, so daß die einen die anderen bedauern, die anderen die einen beneiden konnten. Und als – eine bittere Einsicht für die Ostbewohner – die Westbewohner eigentlich keinen Grund hatten, die Einheit herbeizusehnen. Nun sollen sie aber zusammenleben, und es zeigt sich, daß sie sich wechselseitig voneinander bedroht fühlen. Die einen sollen alles aufgeben, nicht nur das, was ihnen lästig oder unerträglich war; sie sollen ihr Leben nachträglich entwerten. Die anderen sollen von dem, was ihnen jetzt erst gut und teuer wird, abgeben. Da projiziert man seine Ängste auf den je anderen: Die sind faul und rückständig und wollen immer nur Geld. Und: Die sind arrogant und besserwisserisch und wollen sich an uns gesundstoßen.
Da helfen nur mühsame, schmerzhafte, oft verletzende Sprachübungen in kleineren und größeren Kreisen, aus denen wir alle vielleicht verändert herauskommen. Es gibt sie – zu selten, glaube ich. Das kann in einem Jahr schon anders aussehen. Wie einer von diesen ewigen Mauermalern verkündet: ALLES WIRD BESSER, NICHTS WIRD GUT.
Ihre Christa Wolf
Ein Brief
Liebe Angela Drescher,