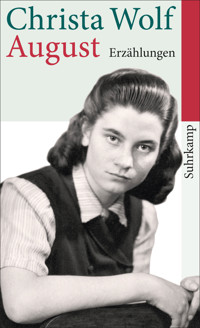14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
1960 nahm Christa Wolf ein ganz besonderes Tagebuch-Projekt in Angriff: Vierzig Jahre lang porträtierte sie jeden 27. September, notierte die Erlebnisse, Gedanken und Gefühle eines jeden dieser Tage. Entstanden ist eine erstaunliche persönliche Chronik, ein beeindruckendes Zeugnis ihrer Existenz als Autorin, als Frau, Mutter, als Bürgerin der DDR und schließlich der BRD.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 900
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
1960 rief die Moskauer Zeitung Iswestija die Schriftsteller der Welt dazu auf, einen Tag jenes Jahres, den 27. September, genau zu beschreiben. Christa Wolf ließ sich darauf ein – und behält über vier Jahrzehnte den genauen, den persönlichen Blick auf diesen einen Tag im Jahr bei. So ist nicht nur ein außergewöhnliches autobiographisches Werk entstanden, das die Frau, die Autorin, die Mutter, die Bürgerin der DDR und später der BRD zeigt, sondern auch ein einzigartiges Dokument der Zeitgeschichte.
»Ein privates und politisches Buch, es zeigt eine Autorin, die immer wieder am Dasein verzweifelt. Ein schutzloses Werk – und darin liegt seine Kraft.« Der Tagesspiegel
Christa Wolf, geboren am 18. März 1929 in Landsberg/Warthe (Gorzów Wielkopolski), starb am 1. Dezember 2011 in Berlin. Ihr Werk, das im Suhrkamp Verlag erscheint, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Georg-Büchner-Preis und dem Deutschen Bücherpreis für ihr Gesamtwerk.
Christa Wolf
Ein Tag im Jahr1960-2000
Suhrkamp
Die Erstausgabe von
Ein Tag im Jahr
erschien 2003 im Luchterhand Literaturverlag.
Der Text, der der 2005 erschienenen Taschenbuchausgabe folgt, wurde für die vorliegende Ausgabe durchgesehen und korrigiert.
Umschlagfoto:
SLUB Dresden/Abt. Deutsche Fotothek/Christian Borchert
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2008
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziertoder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73307-3
www.suhrkamp.de
Der schöne 27. September
Ich habe keine Zeitung gelesen.
Ich habe keiner Frau nachgesehn.
Ich habe den Briefkasten nicht geöffnet.
Ich habe keinem einen Guten Tag gewünscht.
Ich habe nicht in den Spiegel gesehn.
Ich habe mit keinem über alte Zeiten gesprochen und mit keinem über neue Zeiten.
Ich habe nicht über mich nachgedacht.
Ich habe keine Zeile geschrieben.
Ich habe keinen Stein ins Rollen gebracht.
Thomas Brasch
Mein siebenundzwanzigster September
Wie kommt Leben zustande? Die Frage hat mich früh beschäftigt. Ist Leben identisch mit der unvermeidlich, doch rätselhaft vergehenden Zeit? Während ich diesen Satz schreibe, vergeht Zeit; gleichzeitig entsteht – und vergeht – ein winziges Stück meines Lebens. So setzt sich Leben aus unzähligen solcher mikroskopischen Zeit-Stücke zusammen? Merkwürdig aber, daß man es nicht ertappen kann. Es entwischt dem beobachtenden Auge, auch der fleißig notierenden Hand und hat sich am Ende – auch am Ende eines Lebensabschnitts – hinter unserem Rücken nach unserem geheimen Bedürfnis zusammengefügt: gehaltvoller, bedeutender, spannungsreicher, sinnvoller, geschichtenträchtiger. Es gibt zu erkennen, daß es mehr ist als die Summe der Augenblicke. Mehr auch als die Summe aller Tage. Irgendwann, unbemerkt von uns, verwandeln diese Alltage sich in gelebte Zeit. In Schicksal, im besten oder schlimmsten Fall. Jedenfalls in einen Lebenslauf.
Der Aufruf der Moskauer Zeitung »Iswestija«, der 1960 an die Schriftsteller der Welt erging, hat mich sofort gereizt: Sie mögen einen Tag dieses Jahres, nämlich den 27. September, so genau wie möglich beschreiben. Das war eine Wiederaufnahme des Unternehmens »Ein Tag der Welt«, das Maxim Gorkij 1935 begonnen hatte, das nicht ohne Resonanz geblieben war, dann aber nicht weitergeführt wurde. – Ich setzte mich also hin und beschrieb meinen 27. September 1960.
So weit, so gut. Aber warum beschrieb ich dann auch den 27. September 1961? Und alle darauf folgenden 27. September, bis heute – dreiundvierzig Jahre lang, nun schon mehr als die Hälfte meines erwachsenen Lebens? Und kann damit nicht aufhören? – Nicht alle Gründe dafür sind mir bewußt, einige kann ich nennen: Als erstes meinen Horror vor dem Vergessen, das, wie ich beobachtet habe, besonders die von mir so geschätzten Alltage mit sich reißt. Wohin? Ins Vergessen eben. Vergänglichkeit und Vergeblichkeit als Zwillingsschwestern des Vergessens: Immer wieder wurde (und werde) ich mit dieser unheimlichen Erscheinung konfrontiert. Gegen diesen unaufhaltsamen Verlust von Dasein wollte ich anschreiben: Ein Tag in einem jeden Jahr wenigstens sollte ein zuverlässiger Stützpfeiler für das Gedächtnis sein – pur, authentisch, frei von künstlerischen Absichten beschrieben, was heißt: dem Zufall überlassen und ausgeliefert. Was diese zufälligen Tage mir zutrieben, konnte und wollte ich nicht steuern; so stehen scheinbar belanglose Tage neben »interessanteren«, Banalem durfte ich nicht ausweichen, »Bedeutendes« nicht suchen oder gar inszenieren. Mit einer gewissen Spannung begann ich darauf zu warten, was dieser Tag des Jahres, wie ich ihn bald nannte, mir in dem laufenden Jahr bringen würde. Die Aufzeichnungen wurden zu einer manchmal genußvollen, manchmal lästigen Pflichtübung. Sie wurden auch zu einer Übung gegen Realitätsblindheit.
Als schwieriger erwies es sich schon, auf diese Weise Entwicklungen einzufangen. Alle diese einzelnen Tagesprotokolle können ja nicht beanspruchen, für die vierzig Jahre zu stehen, aus denen sie, inselhaft, herausgepickt wurden. Doch hoffte ich: Indem ich punktuell, in regelmäßigen Abständen, einen Befund erhob, mochte sich mit der Zeit eine Art Diagnose ergeben: Ausdruck meiner Lust, Verhältnisse, Menschen, in erster Linie aber mich selbst zu durchschauen. Ich notierte – oft am gleichen Tag beginnend, meistens noch bis in die nächsten Tage hinein –, was ich an jenem Tag erlebt, gedacht, gefühlt hatte, Erinnerungen, Assoziationen – aber auch die Zeitereignisse, die mich in Bann hielten, politische Vorgänge, die mich betrafen, den Zustand des Landes, in dem ich bis 1989 Anteil nehmend lebte, und – das war nicht vorhersehbar gewesen – die Phänomene des Zusammenbruchs der DDR und die des Übergangs in eine andere Gesellschaft, einen anderen Staat. Und natürlich spiegeln sich meine manchmal jäh, häufiger aber allmählich sich verändernden Einstellungen zu all diesen komplexen, komplizierten Vorgängen: Konflikthafte, angreifende Auseinandersetzungen. In diesem Sinne sind diese Aufzeichnungen mehr als nur Material, sie wurden – wenn auch keineswegs vollständig – auch ein Beleg für meine Entwicklung. Der Versuchung, frühere Fehlurteile, ungerechte Einschätzungen aus heutiger Sicht zu korrigieren, mußte ich widerstehen.
Diese Tagebuchblätter unterscheiden sich deutlich von meinem übrigen Tagebuch, nicht nur in ihrer Struktur, auch inhaltlich und durch stärkere thematische Gebundenheit und Begrenztheit. Aber auch sie waren nicht zur Veröffentlichung bestimmt, wie etwa jene anderen Texte es von vorneherein waren, die den Ablauf eines Tages zum Anlaß für ein Prosastück nehmen: »Juninachmittag«, »Störfall«, »Was bleibt«, »Wüstenfahrt« – Beweisstücke für meine Faszination von dem erzählerischen Potential in beinahe jedem beliebigen Tag. Dagegen bedurfte es eines ausdrücklichen Entschlusses, diese Aufzeichnungen zu publizieren, in denen das »Ich« kein Kunst-Ich ist, sich ungeschützt darstellt und ausliefert – auch jenen Blicken, die nicht von Verständnis und Sympathie geleitet sind.
Warum tut man das. Meine Erfahrung ist: Von einem bestimmten Zeitpunkt an, der nachträglich nicht mehr zu benennen ist, beginnt man, sich selbst historisch zu sehen; was heißt: eingebettet in, gebunden an seine Zeit. Ein Abstand stellt sich her, eine stärkere Objektivität sich selbst gegenüber. Der selbstkritisch prüfende Blick lernt vergleichen, wird dadurch nicht milder, vielleicht etwas gerechter. Man sieht, wieviel Allgemeines auch in Persönlichstem steckt, und hält für möglich, daß das Bedürfnis des Lesers, zu urteilen und zu richten, ergänzt werden kann durch Selbstentdeckung und, im günstigsten Fall, Selbstwahrnehmung.
Subjektivität bleibt wichtigstes Kriterium des Tagebuchs. Dies ist ein Skandalon in einer Zeit, in der wir mit Dingen zugeschüttet und selbst verdinglicht werden sollen; auch die Flut scheinbar subjektiver schamloser Enthüllungen, mit denen die Medien uns belästigen, ist ja kühl kalkulierter Bestandteil dieser Warenwelt. Ich wüßte nicht, wie wir diesem Zwang zur Versachlichung, der bis in unsere intimsten Regungen eingeschleust wird, anders entkommen und entgegentreten sollten als durch die Entfaltung und auch durch die Entäußerung unserer Subjektivität, ungeachtet der Überwindung, die das kosten mag. Das Bedürfnis, gekannt zu werden, auch mit seinen problematischen Zügen, mit Irrtümern und Fehlern, liegt aller Literatur zugrunde und ist auch ein Antriebsmotiv für dieses Buch. Es wird sich zeigen, ob die Zeit für ein solches Wagnis schon gekommen ist.
Aber der ausschlaggebende Grund dafür, diese Blätter zu publizieren: Ich denke, sie sind ein Zeitzeugnis. Ich sehe es als eine Art Berufspflicht an, sie zu veröffentlichen. Unsere jüngste Geschichte scheint mir Gefahr zu laufen, schon jetzt auf leicht handhabbare Formeln reduziert und festgelegt zu werden. Vielleicht können Mitteilungen wie diese dazu beitragen, die Meinungen über das, was geschehen ist, im Fluß zu halten, Vorurteile noch einmal zu prüfen, Verhärtungen aufzulösen, eigene Erfahrungen wiederzuerkennen und zu ihnen mehr Zutrauen zu gewinnen, fremde Verhältnisse etwas näher an sich heranzulassen . . .
An der Authentizität der Texte habe ich festgehalten. Leichte Kürzungen wurden vorgenommen. In einigen Fällen mußten Sätze aus Gründen des Personenschutzes gestrichen werden.
April 2003
Dienstag, 27. September 1960
Halle/S., Amselweg
Als erstes beim Erwachen der Gedanke: Der Tag wird wieder anders verlaufen als geplant. Ich werde mit Tinka wegen ihres schlimmen Fußes zum Arzt müssen. Draußen klappen Türen. Die Kinder sind schon im Gange. Gerd schläft noch. Seine Stirn ist feucht, aber er hat kein Fieber mehr. Er scheint die Grippe überwunden zu haben.
Im Kinderzimmer ist Leben. Tinka liest einer kleinen, dreckigen Puppe aus einem Bilderbuch vor: Die eine wollte sich seine Hände wärmen; die andere wollte sich seine Handschuh wärmen; die andere wollte Tee trinken. Aber keine Kohle gab’s. Dummheit!
Sie wird morgen vier Jahre alt. Annette macht sich Sorgen, ob wir genug Kuchen backen werden. Sie rechnet mir vor, daß Tinka acht Kinder zum Kaffee eingeladen hat. Ich überwinde einen kleinen Schreck und schreibe einen Zettel für Annettes Lehrerin: Ich bitte, meine Tochter Annette morgen schon mittags nach Hause zu schicken. Sie soll mit ihrer kleinen Schwester Geburtstag feiern.
Während ich Brote fertigmache, versuche ich mich zu erinnern, wie ich den Tag, ehe Tinka geboren wurde, vor vier Jahren verbracht habe. Immer wieder bestürzt es mich, wie schnell und wie vieles man vergißt, wenn man nicht alles aufschreibt. Andererseits: Alles festzuhalten wäre nicht zu verwirklichen: Man müßte aufhören zu leben. – Vor vier Jahren war es wohl wärmer, und ich war allein. Abends kam eine Freundin, um über Nacht bei mir zu bleiben. Wir saßen lange zusammen, es war das letzte vertraute Gespräch zwischen uns. Sie erzählte mir zum erstenmal von ihrem zukünftigen Mann . . .
Nachts telefonierte ich nach einem Krankenwagen.
Annette ist endlich fertig. Sie ist ein bißchen bummelig und unordentlich, wie ich als Kind gewesen sein muß. Damals hätte ich nie geglaubt, daß ich meine Kinder zurechtweisen würde, wie meine Eltern mich zurechtwiesen. Annette hat ihr Portemonnaie verlegt. Ich schimpfe mit den gleichen Worten, die meine Mutter gebraucht hätte: So können wir mit dem Geld auch nicht rumschmeißen, was denkst du eigentlich?
Als sie geht, nehme ich sie beim Kopf und gebe ihr einen Kuß. Mach’s gut! Wir blinzeln uns zu. Dann schmeißt sie die Haustür unten mit einem großen Krach ins Schloß.
Tinka ruft nach mir. Ich antworte ungeduldig, setze mich versuchsweise an den Schreibtisch. Vielleicht läßt sich wenigstens eine Stunde Arbeit herausholen. Tinka singt ihrer Puppe lauthals ein Lied vor, das die Kinder neuerdings sehr lieben: »Abends, wenn der Mond scheint, ins Städtele hinaus . . .«, die letzte Strophe geht so:
Eines Abends in dem Keller
aßen sie von einem Teller
eines Abends in der Nacht
hat der Storch ein Kind gebracht . . .
Wenn ich dabei bin, versäumt Tinka nie, mich zu beschwichtigen: Sie wisse ja genau, daß der Storch gar keine Kinder tragen könne, das wäre ja glatt Tierquälerei. Aber wenn man es singt, dann macht es ja nichts.
Sie beginnt wieder nach mir zu schreien, so laut, daß ich im Trab zu ihr stürze. Sie liegt im Bett und hat den Kopf in die Arme vergraben.
Was schreist du so?
Du kommst ja nicht, da muß ich rufen.
Ich habe gesagt, ich komme gleich.
Dann dauert es immer noch lange lange lange bange bange bange. Sie hat entdeckt, daß Wörter sich reimen können. Ich wickle die Binde von ihrem zerschnittenen Fuß. Sie schreit wie am Spieß. Dann spritzt sie die Tränen mit dem Finger weg. Beim Doktor wird’s mir auch weh tun.
Willst du beim Doktor auch so schrein? Da rennt ja die ganze Stadt zusammen. – Dann mußt du mir die Binde abwickeln. – Ja, ja. – Darf ich heute früh Puddingsuppe? – Ja, ja. – Koch mir welche! – Ja, ja.
Der Fußschmerz scheint nachzulassen. Sie kratzt beim Anziehen mit den Fingernägeln unter der Tischplatte und möchte sich ausschütten vor Lachen. Sie wischt sich die Nase mit dem Hemdzipfel ab. He! schreie ich, wer schneuzt sich da ins Hemde? – Sie wirft den Kopf zurück, lacht hemmungslos: Wer schneuzt sich da ins Hemde, Puphemde . . .
Morgen habe ich Geburtstag, da können wir uns heute schon ein bißchen freuen, sagt sie. Aber du hast ja vergessen, daß ich mich schon alleine anziehen kann. – Hab’s nicht vergessen, dachte nur, dein Fuß tut dir zu weh. – Sie fädelt umständlich ihre Zehen durch die Hosenbeine: Ich mach das nämlich viel vorsichtiger als du. – Noch einmal soll es Tränen geben, als der rote Schuh zu eng ist. Ich stülpe einen alten Hausschuh von Annette über den verletzten Fuß. Sie ist begeistert: Jetzt hab ich Annettes Latsch an!
Als ich sie aus dem Bad trage, stößt ihr gesunder Fuß an den Holzkasten neben der Tür. Bomm! ruft sie. Das schlägt wie eine Bombe! – Woher weiß sie, wie eine Bombe schlägt? Vor mehr als sechzehn Jahren habe ich zum letzten Mal eine Bombe detonieren hören. Woher kennt sie das Wort?
Gerd liest in Lenins Briefen an Gorki, wir kommen auf unser altes Thema: Kunst und Revolution, Politik und Kunst, Ideologie und Literatur. Über die Unmöglichkeit deckungsgleicher Gedankengebäude bei – selbst marxistischen – Politikern und Künstlern. Die »eigene« Welt, die Lenin Gorki zugesteht (und mehr als zugesteht: die er voraussetzt) bei aller Unversöhnlichkeit in philosophischen Fragen. Seine Rücksichtnahme, sein Takt bei aller Strenge. Zwei gleichberechtigte Partner arbeiten miteinander, nicht der alles Wissende und der in allem zu Belehrende stehen sich gegenüber. Freimütige und großmütige gegenseitige Anerkennung der Kompetenzen . . . Wir kommen auf die Rolle der Erfahrung beim Schreiben und auf die Verantwortung, die man für den Inhalt seiner Erfahrung hat: Ob es einem aber freisteht, beliebige, vielleicht vom sozialen Standpunkt wünschenswerte Erfahrungen zu machen, für die man durch Herkunft und Charakterstruktur ungeeignet ist? Kennenlernen kann man vieles, natürlich. Aber erfahren? – Es gibt einen Disput über den Plan zu meiner neuen Erzählung. Gerd dringt auf die weitere Verwandlung des bisher zu äußerlichen Plans in einen, der mir gemäß wäre. Oder ob ich eine Reportage machen wolle? Dann bitte sehr, da könnte ich sofort loslegen. Leichte Verstimmung meinerseits, wie immer geleugnet, wenn ich in Wirklichkeit spüre, daß »was Wahres dran ist«.
Ob ich das gelesen habe? Einen kleinen Artikel Lenins unter der Überschrift »Ein talentiertes Büchlein«. Gemeint ist ein Buch eines »fast bis zur Geistesgestörtheit erbitterten Weißgardisten«: »Ein Dutzend Dolche in den Rücken der Revolution«, das Lenin bespricht – halb ironisch, halb ernsthaft, und dem er »Sachkenntnis und Aufrichtigkeit« bescheinigt, wo der Autor beschreibt, was er kennt, was er durchlebt und empfunden hat. Lenin nimmt ohne weiteres an, daß die Arbeiter und Bauern aus den reinen, sachkundigen Schilderungen der Lebensweise der alten Bourgeoisie die richtigen Schlüsse ziehen würden, wozu der Autor selbst nicht imstande ist, und scheint es für möglich zu halten, einige dieser Erzählungen zu drucken. »Ein Talent soll man fördern« – was wiederum Ironie ist, aber auch Souveränität. – Wir kommen auf die Voraussetzungen für souveränes Verhalten in einem Land, in dem sich die sozialistische Gesellschaft unter Voraussetzungen und Bedingungen wie bei uns entwickeln muß. Über Gründe und Grundlagen des Provinzialismus in der Literatur.
Wir lachen, wenn wir uns bewußt machen, worüber wir endlos zu jeder Tages- und Nachtzeit reden – wie in schematischen Büchern, deren Helden wir als unglaubwürdig kritisieren würden.
Ich gehe mit Tinka zum Arzt. Sie redet und redet, vielleicht, um sich die Angst wegzureden. Mal verlangt sie die Erläuterung eines Wandbildes (Wieso findest du es nicht schön? Ich find es schön bunt!), mal will sie mit Rücksicht auf ihren kranken Fuß getragen werden, mal hat sie allen Schmerz vergessen und balanciert auf den Steinumfassungen der Vorgärten.
Unsere Straße führt auf ein neues Wohnhaus zu, an dem seit Monaten gebaut wird. Ein Aufzug zieht Karren mit Mörtelsäcken hoch und transportiert leere Karren herunter. Tinka will genau wissen, wie das funktioniert. Sie muß sich mit einer ungefähren Erklärung der Technik begnügen. Ihr neuer, unerschütterlicher Glaube, daß alles, was existiert, »zu etwas gut ist«, ihr zu etwas gut ist. Wenn ich so oft um die Kinder Angst habe, dann vor allem vor der unvermeidlichen Verletzung dieses Glaubens.
Als wir die Treppen der Post hinunterlaufen, klemme ich sie mir unter den Arm. – Nicht so schnell, ich fälle! – Du fällst nicht. – Wenn ich groß bin und du klein, renne ich auch so schnell die Treppen runter. Ich werd größer als du. Dann spring ich ganz hoch. Kannst du übrigens über das Haus springen? Nein? Aber ich. Über das Haus und über einen Baum. Soll ich? – Mach doch! – Ich könnte ja leicht, aber ich will nicht. – So, du willst nicht? – Nein. – Schweigen. Nach einer Weile: Aber in der Sonne bin ich groß. – Die Sonne ist dunstig, aber sie wirft Schatten. Sie sind lang, weil die Sonne noch tief steht. – Groß bis an die Wolken, sagt Tinka. Ich blicke hoch. Kleine Dunstwolken stehen sehr hoch am Himmel.
Im Wartezimmer großes Palaver. Drei ältere Frauen hocken beieinander. Die eine, die schlesischen Dialekt spricht, hat sich gestern eine blaue Strickjacke gekauft, für hundertdreizehn Mark. Das Ereignis wird von allen Seiten beleuchtet. Gemeinsam schimpfen alle drei über den Preis. Eine jüngere Frau, die den dreien gegenüber sitzt, mischt sich endlich überlegenen Tons in die fachunkundigen Gespräche. Es kommt heraus, daß sie Textilverkäuferin und daß die Jacke gar nicht »Import« ist, wie man der Schlesierin beim Einkauf beteuert hatte. Sie ist entrüstet. Die Verkäuferin verbreitet sich über die Vorund Nachteile von Wolle und Wolcrylon. Wolcrylon sei praktisch, sagt sie, aber wenn man so richtig was Elegantes haben will, nimmt man Wolle. – Was gut ist, kommt wieder, sagt die zweite der drei Frauen, und ich blicke beschwörend Tinka an, die zu einer gewiß unpassenden Frage ansetzen will. Im Westen kostet so eine Jacke fünfzig Mark, meint die Schlesierin. – Na ja, erklärt die zweite, rechnen Sie doch um: eins zu drei. Kommen auch hundertfünfzig Mark raus. – Stimmt schon.
Es hat wohl keinen Sinn, sich in ihre Umrechnungen einzumischen.
Ich habe das Geld von meiner Tochter, sagt die Schlesierin. Von meinen hundertzwanzig Mark Rente hätte ich’s nicht gekonnt. – Alle drei seufzen. Dann meint die Nachbarin: Dafür bin ich immer gewesen: schlicht, aber fein. – Ich mustere sie verstohlen und kann das Feine an ihr nicht finden. – Sie, unbeirrt: Diesen Mantel hier. Hab ich mir 1927 gekauft. Gabardine. Friedensware. Nicht totzukriegen. – Entsetzt sehe ich mir den Mantel an. Er ist grün, leicht schillernd und unmodern, sonst ist ihm nichts anzumerken. Ein Mantel kann doch nicht unheimlich sein. Tinka zieht mich am Ärmel, flüstert: Wann ist neunzehnhundertsiebenundzwanzich? – Vor dreiunddreißig Jahren, sage ich. – Sie gebraucht eine Redewendung ihres Vaters: War da an mich schon zu denken? – Mitnichten, sage ich. An mich war auch noch nicht zu denken. – Ach du grüne Neune, sagt Tinka. – Die Schlesierin, immer noch mit ihrer blauen Strickjacke beschäftigt, tröstet sich: Jedenfalls werde ich im Winter nicht frieren.
Die Dritte, eine dürre Frau, die bisher wenig gesprochen hat, bemerkt jetzt mit stillem Triumph: Über all das brauch ich mir gottlob keine Gedanken zu machen . . . – Stumme Frage der anderen. Schließlich: Sie haben Verwandte drüben? – Nein. Das heißt: Doch. Meine Tochter. Aber die arrangiert das bloß. Da ist ein Herr. Ich kenn den gar nicht, aber er schickt mir, was ich brauche. Jetzt hat er schon wieder nachfragen lassen, was mir für den Winter noch fehlt. – Blanker Neid in den Augen der anderen. Ja – dann! Besser kann’s einem heutzutage ja gar nicht gehen.
Ich schweige, habe längst aufgegeben zu lesen. Die Sprechstundenhilfe ruft alle drei hinaus.
Tinka ist ganz still, als der Arzt an der Wunde herumdrückt. Sie ist blaß, ihre Hand in der meinen wird feucht. Hat’s weh getan? fragt der Arzt. Sie macht ihr undurchdringliches Gesicht und schüttelt den Kopf. Sie weint nie vor Fremden. Draußen, als wir auf den Verband warten, sagt sie plötzlich: Ich freu mich, daß ich morgen Geburtstag hab!
Der Himmel hat sich mit Wolken überzogen. Wir sind schon gespannt auf den Maureraufzug. Tinka hätte lange da gestanden, hätte sie nicht eilig ein Eckchen suchen müssen. Dann wird sie schweigsam. Der große schwarze Hund, an dessen Hütte wir bald vorbeimüssen, beschäftigt sie. Wie immer erzählt sie mir an dieser Stelle, daß dieser Hund einer Frau mal in den Finger gebissen hat. Es muß jahrelang her sein, falls es überhaupt stimmt, aber auf Tinka hat die Legende davon einen unauslöschlichen Eindruck gemacht. Wirkung von Erzähltem!
Die Post, die ich zu Hause vorfinde, ist enttäuschend, eine nichtssagende Karte von einem nichtssagenden Mädchen. Dafür halten ein paarmal Motorräder vor dem Haus, Eil- und Telegrammboten, Ersatz fürs Telefon. Einer bringt die Korrekturfahnen von Gerds Buch über Louis Fürnberg.
Während das Essen kocht, lese ich Kinderaufsätze zu dem Thema »Mein schönster Ferientag«, die in der Bibliothek des Waggonwerks abgegeben wurden. Ein neunjähriges Mädchen schreibt: »Bei uns im Ferienlager war es herrlich. Wir hatten einen Tag frei. Da konnten wir hingehen, wohin wir wollten. Ich bin in den Wald gegangen. Da habe ich einen großen und einen kleinen Hirsch gesehen. Sie lagen alle beide da und rührten sich nicht. Sie waren so zahm, daß man sie anfassen konnte. Da bin ich schnell wieder zurückgelaufen und habe den Lagerleiter geholt. Es war ja nicht weit bis in unser Lager. Ich habe ihm alles erzählt, und er ist mit mir mitgegangen. Er hat den großen Hirsch an einer Leine mitgenommen, und ich durfte den kleinen Hirsch tragen. Wir hatten einen kleinen Stall, da habe ich sie alle beide reingestellt und habe sie jeden Tag gefüttert. So war mein schönster Tag.«
Ich bin dafür, diesem Mädchen für seine unwahrscheinliche Geschichte den ersten Preis im Wettbewerb zu geben.
Nach dem Essen fahre ich ins Waggonwerk, zur Parteigruppensitzung der Brigade. In der Straßenbahn sucht ein älteres Ehepaar in allen Taschen verzweifelt nach dem Groschen, der den beiden fehlt, um die Fahrscheine kaufen zu können. Sie haben sich beim Einkaufen verausgabt. Ich biete der Frau den Groschen an. Große Verlegenheit: Ach nein, ach nein, sie könnten ja auch laufen. Schließlich nimmt der Mann den Groschen, unter Beteuerungen, wie peinlich es ihm sei. So was ist wohl nur bei uns Deutschen möglich, denke ich.
Im Betrieb war ich ein paar Wochen nicht. Die Halle steht voller halbfertiger Waggons. Anscheinend ist die Produktionsstockung überwunden. Ich freue mich zu früh.
Willy bemerkt mich nicht gleich. Ich sehe zu, wie er mit seiner neuen Vorrichtung zur Vorbereitung der Druckrahmen arbeitet. Er und J., sein Brigadier, haben diese einfache, aber praktische Vorrichtung entwickelt und als Verbesserungsvorschlag eingereicht. Sie sparen damit die Hälfte der Zeit für diesen Arbeitsgang ein. Im Betrieb wurde hinter ihrem Rücken getuschelt, es hat böses Blut gegeben. Heute soll ich erfahren, was wirklich los ist.
Willy blickt auf. Na, mei Herze? sagt er. Er freut sich. Er hat noch zu tun. Ich setze mich in den Brigadeverschlag, den sie selbst »Rinderoffenstall« nennen. Noch fünfundvierzig Minuten bis Arbeitsschluß, aber drei sitzen schon hier und warten, daß die Zeit vergeht. Immer noch nicht genug Arbeit? Köpfeschütteln. Das Bild in der Halle trog. – Und was macht ihr mit der übrigen Zeit? – Beschäftigungstheorie, sagen sie. Eisenplatz, Holzplatz, Bohlen ausbessern. – Und das Geld? – Das stimmt. Wir kriegen ja den Durchschnitt. – Sie sind mißgelaunt, resigniert, wütend – je nach Temperament. Und was das Schlimmste ist: Sie hoffen nicht mehr auf die entscheidende Wende zum Besseren. Lothar sagt: Im Januar sitzen wir wieder in der Tinte, wenn wir uns auch jetzt im letzten Quartal noch ein Bein ausreißen, um den Plan zu machen. Das Geld wird für Überstunden rausgeschmissen. Soll das rentabel sein?
Sein Geld stimmt, aber er ärgert sich über die Unrentabilität des Betriebes. Kann der Werkleiter in jede Brigade gehen und erklären, was mit dem Betrieb los ist? Er kann es nicht. Aber erklärt werden müßte es, und zwar ganz genau, und möglichst jede Woche nach dem neuesten Stand. Uneingeweihte Leute fangen an, verantwortungslos zu handeln.
Inzwischen dreht sich das Gespräch um das Betriebsfest am letzten Sonnabend. Jürgen erzählt, wie er seine Frau, die zu viel getrunken hatte, mit Mühe und Not in einem Werksomnibus nach Hause schaffen konnte, nachdem sie einen aufdringlichen Kollegen öffentlich geohrfeigt hatte. Vor Wut habe ich mir am nächsten Tag noch einen angetrunken, sagt er. Er hat ein bißchen Angst, er könnte durch seine Frau blamiert sein. Da fangen die anderen an, ähnliche Vorfälle mit ihren Frauen zu erzählen, sachlich, ohne Gefühlsaufwand, wie Männer eben über Frauen reden. Ich denke: Bestimmt hatte der zudringliche Kollege die Ohrfeige verdient . . .
Im Sitzungszimmer der Parteileitung treffen sich neun Genossen. Sie kommen in ihrem Arbeitszeug, ungewaschen. Eine Frau ist dabei, mit lustigen, lebendigen Augen; ich habe in der Brigade schon mal erlebt, daß sie auf den Tisch haut. Hier sagt sie nichts.
Lange Rede, kurzer Sinn – wir fangen an, sagt Willy. Er ist Gruppenorganisator. Ich weiß, was er heute vorhat, und beobachte gespannt und anerkennend, wie er rücksichtslos sein Ziel ansteuert. Vor ihm liegt der Bericht für die öffentliche Rechenschaftslegung seiner Brigade. Ich kenne ihn. Aber die Genossen aus der Nachbarbrigade, die Wettbewerbspartner, sitzen ein bißchen verdattert vor den dreiundzwanzig Seiten der anderen, die ja bei aller Freundschaft doch auch die Rivalen sind. Und wenn man die verzwickte Geschichte der beiden Brigaden kennt, die doch mal eine Brigade waren . . . Die Starbrigade des Werkes, unter der Führung von P., der Willy gegenübersitzt, sich immer wieder den Schweiß abwischt und sich übertölpelt vorkommt.
Schnell und undeutlich beginnt Willy aus dem Rechenschaftsbericht vorzulesen, ein sorgfältig ausgewähltes Stück. Die Hände, in denen er das Blatt hält, zittern ein bißchen. Auf einen Uneingeweihten muß die Atmosphäre in dem überheizten Zimmer eher einschläfernd wirken.
Niemand nimmt Zitate so ernst wie Willy. Er liest vor, was Lenin über die Steigerung der Arbeitsproduktivität gesagt hat. Und wie geht es bei uns? unterbricht er sich. Ein Kollege sagt: Als wir noch keine Brigade der sozialistischen Arbeit werden wollten, waren wir uns immer einig. Jetzt gibt es dauernd Stunk. – Willy hebt die Stimme. Er kommt jetzt auf ihren Verbesserungsvorschlag zu sprechen: eben jene einfache Vorrichtung, die ich vorhin in Aktion sah. Einen Riesenqualm gab es! sagt er und läßt das Blatt sinken, blickt über seine Drahtbrille direkt auf P.: Fünfzig Prozent Einsparung! Das hat es noch nicht gegeben – bei uns nicht! Man hat die Realität des Vorschlags angezweifelt. Ja, auch du, P.! Red nicht, jetzt bin ich dran. Aber der Vorschlag ist real, da gibt’s nichts dran zu wackeln. Klar haben wir ne Prämie gekriegt. Klar werden wir beiden die nächsten drei Monate gut verdienen. Tausend Mark kommen für mich dabei zusammen, wenn ihr’s wissen wollt. Und was weiter? Gilt vielleicht der materielle Anreiz für uns Genossen nicht? Alles wäre in Ordnung gewesen, wenn die beiden ihre Prämie verteilt, die Mäuler mit ein paar Flaschen Bier gestopft hätten. Aber damit ist Schluß! ruft Willy. Gleichmacherei gibt’s nicht mehr. Und auf dem nächsten Brigadeabend geben wir einen aus.
So kam in der Abteilung die hinterhältige Frage auf: Bist du Kommunist oder Egoist?
Und das, ruft Willy aus, längst schon erregt und sich oft verhaspelnd, das haben wir alle gewußt. Oder nicht? Und wie sind wir als Genossen aufgetreten? Gar nicht. Wie konnten wir auch! Waren uns ja selbst nicht einig. Konkreter! ruft einer aus der Nachbarbrigade.
Willy, immer lauter: Jawohl! So konkret, wie du willst! In der Gewerkschaftsleitung werden wir beide zu Aktivisten vorgeschlagen. Wer spricht dagegen? Genosse P.! In der Parteileitung will man unser Bild zum Tag der Republik an der »Straße der Besten« aufstellen. Wer rät ab? Genosse P.! Konkret genug?
Vielleicht darf ich jetzt auch mal was sagen, verlangt P. Bitte, sagt Willy. Bloß eins noch: Es geht um die Sache und nicht darum, ob mir deine Nase oder dir meine Nase nicht paßt. Jeder hier am Tisch kennt P.s Ausspruch aus der Zeit, als Willy mit seiner »rückläufigen Kaderentwicklung« neu in seiner Brigade war: Er oder ich, das ist hier die Frage. Für uns beide ist in einer Brigade kein Platz. – Am Ersten Mai stand noch P.s Bild an der »Straße der Besten«. Beide müssen viel vergessen und manches gedacht haben, was sie sich selbst nicht zugeben würden, damit überhaupt geredet werden kann wie heute. Man muß nicht erwarten, daß der Konflikt nach den Regeln klassischer Dramaturgie zugespitzt und bis zu Ende »ausgetragen« wird. Viel ist schon, daß P. zugibt: Euer Vorschlag war real. Daß ihr die Prämie kriegt, ist richtig. – Danach ist sein Vorrat an Selbstverleugnung erschöpft. Er weicht aus, zerrt eine alte Geschichte hervor, über die er sich weitschweifig ergeht. Er kann sich nicht einfach so geschlagen geben. Es geht hin und her zwischen den beiden Brigaden, die Spannung flacht ab, auch Willy muß mal ein Loch zurückstecken, was ihm schwer genug fällt.
Vor ihm liegt immer noch der Rechenschaftsbericht seiner Brigade. In einer Woche sollen P.s Leute auch soweit sein. Plötzlich wird ihnen vor der Arbeit bange. Diesen kleinen Triumph gönnt Willy sich noch, das merkt jeder. Aber nun ist es genug, man muß sich einigen. Man bespricht, wer P. helfen soll. Wenn du mich Querpfeifer auch haben willst . . ., sagt Willy. – Alter Idiot! erwidert P.
Jemand kommt auf die Idee, man müsse die Frauen zur Rechenschaftslegung der Brigade einladen, das sei ein Zug der Zeit. Dagegen kann keiner öffentlich sprechen, aber klar wird: Feurige Fürsprecher hat der Vorschlag nicht. Die Frauen, sagt einer, haben doch alle genug mit den Kindern zu tun, besonders nach Feierabend . . . Günter R. ist froh: Eine Frau könne ja nur mitbringen, wer eine habe.
Na und du? fährt Willy ihn an. Hast wohl keine? – Nee, sagt Günter. Nicht mehr. – Was ist eigentlich los mit deiner Ehe? Daß du mir nicht absackst wegen solcher Geschichten! droht Willy. – Günter ist der Jüngste am Tisch. Er macht eine wegwerfende Handbewegung, ist aber glühend rot geworden: Lappalie! Nicht der Rede wert!
Später erzählt mir P.: Günter war für ein paar Wochen zur sozialistischen Hilfe in den Schwesterbetrieb nach G. geschickt worden, und als er eines Tages unvermutet nach Hause kommt, spaziert ihm doch der Meister seiner Frau aus seinem Schlafzimmer entgegen. Da ist er natürlich gleich am nächsten Tag aufs Gericht. Da ist auch nichts mehr zu flicken . . .
Nach und nach ist die Stimmung heiter geworden. Witze werden gerissen. Als ich behaupte, sie wollten alle nichts von Kultur wissen, gibt es Protest. Die Einladungskarten für die Rechenschaftslegung werden herumgezeigt, weiße Doppelkärtchen, auf denen in goldener Schnörkelschrift Einladung gedruckt ist. Das ist ihnen gerade vornehm genug. Sie wollen sich allerhand Gäste einladen, wollen »ein Beispiel geben«, wie Willy sagt. Er läßt die Versammlung jetzt locker schleifen, ist kaum noch verkrampft, sieht ganz zufrieden aus. Er blinzelt mir zu und grinst. Ganz schön durchtrieben, sage ich später zu ihm. Muß man ja sein, Meechen, sagt er. Kommst sonst zu nichts.
Ich gehe schnell nach Hause, aufgeregt, mit aufgestörten Gedanken. Ich höre noch einmal, was sie sagen, dazu, was sie nicht sagen, was sie nicht einmal durch Blicke verraten. Wem es gelänge, in dieses fast undurchschaubare Geflecht von Motiven und Gegenmotiven, Handlungen und Gegenhandlungen einzudringen . . . Das Leben von Menschen groß machen, die zu kleinen Schritten verurteilt scheinen . . .
Um diese Jahreszeit ist es gegen Abend schon kalt. Ich kaufe noch ein, was ich zum Kuchenbacken brauche, und nehme ein paar Geburtstagsblumen mit. In den Gärten welken schon die Dahlien und Astern. Mir fällt der riesige Rosenstrauß ein, der damals, vor vier Jahren, im Krankenhaus auf meinem Nachttisch stand. Mir fällt der Arzt ein, den ich sagen hörte: Ein Mädchen. Aber sie hat ja schon eins. Na, es wird ihr wohl nichts ausmachen . . . Seine Erleichterung, als ich schon den Namen hatte. Die Schwester, die mich belehrte, wie unerwünscht manchmal Mädchen noch seien und was man da alles erleben könne, besonders mit den Vätern. Die kommen einfach nicht, wenn es wieder ein Mädchen ist, ob Sie’s glauben oder nicht. Darum dürfen wir am Telefon nicht sagen, was es ist, Junge oder Mädchen.
Alle wollen mithelfen beim Kuchenbacken. Die Kinder stehen überall im Wege. Schließlich lege ich ihnen im Zimmer eine Märchenplatte auf: »Peter und der Wolf«. Nachher kratzen sie die Teigschüsseln aus, bis sie ihnen entzogen werden. Annette erzählt aus der Schule: Wir haben ein neues Lied gelernt, aber es gefällt mir nicht besonders. Republik reimt sich auf Sieg – wie findest du das? Ich find’s langweilig. Wir haben eine neue Russischlehrerin. Die hat sich gewundert, wie viele Wörter wir schon kennen. Aber denkst du, die hat uns ihren Namen gesagt? Nicht die Bohne. Dabei mußten wir ihr unseren Namen alle auf einen Sitzplan aufschreiben. Die denkt sich gar nichts dabei, glaube ich. – Sie quirlen lange unruhig umher und wollen sich nicht damit abfinden, daß man auch in der Nacht vor dem Geburtstag schlafen muß.
Der Kuchen geht im Ofen über alle Maßen. Jetzt, wo es still wird, ist mir, als könnte ich hören, wie er geht. Die Formen waren zu voll. Der Teig geht und geht und tropft in die Röhre und verbreitet einen Geruch nach Angebranntem in der ganzen Wohnung. Als ich den Kuchen herausziehe, ist eine Seite schwarz, ich ärgere mich und finde keinen, dem ich die Schuld geben könnte außer mir selbst, und dann kommt noch Gerd und nennt den Kuchen »etwas schwarz«, da sage ich ihm ungehalten, daß es an den zu vollen Formen und am schlechten Ofen und am zu starken Gasdruck liegt. Na ja, sagt er und zieht sich zurück.
Später hören wir die Violinsonate op. 100 von Antonin Dvořák, auf die Fürnberg ein Gedicht gemacht hat. Eine liebliche, reine Musik. Mein Ärger löst sich auf. Wir merken beide gleichzeitig, daß wir nach verbranntem Kuchen riechen und fangen an zu lachen.
Ich muß noch etwas schreiben, aber alles stört mich: Das Radio, der Fernseher nebenan, der Gedanke an den Geburtstagstrubel morgen und an diesen zerrissenen Tag, an dem ich nichts geschafft habe. Unlustig decke ich den Geburtstagstisch, mache den Lichterkranz zurecht. Gerd blättert in irgendeinem Büchlein, findet es »gut geschrieben«. Aus irgendeinem Grund stört mich auch das.
Ich sehe die Manuskriptanfänge durch, die auf meinem Schreibtisch übereinanderliegen. Die Langwierigkeit des Vorgangs, den man Schreiben nennt, erbittert mich. Aus der reinen Brigadegeschichte haben sich schon ein paar Gesichter herausgehoben, Leute, die ich besser kenne und zu einer Geschichte miteinander verknüpft habe, die, wie ich deutlich sehe, noch viel zu simpel ist. Ein Mädchen vom Lande, das zum erstenmal in ihrem Leben in die größere Stadt kommt, um hier zu studieren. Vorher macht sie ein Praktikum in einem Betrieb, bei einer schwierigen Brigade. Ihr Freund ist Chemiker, er bekommt sie am Ende nicht. Der dritte ist ein junger Meister, der, weil er einen Fehler gemacht hat, in diese Brigade zur Bewährung geschickt wurde . . . Es ist merkwürdig, daß diese banalen Vorgänge, »dem Leben abgelauscht«, auf den Seiten eines Manuskripts ihre Banalität bis zur Unerträglichkeit steigern. Ich weiß, daß die wirkliche Arbeit erst beginnen wird, wenn die »Überidee« gefunden ist, die den Stoff erzählbar und erzählenswert macht. Aber sie findet sich nur – wenn überhaupt, woran ich heute abend ernsthaft zweifle – durch diese lange Vorarbeit, deren Vergeblichkeit mir klar ist.
Ich weiß, daß weder die Seiten, die schon daliegen, noch die Sätze, die ich heute schreibe, bleiben werden – nicht ein Buchstabe von ihnen. Ich schreibe, und dann streiche ich es wieder aus: Wie immer wurde Rita pfeilschnell aus dem Schlaf geschleudert und war wach, ohne Erinnerung an einen Traum. Nur ein Gesicht mußte da gewesen sein. Sie wollte es festhalten, es verging. Robert lag neben ihr.
Vor dem Einschlafen denke ich, daß aus Tagen wie diesem das Leben besteht. Punkte, die am Ende, wenn man Glück gehabt hat, eine Linie verbindet. Daß sie auch auseinanderfallen können zu einer sinnlosen Häufung vergangener Zeit, daß nur eine fortdauernde unbeirrte Anstrengung den kleinen Zeiteinheiten, in denen wir leben, einen Sinn gibt . . .
Die ersten Übergänge in die Bilder vor dem Einschlafen kann ich noch beobachten, eine Straße taucht auf, die zu jener Landschaft führt, die ich so gut kenne, ohne sie je gesehen zu haben: Der Hügel mit dem alten Baum, der sanft abfallende Hang zu einem Wasserlauf, Wiesengelände, und am Horizont der Wald. Daß man die Sekunden vor dem Einschlafen nicht wirklich erleben kann – sonst schliefe man nicht ein –, werde ich immer bedauern.
Mittwoch, 27. September 1961
Amselweg, Halle/S.
Gestern, als eigentlich der »Tag des Jahres« sein sollte – eine Tradition, die ich doch anfangen möchte –, habe ich den ganzen Tag über nicht daran gedacht, erst heute früh, beim Erwachen, fiel es mir ein, kein lustvoller Einfall, ich spürte Unlust, mich pflichtgemäß schreibend an gestern zu erinnern. In älteren Tagebüchern blätternd, sah ich wieder, was alles man vergißt, wenn man es nicht aufschreibt: Fast alles. Besonders die wichtigen Kleinigkeiten. Also aufschreiben. Und zugleich ein Test, was ich vom gestrigen Tag noch weiß, was ich aus der schnell verblassenden Erinnerung festhalten, »retten« kann. Und die Frage wegschieben: Wozu retten? Was ist denn wichtig an einem durchschnittlichen Tag in einem durchschnittlichen Leben? Was bringt mich dazu, die früh eingeprägte Mahnung: Nimm dich doch nicht so wichtig! zu mißachten? Selbstüberhebung? Aber ist Selbstüberhebung, sich wichtig nehmen, nicht die Wurzel allen Schreibens?
(In Klammern vermerkt, da es eigentlich peinlich ist: In der letzten Woche, da ich leider wieder krank war – die alte Krankheit: Herzschmerzen, Schlaflosigkeit, Müdigkeit –, las ich eine Zusammenstellung von Dokumenten aus Goethes Leben: Dichtung und Wahrheit, Briefe, Tagebuchblätter, und dachte wieder: Man muß aufschreiben, und sei es, jeden Tag nüchtern zu registrieren. Nicht »schön« schreiben wollen. Stichworte, Tatsachen. Keine Seelenergüsse.)
Am ehesten hält sich das Gerüst des Tages, das Gerüst der meisten Tage, das aus härterem Stoff ist als die Füllmasse, das eigentliche Leben, das jeden Tag ein bißchen anders ist. Der Wecker um halb sieben, der erste Blick aus dem Fenster auf den Amselweg, ein bezogener Himmel, Wolken gehen, doch Regen scheint nicht anzustehen. Frühherbstliche Blattfärbung. Einige Fahrradfahrer, die zu ihren Betrieben müssen, darunter sicher manche, die zum Waggonwerk Ammendorf fahren. Der Name ist ein Signal, das eine Bilderfolge in mir auslöst, bestimmte Wege im Werk weiß ich inzwischen auswendig und kann sie auf meiner inneren Landkarte nachgehen, mit einer gewissen Genugtuung: Etwas Fremdes habe ich mir angeeignet.
Stille im Kinderzimmer. Im Bad die gewohnten Prozeduren und Handgriffe. Gerd ist schon in der Küche und hat angefangen, Frühstück zu machen, geht ins Bad. Leider muß ich jetzt Annette wecken. Als ich vorsichtig die Tür zum Kinderzimmer aufmache, stellt sich heraus, daß beide wach sind, mucksmäuschenstill in ihren Betten sitzen und lesen. Jedenfalls nennt Tinka die Beschäftigung mit ihren Bilderbüchern, die sie auf ihrem Bett aufgehäuft hat, »lesen«, worüber Annette sich mit mir durch einen mitleidig-nachsichtigen Blick verständigt. Man muß der kleinen Schwester ihre Defizite ja nicht aufs Butterbrot schmieren. Sie selbst ist in ein Märchenbuch vertieft. Manchmal fragt sie, ehe sie ein neues Märchen anfängt, ob es »gut« oder »schlimm« ausgeht. Wie ich sie verstehe! Aber was ist gut, was schlimm? Annette ist da ganz sicher: Wenn der Gute recht bekommt und siegt, geht das Märchen gut aus. Einmal habe ich versucht, einen leisen Zweifel in ihre Gewißheit zu säen: Tue es ihr nicht leid, wenn die böse Stiefmutter am Ende in glühenden Pantoffeln tanzen muß? O nein. Hauptsache, Schneewittchen ist wieder lebendig und hat ihren Prinzen geheiratet. Die Schicksale der Nebenpersonen sind unerheblich, und die böse Gegenspielerin muß unbedingt bestraft werden. Ich habe als Kind in Annettes Alter der Hexe auf der Abbildung in meinem Märchenbuch die Augen ausgekratzt. Annette hat im Sommer mit den Kindern aus dem Haus und aus der Umgebung »Rotkäppchen« aufgeführt, sie als die Älteste war Regisseurin, ganz ernst hat sie ihre Aufgabe genommen – wie jede Aufgabe –, vor der Aufführung mit Publikum aus der Nachbarschaft war sie aufgeregt wie ein echter Regisseur vor seiner Premiere. Sie hat sich einen Bestand von Lieblingsmärchen angelegt, die gut ausgehen und die sie wieder und wieder liest. Was ist es heute früh? – Aschenputtel. – Komm, aufstehen. – Erst zu Ende lesen. – Aber du weißt ja, wie es ausgeht. – Trotzdem. Tinka gibt von ihrem Bett aus den altklugen Kommentar, daß man nicht mitten in einer Geschichte aufhören kann, dann muß man nämlich immerzu daran denken. Sie steckt zur Zeit voller Lebensweisheiten.
Wir finden einen Kompromiß, Annette sitzt rechtzeitig am Frühstückstisch, löffelt ihre Haferflocken, verdreht auf die vorsichtige Frage, ob sie ihre Mappe gepackt hat, die Augen und muß dann, nachdem sie schon die Treppe runter war, noch mal zurückkommen, weil sie vergessen hat, ihr Russischbuch einzupacken. Klug enthalte ich mich jeglichen Kommentars, und Annette enthält sich jeglichen Anzeichens von Einsicht. So sind wir quitt.
Ich stelle mich auf den kleinen Erkerbalkon an Gerds Arbeitszimmer und blicke ihr nach. Sie hat die dunkelblaue Jacke mit den karierten Aufschlägen an, ihr Pferdeschwanz wippt, ihre Kniekehlen blitzen. Strumpfhosen kommen noch nicht in Frage, wurden entrüstet abgelehnt. Wie jeden Morgen zieht sich mir das Herz ein wenig zusammen, wenn sie weggeht. Wie jeden Morgen frage ich mich, ob wir ihr die andere Schule hätten zumuten sollen, die weiter weg liegt, zu der sie mit der Straßenbahn fahren muß, bloß weil es eine Russischschule ist, an der die besten Schüler aus allen Schulen von Halle gesammelt werden. Ich warte, daß sie sich noch einmal umdreht. Als es fast zu spät ist, tut sie es, ich winke, sie winkt zurück. Dieser Gruß tröstet mich jeden Morgen, unvernünftigerweise.
Tinka hat sich teilweise angezogen, steht im Bad, täuscht eine Wäsche vor, imitiert etwas wie Zähneputzen, schielt dabei zu mir hoch, ich bleibe ernst und bemerke nichts.
Während sie sich die Strümpfe anzieht, wobei ich etwas nachhelfe, weil sie neu und eng sind, erläutert sie beiläufig ihrem abgeschabten Teddy, dem sie großmütig erlaubt hat, in ihrem Bett weiterzuschlafen, daß es leider keine Zahnbürsten für Teddys gibt, sonst würde sie ihm eine kaufen und jeden Morgen und Abend aufpassen, daß er sich gründlich die Zähne putzt. Der Teddy setzt sich mit meiner tiefen Stimme zur Wehr. Er hat Angst vorm Zähneputzen, er glaubt, die Zahnpasta schmecke scheußlich und das Putzen würde den Zähnen weh tun. Da ist ja nun Tinka ganz anderer Meinung, die Zahnpasta schmeckt ein bißchen nach Himbeere, und die Zähne merken nichts vom Putzen. Höchstens fangen sie an, weh zu tun, wenn man sie nicht putzt. Aber der Teddy ist störrisch und uneinsichtig, Tinka muß zuerst sanft, dann immer heftiger auf ihn einreden, er leistet Widerstand bis zuletzt und ruft uns, als wir aus dem Kinderzimmer gehen, in ungehörigem Ton noch nach, daß er sich nie und nimmer die Zähne putzen werde. Tinka schimpft lautstark zurück, sie ist ernsthaft besorgt und entrüstet. Sie weiß ja einerseits genau, mit wessen Stimme der Teddy gesprochen hat, andererseits ist sie überzeugt, daß sie mit ihm geredet hat, mit niemand anderem. Die beiden einander widersprechenden Einsichten und Meinungen laufen in ihrem Kopf unangefochten nebeneinanderher; ich denke, ob Erwachsenwerden bedeutet, Vorstellungswelt und Wirklichkeit streng voneinander trennen zu können – jedenfalls in unseren Breiten. Naturvölker leben in einer Welt, in der die Tiere sprechen und die Elemente Persönlichkeiten sind. Wenn man sie zwingt, »erwachsen« zu werden, flüchten sie sich in den Alkohol. In welchen Ersatz haben sich unsere Vorfahren geflüchtet, als man ihnen die durch Nymphen und Elfen und Götter beseelte Natur nahm, um sie in nutzbare Bestandteile zu zerlegen?
»Honigbrot« ist das Losungswort für jedes Frühstück, es hätte keinen Sinn, Tinka etwas anderes anzubieten. Des langen und breiten erörtert sie mit ihrem Vater den Charakter des Teddys, der macht es sich zu leicht mit der Behauptung, Teddys seien von Natur aus schwierig, und hat dann zu tun, sich von seinem Standpunkt wieder zurückzuziehen, nachdem Tinka ihm viele Beweise für die Sanftmut ihres Teddys geliefert hat. Endlich ist sie bereit, Schuhe und Anorak anzuziehen, ihr Stullentäschchen zu schultern und mit mir zum Kindergarten zu gehen. Ich memoriere im Kopf, was ich einkaufen muß, aber Tinka will noch ein Problem besprechen. In der Nachbarschaft hat ein junges Paar geheiratet, Tinka hat die Einzelheiten der Zeremonie erfahren. Warum kriegt jeder einen Ring, wenn er heiratet? möchte sie wissen. – Damit die anderen Leute sehen, daß man verheiratet ist. – Tinka überlegt. Dann: Ach so. Dann sucht sich ein Mann, der keine Frau hat, nur eine ohne Ring. – So ungefähr. – Aber wenn nun alle Mädchen einen Ring haben, und trotzdem hat der Mann noch keine Frau? – Dann bleibt er alleine übrig. Das kommt vor. – Kann er dann wenigstens Kinder kriegen? – Kaum. Dazu gehören immer Vater und Mutter. – Schade. Dann ist der aber traurig, was?
Ich gebe sie im Kindergarten ab, der merkwürdigerweise »Freie Scholle« heißt. Ich darf ihr keinen Abschiedskuß geben oder ihr nachwinken. Mit steifem Rücken geht sie hinein.
Es muß halb neun gewesen sein, gestern, an dem Tag, den ich beschreibe. Das gehört zu seinem Gerüst, daß es halb neun ist, wenn ich vom Kindergarten nach Hause gehe, dabei das Nötigste einkaufe, Milch, Butter, Äpfel, Schabefleisch, und in Gedanken versinke. Gestern könnte ich, wie öfter in den letzten Tagen, mir überlegt haben, was eigentlich die zwei Jahre in Halle uns bis jetzt gebracht haben. Auf jeden Fall: Einblick in neue, uns vorher ganz unbekannte Verhältnisse. Eine Stadt, die von der Industrie um sie herum bestimmt ist – dadurch allerdings auch von Luftverschmutzung. Der Kontakt mit den Waggonbauern in Ammendorf ist der größte Gewinn. Aber auch: Immer häufiger Überforderungssymptome, Herzschmerzen, Schlaflosigkeit: Schon wieder zu zersplittert, aufgerieben, vom Eigentlichen weggetrieben. Zuviel Kleinkram: Artikelchen, Sitzungen, Verlagsarbeit, Zerstreuung, bin hin und her gerissen zwischen unterschiedlichen Verpflichtungen, von denen keine mich ganz erfüllt – außer wenn ich schreiben kann. Die »Moskauer Novelle« erregte schon Aufsehen als Vorabdruck im »Forum« und trug anscheinend zur Lockerung der kulturpolitischen Atmosphäre bei, ich kann sie eigentlich nur noch als Magazingeschichte sehen, bei Lesungen habe ich Erfolge damit, aber ich will mich heute und immer hüten, das zum Maßstab zu nehmen. Was mich reizt: Diesen Stoff noch einmal durchzuarbeiten, für den Film, zusammen mit Konrad Wolf, der sich dafür interessiert und mit dem wir schon in der DEFA zusammengesessen haben: Die Figur des Pawel gibt ihm die Möglichkeit, autobiographische Elemente einzubringen. Eine neue Ebene, eine Vertiefung der Personen und ihrer Motive scheint mir denkbar. Und: Was aus Moskau herüberdringt über den neuen sowjetischen Film der Jungen, muß sich auf Geist und Stil unseres Films auswirken: Kein Pathos, kein Zugeständnis an das Bedürfnis nach dem »Heldischen«, statt dessen Suche nach dem Verhalten der Personen im Alltag. Darin mit Konrad Wolf vollkommen einig, der offenbar lange schon nach einem Stoff sucht, der ihm diese Stilmittel nahelegt; er scheint sehr unter dem Verbot von »Sonnensucher« zu leiden – sein Film, den wir nicht kennen. – In »unserem« Film wird die Gegenwartsebene die meisten Schwierigkeiten machen: Wie erzählen, daß Pawel und Vera, die sich wiedertreffen, zwischen denen die Zuneigung wieder wächst, die füreinander geschaffen scheinen, sich wieder trennen – aber auf welch andere, nicht endgültige Weise trennen, als damals, nach Kriegsende: Regierte zu der Zeit das Gesetz der Notwendigkeit, ja der Befehl die Beziehungen zwischen unseren beiden Völkern, ist es heute Einsicht. Züge wirklicher menschlicher Freiheit wurden gemeinsam erkämpft, nicht mehr die dumpftierhafte Abhängigkeit von Vorurteilen und Leidenschaften beherrscht das Leben eines Menschen wie Vera. Wie das glaubhaft darstellen, ohne erhobenen Zeigefinger?
Wann war ich gestern am Schreibtisch? Gegen zehn, jedenfalls wieder später als erwünscht. Die Schreibtischplatte ist mit Häufchen von Blättern bedeckt. Die neue Erzählung, die mich seit über einem Jahr beschäftigt. Mindestens fünfmal habe ich angefangen. Bezeichnend schon die Metamorphosen der Titel: »Entdeckungen«, »Begegnung«, »Zur Zeit der Trennung«, vielleicht noch nicht endgültig. Zuerst sollte es, letzten Endes, unter dem Einfluß meiner Erlebnisse im Waggonwerk, eine Brigadegeschichte werden, wie es jetzt viele gibt: Ein Mädchen vom Lande, das in der Stadt Pädagogik studieren will, kommt zum Praktikum in eine Brigade eines Waggonwerks; die Brigade ist berühmt, aber im Innern ist etwas faul. Ein junger Meister, der die Manipulationen des Brigadiers nicht bemerkt hat, wird in die Brigade versetzt, hat es dort zuerst sehr schwer, Rita verliebt sich in ihn, die beiden finden zusammen, die Brigade gesundet . . .
Also eine enge Geschichte, mit Reportagezügen, zweckgebunden, Gebrauchsliteratur, konstruiert, vordergründig, provinziell – ein Wort, das jetzt, mit durch unsere Hilfe, sehr modern wird. In meiner nächsten Konzeption, an der ich (zu) lange festhielt, trifft ein Mädchen nach ihrem ersten Studienjahr am Pädagogischen Institut in Westberlin noch einmal ihren früheren Freund, der vor fast einem Jahr republikflüchtig geworden ist, sie verbringt einen Nachmittag mit ihm, ist aber schon mit einem anderen Mann – dem Meister aus der ersten Fassung – verheiratet. Das Ganze ist für sie also nur noch ein, wenn auch wehmütiger, Abgesang. Manfred steht also schon mehr im Mittelpunkt, schon besser, weil problematischer, aber wieder das leidige Dreiecksverhältnis. Lange habe ich im Kreis gedacht, bis Gerd sagte: Du müßtest anfangen, wenn sie aus Berlin zurückkommt. Also eine neue Variante: Rita noch nicht verheiratet, sie kommt von dem Treffen aus Westberlin zurück, ganz mutlos, muß in ihrer alten Brigade aushelfen, das Werk ist, nicht zuletzt durch westdeutschen Lieferstopp, in unerhörten Schwierigkeiten; sie findet durch die Anspannung der Arbeit – wird in Rückblenden erzählt – wieder zu sich selbst. Sie und Ernst, der junge Werkleiter, nähern sich einander an.
Der junge Werkleiter mit seiner Problematik sollte also mehr in den Vordergrund rücken, als positive Gestalt. War eine Zwischenstufe zu der Erkenntnis, daß ich die Liebesgeschichte des Mädchens Rita Seidel schreiben muß. Eine Geschichte mit unglücklichem Ausgang durch die unselige Spaltung Deutschlands, an der ihr Freund, Manfred, zerbricht. Manfred wird so weit getrieben – in erster Linie durch sich selbst –, daß er die Republik verläßt. Rita bleibt hier, obwohl sie fast daran zugrunde geht.
Diese Konzeption hatte ich angefangen zu verwirklichen vor dem 13. August. Ich mußte sie nicht verändern. Daß Manfred jetzt gar nicht mehr weggehen könnte, ist kein Argument: Ihre Liebe ist vorher zerbrochen, nicht dadurch, daß er weggeht. Allerdings hat die Trennung jetzt etwas Endgültiges und schneidet noch tiefer ein.
Eine Seite an diesem Tag, handschriftlich, nachmittags auf der Maschine korrigiert und zu dem Häufchen der letzten Fassung gelegt.
Mittags Königsberger Klopse, die Gerd gemacht hat, eines der wenigen Gerichte aus der Brandenburger Küche, die er von mir gelernt hat, sonst steuert er mehr aus seiner feineren Thüringer Küche zu unserem Speiseplan bei. Bei Königsberger Klopsen, bei Mohnpielen, bei Blutwurst mit Sauerkraut, bei Grünkohl sehe ich immer meine Großmutter in ihrer Küchenschürze am Herd stehen (ihrer »Kochmaschine«). An einer Gedankenkette, deren einzelne Glieder mir ganz logisch vorkommen, hangele ich mich bis zu der Bemerkung, die ich ausspreche: Was für Katastrophen passieren mußten, daß wir uns kennenlernen konnten. – Wie kommst du darauf. – Durch meine Großmutter. – Gerd versucht meinem Gedankengang nachzugehen: Faschismus, Krieg, Flucht, ein fremder Wohnort als Möglichkeit, sich zu begegnen. – Welche Großmutter, fragt er. – Die, die du kennst. Die für Annette ein Wolljäckchen gestrickt hat, ehe sie starb. Die immer »Jerhard« zu dir gesagt hat. – Die andere Großmutter, die auf der Flucht verhungert ist, kommt nicht ins Gespräch.
Ins Gespräch kommt überraschenderweise die Frage, was uns eigentlich, ganz konkret, in der DDR hielt (und hält), da so viele weggingen. (Diese Frage ist ja nun auch zu einem Unterton in meiner Erzählung geworden.) Im Negativen sofort zu beantworten: Man weiß, was »drüben« gespielt wird, und daß man da nicht hingehört. Im Positiven: daß hier bei uns die Bedingungen zum Menschwerden wachsen. Theoretisch ganz klar. Praktisch: Wachsen sie wirklich? Streuen wir uns nicht oft über die konkreten »inneren Verhältnisse« »unserer Menschen« Sand in die Augen? Zum Beispiel: Ihre Beziehung zur Vergangenheit. Eines Abends, als die Ammendorfer Brigade bei uns war, wurde es erst lebhaft beim Austausch von Kriegserinnerungen. Und so bei vielen Leuten. Es fällt ihnen unendlich schwer, sich selbst gegenüber kritisch zu sein.
Und das in den Zeitungen gerühmte »politische Bewußtsein« der Arbeiter? Viele wirtschaftliche Erfolge haben natürlich als Ursache materielle Berechnungen der Arbeiter zugunsten ihrer Lohntüte, wie es ja nicht anders sein kann. Aber ich erlebe in Ammendorf, daß so etwas wie die Werksehre den Arbeitern nicht gleichgültig ist und daß die Genossen in mühevollen täglichen Diskussionen etwas wie »Bewußtsein« vermitteln. Immerhin bauen sie in unserer Brigade jetzt zehn Fenster pro Schicht, was mir vor einem Jahr noch utopisch erschien. Und sie sind stolz darauf, was sie niemals zugeben würden.
Aber wie viele, denen man es niemals zugetraut hätte, waren am nächsten Morgen verschwunden, Richtung Westen. Ich hatte das Gefühl: Das Land blutet aus. Und die Funktionäre, die in den Ämtern ihre Sessel drücken und Bürokratismus exerzieren, tun das Ihre dazu. Wie lange, fragen wir uns, können wir uns noch mit Brechts Spruch trösten: »Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein«? Wenn aber die Freundlichkeit schwände, was hätte denn all diese unerhörte Anstrengung in diesem Land für einen Sinn?
Mittagsruhe. Las in Aragons »Karwoche«, das mir technische Anregungen gibt, um mich von dem Zwang der Prosa-Konstruktion aus dem 19. Jahrhundert zu entfernen, die bei uns als realistisch gilt, und mir mehr Freiheit dem Stoff gegenüber nehmen zu können. Kurzer Schlaf. Kaffee. Die eine Maschinenseite, die das Ergebnis dieses Tages bleiben wird und die natürlich den handschriftlichen Text verändert hat. Ein mageres Resultat, das sage ich mir fast jeden Tag, während ich wieder zum Kindergarten gehe, um Tinka abzuholen. Ich muß möglichst pünktlich um vier Uhr da sein, sie steht schon abmarschbereit an der Tür, ich vergesse den Blick nicht, als ich es einmal nicht schaffte und sie als letzte abholte. – Wie war’s heute? – Ganz schön. – Was habt ihr gespielt? – Es geht ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Kreis herum. – Aha. Und? – Ich kann bis zehn zählen. – Das konntest du doch schon. – Jetzt kann ich’s richtig. Morgen hab ich Geburtstag. Muß ich da auch zum Kindergarten?
Deutlicher hat sie noch nie gesagt, daß sie lieber zu Hause bleiben möchte. Sie direkt zu fragen, ist sinnlos, sie sagt nichts, wenn sie nicht will. – Morgen hol ich dich mittags ab. Nachmittags feiern wir deinen Geburtstag. Ein verwandeltes fröhliches Kind hüpft neben mir her, während ich spüre, wie mir das Herz schwer wird. Die Kinder sind in letzter Zeit viel kränklich und brauchen Pflege, der Arzt, der zwar freundlich ist, aber von ihnen gehaßt wird, weil er immer Schwitzkuren verordnet, meint, die Hallenser Luft lege sich ihnen auf die Bronchien, man müsse schon abgehärtet sein, um den Chemienebel hier zu vertragen. Sicher spüren sie aber auch meine stumme Verzweiflung, wenn die Tage mir auseinanderlaufen, manchmal lasse ich es sie entgelten, was nicht recht ist und meine Verzweiflung steigert. Es ist doch etwas daran, daß eine Frau in »Künsten und Wissenschaften«, wenn sie Kinder hat, nicht leisten kann, was einem Mann mit gleichen Anlagen zu leisten möglich ist. Ein häufig durchdachtes Kapitel, das einen bitteren Bodensatz hinterläßt, der Gerd rasend macht. Aber die Kinder werden größer, und einmal muß doch wieder Konzentration in mein Leben kommen – wenn ich sie dann nicht schon verlernt habe.
Zu Hause überreicht Tinka mir ihre Stullentasche und witscht sofort um die Hausecke in den Garten zu ihrem Freund Olaf, der schon sehnsüchtig auf sie gewartet hat. Vom Küchenbalkon aus sehe ich sie auf der morschen Bank an der Laube sitzen, in ein Gespräch vertieft, das ich zu gerne belauschen möchte. Man übertreibt wohl nicht, wenn man annimmt, daß Olaf Tinkas erste Liebe ist. Aber ich muß noch eine unruhige halbe Stunde überstehen, ehe auch Annette zu Hause ist – wieder hat sie die Bahn, mit der wir sie erwarten, nicht geschafft, wieder mußte ich mir vorstellen, was ihr alles passiert sein kann, vielleicht ist sie müde, paßt auf der Straße nicht auf, ist durch den langen Schultag überfordert. Meine Erleichterung ist groß, als sie die Treppe raufkommt, unsere Begrüßung ist stürmisch, ein ganzer Abend und eine lange Nacht liegen vor uns, in denen wir alle zusammen in Sicherheit sind und ich mich um keinen sorgen muß. Nicht erst seit dem Krieg und der Flucht, schon als Kind hatte ich diese Katastrophenangst, die ich vor Gerd zu verbergen suche, aber er spürt sie immer. Er sammelt die Kinder ein, während ich Abendbrot mache – ja, Königsberger Klopse wären den Kindern willkommen –, und besieht mit ihnen »Erwachsenenbilderbücher«, eine beliebte Beschäftigung. Am allerliebsten vertiefen sie sich in die Bilder der naiven Maler.
Als ich ins Zimmer komme, um sie zum Abendbrot zu rufen, klappt Tinka gerade einen der Bildbände zu: Habt ihr nur Bilder von Arbeitern? – Warum? – Die will ich nicht mehr sehen. – Warum nicht? – Weiß nicht. Sie sind langweilig. – Aber Arbeiter sind doch sehr wichtig. – Wichtig schon. Aber ich will sie nicht immerzu sehen. – Was willst du denn lieber sehen? – Na, andere Menschen. Oder wie ich mit Berit im Kinderzimmer spiele . . .
Gerd ist entzückt. Literaturkritik auf hohem Niveau, sagt er. Der künftige Leser meldet seine Ansprüche an. Das laß dir mal gesagt sein, Frau Autorin. Keine Arbeiter, wenn’s möglich ist. – Dafür muß ich ihn boxen, Tinka wirft sich sofort auf seine Seite und stellt sich schützend vor ihn, während Annette mit ihrem Gerechtigkeitssinn findet, Vater hätte mir nicht die Freude an den Arbeitern verderben dürfen. Sie weiß, woran ich gerade schreibe.
Das Abendbrot ist ziemlich turbulent, Tinka versucht mit durchsichtigen Tricks, nacheinander aus jedem von uns herauszukriegen, was für Geschenke sie morgen zu erwarten hat, wir drei sind eine undurchdringliche Front, Annette hat es gern, wenn sie bei solchen Gelegenheiten zu den Erwachsenen zählt. Sie darf den Geburtstagstisch in meinem Zimmer mit aufbauen, die fünf Kerzen in den nassen Sand auf dem Teller stecken und ihn mit Asternblüten schmücken, während Tinka schon im Bett liegt und einsames, verstoßenes Kind spielt. Am Ende kriegen beide noch ihr Gute-Nacht-Lied, am liebsten »Der Mond ist aufgegangen«, weil es so viele Strophen hat. Nach der letzten Strophe sagt Tinka jedesmal: Aber wir haben zum Glück keinen kranken Nachbarn, nicht?
Wir machen es uns im Zimmer bequem; ich nehme mir noch die Zeitungen vor, zu denen ich bis jetzt keine Zeit hatte und die ich in zehn Minuten durchgeblättert habe. Offenbar geht es darum, »Bonn« nach der Grenzschließung am 13. August als isoliert darzustellen: »Washington über Bonn verärgert.« »Nur noch Brandt für Adenauers Politik.« »Absage an Brandt-Kurs auf SPD-Versammlung.« »Kofferpacken in Westberlin. Konzerne wie AEG, Siemens, Osram haben begonnen, wichtige Produktionsabteilungen nach Westdeutschland zu verlegen.« »Bonn nach der Wahl: Steuerlasten nehmen zu, Preise steigen rapide.« Und dann ganze Seiten begeisterte Zuschriften aus der Bevölkerung an die Kanzlei des Staatsrates zum Verteidigungsgesetz: »Wir schützen unsere Republik«. Und in der Kultur: »Ein glanzvoller Auftakt: Felsensteins bezaubernder ›Sommernachtstraum‹ zu Beginn der neuen Spielzeit«. Und: »Auf Gagarins und Titows Spuren: Eine Schulsternwarte in der Auguststraße«.
Mein Bruder ruft an; wie es geht, ob die Kinder gesund sind, oberflächlich ist alles in Ordnung, ich merke, daß er nicht in bester Stimmung ist, dann platzt er heraus: Wie er uns beneide, daß wir beide »freiberuflich« arbeiteten, und das ja wohl nicht ohne Grund. (Da hat er recht: Weil die Atmosphäre und die Zumutungen in den Institutionen uns zu sehr belasteten, haben wir uns, zuerst Gerd, aus den jeweiligen Apparaten herausgezogen.) Horst: In den Betrieben und an der Uni sei »keine gute Luft«. – Aber jetzt wehe doch von oben etwas frischer Wind hinein, sage ich. – Er glaubt nicht daran: Taktik, sagt er. Zu viele feige Menschen ohne Gedanken und Initiative drücken die Sessel, man begrüßt sich süßsauer auf Sitzungen, sagt nicht, was man voneinander hält . . . Wie ich das kenne!
Horst gibt aus seinem Gebiet ein paar Beispiele, bei denen die Fehlentscheidungen aus Dummheit und Feigheit gleich Hunderttausende von Mark kosten. Schlimm. Konnte darüber lange nicht einschlafen.
Donnerstag, 27. September 1962
Kleinmachnow, Förster-Funke-Allee