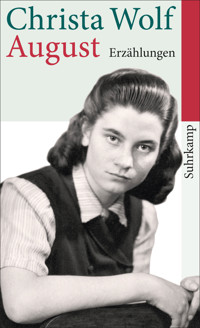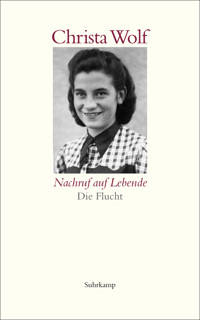
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für die fünfzehnjährige Ich-Erzählerin ist ihre Mutter Charlotte der Mittelpunkt der Familie, geliebt, alles beherrschend und geradeheraus. Das Offensichtliche aber wird auch von Charlotte totgeschwiegen: dass die Nachrichten von der Front beunruhigen und die Flüchtlingstrecks aus dem Osten in immer kürzeren Abständen durch die Stadt ziehen. Bis zu dem Januarmorgen 1945, an dem plötzlich vollgestopfte Bettensäcke im Flur bereitstehen, vom Führerbild an der Wand nur noch ein heller Fleck zu sehen ist und die Mutter ihren Silberfuchs mit einer endgültigen Geste, die ihre Tochter nicht mehr vergessen wird, in den Schrank zurücklegt. Mitreißend, anrührend und mit liebevoller Ironie erzählt Christa Wolf von den inneren Verflechtungen einer Familie, von einer Fünfzehnjährigen, die erwachsen wird, vom Trauma der Flucht. 1971 entstanden, ist diese Erzählung der Auftakt zum späteren, weit ausholenden Kindheitsmuster, dem autobiographischen Meisterwerk, das bis heute ein Weltecho hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Für die fünfzehnjährige Ich-Erzählerin ist ihre Mutter Charlotte der Mittelpunkt der Familie, geliebt, alles beherrschend und geradeheraus. Das Offensichtliche aber wird auch von Charlotte totgeschwiegen: daß die Nachrichten von der Front beunruhigen und die Flüchtlingstrecks aus dem Osten in immer kürzeren Abständen durch die Stadt ziehen. Bis zu dem Januarmorgen 1945, an dem plötzlich vollgestopfte Bettensäcke im Flur bereitstehen, vom Führerbild an der Wand nur noch ein heller Fleck zu sehen ist und die Mutter ihren Silberfuchs mit einer endgültigen Geste in den Schrank zurücklegt, die ihre Tochter nicht mehr vergessen wird.
Mitreißend, anrührend und mit liebevoller Ironie erzählt Christa Wolf von den inneren Verflechtungen einer Familie, von einer Fünfzehnjährigen, die erwachsen wird, vom Trauma der Flucht. 1971 entstanden, ist diese hier erstmals veröffentlichte Erzählung der Auftakt zum späteren, weit ausholenden Kindheitsmuster, dem autobiographischen Meisterwerk, das bis heute ein Weltecho hat.
Christa Wolf, geboren am 18. März 1929 in Landsberg/Warthe (Gorzów Wielkopolski), wurde für ihr Werk mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Georg-Büchner-Preis sowie zuletzt dem Thomas-Mann- und dem Uwe-Johnson-Preis. Sie starb am 1. Dezember 2011 in Berlin.
Christa Wolf
Nachruf auf Lebende
Die Flucht
Mit einem Nachwort vonGerhard Wolf
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4506.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2014
© 2010 Gerbrand Bakker und Uitgiverij Cossee BV, Amsterdam
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Hümmer, Waldbüttelbrunn
Umschlagfoto: Archiv Gerhard Wolf
eISBN 978-3-518-73714-9
www.suhrkamp.de
Nachruf auf Lebende
In die Erinnerung muß man einen
Hauch von Gegenwart einblasen.
Kazimierz Brandys
1.
Nein, so ist es nicht gewesen. Wenn ihr es wissen wollt: Das einzig wirklich Lästige war das Gezänk, das auch jetzt nicht aufhörte. Jedermann sah in mir noch das Kind, und ich hatte aufgehört, Erklärungen abzugeben, aber einmal würde ich es ihnen sagen, in aller Liebe, denn ich hing ja an ihnen, das war es doch. Einmal würde ich ihnen sagen, dachte ich damals, doch ich habe es nie getan: Man muß darauf sehen, daß man sich angemessen benimmt. Wirklich, mir lag daran, obwohl ich nicht weiß, woher ich es hatte – von dieser Familie doch nicht. Oder gerade? Von meiner Mutter vielleicht, in deren großen Ausbrüchen ein verzweifeltes Flehen um Würde steckte? Oder von meinem Vater, der diesen Appell absichtlich überhörte, weil er ihm nicht gewachsen war?
Doch, das weiß man mit fünfzehn Jahren. Übrigens waren die Väter ja abwesend. Der meine zog mit einer Gruppe gefangener Franzosen, zu deren Bewachungspersonal er gehörte – eine Stellung, die sich noch am gleichen Tag radikal in ihr Gegenteil verkehren sollte –, eben jene Soldiner Straße befehlsgemäß in Richtung Nordosten, deren Anfang ich sehen konnte, wenn ich aus dem Wohnzimmerfenster blickte. Es fing endlich an, hell zu werden, das war mir recht, der Morgen würde diesem ganzen Gerenne und Geschreie und Geschluchze ein Ende machen. Viereckige schwarze Klötze tauchten aus dem weißen Schnee auf, es dauerte ein Weilchen, ehe mir klar wurde, daß viele der Leute, die nachts oder vielleicht jetzt erst, vor Minuten, an unserem Haus vorbeigezogen waren, gerade hier, an der Ecke, ihre Koffer einfach in den Schnee gestellt hatten. Ich hatte ja immer, wenn ich oben von meinem Fenster aus die ganze Stadt und den Fluß übersehen hatte, unser Haus als eine Art Vorposten betrachtet, denn was danach kam, konnte man beim besten Willen nicht mehr Stadt nennen. Aber der Gedanke, daß es für die vorbeiziehenden Flüchtlinge genau auf der Grenze zwischen Hoffnung und Verzweiflung stand, war mir unheimlich. Denn dazwischen läuft dieser haarschmale Streifen von Gleichgültigkeit, die ich fürchtete, weil ich von ihr bedroht war.
Es war mir nämlich gleichgültig, was mit den Goldrandtassen im Buffet geschehen würde; und ob man sie einschließen und den Schlüssel an sich nehmen oder ob man ihn stecken lassen sollte, damit der Feind, der hier bald hausen würde, wenigstens die Möbel nicht beschädigen müßte, um an die Tassen zu kommen – die Frage ließ mich kalt. Mit Recht warf mir die Mutter vor, daß ich allen im Wege stand und kein Wort aus mir herauszukriegen war, denn meine wirkliche Meinung wäre gewesen, daß man, trotz aller Angst, nach Osten, dem Kanonendonner entgegenziehen und mit allen Mitteln verhindern müsse, daß der Feind die Stadt besetze. Zugleich wußte ich wie immer in Katastrophenfällen, daß das Schlimmste, vor dem sie alle durch ihr kopfloses Gehabe davonzukommen suchten, schon eingetreten war. Ich wußte seit dem Bruchteil der Sekunde, da ich wach wurde, den Umriß meiner Mutter im Türspalt gegen den hellen Flur sah und ihre Worte hörte, die nicht anders waren als sonst, wenn sie uns für die nächtlichen Fliegeralarme weckte: Ihr müßt euch fertigmachen – ich wußte durch den Klang ihrer Stimme, in der das Wissen um die ganze Wahrheit war und auch das Entsetzen über dieses Wissen, daß ich sie zum letzten Mal so in der Tür unseres Kinderzimmers stehen sah, in dem ich wieder mit meinem Bruder Bodo, den ich Oddo nannte, zusammen schlief, seit Flüchtlinge, Verwandte aus Ostpreußen, mein Mädchenzimmer im ersten Stock bezogen hatten. In dem Augenblick vor ihrem nächsten Satz hatte ich alles begriffen und – vielleicht, weil ein langer Abschied unerträglich gewesen wäre – schon alles hinter mir gelassen, alles schon verraten, und mir graute vor mir selbst, während meine Mutter weitersprach: Es ist soweit. Wir müssen weg.
Ihr werdet nicht begreifen, daß vorher niemals zwischen uns davon die Rede gewesen war. Niemals von Weggehen, niemals von Flucht, und niemals von Niederlage. Daß meine Mutter davon gesprochen hatte, im Laden, und in der ungeeigneten Gegenwart der NS-Frauenschaftsführerin, und was für Folgen das hatte – das alles erfuhren wir später. Denn die Aussichten, etwas Stichhaltiges über die Meinung der eigenen Eltern oder über den Verlauf des Krieges oder über allgemeine Lebenszustände zu erfahren, waren nicht gerade günstig für Kinder eines Lebensmittelkaufmanns, die in einer mittleren, für gepflegte Parks bekannten Stadt jenseits der Oder eine Oberschule besuchten, wofür ihr Vater monatlich 18 deutsche Reichsmark widerspruchslos an die Schulbehörde überwies. Keiner von uns Kindern hatte je einen Zweifel gelassen, daß er nicht gewillt war, das Geschäft einst zu übernehmen, und es ist auch nie ein Druck auf uns ausgeübt worden – aus Gründen, die ich heute besser verstehe als damals. Jedenfalls bekam mein Bruder Oddo zu Weihnachten den neuen Zusatzkasten zum Stabilbaukasten, der es ihm erlaubte, seine Krananlage um einen Schreitbagger zu erweitern, und ich sammelte unangefochten die Kinder der Nachbarschaft »auf den Röhren« zum Schulunterricht. Sie will ja Lehrerin werden, hieß es von mir, es gab eine wohlwollende Übereinkunft zwischen allen meinen Lehrern und allen meinen Verwandten – unter denen es Buchhalter und Schlossermeister und Fuhrunternehmer gab, aber keinen Lehrer – und mir selbst, einen Respekt, der mich trug und den ich unverfroren ausnutzte, wenn es nötig wurde. Sie hat ja wieder das beste Zeugnis, hieß es, oder nein – das zweitbeste nur diesmal? Immerhin. Ihr fällt ja das Lernen leicht, sie hat ja einen Kopf, mit dem sich was anfangen läßt, bleib nur brav, mein Kind, fleißig bist du ja sowieso, hier hast du eine Mark, für das gute Zeugnis. Die Großmutter in Heinersdorf gab fünfzig Pfennig, sie sagte, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, als wir so alt waren wie ihr, wußten wir nicht, wie ein Groschen aussieht, wenn wir ihn uns nicht selbst verdient hatten.
Die Heinersdorf-Großeltern würden hierbleiben, hieß es, an jenem Morgen, dessen Datum ich mir merken wollte. Es war der dreißigste Januar neunzehnhundertfünfundvierzig. Heinersdorf-Oma hatte erklärt, man müsse sie schon aus ihrem Haus heraustragen, freiwillig verlasse sie es nicht, und dieser Ausspruch entsprach unseren Erwartungen. So kam es, daß wir sie bei unserem Weihnachtsbesuch im alten Jahr vierundvierzig zum letzten Mal gesehen haben, wie immer hatten sie das Wohnzimmer für den ersten Feiertag geheizt, Heinersdorf-Oma wärmte sich ihr Kreuz am Ofen, der Streuselkuchen war so gut, wie er heute leider nicht mehr gebacken wird, Urgroßvater war nicht mehr bei Tisch zugelassen, er aß unmanierlich, und er war ja auch so gut wie taub. Außerdem hatte er ja sein schönes Zimmer, und wenn der Mensch hoch über neunzig ist, wartet er auf den Tod, sagte Heinersdorf-Oma. Sie wartete auf den Tod ihres Vaters, wie mein Bruder schon als kleiner Junge auf die versprochene Erb-Uhr des Urgroßvaters gewartet und ihn häufig mit der Mahnung geärgert hatte, daß er endlich sterben solle. Urgroßvater aber starb überhaupt nicht von selbst, wenn man in seiner Jugend durch halb Polen und Schlesien als Saisonschnitter gezogen ist, hat man Kräfte gesammelt für ein ganzes Jahrhundert. Urgroßvater wollte nicht »woanders« leben, er hat sich erhängt, als die Heinersdorf-Großeltern im Juni evakuiert wurden, Nachbarn haben ihn abgeschnitten und die Nachricht über die Oder gebracht, wo Heinersdorf-Oma im Herbst in einem konfessionellen Heim verhungert ist. Ihr Grab liegt in Bernaux und wird regelmäßig besucht, und zwar vor jedem Totensonntag von meinem Vater, ihrem Sohn, und einmal jährlich von meiner Tante Magda, heute Bremen, die wir als Kinder Tante Leni nannten. Sie heißt Magdalene und sollte an jenem Morgen mit uns gemeinsam die Stadt verlassen, diesmal endgültig, in die sie zehn Jahre vorher als geschiedene Frau nach einer verunglückten Ehe mit einem Schweriner Tankstellen- und Autoreparaturbesitzer – einer Ehe, der sie bis an ihr Lebensende eine dankbare Erinnerung bewahren wird – hatte zurückkehren müssen. Achim, ihr angenommener Sohn, dessen Mutter ein gutaussehendes, geistig normales Dienstmädchen war und dessen Vater ein SS-Sturmbannführer, dem man äußerlich auch nichts hatte ansehen können – Achim also, der ursprünglich Sieghurt geheißen hatte und von Tante Lenis Gatten, dem Tankstellenbesitzer, umgetauft worden war, schlug in der Schule nicht so gut an, er war ein Beweis dafür, daß man nie wissen kann, was in angenommenen Kindern drinsteckt, aber immerhin würde auch er nun, zehnjährig, mit uns auf diesen Treck gehen.
Immerhin war es eigentlich beschämend, wie leicht wir alle, gemessen an der Standfestigkeit der Heinersdorf-Großeltern, zu vertreiben waren. Da brauchte nur dieser Drahtfunksprecher, der sonst für die Luftlagemeldungen zuständig war und der sich sicher jedesmal, ehe man ihm das Mikrophon freigab, »kernig!« zurief – der brauchte nur etwas Angst in die Stimme zu kriegen, richtiger gesagt, Panik, je näher der Morgen und der Feind rückte; sowjetische Panzerspitzen, sagte er, und allerdings hätte ihm kein Wort einfallen können, das der tapferen Bevölkerung unserer Heimatstadt – so redete er uns an – tiefer in die Glieder hätte fahren können. Ich glaube nicht, daß er »Rette sich, wer kann!« gerufen hat, aber ich glaube, daß er sich nach seiner letzten Durchsage hat retten können, beim Krankenhaus am Osteingang der Stadt habe sich Volkssturm verbarrikadiert, trotzdem rate der Kreisleiter der tapferen, schwer geprüften Bevölkerung unserer unvergeßlichen Heimatstadt …
Feige Schweine, sagte meine Mutter. Sie sprach sonst nicht so, oder nur bei seltenen Anlässen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Sie hatte Kraftausdrücke nicht gern, sie besaß etwas mehr Bildung, als die Frau eines Lebensmittelkaufmanns besitzen muß, sie hatte, wie auch ihre Geschwister, Tante Lissy und Onkel Herbert, die Mittelschule in der Zimmerstraße besucht, die übrigens in der Nähe des jetzt von Volkssturm verbarrikadierten Krankenhauses lag. Dort hatte eine Französischlehrerin, die Fräulein Scharnowsky hieß und von ihren Schülerinnen heimlich »Mopsky« genannt wurde, sie durchaus nicht leiden können, um keinen Preis, all die Jahre nicht, denn sie, meine Mutter, hatte dieser Mademoiselle gleich am Anfang, in Unkenntnis ihrer Bazillenfurcht, versehentlich lange und herzlich die Hand gedrückt. Charlotte, hieß es seitdem, deine Aussprache befriedigt mich nicht! Und noch ich, fünfundzwanzig Jahre später, litt in meinem Bett unter der frühen Ungerechtigkeit, der meine Mutter ausgesetzt war, und bestätigte ihr stürmisch ihre tadellose französische Aussprache, wenn sie mir das einzige französische Liedchen vorsang, das sie konnte: Au clair de la lune … Denn singen konnte sie, meine Mutter, da biß auch das übellaunige, nachträgerische Fräulein Mopsky keinen Faden von ab, sie sang ja schon als Volksschülerin im Kirchenchor »Vom Himmel hoch, da komm ich her«, wozu meine Großmutter, Schneiderin von Beruf, ihr ein langes weißes Gewand und goldpapierbeklebte Flügel angefertigt hatte, niemand sollte denken, meine Mutter käme aus einem armen Haus, was sie aber dennoch tat. Zwar hatte sie am Tage ihres Auftritts in der kalten Kirche eine heftige Angina, aber der Kirchenvorstand flehte, sie könne sie doch nicht alle sitzenlassen, und schickte eine geschlossene Kutsche, mit zwei Pferden, und in dieser wurden meine achtjährige Mutter mit den Engelsflügeln und meine Großmutter, die jetzt oben in ihrer Wohnung alle Türen abschloß, zur Konkordienkirche gefahren. Sie soll wie ein Engel gesungen und dann drei Wochen das Bett gehütet haben.
Mit den Ostpreußen und den Westpreußen war es etwas anderes als mit uns, ich hatte sie wochenlang beobachtet, seit die Schule nicht mehr stattfand oder vielmehr für die Flüchtlinge stattfand, die in den Klassenzimmern und besonders in der Turnhalle auf Stroh lagen. Mir kam es so vor, daß diese Menschen aus irgendeinem Grund besser für den Treck geschaffen waren als wir, denn sie hatten praktische Techniken ihres Alltagslebens und einen Gesichtsausdruck entwickelt, die ich uns einfach nicht zutrauen konnte. Und da wir in einer Luft aufwuchsen, in der der Spruch »Jedem das Seine!« lag, zweifelte ich nicht, daß die Flucht das Unsere nicht sein konnte. Je bekannter die Namen der Orte wurden, welche die Flüchtlinge nannten, wenn wir ihnen Kräutertee und Mettwurstbrote reichten, je dichter und hastiger die Trecks, deren Teilnehmer zuletzt nur noch mit Hohnlachen auf die Aufforderung reagierten, bei uns Rast zu machen, um so hartnäckiger schwiegen wir. Gewiß, heimlich, bei Nacht vermutlich, wurden Koffer gepackt und Bettensäcke gestopft, wie sich jetzt herausstellte, und ich wurde, wie immer in solchen Fällen, nicht eingeweiht, denn Kinder sind zu schonen, Kinder dürfen nicht alles wissen, Kinder müssen trotz allem eine glückliche Kindheit haben, Kinder verplappern sich ungewollt. Oder gewollt.
Kinder wissen von nichts.
Ich reagierte auf das verdrängte Wissen mit einem Weinkrampf, den meine Mutter Schwächeanfall nannte – sie hat sich ja auch überanstrengt, das Kind! – und von unserem Mädchen Elli mit einer großen Tasse heißen Pfefferminztees kurieren ließ. Morgen bleibst du aber zu Hause, nicht wahr, morgen gehst du nicht zur Flüchtlingsbetreuung, ich rufe deine Lehrerin an. Das tat sie, und so war sie es, meine Mutter, die zuletzt mit meiner angebeteten Lehrerin sprach, Fräulein Dr. Strauch, die volles Verständnis und Entgegenkommen zeigte und meine Einsatzbereitschaft ausdrücklich lobte. Aber den kleinen Jungen wollte meine Mutter doch nicht aufnehmen, nicht einmal solange, bis seine eigene Mutter in aller Ruhe hatte entbinden können, was unmittelbar bevorstand, wie die Hebamme ihr in meiner Gegenwart in der überfüllten Turnhalle der Hermann-Göring-Schule versichert hatte. Allerdings erst, wenn es ihr gelungen sein würde, warme Füße zu bekommen, mit kalten Füßen spielt sich gar nischt ab, junge Frau, kein einziges Baby auf der ganzen Welt geht zu einer Mutter, die kalte Füße hat. Nein, sagte meine Mutter, wir können den Jungen nicht nehmen, was sollen wir mit ihm machen, wenn wir selber … Da hätte sie es fast ausgesprochen, wenn ich nicht sofort in meinen Weinkrampf verfallen wäre, der nicht nur mit dieser fehlenden Satzhälfte zusammenhing, die ich nicht hören wollte, sondern auch mit dem kleinen steifen Paket, das ich am Abend aus einem der Flüchtlingswagen herausgeholt und an die Mutter weitergereicht hatte, die es aufwickelte und in schrille Schreie ausbrach. In diesem Januar waren Temperaturen von zwanzig Grad unter Null ja keine Seltenheit, man kann nicht unbegrenzte Zeit eine Säuglingen zuträgliche Temperatur in einem Treckwagen aufrechterhalten, das leuchtete jedem ein, aber ich wollte das erfrorene Kind nicht sehen, ich wollte diese Steife loswerden, die in meinen Armen zurückgeblieben war, ich wollte eine gute Tat tun und den kleinen Jungen der Schwangeren nach Hause bringen, ich wollte glauben, daß ich mein Zuhause noch anderen Leuten anbieten konnte, ohne sie zu betrügen, ich kriegte das alles nicht fertig, da brach ich in Tränen aus und trank in großen Schlucken den heißen süßen Pfefferminztee.