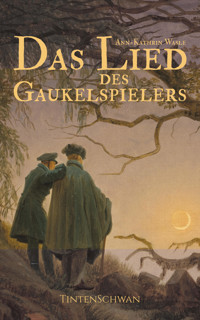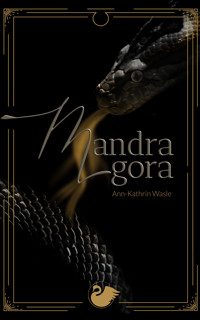
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TintenSchwan
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Doch die Schlange war klüger als alle Tiere des Feldes, die der Herrgott geschaffen hatte. Und sie sprach zu der Frau: Nun, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht von jedem Baum des Gartens essen? Prag, heute: Eine unerwartete Einladung führt Lucián in den alten Glockenturm, wo sich eine Handvoll unsterblicher Geistwesen versammelt hat, um mit einigen Flaschen Wein den Abend zu verbringen. Die Anstifterin dieses Zusammentreffens ist Nyoka, die älteste der Anwesenden. Sie hat schon gelauscht, als die Wunderkinder Mozart durch Europa fuhren, und sie hat Kleopatra einst in ihrer dunkelsten Stunde Mut zugesprochen. Seit Jahrtausenden hat sie die Menschheit begleitet und ist all jenen zur Seite gestanden, die sie für würdig erachtet hat. So ist es kaum verwunderlich, dass Nyoka auch am heutigen Abend ihre Gästeschar aus Menschen und Geistern nicht zufällig ausgewählt hat. Die Frage ist nur, wen sie nun unter ihre schwarzen Fittiche nehmen will …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ann-Kathrin Wasle
Mandragora
www.TintenSchwan.de
TintenSchwan
Buchbeschreibung:
Doch die Schlange war klüger als alle Tiere des Feldes, die der Herrgott geschaffen hatte. Und sie sprach zu der Frau: Nun, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht von jedem Baum des Gartens essen?
Prag, heute: Eine unerwartete Einladung führt Lucián in den alten Glockenturm, wo sich eine Handvoll unsterblicher Geistwesen versammelt hat, um mit einigen Flaschen Wein den Abend zu verbringen.
Die Anstifterin dieses Zusammentreffens ist Nyoka, die älteste der Anwesenden. Sie hat schon gelauscht, als die Wunderkinder Mozart durch Europa fuhren, und sie hat Kleopatra einst in ihrer dunkelsten Stunde Mut zugesprochen. Seit Jahrtausenden hat sie die Menschheit begleitet und ist all jenen zur Seite gestanden, die sie für würdig erachtet hat.
So ist es kaum verwunderlich, dass Nyoka auch am heutigen Abend ihre Gästeschar aus Menschen und Geistern nicht zufällig ausgewählt hat. Die Frage ist nur, wen sie nun unter ihre schwarzen Fittiche nehmen will …
Über die Autorin:
Ann-Kathrin Wasle schreibt Historisches mit einem Hauch Phantastik. Ihre Romane zeichnen sich durch einen magischen Realismus aus, der verschiedene Einflüsse zu einem neuen Ganzen vereint. Gleich ob ihre Geschichten in der heutigen Zeit spielen oder in vergangenen Jahrhunderten, immer wird ihre Welt durchströmt von einer mystischen Aura, die ihre Figuren und die Leser gleichermaßen verzaubert.
Eigentlich hat Ann-Kathrin Mathematik studiert und mehrere Jahre als Software-Entwickler gearbeitet, doch bald stellte sie fest, dass ihr das nicht reicht. Also begann sie damit, in ihrer freien Zeit an ihrem ersten historischen Roman zu schreiben. Zurzeit wohnt sie zusammen mit ihrem Mann, ihren beiden Kindern und ein paar Freunden in einer quirligen Hausgemeinschaft am Rand der Karlsruher Rheinauen.
© 2022 Ann-Kathrin Wasle
Hirtenweg 22
76287 Rheinstetten
Lektorat: Martha Wilhelm
Coverdesign: Vanessa Hahn
Ein Sensitivity-Reading mit Schwerpunkt auf Anti-Schwarzen Rassismus wurde von zwei betroffenen Personen durchgeführt.
ISBN: 978-3-949198-10-6
1. Auflage, Oktober 2022
»Weiche von mir, Versucher!«
– Jesus von Nazareth
Evangelium nach Matthäus
Die Bibel
Alexandria, 30 v. Chr.
Die Königin lehnt auf ihrem Diwan und betrachtet nachdenklich die Feige in ihrer Hand. Dabei lauscht sie der Rede ihres Besuchers. Der magere Römer steht wenige Schritte entfernt neben einer marmornen Säule, die Arme vor der Brust verschränkt und ein verächtliches Lächeln auf den Lippen. Seine gesamte Haltung zeugt von einer Geringschätzung, die seine huldvollen Worte Lügen straft.
»Ich hoffe, dass du mir meine Offenheit verzeihen wirst, o Königin. Aber deine Flotte ist zerstört, deine Truppen haben keinen Feldherrn mehr, der sie führen könnte. Ägypten hat diesen Krieg verloren – ich nehme an, das ist dir ebenso klar wie mir. Doch das muss nicht das Ende für das ägyptische Reich sein.« Aus halbgeschlossenen Augen sieht er auf sie herab. »Du könntest dich entschließen, mit mir zusammenzuarbeiten. Ägypten wird von nun an natürlich unter römischer Herrschaft stehen, als treuer Vasallenstaat des Imperiums. Aber auch dafür brauchen wir einen Statthalter – deinen ältesten Sohn zum Beispiel …«
»Er ist nicht mehr hier«, versetzt Kleopatra knapp. »Er ist nach Süden gezogen, am selben Tag, da deine Truppen in Alexandria gelandet sind, o großer Octavian.« Die letzten Worte sind in einem freundlichen Spott gesprochen, den sie sich nicht verbeißen kann.
Octavian lässt für einen Moment die Maske fallen und funkelt sie ärgerlich an. »Der offizielle Titel ist nun Imperator Caesar Divi filius«, stellt er in verschnupftem Tonfall fest. »Du könntest dich langsam daran gewöhnen.«
Mit einem Schnauben führt Kleopatra die Feige zum Mund und beißt hinein. Octavianus ist der Name, der ihr Gegenüber als Caesars Adoptivsohn kennzeichnet … Nie wird er die gleiche Stellung einnehmen wie ihr Caesarion, der einzig wahre Erbe Caesars. Sie bemüht sich, eine ruhige Miene zu zeigen, während sie die süße Frucht schmeckt.
In Wahrheit ist ihr kaum nach Essen zumute. Der Krieg ist zu Ende, wenigstens darin hat Octavian recht. Das ägyptische Heer hat kapituliert, ihre Flotte ist gesunken. Und Marcus Antonius – ihr geliebter Antonius – hat sich aus Verzweiflung in sein eigenes Schwert gestürzt. Kleopatra muss sich mit aller Gewalt zur Ruhe rufen, um den aufquellenden Schmerz zu verwinden. Niemand ist mehr da, um Ägypten vor Roms gierigem Rachen zu beschützen – niemand außer ihr selbst, und sie ist eine Gefangene in ihrem eigenen Palast.
Es ist vorbei. Ägypten wird verfallen; Rom wird ihr goldenes Königreich ausbluten lassen bis auf die letzte Ähre.
Und alles wegen dieses Bürschleins, dieses schwächlichen Adoptivsohns des großen Caesars, der selbst noch nie an einer Schlacht teilgenommen hat. All seinen Ruhm hat Octavian sich durch Lug und Täuschung ergaunert – vom römischen Volk, vom Senat und nicht zuletzt von Marcus Antonius, seinem früheren Schwager und Freund. Die Zeit, die Antonius in der Ferne verbrachte, um für Rom zu kämpfen, hat Octavian genutzt, um in der Hauptstadt gegen ihn zu hetzen und ihn zum Staatsfeind erklären zu lassen.
Unter halb erhobenen Lidern hervor mustert Kleopatra ihn, wie er vor ihr steht, schwitzend in seiner Prachtrüstung mit dem purpurfarbenen Umhang und den hohen Sandalen, die seine schmächtige Statur etwas größer erscheinen lassen sollen. Seine Lippen sind abschätzig verzogen und Schweißtropfen rinnen ihm die Stirn hinab. Kleopatra hat mit dem Gedanken gespielt, ihn für sich zu gewinnen; ihn zu bezirzen, wie es ihr schon mit Antonius so mühelos gelungen ist – auch aus diesem Grund hat sie heute das goldgetrimmte Leinenkleid gewählt, das ihre Schultern und Teile ihrer Arme zeigt. Aber der Anblick seiner käsigen Züge lässt einen Widerwillen in ihr aufsteigen, den keine Strategie der Welt aufwiegen kann. Eher würde sie sterben, als sich solch eine Schmach anzutun.
»Möchtet Ihr noch mehr Feigen, o große Königin?«
Die Frage reißt Kleopatra aus ihren Gedanken. Neben ihrem Diwan wartet eine Dienerin mit einem tönernen Krug, der bis zum Rand mit den süßen Früchten gefüllt ist. Sie will schon ungeduldig abwinken – da hebt die Dienerin den Kopf und ein Paar goldener Augen sieht ihr aus dem schwarzen Gesicht entgegen.
Erstarrt erwidert Kleopatra den Blick. Sie kennt diese Züge, auch wenn es lange her ist, seit sie die andere zum letzten Mal gesehen hat. Nyoka. Schon hebt sie den Arm, streckt ihre Finger nach der Frau aus …
»… also, was schlägst du wegen deiner Nachkommenschaft vor, Königin?«
Octavians Worte lassen sie innehalten. Sie räuspert sich, während sie sich in Erinnerung ruft, was der Römer gerade gesagt hat. Ihre Nachkommen … Natürlich: Selene, Helios und Philadelphos, ihre und Antonius’ Kinder, befinden sich allesamt in Octavians Gewalt. Aus dem Augenwinkel sieht sie, wie sich die Frau mit dem Krug von dannen macht.
»Nun«, antwortet Kleopatra und bemüht sich, eine zuversichtliche Miene zu zeigen. »Du sagtest, du brauchst einen Statthalter. Da sich Caesarion nun einmal nicht im Land befindet, wäre das vielleicht eine geeignete Position für Alexander Helios. Seine Schwester Selene könnte ihm nach ägyptischer Tradition zur Seite stehen. Alles unter der leitenden Hand Roms, versteht sich.«
Octavian setzt einen nachdenklichen Gesichtsausdruck auf, dann nickt er bedächtig. »Das wäre in der Tat eine Möglichkeit. Wie alt ist der Knabe – zehn? Solch ein Arrangement hätte den Vorteil, dass es dem ägyptischen Volk entgegenkommen würde. Ich werde mit meinen Beratern darüber reden.«
»Das freut mich.« Kleopatra zwingt sich, sein Nicken zu erwidern. Das Lächeln, das sie auf ihre Züge presst, schmerzt auf ihren Lippen.
Es ist gelogen … Jedes Wort, das Octavian von sich gibt, ist gelogen. Niemals würde dieser rachsüchtige Feigling es in Betracht ziehen, Marcus Antonius’ Sohn den ägyptischen Thron zu überlassen, selbst wenn es nur als Marionette des Römischen Imperiums wäre. Außerdem, wann hätte es Rom je interessiert, was die Menschen der Vasallenstaaten von ihrer Regierung halten?
Was auch immer Octavian für sie und ihre Kinder geplant hat, es muss so grausam sein, dass er sich nicht einmal jetzt traut, seiner Gefangenen die Wahrheit ins Gesicht zu sagen.
»Nun denn.« Mit einem Seufzen löst Octavian sich von der Säule und versucht unauffällig, sich den Schweiß vom Nacken zu reiben. »Damit wäre wohl fürs Erste alles geklärt. Ich freue mich, dass du dich so zugänglich zeigst.«
Kleopatra antwortet ihm mit einem unverbindlichen Lächeln. Auch sie setzt sich auf ihrer Liege auf. »Ich danke dir für deine Freundlichkeit und für die Gnade, die du mir und meiner Familie erweist.«
Sie weiß, dass die höflichen Floskeln notwendig sind, zumindest für den Moment. Dennoch schmecken die Worte wie Asche in ihrem Mund.
Ohne ihr Lächeln aufzugeben, sieht sie zu, wie der römische Imperator sich knapp von ihr verabschiedet und dann durch die offene Halle hinausgeht. Erst als er sicher außer Hörweite ist, lässt sie die Grimasse sinken. Sie beißt sich auf die Fingerknöchel und stößt einen wimmernden Laut der Qual aus, um wenigstens einem kleinen Teil ihrer Gefühle Raum zu geben.
Mit eiligem Schritt betritt Kleopatra ihre persönlichen Gemächer und lässt ihren Blick über die übriggebliebene Dienerschaft gleiten, die in banger Erwartung zu ihr aufschaut.
Nyoka … Wo ist sie nur hingegangen?
Kleopatra weiß, was sie gesehen hat. Sie kennt niemanden sonst mit solchen Augen, niemanden, der ihren Ausdruck so unverstellt erwidert. Mühsam zwingt sie sich zur Ruhe, während sie die Dienerinnen eine nach der anderen mustert. Es sind nicht mehr viele bei ihr; vielleicht ein halbes Dutzend Frauen und ein paar Eunuchen, die sich hinter dem gefliesten Brunnen in der Mitte des Raumes gesammelt haben, um ihren forschenden Blick über das Wasserbecken hinweg zu erwidern.
Und wenn es wirklich Nyoka war – könnte das womöglich alles ändern? Kleopatra erinnert sich an frühere Gelegenheiten, da ihre Freundin ihr in höchster Not geholfen hat. Nyoka war es, die ihr damals den Mut zugesprochen hat, sich in tiefster Nacht in den eigenen, von Römern besetzten Palast zu schleichen und dem allmächtigen Caesar unter die Augen zu treten. Mehr als einmal hat Kleopatra ihren Thron und ihr Reich mit Zähnen und Klauen verteidigen müssen – und jedes Mal stand Nyoka ihr dabei zur Seite. Warum sollte es heute anders sein?
Ist ihr Kampf vielleicht doch noch nicht zu Ende?
»Herrin?«
Abrupt wendet Kleopatra sich um. Vor ihr steht Charmion, ihre erste Hofdame, und sieht sie mit einer Mischung aus Sorge und Mitgefühl an. Kleopatra schließt die Augen. Sie stößt die Luft aus und zwingt sich zu einem gesetzten Lächeln. »Es ist schon gut, Charmion. Ich habe nur … Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen.«
Der Ausdruck ihrer Dienerin wird noch sorgenvoller. Kleopatra bemerkt, dass das Leinenkleid ihr über die bronzefarbene Schulter gerutscht ist – eine Unachtsamkeit, die so gar nicht zu der sorgsamen Hofdame passt. Im gesamten Palast herrscht zurzeit eine ungewohnte Aufregung, die nicht einmal vor ihren engsten Kreisen haltgemacht hat.
Charmion sieht sie noch einen Moment zögernd an, dann senkt sie den Kopf, wie um dem Blick ihrer Herrin auszuweichen. »O große Königin, ich muss dir etwas sagen. Dolabella ist hier gewesen – er hat Octavians Besuch genutzt, um unbemerkt mit mir zu sprechen. Du weißt, dass er dir immer zugetan war …«
Kleopatra nickt langsam. Cornelius Dolabella, einer der niederen Heerführer unter Octavian … Sie kennt ihn aus ihrer Zeit in Rom, als er sich unter Caesar – ihrem, dem wahren Caesar – mit seinen Siegestaten hervorgetan hat. Schon damals hat er ihr bewundernde Blicke zugeworfen, keusch und unaufdringlich natürlich, wie es sich für die Erwählte seines Imperators ziemte.
Und nun hat er die Todesgefahr auf sich genommen, sich aus Octavians Heer zu schleichen, um ihr eine Nachricht zu senden. Welche Worte können solch ein Risiko wohl wert sein?
»Was hat er gesagt?«, fragt sie, den Blick auf das glitzernde Wasser gerichtet. Mit den Händen fährt sie sich über die Oberarme, die nur zur Hälfte von dem goldbestickten Stoff umhüllt sind. Mit einem Mal scheint es ihr in dem sonnendurchfluteten Palast zu kalt zu sein.
»Er hat gehört, wie Octavian Befehl gegeben hat, das Heer vorzubereiten. Der Imperator will weiterziehen, in Richtung Syrien – und er will dich mitsamt deiner Kinder nach Rom schicken lassen, auf dass ihr in seinem Triumphzug vorgeführt werdet, sobald er siegreich zurückkehrt.«
Die Worte ziehen über Kleopatra hinweg, als würden sie sie kaum betreffen. Ihr Blick fährt über die Fliesen zu ihren Füßen, so als könnte ihr das verschlungene Muster dabei helfen, dieses sonderbare Rätsel zu lösen. Imperator, Rom, Triumphzug … Mit aller Kraft weigert sich ihr Geist, die Bedeutung der Sätze zu verstehen.
Es ist nicht möglich … Bei ihrem letzten Besuch in Rom wurde sie von berstendem Jubel begrüßt, als Geliebte des göttlichen Caesars, eine fremde Königin und Wiedergeburt der Isis. Wie könnte sie nun in einem Triumphzug durch die Gassen und Straßen geführt werden, gleichgestellt den syrischen Schätzen und den wilden Tieren, die die Römer tief im Zweistromland gefunden haben? Wie könnten ihre Kinder als exotische Raritäten vorgezeigt werden, vor den gleichen Bürgern, die den kleinen Caesarion damals als Caesars Sohn und Nachfolger verehrt haben?
Nein, es muss ein Irrtum sein. Dolabella meint es gut, doch er hat die Anweisungen seines Feldherrn falsch verstanden. Nicht einmal Octavian könnte so tief sinken, das Andenken des großen Caesars auf diese Weise zu beschmutzen. Kleopatra hebt den Kopf, um Charmion auf ihren Fehler hinzuweisen, auf ihren Lippen ein ungefähres Lächeln.
Dann, als sie den Mund öffnet, kommt nur ein einziges Wort heraus: »Wann?«
Charmion begegnet ihrem Blick, eine tiefe Trauer in den dunklen Augen. »In drei Tagen, sagt er.«
Die Königin nickt. Sie schaut ihre treue Gefährtin an, dann sieht sie hinüber zu den Gestalten, die immer noch drüben um das Wasserbecken versammelt stehen und ihrer Befehle harren. So leise, dass sie selbst die Worte kaum hören kann, sagt sie: »Lasst mich allein.«
Charmion nickt langsam, wobei sie ihre Königin mitfühlend betrachtet. Kleopatra möchte Liebe empfinden für ihre Vertraute, diese Freundin, die ihr seit so vielen Jahren treu und zuverlässig folgt. Doch selbst dafür fehlt ihr heute die Kraft. So beobachtet sie nur stumm, wie ihre Hofdame den Saal verlässt, gefolgt von der restlichen Dienerschaft – oder dem, was davon noch übrig ist.
Die letzten Schritte klingen durch den Säulengang hinaus, dann endlich wird es still um Kleopatra. Stumm blickt die Königin sich in dem verlassenen Gemach um. Das Sonnenlicht fällt in den Hof und funkelt auf dem gefliesten Wasserbecken, auf dem sich zwei Seerosen in der Nachmittagssonne räkeln. Die Spiegelung des Wassers tanzt über die Wände und sprenkelt die altehrwürdigen Säulen mit flimmernden Farbklecksen.
Das Herz Ägyptens … Was wird von all dieser Pracht übrig bleiben, wenn Rom erst seine gierige Hand nach Alexandria ausgestreckt hat?
Bei der Vorstellung, wie sich die römischen Legionen in ihrem Palast, ihrer Stadt ausbreiten, überfällt Kleopatra ein hilfloses Zittern. Am liebsten würde sie sich hinsetzen, den Kopf in den Händen vergraben – aber nein, noch ist sie Königin von Ägypten: Kleopatra die Große, Herrin der Vollkommenheit, die Inkarnation der Isis. Sie wird auf ihren eigenen Beinen stehen und über ihr Land wachen, solange ein letzter Funken Kraft in ihr verbleibt.
Ein leises Scharren auf der anderen Seite des Saals lässt sie aufmerken. Dort drüben im Schatten des Säulengangs, wo das glänzende Sonnenlicht nicht hinfindet, ist eine gleitende Bewegung zu erahnen.
Kleopatra hebt den Blick, jede Sehne ihres Körpers angespannt. Hat ein ungehorsamer Diener ihren Wunsch nach Ruhe missachtet? Oder ist es gar einer der römischen Soldaten, der sich dreist bis in ihre persönlichen Gemächer vorgewagt hat? Sie öffnet den Mund, um den Eindringling zur Rede zu stellen – doch ehe sie ein Wort herausbringt, sieht sie, dass es keines von beidem ist. Die zierliche Gestalt, die dort im Schutz der Schatten auf sie zutritt, ist zu klein für einen Legionär und ihre Haut ist noch dunkler als die von Charmion.
Die Königin erstarrt, als sie die andere Frau erkennt, die dort aus dem Säulengang zu ihr herüberkommt. Nyoka trägt einen buntgefärbten Leinenrock und über ihren Schultern hängen goldene Ohrringe. Golden blicken Kleopatra auch die tiefen Augen entgegen – in ihrem schwarzen Gesicht glänzen sie wie die Sterne am nächtlichen Himmel über der Wüste. In den Händen trägt Nyoka den tönernen Krug mit den Feigen, verschlossen mit einem Deckel, um den sich als Griff eine Schlange windet.
Ohne den Blick von ihr zu nehmen, stellt die Frau den Krug auf einem mosaikbesetzten Goldtischchen ab. »Ein Präsent für Kleopatra, die Königin der Könige.«
Die ehrerbietige Begrüßung reißt Kleopatra aus ihrer Starre. Mit großen Augen geht sie auf die andere Frau zu. »Du bist hergekommen, gerade jetzt …« Ungebeten flammt Hoffnung in ihr auf. »Warum bist du hier? Willst du mir helfen?«
Nyoka lässt die Frage an sich abperlen. Ungerührt erwidert sie Kleopatras Blick. »Ich bin gekommen, weil ich eine Geschichte von dir hören will. Eine letzte Geschichte, wie du sie noch keinem Menschen erzählt hast.«
Die Worte sind alles, was Kleopatra gebraucht hat, um ihre Befürchtungen zu bestätigen. Nein, die Götter haben ihr keinen letzten Ausweg geschenkt. Nicht einmal ihre älteste Freundin kann sie jetzt noch retten.
Mit einer Wut, die aus der Verzweiflung erwächst, richtet Kleopatra sich auf. Ihre Stimme zittert vor Empörung. »Du hattest mir Größe versprochen – Unsterblichkeit! Und nun? Du wagst es, zu mir von Geschichten zu reden? Sieh dich um, mein Palast ist von Römern überrannt. In drei Tagen werden sie mich und meine Kinder nach Rom schleppen, um uns in Octavians Triumphzug dem Pöbel zu präsentieren!« Ihre Stimme droht zu brechen und sie schüttelt den Kopf. Anklagend streckt sie den Finger nach Nyoka aus. »Die größte Herrscherin, die war und jemals sein wird – das waren deine Worte. Du hast gesagt, ich könnte als Königin sterben!«
Nyoka antwortet mit einem Lächeln. »Das kannst du immer noch.«
Die Worte sind ruhig gesprochen, so als würden Kleopatras Vorwürfe sie kaum berühren. Sie tritt zu dem goldenen Tischchen und hebt den Deckel von dem Krug.
Kleopatra wirft einen kurzen Blick auf die violetten Früchte, die sich darunter verbergen – und hält inne, als sie unter den Feigen eine gleitende Bewegung erahnt. Die oberste Frucht rollt beiseite und gibt den Leib einer schwarzen Schlange frei, deren glänzender Körper zwischen den Feigen entlangzieht.
Es ist die größte Uräusschlange, die Kleopatra je gesehen hat.
Schlagartig überkommt sie eine beinahe traumartige Ruhe. Ein Biss dieses Tieres trägt genug Gift in sich, um noch den stärksten Mann zu fällen – mit Sicherheit wird es auch für eine Königin ausreichen.
Sie hebt den Kopf und sieht Nyoka aus großen Augen an. »Wenn ich das tue, wird Octavian meine Kinder bestrafen. Sollte ich Hand an mich legen und ihn dadurch um seinen Triumph bringen, so wird er seine Wut an Selene und Helios auslassen …«
»Möglich«, antwortet Nyoka, ohne ihrem Blick auszuweichen.
Mit klopfendem Herzen denkt Kleopatra an ihre Kinder. Die Zwillinge und der kleine Philadelphos sind in Octavians Gewalt. Und Caesarion, Caesars einziger Sohn und Erbe …
»Octavian lässt bereits nach Caesarion suchen«, murmelt sie, den Blick auf den dunklen Schlangenleib gerichtet. »Charmion hat gehört, dass er ihm Späher hinterhergeschickt hat. Nach Äthiopien und bis nach Indien lässt er seine Spur verfolgen. Es kann nur einen Nachfolger Caesars geben … Wenn Octavian seiner habhaft wird, wird er Caesarion ohne zu zögern umbringen.«
»Das ist wahrscheinlich«, sagt Nyoka sanft.
Zwei Feigen rollen auf den Tisch, als die schwarze Schlange sich nun aufrichtet und ihren Kopf aus dem Tonkrug erhebt. Ruhig sieht das Tier Kleopatra an, als würde es ihren Worten lauschen.
Sie hebt die Hand, wie um die Schlange zu berühren. Leise, beinahe monoton fährt sie fort: »Es war nicht leicht, einen Doppelgänger für meinen Sohn zu finden. Einen aufrechten jungen Mann, etwa in dem richtigen Alter … Es gibt genug treue Ägypter, doch nur wenige von ihnen haben so helle Haut, dass man sie für Caesars Sohn halten könnte. Aber natürlich war Charmion erfolgreich, so wie sie es immer ist.« Zärtlich streichen ihre Finger bei der Erinnerung den Rand des Krugs entlang. »Essam heißt der tapfere Knabe, der sich nun zusammen mit Caesarions Lehrer auf dem Weg nach Äthiopien befindet. Octavian wird ihn finden, früher oder später … Er wird ihn hinrichten lassen und dafür sorgen, dass die Nachricht so schnell wie möglich nach Rom gelangt.« Kleopatra hebt den Blick und sieht Nyoka an. Ein schmerzliches Lächeln streicht über ihre Lippen. »Wenn Octavian wirklich so klug ist, wie er glaubt, wird er den Betrug vielleicht entdecken – schließlich spricht der arme Knabe nicht halb so gut Latein, wie Caesarion es tut. Aber dieser selbsternannte Caesar wird sich hüten, etwas darüber verlauten zu lassen. Für ihn und für die Welt wird Caesars einzig rechtmäßiger Sohn tot sein, seine Linie beendet.«
»Und dein Sohn?«, fragt Nyoka. »Wo ist er?«
Ängstlich sieht Kleopatra ihre Besucherin an. Sie presst die Lippen zusammen. Selbst hier, in der Einsamkeit ihrer Gemächer, fällt es ihr schwer, das Geheimnis auszusprechen.
Doch Nyokas durchdringender Blick ruht auf ihr, und so fließen die Worte schließlich wie von selbst aus ihr hinaus. »Er ist nach Griechenland gegangen«, sagt sie leise. »Nach Ephesos – mitten hinein in die Höhle des Löwen. Niemals wird Octavian ihn dort vermuten, so nahe an den Fängen Roms. Caesarion spricht fließend Griechisch und Latein, er wird dort oben als Einheimischer durchgehen.« Ein klirrendes Lachen bricht aus ihr heraus. »Er hat sich entschieden, dem Thron zu entsagen, für den ich mein Leben lang gekämpft habe. Dafür wird er in Sicherheit weiterleben – und ich …« Wieder fällt ihr Blick auf die aufgerichtete Schlange, die sich nun langsam hin- und herwiegt, als würde sie ihrer Geschichte lauschen.
»Ich danke dir.« Ruhig durchdringen Nyokas Worte ihre Gedanken. Als Kleopatra sich umdreht, sieht sie in der Hand der anderen eine tiefschwarze Perle, glänzend wie ein dunkler Stern. »Ich werde deine Geschichte für dich bewahren.«
Noch einen Herzschlag lang betrachtet Nyoka das Juwel zwischen ihren Fingern, dann lässt sie es in den Falten ihres Rocks verschwinden. Sie sieht Kleopatra wieder an, mit einem Lächeln, in dem sich Fürsorge und Mitgefühl mischen.
»Hier«, sagt sie und weist auf den Tonkrug. »Es ist so weit.«
Kleopatra nickt. Sie presst die Kiefer zusammen, um jedes Zittern zu unterdrücken. Vorsichtig greift sie nach der Giftschlange und fährt dem Tier über den Rücken, in ihrer Geste halb Zärtlichkeit und halb Grausen. »Sie werden sich an mich erinnern … Ich werde als Königin sterben?«, fragt sie geistesabwesend. Der Leib der Schlange fühlt sich warm an, weit freundlicher, als sie erwartet hätte.
»Als Königin der Könige«, antwortet Nyoka ruhig. »Die letzte Pharaonin von Ägypten. Du wirst in die Geschichte eingehen als die größte Herrscherin, die war und jemals sein wird.«
Ein wehes Lächeln zieht um Kleopatras Lippen. »Ich danke dir«, sagt sie, ohne Nyoka dabei anzublicken. Sanft fahren ihre Finger über den Rücken der Uräusschlange, die sich an ihre Berührung anschmiegt.
Dann greift sie nach dem Schlangenleib und hebt das gewaltige Tier aus dem Krug.
Prag, heute
»Ich wünsche noch einen schönen Abend!«
Mit einem Schnarren öffnet sich die Tür der Absintherie, eine späte Besucherin stolpert auf die Straße hinaus. Ein willkommener Stoß frischer Abendluft zieht in den Schankraum, ehe der Türflügel wieder zuschwingt und mit einem dumpfen Schlag ins Schloss fällt.
Abwesend schaut der Barkeeper der Gestalt durch das Fenster hinterher, bis sie aus seinem Sichtbereich verschwunden ist. Dann wirft er einen Blick zu dem runden Tisch am Rand unter der Empore. Ein letzter Gast sitzt dort vor seiner Absinthfontäne, auch wenn er sein halbvolles Glas schon seit einer Weile kaum beachtet. Der Fremde ist ganz in Weiß gekleidet, bis auf ein blaues Seidentuch, das er um den Hals trägt. Zwischen seinen Fingern lässt er einen Stapel Spielkarten so schnell hin- und hergleiten, dass der Barkeeper den Bewegungen kaum folgen kann. Der Blick des Besuchers ist abwesend; ohne auf seine Hände zu schauen, mischt er die Karten und lässt sie immer wieder einen weiten Bogen durch die Luft beschreiben, ehe sie sich auf dem Tisch erneut zu einem sauberen Stapel zusammenfinden. Eine einzelne Karte taucht dabei wieder und wieder auf, sie tanzt zwischen seinen Fingern, als hätte sie ein Eigenleben.
Getrieben von einer Mischung aus Neugierde und Langeweile, schiebt sich der Barkeeper hinter seinem Tresen hervor und geht hinüber. »So weit alles in Ordnung?«
Der einsame Gast schaut auf, ein wachsamer Ausdruck in seinen Augen. Die Karten bleiben zwischen seinen Fingern hängen, als wäre das Leben mit einem Schlag aus ihnen gewichen.
»Bitte um Verzeihung?«
»Na, ich meine nur …« Unschlüssig nickt der Barkeeper zu dem halbleeren Glas hinüber. »Du sagst Bescheid, wenn du etwas brauchst, ja?« Er erlaubt sich einen näheren Blick auf die Spielkarten. Wieder ist die eine Karte offen zu sehen – darauf das Bild einer hübschen Frau, die eine Rose in der Hand hält. »Französische Karten, hm?«, fragt er, nur um irgendetwas zu sagen.
Sein Gast schenkt ihm ein Lächeln. Nonchalant lehnt er sich auf seinem Stuhl zurück und breitet die Karten mit dem Rücken nach oben in einem Bogen vor sich aus. Auf seiner Brust ist ein großer Weinfleck zu sehen, der das ansonsten makellose Hemd verunstaltet.
»Ganz recht«, erwidert er gelassen. »Ich finde sie ansprechender als das deutsche Blatt. Meinst du nicht auch?« Scheinbar willkürlich zieht er einige Karten aus der verdeckten Folge und dreht sie nebeneinander um. Nun liegen Damen, Könige und Buben ordentlich aufgereiht neben den übrigen Karten.
»Nicht schlecht«, grinst der Barkeeper beeindruckt. Er stemmt die Hand in die Seite und mustert den Besucher mit neuem Interesse. Der ist noch keine dreißig, mit welligen Haaren und vollen Lippen, die die scharfgeschnittenen Gesichtszüge weicher erscheinen lassen. »Bist wohl so was wie ein Zauberer, was?«, fragt er neugierig. »So einer mit Kartentricks? Ich hab dich hier noch nie gesehen.«
»Oh, aber ich kenne dich gut genug«, erwidert der Gast beiläufig, während er die Karten wieder durch seine Finger gleiten lässt. »Dein Name ist Valentýn. Du arbeitest nun seit fast zehn Jahren hier. Zuhause hast du einen kleinen Hund, den du über alles liebst – mehr noch als Radek, deinen Partner. Du hast immer schon davon geträumt, einmal nach Amerika zu reisen, aber bisher hat es nie geklappt. Obwohl du immer wieder davon redest, den Job hier zu schmeißen, liebst du es doch zu sehr, dich mit deinen Gästen zu unterhalten.« Während er spricht, lässt er die einzelne Karte wieder und wieder über seine Finger tanzen – die Frau mit der Rose, die Herz-Dame. Sein Blick hängt ungerührt an der Karte, dann sieht er den Barkeeper mit einem breiten Lächeln an. »Mein Name ist Lucián.«
Valentýn betrachtet seinen Gast entgeistert. »Woher weißt du das alles?«, fragt er mit einem Stirnrunzeln.
Lucián hebt die Schultern. »Die Karten haben es mir gesagt«, erwidert er, während er die Spielkarten nun erneut in nach Farben geordneten Stapeln auf dem Tisch niederlegt.
Natürlich ist das nicht alles. Seit Langem hat Lucián es sich zur Gewohnheit gemacht, jederzeit ein grundlegendes Wissen über seine Gesprächspartner parat zu halten, das er einer Mischung aus exzellenter Vorbereitung und seiner speziellen Verbindung zu der Fürstin von Prag verdankt.
Auch wenn Zweiteres gerade heute Abend nicht so stark ist wie gewohnt. Schließlich ist Libuše heute mit einem anderen beschäftigt … Lucián greift nach dem halbvollen Absinthglas und leert es in einem Zug.
Dem Barkeeper hingegen reicht die Erklärung voll und ganz aus. »Die Karten haben es dir gesagt!«, wiederholt er und lässt ein bärbeißiges Lachen hören. »Ein Bühnenmagier, hab ich’s doch gewusst! Warte, ich hol dir noch ein Glas.«
Er geht zur Bar hinüber und greift nach einer Flasche, die unter dem Tresen verborgen ist. Mit einem freundlichen Zwinkern füllt er zwei Gläser je einen Fingerbreit mit dem lindgrünen Getränk und stellt eines davon vor Lucián auf den Tisch.
»Hier, der geht aufs Haus.« Damit setzt er selbst das zweite Glas an, ohne sich die Mühe zu machen, den Inhalt zuvor zu verdünnen. Den Arm auf das Ende des Tresens gestützt, blickt er Lucián an. »Wie sieht es aus, magst du erzählen, was dich heute Abend hergetrieben hat?«
Lucián schaut abwägend zu dem Barkeeper. Dann setzt er ein unverbindliches Lächeln auf. Libuše wird seine Dienste heute nicht mehr benötigen, so viel hat sie deutlich genug gemacht. Was spricht also dagegen, sich nun ein wenig die Zeit zu vertreiben – und wenn es im Gespräch mit diesem gutmütigen, wenn auch etwas einfältigen Kerl ist?
Beiläufig hebt er die Schultern und greift nach dem Glas, um es mit etwas Wasser aus der Fontäne zu verdünnen. »Ich habe ein paar Stunden totzuschlagen«, gibt er frei heraus zu und nimmt einen Schluck. »Die Frau meines Herzens verbringt diese Nacht mit einem anderen.«
Er greift wieder nach den Karten und lässt sie zwischen seinen Händen tanzen. Immer wieder blitzt die Herz-Dame zwischen seinen Fingern auf, als wollte sie ihm Avancen machen – oder ihn verhöhnen.
»Oh, das ist bitter.« Von der Seite legt ihm der andere die Pranke auf die Schulter. »Glaub mir, ich weiß, wie sich so was anfühlt.«
Luciáns Lippen nehmen einen abfälligen Zug an, gerade so viel, dass der breite Mann es nicht mitbekommt. »Ja, das ist bitter«, wiederholt er leise.
Natürlich hat Valentýn keine Ahnung, wovon er redet – aber was würde es bringen, ihm das auf die Nase zu binden? Es ist schließlich nicht so, als würde sich die Fürstin von Prag dazu herablassen, mit ihrem neuen Welpen heute Nacht etwas anderes zu teilen als ein keusches Händchenhalten. Sie werden auf dem Turm stehen, oben auf dem Laurenziberg, und die Mondfinsternis beobachten, nicht mehr und nicht weniger.
Während er selbst hier unten sitzt und sich mit Kartentricks und Absinth die Zeit vertreibt.
Jäh wird Lucián der mitleidige Blick bewusst, mit dem ihn der Barkeeper mustert. »Nicht, dass die Sache etwas zu bedeuten hätte«, erklärt er ungehalten. Plötzlich stört ihn die Vorstellung, dass dieser fremde Kerl an dem engen Band zweifeln könnte, das Libuše und ihn verbindet … an der Liebe, die zwischen ihnen besteht. »Sie hat sich nur wieder irgendein Bübchen herausgepickt, das ihr den Hof macht.«
Zielsicher ziehen seine Finger erneut die Herz-Dame aus dem Kartenpäckchen und legen sie neben der Absinthfontäne auf den Tisch. Daneben legt er den Kreuz-Buben, der die andere Karte schmachtend anhimmelt.
Valentýns Augen streichen über die beiden Karten, dann mustert er Lucián verständnisvoll. »Und du bist dann wohl der Herz-König?«, fragt er und hebt zwinkernd sein Glas zum Mund.
Lucián erwidert seinen Blick ausdruckslos. Noch einmal lässt er die Karten durch seine Finger gleiten, bis er eine Gestalt mit Schellenstab und Narrenkappe zwischen Zeige- und Mittelfinger hält. »Eher der Narr«, stellt er mit einem feinen Lächeln fest.
Der verständnislose Ausdruck des Barkeepers zeigt, dass er mit dieser Analogie wenig anfangen kann. Wahrscheinlich hat der Kerl bisher wirklich nur mit deutschen Karten gespielt.
Also fügt Lucián geduldig hinzu: »Der Joker hat eine der mächtigsten Funktionen im Blatt. Je nach Spiel kann er für jede andere Karte einspringen.« Ungnädig runzelt er die Stirn. »Gerade weil er zu keiner eigenen Farbe gehört …«
Mit diesen Worten legt er den Narren neben der Herz-Dame ab. Die betrachtet ihn mit wissendem Blick, so als ahne sie ganz genau, welche Gedanken ihm durch den Kopf gehen. Lucián verzieht den Mund. Er weiß ja selbst, dass er über solche Dinge erhaben sein sollte. Wenn die mythenbesetzte Fürstin von Prag geruht, einen Abend mit einem dahergelaufenen Teenager zu verbringen, sollte ihm das wirklich kein Kopfzerbrechen bereiten.
Grimmig senkt er den Blick und mustert den dunklen Weinfleck auf seinem Hemd, den ihm der Junge in seiner Ungeschicklichkeit verpasst hat.
»Also«, sagt da der Barkeeper und zieht Luciáns Aufmerksamkeit wieder auf sich, »ist das Ganze so etwas wie eine offene Beziehung?« Sein Blick fährt immer noch über das Dreiergespann der Karten auf dem Tisch, so als würde er versuchen, die sonderbare Konstellation zu durchschauen.
»Etwas in der Art«, bringt Lucián einsilbig hervor.
»Ah, verstehe.« Wieder hebt Valentýn das Glas zum Mund, dankbar, dass er die Situation richtig gedeutet hat. »Mein Freund hatte so was mal am Laufen. Er sagt, es hätte ganz gut funktioniert … Ich könnte mir ja nicht vorstellen, meinen Partner mit anderen zu teilen.« Er beugt sich zu Lucián herab und greift nach der mittleren Karte. »Und, wie heißt deine Herz-Dame?«, fragt er, während er die Figur mit der Rose mustert.
Ein stummer Seufzer dringt aus Luciáns Brust. Sein Blick wird weich, als er sich nun auf seinem Stuhl zurücklehnt und mit dem Finger über den Rand des Glases fährt. »Libuše.«
Für zwei Sekunden, während der Name über seine Lippen kommt, ist sie voll und ganz bei ihm. Libuše, Ahnherrin der Přemysliden, Gründerin und Fürstin von Prag. Die einzige Frau, für die je Raum in seinem Herzen war. Ihr Duft, ihre Anwesenheit ist es, die ihn am Leben hält.
Dann sind die Silben verklungen, Lucián bleibt allein zurück. In diesem Moment hasst er seinen jungen Nebenbuhler mehr, als er in Worte fassen könnte.
»Libuše«, wiederholt der Barkeeper wohlgefällig. »Ein klassischer Name. Wie diese Schauspielerin, die letztes Jahr gestorben ist, nicht wahr? Das Aschenbrödel!« Er nickt Lucián zu und leert den Rest seines Getränks in einem Zug. Dann stellt er das Glas auf den Tresen. »Sie ist wohl nach der Schauspielerin benannt?«
Lucián kräuselt die Lippen. »Wohl eher umgekehrt«, sagt er und greift wieder nach seinem eigenen Glas, ohne auf die verwirrte Miene seines Gegenübers zu achten.
»Na dann«, meint Valentýn schließlich schulterzuckend, während er zurück hinter seinen Tresen schlurft. »Solange die Sache für euch beide funktioniert … Ich wünsche dir alles Gute dabei.«
Gedankenverloren nickt Lucián. »Ich danke dir.«
Mag der bärtige Kerl auch einfältig sein, Lucián hat in seinem Leben genug Erfahrung gesammelt, um gute Wünsche anzunehmen, wann immer sie ihm über den Weg laufen.
Das Schnarren der Tür unterbricht Luciáns Betrachtung. Er muss nicht erst aufsehen, um zu wissen, dass es kein Mensch ist, der dort hereinspaziert. Die Spannung in der Luft, das Klarer-Werden seiner eigenen Gedanken … Es gibt genug Anzeichen, die ihn warnen, wenn er es mit einer übernatürlichen Wesenheit zu tun hat.
Also wartet Lucián ab, bis die fremde Gestalt seinen Tisch erreicht, ehe er den Blick hebt und an ihr emporschaut.
Vor ihm steht eine großgewachsene Frau – dunkle Haare, die offen um das Gesicht fallen, darunter ein einteiliger Hosenanzug mit Kragen und freien Schultern, während sie die Arme vor der Brust verschränkt hält. Erika. Die schwarzgeschminkten Lippen öffnen sich zu einem Grinsen. »Hallo, Lucián. Ich bin’s, deine grüne Fee!«
Lucián lehnt sich auf seinem Stuhl zurück und mustert den Neuankömmling ungerührt. Erika, die rechte Hand des Leibhaftigen, der zurzeit mit seinem Gefolge in Prag weilt. Er fragt sich, was sie von ihm will – ist sie im Auftrag ihres teuflischen Dienstherrn hier?
Nun, auf jeden Fall wird er ihr gegenüber keinerlei Schwäche zeigen.
»Einen schönen Abend wünsche ich dir!« Mit strahlendem Lächeln sieht er der dunkel geschminkten Frau entgegen. »Valentýn, darf ich vorstellen«, wendet er sich mit einem Zwinkern an den Barkeeper, »das ist meine Freundin Erika. Gerade wie in dem alten Lied: Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein …«
Bei der Erwähnung des deutschen Liedtextes werden Erikas Augen schmal. Lucián unterdrückt ein zufriedenes Grinsen. Zugegeben, er weiß nicht genau, was sie an diesem Lied so verärgert – auch wenn er da den einen oder anderen Verdacht hat, was ihr unrühmliches Ableben vor achtzig Jahren angeht. Aber es reicht, dass er eine Schwachstelle in ihrer ach-so-harten Schale gefunden hat.
»Denn ihr Herz ist voller Süßigkeit …« Lucián seufzt schwelgerisch auf. »Nach deinem Besuch vor ein paar Wochen hat Havel uns die Freude gemacht, das Lied vorzutragen. Du erinnerst dich doch an ihn, der alte Sänger oben auf der Hochfeste? Er sagt, sein Vater hätte den Text damals noch von den deutschen Truppen gehört, die in Prag stationiert waren.«
Erikas Lippen kräuseln sich abfällig. »Charmant.« Ihr Blick fällt auf den großen Weinfleck, der sein Hemd verunstaltet, dann sieht sie ihm wieder in die Augen. »Wie schön, dass du dich in so guter Laune befindest. Hier, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht.« Damit greift sie in die Hosentasche und zieht etwas heraus – einen roten Apfel, wie Lucián stirnrunzelnd erkennt. Mit einer saloppen Geste wirft sie ihn über den Tisch. »Der Schönsten.«
Instinktiv fängt Lucián die Frucht auf. Er dreht sie zwischen den Händen – wie es aussieht, ist es ein ganz gewöhnlicher Apfel, wie er ihn an jedem Marktstand finden würde. Fragend schaut er zu Erika auf.
»Du musst verzeihen, aber ich habe schon zu Abend gegessen.«
Sie zuckt mit den Schultern. »Vielleicht willst du dir einen Nachtisch gönnen. Und etwas Zeit für dich allein.« In ihrem Blick funkelt sanfter Spott. »Ich habe eine Einladung für dich, von hoher Stelle – jemand möchte mit dir sprechen. Anscheinend soll dieses Ding da das Band zwischen dir und deiner heißgeliebten Fürstin ein wenig lockern, damit Libuše nicht alles mitbekommt, was du hinter ihrem Rücken treibst.«
»Eine Einladung …« Immer noch dreht Lucián den Apfel zwischen seinen Händen.
Es ist eine ungewöhnliche Wendung, die sein Abend so plötzlich genommen hat. Er wirft einen kurzen Blick hinüber zur Bar. Der Barkeeper – Valentýn – scheint ganz damit beschäftigt, die Gläser der letzten Besucherin auszuspülen, doch seine Kopfhaltung verrät, dass er der Unterhaltung interessiert lauscht. Nun, soll er. Spätestens wenn Erika wieder verschwunden ist, wird er sich an nichts davon erinnern, was hier zwischen Mensch und Dämon gesprochen wurde.
Ganz im Gegensatz zu Lucián, der über Mittel und Wege verfügt, um seiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Er fokussiert sich auf die üblichen Gerüche und Gedanken, die er mit Erika verbindet – ein scharfes Grün, Pulvergeruch, das Quietschen von Leder –, während er sie misstrauisch mustert. Wer könnte wohl hinter dieser unerwarteten Einladung stecken? Nun, wer anderes als Logos, ihr teuflischer Herr und Meister?
Lucián macht sich keine Illusionen, mit wem er es hier zu tun hat. Auch wenn Erika wirkt, als wäre sie im gleichen Alter wie er, hat sie doch schon mehr als ein Menschenleben hinter sich. Und was immer sie in ihrer Vergangenheit getan hat, es hat ausgereicht, dass der Teufel selbst sie nach ihrem Tod in seinen Dienst gerufen hat.
Wie es aussieht, wird Lucián heute Abend die Gelegenheit erhalten, ihren dunklen Dienstherrn persönlich zu treffen.
»Wenn ich mich recht erinnere, hast du die Einladung, die ich dir neulich von meiner Fürstin überbracht habe, brüsk abgelehnt«, sagt er in neutralem Ton. Dabei hält er den Blick fest auf sie gerichtet, gespannt auf ihre Reaktion.
Erika hebt zur Antwort die Schultern. »Dann bleib eben hier sitzen und ertränk dein Selbstmitleid weiter in Absinth.« Sie greift nach einer der Karten, die auf dem Tisch verteilt liegen – es ist die Pik-Sieben, die sie nun beiläufig zwischen den Fingern dreht.
Lucián schmunzelt. Auch wenn er längst gelernt hat, seine Gedanken vor den niederen Geistern zu verbergen, steht ihm seine Neugierde wohl offen genug ins Gesicht geschrieben. Mit einer ergebenen Geste steckt er die restlichen Spielkarten ein, dann erhebt er sich und drückt ihr den Apfel im Austausch gegen die letzte Karte in die Hand.
»Danke, aber den hier werde ich nicht brauchen. Meine Fürstin ist heute Nacht beschäftigt; sie hat Besseres zu tun, als mir hinterherzuspionieren. Ich kann auch so mit dir kommen …« Er verzieht das Gesicht und weist auf sein Hemd mit dem Weinfleck darauf. »Erlaube nur, dass ich mir zuerst etwas Angemessenes anziehe.«
Erika bedenkt seine Worte mit einem Schnauben. »Lass gut sein – die Einladung ist nicht mit einer Kleiderordnung verbunden. Glaub mir, du bist mehr als angemessen angezogen.« Ein Schmunzeln zuckt um ihre Mundwinkel, als sie den breiten Fleck nun ungeniert begutachtet.
Zur Antwort runzelt Lucián die Stirn. Wenn sie ihn wirklich zu einer exklusiven Audienz mit ihrem Lehnsherrn mitschleppt, wird er dort sicher nicht in solch einem Aufzug erscheinen. »Du wirst verzeihen, aber ich würde doch lieber …«
»Nun mach nicht so ein Getue«, unterbricht Erika ihn genervt. Sie kommt um den Tisch und greift nach dem blauen Seidenschal, den er um den Hals gebunden hat. Ehe Lucián zurückschrecken kann, hat sie das Tuch auseinandergezupft und drapiert es wie eine breite Krawatte vor seiner Brust. »So, fertig. Schon fällt niemandem mehr auf, dass du zur Abwechslung mal Farbe bekennst.«
Lucián ist alles andere als überzeugt. Zweifelnd schaut er an sich hinab, wo das Seidentuch nun wie ein Plastron über seiner Brust hängt. »Damit sehe ich aus wie ein Lackaffe.«
»Eben. Es passt perfekt!« Das Funkeln in Erikas Blick zeigt, dass die teuflische Abgesandte gerade den Spaß ihres Lebens hat.
Lucián ringt sich ein gequältes Lächeln ab. »Und wohin darf ich dich begleiten? Hinab in die Basilika?« Damit fischt er in seiner Hosentasche nach seiner Geldbörse und wendet sich zum Barkeeper um. Der hat das Gläserwischen nun ganz aufgegeben und starrt die beiden Gäste mit offenem Mund an.
»Nein«, beantwortet Erika seine Frage, »nicht in die Basilika. Heute Abend soll ich dich zum alten Glockenturm bringen.«
Lucián hebt eine Augenbraue. Er kennt das Bauwerk; eine uralte Festungsanlage am Rand der Altstadt, Teil der ehemaligen Stadtmauer. Der Turm ist nicht unbedingt die intuitivste Wahl für eine klandestine Audienz … Der Großteil des Gebäudes ist mit billigen Touristenattraktionen gefüllt und unter dem Dach hat sich ein Edelrestaurant eingenistet. Vielleicht will Erika ihn ja hinauf zum Dachboden führen, der mit seinen giebelbesetzten Fenstern über die Stadt blickt?
In Erikas Lächeln liegt eine dunkle Vorfreude, als sie sich nun umwendet, um zur Straße hinauszugehen. Unwillkürlich zupft Lucián an dem blauen Tuch, um sicherzugehen, dass es den Fleck wirklich voll und ganz verdeckt. Er weiß immer noch nicht, was er von dieser Einladung zu erwarten hat. Eine dekadente Orgie, eine düstere Versammlung, vor die er berufen wird …
Kurz überlegt er, ob es klug ist, dem Dämon ohne Weiteres zu folgen. Aber auf der anderen Seite ist dies eine Gelegenheit, die sich nicht so schnell wiederholen dürfte. Und Lucián hätte in den Kreisen, in denen er verkehrt, nicht seine spezielle Position inne, wenn er vor solch einer Gelegenheit zurückschrecken würde.
Also folgt er Erika hinaus auf die Straße, die im abendlichen Licht der Laternen vor ihm liegt. Mit einer knappen Geste verabschiedet er sich von dem Barkeeper, dann tritt er über die Schwelle und lässt die grüne Tür der Absintherie hinter sich ins Schloss fallen.
Das Restaurant oben im Glockenturm erweckt den Eindruck, als stamme es aus einer anderen Zeit. Hölzerne Tische sammeln sich auf engem Raum, der Schein der Kerzen erhellt zusammen mit ein paar versteckten Strahlern das Gewölbe. Der Schankraum ist nicht groß, doch die uralten Balken, die ringsum in die Höhe ragen, geben ihm einen altehrwürdigen Anstrich. Mitten zwischen den Tischen ist eine riesige Glocke zu sehen, die seit Jahrhunderten an ihrem angestammten Platz hängt, während eine schmale Treppe zu einer aus Holz und Glas errichteten Empore direkt darüber führt.
Ein zwitscherndes Lachen dringt durch den Raum und bringt einige der Umsitzenden dazu, zu dem Tisch in der Ecke hinüberzuspähen, ehe sie sich wieder ihren eigenen Gesprächen zuwenden. Der Ton kommt von einer hellhäutigen Frau mit blonden Haaren, die dort neben einer zierlichen Schwarzen hockt und sie fasziniert anstarrt.
»Und du meinst wirklich, dass ich so etwas schaffen könnte? Diese aufgeblasenen Kirchenmänner da oben zum Umdenken zu bringen?«
Die andere Frau lehnt sich auf ihrem Stuhl zurück und betrachtet ihre Sitznachbarin abschätzend. »Wenn du es wirklich willst, Olga, dann schon. Wenn du nicht lockerlässt, was sich dir auch in den Weg stellt.«
Mit einem leisen Seufzen lässt Olga den Kopf zurückfallen. »Das ist das Problem, nicht wahr? Es ist so schwer, nicht aufzugeben.«
»Das ist das Problem.« Die goldäugige Frau – Nyoka – sieht sie noch einmal durchdringend an, dann greift sie nach dem gefüllten Weinglas vor sich auf dem Tisch.
Schon ist sie dabei, das Interesse an Olga zu verlieren. Während sie von dem Wein trinkt, schweift ihr Blick durch den Raum, über die Tische hinweg, an denen sich Paare und kleinere Grüppchen versammelt haben. Dort drüben sitzt ein Mann, der sich sein eigenes Unternehmen aufbauen könnte, wenn er nur endlich den Mut dazu finden würde. An der Wand eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, die mit ihren Ideen die Welt verändern könnte – wenn sie nur hinausgehen und tun würde, wovon sie immer so begeistert spricht. Mehr als genügend Material zum Arbeiten, aber es ist kaum jemand dabei, für den sich die Mühe wirklich lohnt. Nun, abgesehen vielleicht von den beiden Gästen, auf die Nyoka heute Abend wartet …
Ihr Blick fährt hinüber zur Bar direkt neben ihrem Tisch, wo ein älterer Herr in einem etwas antiquierten Frack vor seiner Weinflasche sitzt. Der alte Mann sieht zu ihr herüber, mit einem Ausdruck, in dem sich Neugierde und Argwohn mischen. Als sich ihre Blicke kreuzen, hebt Nyoka grüßend ihr Glas; eine Geste, die der andere zögerlich erwidert. Er ist Teil von Libušes Gefolge, so viel kann sie ihm deutlich ablesen. Immerhin: Unter all den Sterblichen hier im Raum ist er der Einzige, der sie wirklich zu bemerken scheint.
Auch wenn sein misstrauischer Blick zeigt, dass er von ihrer Anwesenheit in der Stadt alles andere als begeistert ist.
Von der Seite wendet sich Olga wieder an sie: »Und du weißt das immer schon im Vorhinein so genau? Was aus den Menschen wird, meine ich … Wer etwas bewirken kann?«
Nyoka lächelt in sich hinein. Sie streicht sich über das Kleid aus Wachstuch, dann greift sie nach einem der Schinkenröllchen, die auf einer hölzernen Platte in der Mitte des Tischs liegen. »Nicht immer«, antwortet sie, ohne sich zu der jüngeren Frau umzuwenden. »Aber meist habe ich eine sehr gute Ahnung.«
»He, Lucián«, tönt es da von der Bar herüber. Es ist der alte Kerl drüben am Tresen, der nun die Weinflasche grüßend zum Eingang hin erhoben hält. »Du auch hier oben?«
Nyoka folgt seinem Blick – gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Lucián durch die Tür ins Restaurant tritt. Hinter ihm kommt Erika herein und nickt ihr kurz zu.
Forsch sieht Lucián sich in dem engen Schankraum um. Er trägt sein übliches weißes Hemd und darüber ein blaues Tuch, das auffällig über der Brust drapiert ist … Nyoka muss sich ein Schmunzeln verkneifen, als sie den Zweck des Tuchs erkennt. Nun schaut Lucián zur Bar hinüber, wo er den Alten entdeckt, und seine Miene verzieht sich irritiert. »Havel, einen guten Abend. Hast du etwa …«
»Ob ich dich hergerufen habe?«, führt Havel seine Frage zu Ende. Er hat die Stimme eines Opernsängers; einen hellen Tenor, wenn auch etwas in die Jahre gekommen. »Aber nicht doch. Ich glaube gar, diese Ehre verdankst du ihr.«
Damit nickt er zu Nyoka hinüber. In Luciáns Blick flackert Erstaunen auf – für einen Moment nur, dann haben sich seine Züge wieder gefestigt. Ganz offenbar hat er einen anderen Gastgeber dieses unerwarteten Treffens vermutet.
Unterdessen winkt Olga am Tisch dem Neuankömmling fröhlich zu. »Lucián! Nyoka hat gar nicht gesagt, dass du kommen würdest.«
»Wie wundervoll, dass du es einrichten konntest«, begrüßt Nyoka ihn nun. Mit einer gleitenden Bewegung erhebt sie sich von ihrem Platz und schenkt ihm ein einladendes Lächeln.
Lucián runzelt die Stirn und wirft einen fragenden Blick zu Erika, den die ungerührt erwidert. Es ist offensichtlich, dass dies hier nicht das ist, was er sich von seinem Ausflug erwartet hat. Er bemüht sich, Haltung zu zeigen, während er sich zu Nyoka umwendet, die ihm über den Tisch hinweg die Hand reicht.
Mit einer formvollendeten Geste greift er nach ihren Fingern und führt sie zum Mund, um einen angedeuteten Kuss darauf zu hinterlassen. »Ich danke dir für die Einladung. Auch wenn ich nicht sicher bin, wie ich zu dieser Ehre komme …«
An Lucián vorbei geht Erika zur Bar und lehnt sich neben dem älteren Mann gegen den Tresen. »Hier«, sagt sie und wirft Nyoka den Apfel zu. »Er meint, er bräuchte ihn nicht.«
Die fängt die Frucht auf und legt sie auf der polierten Tischplatte ab. Er hat ihr kleines Willkommensgeschenk also ausgeschlagen … Zugegeben, es war kaum zu erwarten, dass Lucián so leicht anbeißen würde.
Nyoka mustert ihn prüfend, während sie sich wieder auf ihrem Stuhl niederlässt. Ihr sterblicher Gast ist allzu neugierig darauf, was ihm dieses Zusammentreffen wohl bringen mag – auch wenn er die Erwartung hinter einem Schleier aus souveräner Gelassenheit verbirgt. Nur das Schimmern in seinen Augen verrät seine Ungeduld. Zu gerne würde er erfahren, weshalb sie ihn hierherbestellt hat.
Nun, alles zu seiner Zeit.
»Möchtest du dich nicht zu uns setzen?«, fragt sie und weist auf den Stuhl ihr gegenüber. »Wir wollen gemeinsam einen gemütlichen Abend verbringen und ich dachte, du hättest vielleicht Lust, dich dazuzugesellen.« Ein leichtes Schmunzeln fährt über ihre Lippen. »Wie ich sehe, hast du schon ohne uns mit dem Feiern angefangen …«
Lucián braucht einen Moment, ehe er die Anspielung versteht. Er schaut an seinem Hemd mit dem knapp verborgenen Fleck hinab, dann wendet er sich um und wirft Erika einen bohrenden Blick zu. Nyoka muss ein Grinsen unterdrücken. War sie es etwa, die ihm das Tuch über dem Weinfleck drapiert hat?
Erika beantwortet seinen Blick mit einem Feixen.
Mit einem gezwungenen Lächeln zieht Lucián das Seidentuch von seiner Brust und steckt es in die Hosentasche. »Ich bin untröstlich«, erklärt er an Nyoka gewandt. »Du wirst erlauben, dass ich gehe und mir etwas Neues zum Anziehen suche.«
Nyoka will schon abwinken – da erhebt sich Olga eifrig von ihrem Platz. »Warte doch«, ruft sie Lucián zu, »lass mich dir helfen! Ich krieg das in Nullkommanichts wieder sauber.«
»Olga, lass unseren Gast in Ruhe.« Streng weist Nyoka ihre Sitznachbarin zurecht, worauf die eine beleidigte Schnute zieht. Dann wendet sie sich wieder an Lucián. »Bitte verzeih, ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen.«
Lucián schaut von ihr zu Olga, die immer noch erwartungsvoll neben dem Tisch steht. Seine Miene klärt sich, sein Lächeln hat die übliche Ruhe wiedergefunden.
»Willst du es versuchen?«, fragt er Olga und fängt schon an, das Hemd aufzuknöpfen.
Die Augen der jungen Frau werden groß. »Ähm … ja, sicherlich! Ich krieg das wieder hin.«
Gebannt sieht sie zu, wie Lucián sich das Hemd auszieht und ihr den besudelten Stoff über den Tisch hinweg in die Hand drückt. Von der Seite lässt Erika ein abschätziges Grinsen sehen, als Lucián nun mit bloßem Oberkörper neben ihnen steht. Vereinzelte Blicke schießen von den Nachbartischen zu ihnen herüber, doch das scheint ihm kaum etwas auszumachen; gelassen setzt er sich auf einen der freien Stühle, während Olga mit ihrer Beute zur Bar hinübermarschiert.
»Entschuldigen Sie«, fragt sie den Kellner, »dürfte ich wohl einmal kurz ans Waschbecken? Ich muss hier etwas saubermachen.« Damit hält sie ihm das dreckige Hemd wie eine Trophäe entgegen.
Irritiert weist der Mann zu den Toiletten. »Dort entlang, bitte sehr.«
»Danke schön!«, ruft Olga, schon halb auf dem Weg nach hinten. »Finde ich da drinnen wohl auch Seife und einen Schwamm?«
Lucián hebt die Augenbrauen, während er ihr hinterhersieht. Er seufzt auf, als würde er seine Bereitwilligkeit, Olga das Hemd zu überlassen, bereits bereuen. »Sie hat keine Ahnung, was sie dort treibt, oder?«
Nyoka schüttelt den Kopf. »Wohl eher nicht.« Damit wendet sie sich an Erika. »Wärst du wohl so freundlich, ihr ein wenig zur Hand zu gehen?«
Ohne eine Miene zu verziehen, dreht Erika sich um. Sie geht hinüber zum Kellner, um ein paar Hilfsmittel von ihm zu verlangen – Salz, Gallseife und Backpulver, die ihr der Mann eilig besorgt. Damit folgt sie Olga zur Toilette, ein ergebener Zug auf den schwarzbemalten Lippen.
Stirnrunzelnd schaut Lucián ihr hinterher, dann sieht er wieder zu seiner Gastgeberin herüber. Er hält sich wahrlich gut dafür, dass er nun mit freiem Oberkörper vor ihr am Tisch sitzt. »Also«, lässt er hören, »du und Olga … Ich muss zugeben, diese Zusammenstellung hätte ich nicht erwartet.«
Nyokas Schmunzeln wird ein wenig breiter. »Ich bin beeindruckt«, sagt sie. »Du scheinst keine Probleme zu haben, dich an sie zu erinnern.« Mit einem leisen Wink lockt sie den Kellner herbei. »Noch ein Glas.«
Lucián hebt die Schultern, ehe er sich ebenfalls an den Häppchen auf dem Tisch bedient. »Man lebt nicht sein halbes Leben unter Geistern und Gauklern, ohne sich dabei den einen oder anderen Trick abzuschauen.« Noch einmal nickt er zur Küche hinüber. »Im Ernst, was interessiert dich an ihr? Sucht euer Anführer etwa nach Neuzugängen?«
Als Antwort deutet Nyoka ein Gähnen an. »Ich bin heute nicht wegen Logos hier«, stellt sie fest und mustert Lucián mit erhobener Augenbraue. »Genauso wenig wie du übrigens. Kannst du die Arbeit nicht für einen Abend ruhen lassen?«
»Kannst du es?«, erwidert er. In seinem Blick flackert eine stumme Herausforderung.
Nyoka lässt sich mit ihrer Erwiderung Zeit. Mit einem sanften Schmunzeln betrachtet sie ihr Gegenüber. Sie weiß sehr wohl, weshalb sie Lucián eingeladen hat. Da ist ein Brennen in ihm, kaum überdeckt durch seine sorgsam einstudierte Ruhe. Eine Glut, roh und zehrend, die nur darauf wartet, zu einer hungrigen Flamme angestachelt zu werden.
Oh ja; sie hat sich, was ihn angeht, nicht getäuscht.
»Olga ist ein nettes Mädchen«, antwortet sie schließlich. »Aber nach fünf Minuten habe ich genug von ihr gesehen. Sie würde nur zu gerne mehr aus sich machen, aber wann immer sich die Gelegenheit ergibt, wird sie zielsicher den einfachsten Weg wählen. Du dagegen …«
Lucián erwidert ihren Blick gebannt. »Was siehst du in mir?«, fragt er, die Augenbrauen zusammengezogen.
Sinnend betrachtet Nyoka ihren Gast – die hübschen Züge, die großen Augen, die sie erwartungsvoll anschauen. Unwillkürlich löst Lucián die Arme vor der Brust und stützt sie auf der Tischplatte ab.
»Ich sehe Potenzial«, erwidert Nyoka ruhig. »Weit mehr, als du im Moment zu nutzen bereit bist. Ich sehe ein leuchtendes Feuer, das unter Libuše zu einem Glimmen erstickt wird.«
Ein heiseres Lachen erklingt drüben von der Bar. »Hört, hört«, brummt der Alte mit der Weinflasche und mustert Lucián dabei durchdringend. »Du hast dir ja eine schöne Gesellschaft ausgesucht. Und du hast auf solche Reden nichts zu erwidern?«
Lucián scheint einen Augenblick zu überlegen, ob er den Einwurf einer Antwort würdigen soll. Endlich dreht er sich zu dem anderen Mann hinüber. »Glaub mir, Havel, ich weiß deine Sorge zu schätzen. Aber ich bin überzeugt, dass unsere Fürstin ihre Ehre selbst verteidigen kann.«
Darauf hebt Havel nur die Schultern und wendet sich wieder seinem Wein zu.
Nyoka kann sehen, wie Lucián den alten Sänger verstohlen mustert – seinen altmodischen Frack, der wohl an frühere Hochtage erinnert, die sorgsam zur Seite gekämmten Haare, seine Finger, die auf dem dunklen Holz irgendeinen Walzer trommeln. Auch wenn sie Luciáns Gedanken nicht durchdringen könnte, wären sie doch allzu leicht zu lesen. In Havels Unwillen, vergangene Glanzzeiten aufzugeben, sieht er ein Mahnmal dessen, was aus ihm werden könnte, wenn Libuše eines Tages das Interesse an ihm verliert.
Er muss glauben, dass es Nyokas Hand war, die ihm den Alten heute Abend vor Augen geführt hat. Dabei würde es ihr kaum in den Sinn kommen, ihre Karten so offensichtlich auszuspielen.
Von der Bar kommt der Kellner mit einem leeren Glas und gießt Lucián von dem Francova ein, ohne dass der ihm Beachtung schenkt. Seine Aufmerksamkeit liegt nun wieder ganz bei Nyoka. Mit einem Seufzen lehnt er sich auf seinem Stuhl zurück. »Du bist alt, nicht wahr? Libuše selbst kennt niemanden, der älter wäre.« Er wartet, bis der Kellner verschwunden ist, dann hebt er erneut an. »Sag mir, Nyoka, warum bin ich heute Abend hier? Was willst du wirklich von mir?« Mit einem leisen Schnauben sieht er sich um. »Von uns allen?«
Nyoka erwidert seinen Blick offen. Dann hebt sie in einer entwaffnenden Geste die Hände. »Ich will den Menschen helfen, ihre Bestimmung zu finden. Ich will ihnen die Freiheit schenken.«
»Die Freiheit schenken … Das sind große Worte.« Lucián kräuselt die Lippen. »Beantworte mir eine Frage: Ob nun Menschen oder Geistwesen – sind die Geschöpfe um dich her je irgendetwas anderes als Spielfiguren für dich?«
Die Frage lässt Nyoka innehalten. Ohne dass er es wollte, hat Lucián etwas in ihr angerührt, eine uralte Erinnerung. Unwillkürlich steigt das Antlitz eines bleichen, noch jungen Mannes vor ihr auf, der sie aus todgeweihten Augen anschaut; daneben seine Schwester, die ihr die gleiche Frage stellt. Sein flehender Ausdruck vermischt sich mit den Bildern anderer, Sterbliche und verirrte Geister gleichermaßen, die hoffnungsvoll zu ihr aufsehen. So viele Gesichter, so viele Geschichten, die sie mitangehört hat. Und nicht wenige, bei denen sie selbst ihre Finger im Spiel hatte.
Nyoka greift nach dem Glas auf dem Tisch und nimmt einen Schluck von dem Wein – um sich zu fassen und um das Zittern ihrer Hand zu verbergen. Sie ist nicht gut darin, vor anderen Schwäche zu zeigen. Als sie das Gefäß zurückstellt, kreisen ihre Finger weiter über den Rand. Langsam hebt sie den Blick zu Lucián, der sie immer noch erwartungsvoll ansieht.
»Diese Frage hat mir schon einmal jemand gestellt«, sagt Nyoka leise. »Diejenige hatte mehr Recht dazu als du.«
Lucián verzieht die Lippen. »Das ist keine Antwort.«
»Nein, das ist es nicht.« Nyokas Hand fährt zu dem Apfel, der vor ihr auf dem Tisch liegt. Sie mustert ihr Gegenüber von unten, während ihre Finger über die rote Frucht streichen.
Wieder erscheint das Bild jenes anderen Mannes vor ihrem Auge, jünger noch als Lucián und doch von dem gleichen Feuer beseelt – nur dass es in ihm bereits zu einem hellen Stern entflammt war. Und daneben ein Mädchen im Schatten, seine ältere Schwester … Sie war es, die einst etwas in Nyoka verändert hat, so unwahrscheinlich es auch erscheinen mochte.
Die Menschen, die im Schatten warten, haben Nyoka immer schon mehr fasziniert als jene in der offenen Sonne. Die, die sich erst von ihren Fesseln befreien müssen, um ihren Weg zu finden – so wie Lucián, der nun vor ihr sitzt und sie begierig mustert. Nyoka ist da, um ihnen zur Seite zu stehen.
»Ich rede nicht über diejenigen, denen ich begegne«, erwidert sie schließlich. »Ich wache über ihre Schicksale … Ich hüte ihre Geschichten.« Mit einem Seufzen greift sie nach dem Weinglas vor sich auf dem Tisch. Um sie her klingt leise Klaviermusik durch den Raum, eine Erinnerung an lang vergangene Zeiten. »Aber das heißt nicht, dass sie mir gleichgültig wären. Dass ich nicht an sie denken würde … an manche von ihnen jeden Tag.«
Salzburg, 1761 n. Chr.
Die kleinen Hände tanzen über die Tasten des Cembalos, als wären es zwei eigenständige Wesen, verschlungen in ihr sonderbares Spiel. Immer wieder läuft die rechte Hand der linken für ein paar Takte davon, um den äußeren Tasten einen neuen Triller zu entlocken und sich dann wieder in perfekter Harmonie mit ihrer Schwester zusammenzufinden. Der Kopf des Knaben bleibt dabei aufrecht, die Augen von einem zusammengefalteten Taschentuch bedeckt.
Seine Augen sind die einzigen im Raum, die nicht gebannt an den zierlichen Fingern hängen und deren treffsichere Wanderung beobachten. Der Fürsterzbischof hat sich auf seinem goldgeschmückten Sessel zurückgelehnt und betrachtet das begabte Kind mit gönnerhafter Miene. Ringsum sind auf den Stühlen und Chaiselongues Barone, Gräfinnen und Kirchenmänner versammelt, die diese Vorstellung ihres Landesherrn interessiert verfolgen. Dicht neben dem Jungen steht sein Vater und verfolgt den Lauf der Kinderfinger so stolz, als wäre es sein eigenes Spiel, das das hochgeborene Publikum da fesselt. Selbst seine zehnjährige Schwester, die Wolferls Darbietung schon so oft beobachtet hat, kann die Augen kaum von ihm wenden. Erst eine Viertelstunde zuvor hat sie selbst an dem Cembalo gesessen und ihr Können bewiesen, unter dem wohlgefälligen Beifall der Gästeschar. Und doch ist dies etwas anderes: Die Leichtigkeit, mit der der Fünfjährige das selbstkomponierte Menuett zum Besten gibt, ohne auch nur auf das Instrument zu schauen, begeistert die Zuhörenden weit mehr als ihr sorgsam einstudiertes Cembalospiel.
Endlich reißt Nannerl ihren Blick von den Elfenbeintasten und dreht sich hinüber zu der bewundernden Schar der Gäste. Der Erzbischof hat zu einer Soirée geladen und es dem zweiten Violinisten seiner Hofkapelle erlaubt, seine begabten Kinder der illustren Gesellschaft als Abendunterhaltung zu präsentieren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die beiden in der Alten Residenz zu Besuch sind, doch zum ersten Mal hat Nannerl Gelegenheit, all die hochgestellten Gäste ihres Gönners zu betrachten. Von ihrem Platz am Rande des Raums aus sieht sie sich verstohlen unter den Anwesenden um. Gebauschte Röcke, blendend weiße Strümpfe, Fächer, die über weißgepuderten Gesichtern wedeln. Nannerl klopft das Herz bis in den Hals, während sie die Herren in den adretten Anzügen und die Damen mit ihren hochaufragenden Perücken mustert. Sie alle haben nur Augen für Wolferl, der nun angefangen hat, die selbstkomponierte Melodie aus dem Stehgreif zu variieren.