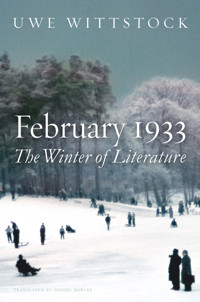15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Er war ein scharfzüngiger Kritiker, dessen Urteil man fürchtete, der es aber auch wie kein Zweiter verstand, für große Bücher zu begeistern: Marcel Reich-Ranicki konnte mit Worten Berge versetzen, aber eines gelang ihm nie: sein Publikum zu langweilen.
Gestützt auf zum Teil bisher unveröffentlichte Quellen und auf Gespräche mit einstigen Weggefährten und Gegnern beschreibt Uwe Wittstock das Leben dieses Büchermenschen und Musikliebhabers: von der Hölle des Warschauer Gettos zum wichtigsten Literaturkritiker der Bundesrepublik Deutschland, der mit dem Literarischen Quartett für einige Jahre leidenschaftliche Diskussionen über Literatur im Fernsehen zu etablieren verstand – ein Wunder, das sich als unwiederholbar erwies.
Uwe Wittstock hat seine 2005 bei Blessing erschienene Biografie komplett überarbeitet und mit zahlreichen neuen Informationen und Fotos sowie einem Rückblick auf die letzten acht Lebensjahre des 2013 verstorbenen Marcel Reich-Ranicki ergänzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Ähnliche
Das Buch
Er ist eine exemplarische Figur des 20. Jahrhunderts: verfolgt von den Nazis, kurzzeitig Anhänger der kommunistischen Partei Polens und Mitarbeiter des Geheimdienstes, ÜBERGESIEDELT nach Deutschland, wo er sich schnell einEN Ruf als bedeutender Literaturkritiker erarbeitet. Anschaulich beschreibt diese Biografie die anfangs mühsame, später rasante Karriere des Marcel Reich-Ranicki. Zugleich entsteht ein Bild des Literaturbetriebes der Bundesrepublik Deutschland: von dem Einfluss der Gruppe 47, den medienaffinen Inszenierungen des IngeborG-Bachmann-Preises in Klagenfurt und von dem fast schon sensationellen Erfolg des Literarischen Quartetts. Lebendig erzählt Wittstock von der tiefen Freundschaft Reich-Ranickis mit Schriftstellern wie Siegfried Lenz und Eva Demski, sowie von den nicht minder intensiven, aber störungsanfälligen freundschaftlichen Beziehungen zu Heinrich Böll und Walter Jens.
Uwe Wittstock hat seine 2005 publizierte Biographie komplett überarbeitet und entsprechend ausführlich die letzten Lebensjahre Reich-Ranickis dargestellt: die Verfilmung seines Bucherfolges Mein Leben 2009, der Tod seiner Ehefrau Tosia 2011, seine große Rede 2012 zum Tag des Gedenkens an die Todesopfer des Holocausts vor dem Bundestag, seine gewaltiges Aufsehen erregende Ablehnung des Deutschen Fernsehpreises 2009 und die anschließende Diskussion mit Gottschalk, schließlich sein Umgang mit Altern und Kranksein.
Der Autor
Uwe Wittstock, 1955 in Leipzig geboren, war von 1980 bis 1989 unter der Ägide von Marcel Reich-Ranicki Literaturredakteur der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. 1989 wurde er mit dem Theodor-Wolff-Preis für Journalismus ausgezeichnet. Anschließend war er Lektor im S. Fischer Verlag und Kulturkorrespondent der »Welt«. Seit 2010 ist Literaturredakteur des Nachrichtenmagazins »Focus«. Zuletzt veröffentlichte er den Essayband »Nach der Moderne« über die deutsche Gegenwartsliteratur.
Uwe Wittstock
Marcel Reich-Ranicki
Die Biografie
Blessing
Der Vorsatz zeigt die beiden Telegramme, mit denen Marcel Reich-Ranicki im Sommer 1945 seine Schwester Gerda in London über das Schicksal seiner Eltern und über seine Heirat informiert.
1. Auflage 2015
Copyright 2015 Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typografie, München
Umschlagmotiv: Daniel Biskup
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-16559-8www.blessing-verlag.de
Inhalt
»Der« Kritiker
Kindheit in Włocławek, Jugend in Berlin
Vom Überleben
Der lange Weg zurück zur Literatur
Kritik, nichts als Kritik
Vom Bewusstsein der Republik
Der Literaturchef
Freundschaften, Feindschaften
Popstar der Kritik
Familie
Vierzig Jahre Frankfurt oder: Die Frage nach der Heimat
Die letzten Jahre
Dank
Abbildungsverzeichnis
Anmerkungen
Namensregister
»Der« Kritiker
»Alles, was ich in diesem Buch beschrieben habe, ist wahr. Aber nicht alles, was ich erlebt habe, habe ich in diesem Buch beschrieben«, bekannte Marcel Reich-Ranicki, als seine Autobiografie Mein Leben erschien. Aus den Gründen dafür machte er kein Geheimnis. »Jeder Autobiograf schont sich selbst, auch wenn er sich das Gegenteil vorgenommen hat. Ich habe auch einiges weggelassen.« Der Kritiker Reich-Ranicki hatte kein naives, kein leichtgläubiges Verhältnis zur Literatur. Er wollte sich von Schriftstellern nichts vormachen lassen, nicht einmal von sich selbst, sobald er zum Erzähler des eigenen Lebens wurde. Es gibt keine Selbstbeschreibung ohne Selbststilisierung, jede Autobiografie ist zwangsläufig lückenhaft, kein Autor kann sich sicher fühlen vor Streichen, die ihm sein Unbewusstes oder sein Gedächtnis spielen, und Reich-Ranicki wusste das. Er hat Mein Leben nie als das letzte Wort über sein Leben betrachtet.
Ein Biograf ist gewiss nicht klüger als der Autobiograf, aber er hat eine andere Perspektive. Er schreibt aus größerer Distanz und aus der Außensicht, was ihm Vorteile ebenso wie Nachteile verschafft. Das letzte Wort wird auch er nie haben. Reich-Ranicki kannte die Perspektive, aus der das vorliegende Buch geschrieben wurde. Als es 2005 in einer ersten Fassung erschien, war er so großzügig, es zu loben. Er habe, sagte er, darin manches über sein Leben erfahren, »was ich nicht gewusst habe, und manches, womit ich nicht ganz einverstanden war. Gott sei Dank.«1 Nach Reich-Ranickis Tod habe ich das Buch nicht nur ergänzt um die Ereignisse seiner letzten Lebensjahre, sondern in allen Teilen gründlich überarbeitet, vervollständigt und aktualisiert. Die Perspektive auf ihn und sein Leben hat sich dabei nicht verändert.
Zu ersten Mal begegnete ich Reich-Ranicki, als ich vierundzwanzig war. Er hatte mich im Herbst 1979 zu einem Vorstellungsgespräch nach Frankfurt eingeladen, eine Stelle in der Literaturredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sollte neu besetzt werden. Ich studierte damals noch und hatte in den Monaten zuvor eine Handvoll Rezensionen für ihn geschrieben, die er zu meiner Freude tatsächlich veröffentlichte. Natürlich war ich nervös, mit dem Gespräch bot sich mir eine großartige Chance, es gab keinen besseren Platz, das journalistische Handwerk zu erlernen, als die FAZ. Aber, um ehrlich zu sein, im Grunde hatte ich das Gefühl, alles in allem könne nicht viel schiefgehen für mich. Falls es mit dieser Bewerbung klappte, wunderbar. Falls nicht, wäre das schade, doch ich war jung, vierundzwanzig, irgendwann würde es eine zweite Chance geben.
»Kommen Sie, kommen Sie«, sagte Reich-Ranicki, als er mich eilig in sein Büro winkte, damals knapp sechzig Jahre alt und noch nicht so fernsehbekannt, wie er es später durchs Literarische Quartett werden sollte. Dass ich – der Frankfurter Verkehr! – ein paar Minuten zu spät kam, ließ er mich nicht spüren, wohl aber seine Ungeduld, mehr über meine literarische Bildung zu erfahren. »Keiner kann alles gelesen haben, wir alle haben Lücken«, sagte er auf dem Weg von der Bürotür zu seinem Schreibtisch, »auch ich, auch ich habe Lücken«, und warf sich in seinen Drehsessel: »Welche Autoren kennen Sie? Oder haben Sie die Zeit an der Universität nur vertrödelt?« Ich zählte auf: Böll, Grass, Frisch, Christa Wolf, Walser, Dürrenmatt, meine frühe Leidenschaft für Heiner Müller fand er kurios, mein Interesse für Peter Handke gerade eben noch verzeihlich.
»Gut, gut, wie steht es mit älteren Schriftstellern, haben Sie schon einmal den Namen Thomas Mann gehört?« Buddenbrooks, Zauberberg, Doktor Faustus, Tonio Kröger, Felix Krull.
»Mehr nicht?« Reich-Ranickis Blick wurde düster. »Kleist, haben Sie denn wenigstens was von Kleist gelesen?« Vermutlich lag es an den tiefen Falten, die sich inzwischen auf Reich-Ranickis Stirn zeigten, wenn meine Antwort etwas großräumiger ausfiel, als es den Tatsachen entsprach.
»Alles.«
»Sehr gut. Sie mögen Kleist, sehr gut. Dann erzählen Sie mal etwas über das Käthchen von Heilbronn.«
Unglücklicherweise zählte das Käthchen zu jenem Teil von Kleists Werk, um den meine Antwort zu großräumig ausgefallen war. Ich schwieg und ließ meinen Blick einen Moment lang auf dem Schreibtisch zwischen uns ruhen, bemühte mich, ein nachdenkliches Gesicht zu machen und sagte dann, unbegreiflicherweise sei mir die Handlung im Augenblick entfallen, eine vorübergehende Gedächtnislücke, ein Blackout.
»Mein Lieber«, sagte Reich-Ranicki, »Sie haben das Käthchen nie gelesen. Als junger Mann wie Sie vergisst man dieses Stück nicht, man vergisst nicht, was Käthchen für den Mann tut, den sie liebt. Besser, Sie bleiben bei der Wahrheit.«
Danach stellte er noch viele Fragen, welche, weiß ich nicht mehr, nur dass ich mit meinen Antworten von nun an streng bei der Wahrheit blieb – und dass ich, als ich wieder zu Hause war, umgehend das Käthchen las. Reich-Ranickis Bemerkung hatte meine Neugier geweckt. Etwas, das er perfekt beherrschte: auf Literatur neugierig zu machen. Ich begriff schnell, was er in unserem Gespräch gemeint hatte: Als das Schloss brennt, geht Käthchen für den Mann, den sie liebt, in die Flammen, sie geht buchstäblich für ihn durchs Feuer, diese Szene vergisst man nicht, das ist richtig.
Später dann, viel später, als ich Reich-Ranickis Autobiografie Mein Leben las, begriff ich noch etwas anderes. Nämlich, dass er gerade vierundzwanzig Jahre alt war, so alt wie ich bei unserem ersten Gespräch, als er das Warschauer Getto und den Holocaust überlebt hatte, und dass seine Frau Tosia und er mehr als einmal für den anderen durchs Feuer gegangen waren. Und mir wurde klar, was für ein unverschämtes Glück es ist, mit vierundzwanzig noch in dem Glauben leben zu dürfen, es könne nicht viel schiefgehen und es warte, falls doch etwas schiefgeht, eine zweite Chance.
Gut zwanzig Jahre nach diesem Bewerbungsgespräch, im Dezember 2001, war Reich-Ranicki auf einem Gipfel von Prominenz und Wirkungsmacht angelangt, den vor ihm kein anderer Kritiker in Deutschland erreicht hatte. Neun Jahre lang hatte ich in seiner Literaturredaktion gearbeitet, und obwohl ich danach die Frankfurter Allgemeine verließ, hatten wir uns nicht aus den Augen verloren. Es war ein sehr kalter Tag in Berlin, wir waren am Gendarmenmarkt verabredet. Reich-Ranicki wohnte dort in einem Hotel mit Blick auf den Deutschen Dom und das ehemalige Schauspielhaus, dem er die großen Theatererlebnisse seiner Jugend verdankte. Er war, als er durch die Lobby auf mich zueilte, ein wenig ungeduldig wie so oft. Die Begrüßung fiel kurz und geschäftsmäßig aus, dann wollte er weiter, dirigierte mich zurück in die Kälte, zum nächsten Taxi.
»Sie kenn ich ausm Fernsehn.« Der Taxifahrer musterte im Rückspiegel den Mann, der sich auf den hinteren Sitz seines Wagens hatte fallen lassen. Er zögerte einen Moment, drehte sich um, studierte das Gesicht seines Fahrgasts und ließ Sendungen, Serien, Shows an seinem inneren Auge vorüberziehen. Für mich auf dem Nebensitz hatte er keinen Blick. Dann hellte sich sein Gesicht auf. »Ja«, brummte er und nickte zufrieden, »Sie sind der Kritiker.« Drehte sich wieder nach vorn, gab kein weiteres Wort von sich und fuhr uns zu der gewünschten Adresse.
© Isolde Ohlbaum:
Nicht: »ein« Kritiker hatte er gesagt. Auch nicht: »dieser« Kritiker. Sondern: »der Kritiker«. Wenn die Kritik, die in Deutschland traditionell zu den missverstandenen und oft ungeliebten Institutionen zählte, nach dem Zweiten Weltkrieg in diesem Land ein neues, anderes Image bekam, dann ist das nicht zuletzt ein Verdienst Reich-Ranickis. Ihm ist gelungen, was hierzulande zuvor undenkbar schien: Er hat die Kritik zu einem vom Publikum gespannt verfolgten, nicht selten bewunderten und in vollen Zügen genossenen Schauspiel gemacht. Er hat die Debatte über Literatur – also über so luftige, schwer fassbare Fragen wie die, ob der Roman X des Autors Y gelungen genannt werden dürfe oder nicht – konsequent popularisiert. Er hat den öffentlichen Streit über Bücher aus den Zirkeln der Fachleute, Akademiker und Intellektuellen herausgeführt und zu den gewöhnlichen Lesern gebracht, und das in Zeiten, in denen der Literatur gebetsmühlenhaft nachgesagt wird, sie sei im Begriff, alle Ausstrahlungskraft einzubüßen.
Zum Zeitpunkt jener Berliner Taxifahrt kannte ihn nahezu jeder Fernsehzuschauer, also: nahezu jeder. Schon als Literaturkritiker der Zeit und als Chef der Literaturredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war Reich-Ranicki zu einer beherrschenden, den Kulturbetrieb zuverlässig polarisierenden Gestalt herangewachsen. Mit einer kaum noch überschaubaren Zahl von Sammel- und Essaybänden, Monografien und Anthologien, Reden und bücherfüllenden Gesprächen manifestierte er über Jahrzehnte hinweg seinen Anspruch auf eine umfassende literaturkritische Zuständigkeit. Und mit dem von ihm konzipierten und dominierten Literarischen Quartett begann schließlich in den neunziger Jahren seine Karriere zum Popstar der Kritik. Er krönte sie 1999 mit seiner Autobiografie Mein Leben, die bislang fast anderthalb Millionen Käufer fand und ihn zu einem der meistgelesenen deutschen Autoren jener Jahre machte.
Wenn also der damals amtierende Bundespräsident Johannes Rau im Dezember 2001 vorschlug, die Abschiedssendung des Literarischen Quartetts in seinen Berliner Amtssitz zu verlegen – und unsere gemeinsame Taxifahrt deshalb vom Gendarmenmarkt durchs kältestarre Berlin zum Schloss Bellevue führte –, dann war das zweifellos in erster Linie als politische Geste zu verstehen. Dreiundsechzig Jahre nachdem der Jude Marcel Reich achtzehnjährig von den Nationalsozialisten aus Berlin deportiert worden war, bereitete ihm das politische Oberhaupt Deutschlands nun in ebendieser Stadt die ganz große Bühne für einen landesweit beachteten, im Literaturbetrieb noch nie dagewesenen Auftritt als Kritiker und Literaturentertainer: Es war eine öffentliche Verbeugung vor der nicht nur beruflichen Lebensleistung Reich-Ranickis. Sie sollte sich in vielleicht noch eindringlicherer Form wiederholen, als Reich-Ranicki anlässlich des Holocaust-Gedenktages im Januar 2012 gebeten wurde, vor dem Deutschen Bundestag zu sprechen.
Andererseits war die Einladung durch Bundespräsident Rau auch als geschickter Schachzug eines auf Öffentlichkeitswirkung bedachten Politikers zu verstehen. PR-Fachleute sprechen in solchen Fällen von positivem Imagetransfer: Der gelernte Buchhändler Johannes Rau wollte einen Abend lang an jenem kulturellen Ansehen teilhaben, das Reich-Ranicki landesweit genoss, wollte sich als Politiker vorteilhaft mit ins Bild setzen, wenn die Kameras den großen Schlussapplaus für das Quartett einfingen. Wann hat es so etwas je gegeben: Der höchste Repräsentant des Landes und ein Literaturkritiker präsentieren sich der Öffentlichkeit, und es ist der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, der Kritiker könnte der Prominentere von beiden sein.
Selbstverständlich ist die Versuchung groß, Reich-Ranickis Aufstieg zum mächtigsten Mann des deutschen Literaturbetriebs biografisch durch sein Schicksal erklären zu wollen, durch seine Erfahrung, ohnmächtiges Opfer von Deportation und Verfolgung gewesen zu sein. Fünf Jahre musste er im Warschauer Getto und auf der Flucht vor den Nationalsozialisten tagtäglich mit seiner Ermordung rechnen – seine Eltern, sein Bruder und die Eltern seiner Frau Teofila, genannt Tosia, überlebten den Holocaust nicht. Derartige Erlebnisse erschüttern einen Menschen bis in den Kern der Persönlichkeit. Kein Zweifel, Reich-Ranicki war, auch wenn er selten darüber sprach, tief geprägt durch die Zeit, in der er Freiwild war für Rassisten in deutschen Uniformen. Sein Leben lang wählte er in jedem Restaurant oder Café seinen Sitzplatz so, dass er die Eingangstür im Blick hatte – wie in den Jahren, in denen er mit möglichen Razzien rechnen musste. Seine Leidenschaft gehörte bis zu seinem Tod den jeweils neuesten Nachrichten – wie in der Zeit, in der er als Mitarbeiter der Warschauer Gettoverwaltung lernen musste, dass von verlässlichen Informationen das Überleben abhängen kann. Er rasierte sich bis in sein hohes Alter zweimal täglich – wie in jenen Tagen, in denen deutschen Soldaten schon ein Bartschatten ausreichte, um einen Juden im Getto als heruntergekommen auszusondern und den Transporten zuzuteilen, die im Gas endeten.
Reich-Ranicki hat, was ihm niemand hätte verübeln können, nicht endgültig mit den Deutschen gebrochen, sondern sie statt dessen unbeirrbar an ihre Kultur erinnert. Er hat ihnen als Maßstab die eigene Literatur vor Augen gehalten, deren klassischer Höhepunkt eine Feier der Humanität war, eine Feier der Menschlichkeit. Es ist nicht leicht, die Größe dieser Geste angemessen in Worte zu fassen. Sicher, er hat den größten Teil seiner Zeit damit verbracht, Bücher zu lesen, um über sie zu schreiben. Und sich dann genussvoll mit anderen Menschen gestritten, die ebenfalls Bücher lesen, um über sie zu schreiben. Aber letztlich ging es ihm dabei nicht nur um die Literatur. Sondern auch darum, der größtmöglichen Öffentlichkeit wieder und wieder etwas ins Gedächtnis zu rufen, was in diesem Land zwölf fatale Jahre lang verschüttet gewesen war und das in den besten Werken der Literatur bewahrt wird: ein Bewusstsein für Toleranz, Weltoffenheit, Gerechtigkeit, kurz: für Kultur.
1 Marcel Reich-Ranicki: Aus persönlicher Sicht. Gespräche 1999 bis 2006. Herausgegeben von Christiane Schmidt. München 2006, S. 38 und S. 98 und S. 264
© Bettina Strauss
Doch selbstverständlich lässt sich aus einem in der Vergangenheit erlittenen Trauma der spätere Lebensweg nicht vollständig erklären. Reich-Ranicki trat nie als bedauernswertes, hilfsbedürftiges Verfolgungsopfer auf, sondern eher als ein Verfolger, zumindest wenn man jenen Schriftstellern glaubt, die sich von ihm missverstanden fühlten. Er hatte die Literatur zu seiner Fluchtburg gemacht und sich selbst in dieser Festung ohne Frage den Part eines Herrschers zugedacht. Doch zugleich war er kein weltferner Träumer, vielmehr verfügte er über einen strengen Realitätssinn, der ihn die Wirklichkeit sehen ließ, wie sie war, und nicht so, wie er sie gern gehabt hätte oder wie sie nach idealistischen Vorstellungen sein sollte. Sein energisches Engagement für das Fernsehen ist ohne diese nüchterne Weltsicht nicht zu begreifen. Denn natürlich zog der Thomas-Mann-Verehrer Reich-Ranicki jedes sorgsam ausformulierte literaturkritische Essay allen temperamentvoll in Kameras und Mikrofone gesprochenen literarischen Stegreif-Urteilen vor. Doch er hatte erkannt, dass er mit keiner gedruckten Rezension einen so großen Einfluss ausüben konnte wie mit einem effektvollen Auftritt im Fernsehen. Die Konsequenz, mit der er nach dieser Einsicht handelte, unterschied ihn von fast allen seinen Konkurrenten im Literaturbetrieb. Und so widerfuhr ihm, den die Nationalsozialisten einst aus der deutschen Kultur verbannten und ermorden wollten, die Genugtuung, für eine enorme Zahl von Deutschen über ein, zwei Jahrzehnte hinweg zu definieren, was deutsche Kultur ausmacht.
Aber Reich-Ranicki war mehr als nur der erfolgreichste Kritiker der deutschen Literaturgeschichte, er war zugleich in mancherlei Hinsicht ein exemplarischer Intellektueller des zwanzigsten Jahrhunderts. An seiner Biografie werden, so deutlich wie nur am Schicksal weniger anderer Menschen, die politischen Katastrophen und kulturellen Umbrüche einer furchterregenden Epoche sichtbar. Reich-Ranicki erlebte die verheerenden Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 1929, war Opfer des nationalsozialistischen Terrors, erlag vorübergehend der geistigen Verführungskraft des Totalitarismus kommunistischer Prägung und bekannte sich schließlich zur offenen, pluralistischen Gesellschaft samt ihres Medienbetriebs vom Qualitätsjournalismus bis hin zu Unterhaltungsshows wie Wetten, dass …
Und wie viele Juden und Literaten gehörte er zeitlebens zu den Außenseitern und war schon deshalb beständig auf Heimatsuche. Er hat diese Heimat, wie er immer wieder betonte, nicht in einem Land gefunden, sondern in der deutschen Literatur. Allerdings stilisierte er die Literatur deshalb nicht, wie viele Intellektuelle des vergangenen Jahrhunderts von rechts bis links, von Heidegger bis Adorno, zu einer elitären, hermetischen, lebensabgewandten Gegenwelt. Sein Ziel war es – und das ist das Herausragende seiner Rolle –, der Literatur ein Publikum zu verschaffen, ihr in Alltagskultur und Alltagsbewusstsein einen beachtlichen und beachteten Platz zu geben. So wurde Reich-Ranicki neben allem anderen zu einer Symbolfigur für einen Rollenwandel der Kultur: einer Kultur, die ihren ehemals normativen Anspruch für die Gesellschaft weitgehend verloren hat und der dennoch, wenn sie sich nicht in einen Schmollwinkel der Selbstgenügsamkeit zurückzieht, eine orientierungsstiftende und integrierende Funktion zufallen kann.
Kindheit in Włocławek, Jugend in Berlin
Die politischen Verwerfungen des zwanzigsten Jahrhunderts haben schon in der Geschichte seiner Namen ihre Spuren hinterlassen: Marcel Reich-Ranicki wurde am 2. Juni 1920 als Marcel Reich in der polnischen Kleinstadt Włocławek geboren. Zumindest trugen die Standesbeamten diesen Namen in seine Geburtsurkunde ein.2 Später, nachdem er von Deutschland nach Polen deportiert worden war, ging die Urkunde im Warschauer Getto verloren. In jener Zeit waren die antideutschen Affekte in dem von der Wehrmacht besetzten und verwüsteten Land derart übermächtig, dass er sich Marceli nannte, nachdem ihn Freunde davon überzeugt hatten, der Vorname Marcel sei in Polen ungebräuchlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm er dann auf Wunsch seiner damaligen Vorgesetzten in Warschau einen polnisch klingenden Nachnamen an und hieß nun Marceli Ranicki. Als er schließlich 1958 in die Bundesrepublik übersiedelte, entschied er sich, den selbst gewählten Namen mit seinem Geburtsnamen zu Marcel Reich-Ranicki zu verschmelzen. Mit anderen Worten, die politischen Konfrontationen griffen so tief in sein Leben ein, dass sie mehrfach sogar die sonst selbstverständlich erscheinende Einheit von Name und Person zerrissen. Das Gefühl einer ungefährdeten, weitgehend bruchlosen, fraglos anerkannten Identität kannte Reich-Ranicki zumindest in der ersten Hälfte seines Lebens nicht. Geprägt wurde er vielmehr, wie sich schon an der Geschichte seiner Namen symbolisch ablesen lässt, durch das Ringen zwischen hartnäckigem Selbstbehauptungswillen und einem politischen Anpassungsdruck, der sich für lange Jahre bis zu einer mörderischen Verfolgung steigerte.
Der Vater: David Reich – Die Mutter: Helene Reich
© Marcel Reich-Ranicki/Andrew Ranicki
In seiner Familie war der kleine Marcel Reich ein Nachzügler, das mit deutlichem Abstand jüngste von drei Geschwistern. Sein Bruder Alexander Herbert war neun Jahre, seine Schwester Gerda dreizehn Jahre älter als er. Der Vater David Reich, Jahrgang 1880, und die Mutter Helene Reich, Jahrgang 1884, konnten sich bei seiner Geburt nicht mehr zu den jungen Eltern zählen. Ob er deshalb in seiner frühesten Kindheit in besonderer Weise bemuttert und verwöhnt wurde, ob er also die Rolle eines typischen Nesthäkchens spielte, lässt sich nicht rekonstruieren. Seine Erinnerungen setzten erst ein kurz vor oder zeitgleich mit seiner Einschulung: »Ich war fünf oder sechs Jahre alt, als meine Mutter während eines kurzen Besuchs bei ihrer Berliner Familie in einem Kaufhaus Kindergarderobe mit der Aufschrift ›Ich bin artig‹ sah. Das fand sie amüsant. Ohne die möglichen Folgen zu bedenken, ließ sie auf meine Blusen und Kittel (…) ebendiese Aufschrift in polnischer Übersetzung sticken. Rasch wurde ich zum Gespött der Kinder – und reagierte darauf mit Wut und Trotz: Brüllend und prügelnd wollte ich jenen, die sich über mich lustig machten, beweisen, dass ich besonders unartig war. Das trug mir den Spitznamen ›Bolschewik‹ ein.«3
Weichselufer in Włocławek zwischen den Weltkriegen
© Polska Agencja Fotografów
Die Geburtsstadt Włocławek lag bis zum November 1918, also anderthalb Jahre bevor Reich-Ranicki geboren wurde, nur wenige Kilometer von der deutsch-russischen Grenze entfernt. Polen war seit 1795 von der politischen Landkarte verschwunden gewesen, aufgeteilt zwischen Russland, Österreich und Preußen, und konnte seine nationale Unabhängigkeit erst mit dem Ende des Ersten Weltkriegs zurückgewinnen. Włocławek war zu der Zeit von Reich-Ranickis Geburt, so erinnerte sich später Tadeusz Nowakowski, einer seiner langjährigen Freunde, ein lebendiges Industriestädtchen an der Weichsel mit der »größten Papierfabrik in Polen«, mit »stets überfüllten Gassen, die sich, sobald die Bauern zum Einkaufen kommen, in einen Basar verwandeln. Viele Tauben und Spatzen. Weiße Kopftücher der Dorffrauen. Flottillen von Panjewagen auf dem Grünen Markt.«4 Reich-Ranicki selbst hielt sich, wenn er seiner Geburtsstadt gedachte, nicht bei solch pittoresken Reizen oder mit sentimentalen Reminiszenzen auf, sondern steuerte, wie üblich, rasch zu aufs Zentrum des kulturellen Angebots: »Es gab dort mehrere große Fabriken, drei Kinos und kein Theater.«5 Włocławek zählte in den zwanziger Jahren rund sechzigtausend Einwohner, ein Viertel davon waren Juden6. Die Stadt gehörte zum ehemals russischen Gebiet des aufgeteilten Polens, zum sogenannten Kongresspolen. Dennoch hatten nicht wenige der Juden von Włocławek, wie Reich-Ranicki schreibt, »eine auffallende Schwäche für die deutsche Kultur«7.
Nach der Wiederherstellung des aufgeteilten Staates befand sich Włocławek mit einem Mal nicht mehr an der Peripherie Russlands, sondern im Zentrum des neuen Polens. Die folgenden Jahre waren politisch extrem unruhig, das junge, sehr nationalbewusste Polen trug mit fast allen Nachbarländern blutige Grenzkonflikte aus: mit der Tschechoslowakei wegen des Gebietes um Teschen, mit Deutschland wegen Oberschlesiens und Danzigs, mit Litauen wegen der Region um Wilna und mit der frisch gegründeten Sowjetunion wegen der Ukraine und der weißrussischen Gebiete bis Minsk. Schon die früheste Kindheit Reich-Ranickis fällt also in nicht eben friedliche Zeiten. Im April 1920 befahl Marschall Józef Piłsudski, der starke Mann Polens, den Einmarsch in die Ukraine. Am 7. Mai, vier Wochen bevor der kleine Marcel Reich zur Welt kam, eroberten die polnischen Truppen Kiew. Doch die Gegenoffensive der Roten Armee drang fast bis Warschau vor. Nordöstlich davon sogar noch weiter, Włocławek wurde belagert. »Die ganze Familie ist geflohen, nach Płock«, berichtete Reich-Ranicki: »In Płock lebte die Familie meines Vaters. Dort war mein Vater geboren und aufgewachsen. Die Russen kamen nach Włocławek. In Płock waren sie nicht«8. Erst Mitte August, also sechs Wochen nach Marcel Reichs Geburt, konnten die sowjetischen Truppen von Piłsudski durch das »Wunder an der Weichsel« zurückgeworfen werden. Schon allein wegen der frischen Erinnerungen an diese Kämpfe gegen die sowjetischen Truppen dürfte der Spitzname »Bolschewik« des fünf- oder sechsjährigen Marcel in polnischen Ohren keinen sehr schmeichelhaften Beiklang gehabt haben. Alle diese territorialen Streitigkeiten des noch jungen Landes blieben auch nach den jeweiligen Waffengängen weitgehend ungelöst und überschatteten das Verhältnis zu den Nachbarstaaten in der folgenden Zeit. So konnte Polen dort kaum mit Sympathien rechnen, als es zwanzig Jahre später, gleich nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, zwischen Deutschland und der Sowjetunion erneut aufgeteilt wurde.
Familientreffen: im Vordergrund als Zweiter von links der Großvater väterlicherseits, Kaufmann in Płock. Als Zweite von rechts die Großmutter. Ganz rechts im Vordergrund und nur halb zu sehen: Vater David Reich. Im Hintergrund als Erste von rechts die Mutter Helene Reich.
© Marcel Reich-Ranicki/Andrew Ranicki
Reich-Ranickis Mutter, Helene Reich, geborene Auerbach, war in Deutschland aufgewachsen, im Grenzgebiet zwischen Schlesien und der Provinz Posen. Sie entstammte einer materiell armen, aber an Traditionen reichen Rabbiner-Familie, die nach einer gern gepflegten, aber nie überprüften Legende weitläufig verwandt war mit dem schwäbischen Erzähler Berthold Auerbach (1812–1882), einem der populärsten deutschen Schriftsteller seiner Zeit. Helene Auerbach hatte eine Schwester und fünf Brüder, von denen nur der älteste als Rabbiner die Familientradition fortsetzte. Die übrigen vier wurden Patent- beziehungsweise Rechtsanwälte – womit sie sich allerdings, wie Reich-Ranicki einmal anmerkte, vom Beruf ihrer Vorfahren nicht allzu weit entfernten.9 Denn Rabbiner waren über Jahrhunderte hinweg nicht nur Geistliche, sondern übernahmen in ihren Gemeinden zugleich das Amt des Lehrers und das des Richters. Bedenkt man, mit welchem geradezu forensischen Furor und pädagogischen Eifer Reich-Ranicki seiner Arbeit als Kritiker nachging, darf man wohl auch ihm eine gewisse Verbundenheit zu den beruflichen Vorlieben der Familie seiner Mutter nachsagen.
Über den väterlichen Zweig der Familie ist wenig bekannt. Reich-Ranickis Großvater, Markus Reich, soll ein erfolgreicher Kaufmann gewesen sein, der in der Kleinstadt Płock, die zwischen Włocławek und Warschau an der Weichsel liegt, ein Mietshaus besaß. Die Familie pflegte musische Interessen: David Reich, Reich-Ranickis Vater, spielte in seiner Jugend Geige, und er sprach neben Polnisch auch fließend Russisch, Jiddisch und Deutsch. Eine seiner Schwestern wurde Zahnärztin, eine andere ließ sich am Warschauer Konservatorium zur Opernsängerin ausbilden und trat in Łódź unter anderem als Madame Butterfly auf. Die Kinder David Reichs zeigten dann später ganz ähnliche Neigungen: Reich-Ranickis Bruder Alexander Herbert promovierte an der Berliner Universität in Zahnmedizin, seine Schwester Gerda spielte mit Hingabe Klavier und studierte in Warschau Philologie. Und an den Leidenschaften des Jüngsten der Familie, Marcel, für Literatur und Musik konnte kein Zweifel bestehen.
David Reich hat sich nicht zuletzt um die musikalische Bildung seines jüngsten Sohnes bemüht und damit bei ihm bleibende Eindrücke hinterlassen: »Ich habe in meiner Kindheit ziemlich viel Musik mitbekommen. Meine ältere Schwester spielte Klavier, ich habe damals häufig Bach und, noch häufiger, Chopin gehört. Aber die wichtigsten Musikeindrücke hängen mit einem anderen Instrument zusammen: mit dem Grammofon. Wir hatten viele Platten, die dem damaligen Geschmack meines Vaters entsprachen – vorwiegend italienische Opern: Rigoletto, Traviata, Aida, Bohème, Madame Butterfly, Bajazzo und so weiter. Aus dieser Zeit rührt meine unverwüstliche Liebe zur italienischen Oper.«10
Die Geschwister Gerda und Alexander Herbert Reich, rechts Marcel Reich
© Marcel Reich-Ranicki/Andrew Ranicki
Die jüdische Religion spielte im Alltag der Familie keine große Rolle. Der Vater war auf eine gewohnheitsmäßige, zurückhaltende Weise gläubig, er besuchte am Sabbat und an Feiertagen die Synagoge, doch nicht unbedingt aus spirituellen Bedürfnissen. Für viele Juden ist die Synagoge nicht nur ein Gotteshaus, sondern zudem ein geselliger Ort. Man versammelt sich dort zum Gebet, aber auch um Bekannte und Freunde zu treffen. Der Vater wollte seinen Sohn gern regelmäßig mit in die Synagoge nehmen, doch da der sich dort langweilte und lieber zu Hause bleiben wollte, gab er bald nach. Reich-Ranickis Mutter zeigte, obwohl ihre Familie seit Generationen viele Rabbiner hervorgebracht hatte, eine deutliche Distanz zu jeder Form von Religiosität. Als ihr Mann einen orthodoxen Juden ins Haus brachte, der dem kleinen Marcel Hebräisch beibringen sollte, schickte sie ihn umgehend wieder fort mit der Begründung, ihr Sohn sei dafür noch zu jung. Weitere innerfamiliäre Versuche, dem Heranwachsenden so etwas wie eine religiöse Erziehung angedeihen zu lassen, hat es nicht gegeben. Was immer er in seiner Jugend über das Judentum lernte, verdankte er, wie er später einmal schrieb, »paradoxerweise vor allem dem preußischen Gymnasium in den Jahren des Dritten Reichs«.11
Helene Reich hatte stattdessen ein auffälliges Interesse für deutsche Literatur, ihre Sehnsucht nach dem damals unvergleichlich vitalen Kulturleben in Berlin muss sehr groß gewesen sein. Sie ließ sich zeitgenössische Neuerscheinungen aus Deutschland nach Włocławek schicken, flocht gern Zitate deutscher Klassiker in ihre Gespräche ein und erinnerte ihren jüngsten Sohn alljährlich am 28. August daran, dass sie ihren Geburtstag mit Johann Wolfgang von Goethe teilte.
Mit anderen Worten, die Reichs waren eine weitgehend assimilierte, gebildete und so sehr an deutscher Kultur orientierte Familie, dass sie, obwohl sie rund fünfhundert Kilometer von Berlin entfernt lebten, das liberale Berliner Tageblatt des legendären jüdischen Chefredakteurs Theodor Wolff abonnierten.
Eins der wesentlichen Lebensthemen Reich-Ranickis klingt schon in diesen ersten Jahren an. Als Jude gehörte er in Włocławek einer zwar keineswegs kleinen, aber trotzdem vielfach benachteiligten, nicht selten verachteten, ja mitunter verfolgten Minderheit an. Er wuchs auf in dem Gefühl, ein Außenseiter zu sein und entwickelte folgerichtig eine besondere Sensibilität dafür, ob er von Gemeinschaften, Gruppen, Organisationen angenommen oder zurückgewiesen wurde. Von Kindheit an hat er um Anerkennung und Zugehörigkeit kämpfen müssen und verspürt schon deshalb ein ausgeprägtes, oft enttäuschtes Bedürfnis nach beidem. »Natürlich bin ich«, sagt er einmal in einem Gespräch mit der Fotografin Herlinde Koelbl, »durch die Folgen der jüdischen Herkunft in hohem Maße geprägt worden. Denn den Antisemitismus habe ich von früher Kindheit an in Polen kennengelernt – in der Kleinstadt, in der ich geboren bin. Es war ein Antisemitismus in relativ gemäßigter Form.«12
In seinen Erinnerungen taucht Reich-Ranicki die Eltern keineswegs nur in positives oder gar verklärendes Licht. Er attestiert seiner Mutter ein »ruhiges, ja nobles Wesen«, beschreibt sie jedoch zugleich als »weltfremd« und »vollkommen unpraktisch«.13 Schlechter noch kommt aus seiner Sicht der Vater weg. Er nennt ihn »solide und anspruchslos, gütig und liebenswert«, bezeichnet ihn aber auch als »willensschwachen Menschen« und »Versager«, tadelt seine »Hilflosigkeit«, seine »erschreckende Untüchtigkeit«, seine »Charakterschwäche und Passivität«.14 Eine wesentliche Ursache für die Unzufriedenheit Reich-Ranickis mit seinem Vater ist wohl der Bankrott von dessen Fabrik für Baumaterialien. David Reich hatte sie kurz nach dem Ersten Weltkrieg gegründet und musste sie im Frühjahr 1929 schließen: »Das Scheitern meines Vaters, kläglich und erbärmlich zugleich, warf einen düsteren Schatten nicht nur auf meine Jugend.«15 Erstaunlicherweise erwähnt Reich-Ranicki die äußeren Rahmenbedingungen dieses Konkurses, zu denen unter anderem die schlechte Wirtschaftslage Polens in jenen Jahren gehörte, nur sehr kurz. Tatsächlich war Polen das einzige Land in Europa, das bis 1929 seine Produktivkraft aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg noch nicht wieder erreichte.16 Hinzu kam, dass antisemitische und antideutsche Ressentiments für das Nationalgefühl des 123 Jahre lang geteilten, nun unter großen inneren und äußeren Spannungen wieder zusammenwachsenden Polen eine erhebliche politische Rolle spielten. Juden wurden in den Schulen, Universitäten und in der Arbeitswelt benachteiligt, jüdische Beamte aus dem Dienst entfernt, jüdische Geschäftsleute wiederholt boykottiert.17 1922 erschoss ein Fanatiker den ersten polnischen Staatspräsidenten Gabriel Narutowicz, weil der bei seiner Wahl die Unterstützung jüdischer Abgeordneter akzeptiert hatte, um sich gegen seinen Gegenkandidaten durchzusetzen.
Sicher, David Reichs weiterer Berufsweg belegt, dass man ihn schwerlich einen geschickten Geschäftsmann nennen konnte. Aber ein Jude – der zudem mit einer Deutschen verheiratet war, die nur unvollkommen Polnisch sprach – traf seinerzeit in Polen nicht eben auf die besten Voraussetzungen, um wirtschaftliche Erfolge zu feiern. Über solche Aspekte geht Reich-Ranicki in seinen Erinnerungen mit knappen Andeutungen hinweg, er neigt hier ebenso wie in seinen Literaturkritiken eher zu klaren und sehr entschiedenen Urteilen als dazu, mildernden Umständen nachzuspüren. Seine von ihm als »weltfremd« bezeichnete Mutter scheint jedoch realitätstüchtig genug gewesen zu sein, um sich über die geschäftlichen Fähigkeiten ihres Ehemannes keine Illusionen zu machen: »Hätte ihr Mann, pflegte sie zu sagen, Särge hergestellt, dann würden die Menschen aufhören zu sterben.«18
Ökonomisch erholte sich die Familie Reich von dem Zusammenbruch ihrer Firma in Włocławek nie wieder. Die Situation in Polen, wo sich Marschall Piłsudski nach einem Putsch im Mai 1926 zwar nicht zum Diktator, aber doch zur autoritär herrschenden Grauen Eminenz aufschwang, war für die Familie weder in politischer noch in wirtschaftlicher Hinsicht aussichtsreich. Also beschloss sie, nach Berlin zu übersiedeln. Dort hatten sich bereits vier Brüder und die Schwester von Helene Reich niedergelassen und bestens etabliert. Der Umzug nach Deutschland kam Reich-Ranickis Mutter in jeder Hinsicht entgegen, und die Entscheidung dazu ist vermutlich von ihr betrieben worden. »Dort würde sich, hofften meine Eltern, eine neue Existenz gründen lassen, wobei, wie sich später zeigte, konkrete Vorstellungen von der künftigen beruflichen Tätigkeit meines Vaters noch gar nicht vorhanden waren.«19
Doch wenn David Reich nach seiner Ankunft in Berlin 1929 keine einträgliche Beschäftigung fand, dürfte dies nicht allein auf seine mangelnde Geschäftstüchtigkeit zurückzuführen sein, sondern auch auf den Börsensturz am Schwarzen Freitag, dem 25. Oktober 1929. Mit ihm begann die Weltwirtschaftskrise, die Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos machte und politisch radikalisierte. Historische Tatsachen, die Reich-Ranicki in seinem Buch Mein Leben mit keinem Wort erwähnt, die aber das berufliche Scheitern David Reichs verständlicher machen und eben nicht allein auf dessen persönliches Versagen zurückführen. Vielleicht setzte Reich-Ranicki die Kenntnis dieser fatalen politischen Zusammenhänge als bekannt voraus und glaubte sie deshalb in seiner Autobiografie nicht mehr erwähnen zu müssen. Vielleicht aber war sein Unmut über den eigenen Vater auch so groß, dass er schlicht verdrängte, welche Zeitumstände David Reich zu seiner Entlastung hätte anführen können, um seine Misserfolge zu erklären.
In seinem Buch über Marcel Reich-Ranicki betrachtet Thomas Anz das Verhältnis des jungen Marcel Reich zu seinen Eltern mit psychoanalytischem Blick. Es entspricht nur mit starken Einschränkungen den zeittypischen ödipalen Strukturen, wie sie Sigmund Freud beschreibt. »Zwar liebt der Sohn die Mutter«, resümiert Anz, »aber er rivalisiert nicht mit dem übermächtigen Vater.«20 Helene Reich war innerhalb der Familie die Repräsentantin der deutschen Kultur und Sprache, der Skepsis gegenüber der Religion und der Begeisterung für Literatur. In all diesen Punkten folgte der junge Marcel der von ihm offenbar anhaltend und zärtlich verehrten Mutter. Doch davon abgesehen, helfen die klassischen Interpretationsmuster der Psychoanalyse in diesem Fall nicht weiter. Der Vater nämlich wird vom Sohn in keiner Weise als Autorität anerkannt, sondern wegen seiner Unfähigkeit, die Familie zu ernähren, bedauert, wenn nicht gar als klägliche Figur betrachtet: »Den beinahe traditionellen Konflikt zwischen Vater und Sohn habe ich also nie kennengelernt«, erinnerte sich Reich-Ranicki: »Wie hätte auch ein solcher Konflikt entstehen können, da ich meinen Vater niemals gehasst und leider auch niemals geachtet, sondern immer bloß bemitleidet habe.«21
Früh schon schämte sich Marcel Reich für die wirtschaftliche Situation seiner Eltern. Fast hat man das Gefühl, dass er, der Jüngste, sich aufgerufen fühlte, Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Zumal sein älterer Bruder in seinen Augen offenbar ebenfalls nicht über das notwendige kämpferische Naturell verfügte. Zwar wählt Reich-Ranicki die Begriffe, mit denen er Alexander Herbert beschreibt, deutlich positiver, aber im Grunde ähnelt das Bild, das er von ihm entwirft, stark dem des Vaters: »Er war in vielerlei Hinsicht ein anderer Typ als ich, vielleicht der Gegentyp: Etwas kleiner, zarter und schmächtiger, gewiss auch schüchterner und in höherem Maße gehemmt. Vor allem war er ein liebenswerter, ein überaus liebenswürdiger Mensch, er hatte ein gewinnendes Wesen, frei von Selbstbewusstsein, von Arroganz oder gar Aggressivität.«22 Offenbar war Reich-Ranicki in seiner Kindheit von weichen, nachgiebigen Menschen umgeben, die ihm aber nicht zum Vorbild, sondern – angesichts der massiven Gefahren für die Familie – in ihrer Hilflosigkeit zu einem Warnbild wurden. »Die Angst vor Verachtung oder gar Mitleid«, schreibt Thomas Anz, »die Furcht vor sozialer Deklassierung und Abhängigkeit scheint eine der Triebkräfte zu sein, die das Leben des Sohnes prägten und seinen forcierten Selbstbehauptungswillen hervorbrachten.«23 Eine Deutung, die sich mit Reich-Ranickis Selbsteinschätzung weitgehend deckt: »Als Halbwüchsiger sah ich sehr genau die Abhängigkeit meiner Eltern von jenen Verwandten, die ihnen halfen. Die Furcht, ich selber könnte je in eine solche demütigende Abhängigkeit geraten, hat noch viele Jahre auf manche meiner Lebensentscheidungen einen starken Einfluss gehabt.«24
Die Bemerkungen über den Charakter seines Bruders lassen nebenbei auch Rückschlüsse auf Reich-Ranickis Selbstbild zu, als er im Alter von bald achtzig Jahren an seiner Autobiografie schrieb. Er nennt Alexander Herbert einen »Gegentyp« zu sich selbst und einen liebenswerten Menschen mit gewinnendem Wesen, der weder ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein noch Arroganz oder gar Aggressivität zeigte. Dem Kritiker Reich-Ranicki, der so oft als unerbittlich apostrophiert wurde, muss man hier eine gute Portion Selbstkritik attestieren. Schließlich schrieb er sich so indirekt eine selbstbewusste Persönlichkeit zu, der aber arrogantes oder gar aggressives Verhalten nicht fremd war.
In Włocławek hatte der kleine Marcel seit Frühjahr 1927 eine deutschsprachige Volksschule besucht und die erste Klasse gleich übersprungen, weil er bereits vor der Einschulung fließend lesen konnte. Seine Lehrerin war eine Deutsche, deren Name Laura und deren großer Busen ihm dauerhaft in Erinnerung blieben. Als er sich von ihr verabschiedete, um nach Deutschland aufzubrechen, gab sie ihm den ebenso pathetischen wie kühnen Satz mit auf den Weg: »Du fährst, mein Sohn, in das Land der Kultur.«25
Da er Schüler einer deutschen Schule gewesen war, erwarteten Reich-Ranicki keine unüberwindlichen sprachlichen Schwierigkeiten. Er wurde von seinen Eltern im Sommer 1929 nach Berlin vorausgeschickt, um mit der Familie seines wohlhabenden Onkels Jacob Auerbach Urlaub in Westerland auf Sylt zu machen. Als seine Mutter ihm wenige Wochen später folgte und ihn auf Polnisch ansprach, antwortete er bereits auf Deutsch.
Die Reichs kamen bei Helenes Vater unter, zunächst provisorisch, doch wie sich dann herausstellte, blieben sie dauerhaft bei ihm. Mannheim Auerbach, der als Rabbiner bereits seit geraumer Zeit emeritiert war und später erblindete, wohnte in der Güntzelstraße 53 in Berlin-Wilmersdorf26 und wurde von seinen Söhnen finanziell unterstützt. Ihre Zuwendungen hielten fortan auch die Familie Reich über Wasser.
Der Enkel Marcel scheint zu seinem Großvater keine enge Bindung entwickelt zu haben. In seiner Autobiografie erwähnt er, dass er ihm täglich eine Viertelstunde Gesellschaft zu leisten hatte – eine Pflicht, der er offenbar ohne Enthusiasmus nachkam. Mannheim Auerbach jedoch muss den Jungen geschätzt haben, er versuchte, ihn davon zu überzeugen, ebenfalls Rabbiner zu werden, denn, so seine Begründung, die unüberhörbar mit der ironischen Intelligenz des noch jungen Gesprächspartners rechnete, »man könne als Rabbiner viel faulenzen«. Nach dem Tod des Großvaters 1936 entschied die Familie, Reich-Ranicki solle dessen einziges Erbstück, eine goldene Uhr, erhalten: Mannheim Auerbach »habe keines seiner Enkelkinder mehr geliebt als mich (…). Ich nahm sie nicht ohne Stolz entgegen und besaß sie noch im Warschauer Getto. Ebendort musste ich diese schöne altmodische Uhr, so leid es mir tat, verkaufen. Aber ich brauchte dringend Geld – um eine Abtreibung bezahlen zu können.«27
In der Schule machte Reich-Ranicki seinen Eltern keinen Kummer. Nach den Sommerferien 1929 besuchte er für die letzten Monate des laufenden Schuljahres die Volksschule in der Witzlebenstraße in Berlin-Charlottenburg. Im Frühjahr 1930 wechselte er in das Werner-von-Siemens-Realgymnasium in Berlin-Schöneberg. Die Aufnahmeprüfung stellte keinerlei Hindernis für ihn dar: »Ich hatte die schriftliche Prüfung so gut bestanden, dass ich von der mündlichen befreit worden war. Meine Mutter war stolz auf mich.«28 Gleichwohl spürte er als Jude und als ein in der polnischen Provinz aufgewachsener Nichtberliner von Anfang an deutliche Vorbehalte seiner neuen Schulkameraden. Wieder war er, vielleicht sogar in höherem Maße als zuvor in Włocławek, ein Außenseiter. Später hat der Literaturkritiker Reich-Ranicki vielen deutsch-jüdischen Schriftstellern eine spezifische Trotzhaltung bescheinigt, die sie in ihrer Arbeit vorangetrieben habe: »Bloß formal anerkannt und in Wirklichkeit überall diskriminiert, versuchten viele Juden durch außergewöhnliche geistige und künstlerische Leistungen Ansehen zu erlangen und auf diese Weise die tatsächliche Emanzipation zu erzwingen.«29 Der Autobiograf Reich-Ranicki beschreibt seine eigene Reaktion auf die Zurückweisung, die er als Schüler empfand, zwar nicht wortgleich, aber in der Argumentation identisch: »Ich wusste ja: Wollte ich integriert oder gar geachtet werden, musste ich mich durch Leistung im Unterricht auszeichnen.«30 Zunächst bemühte sich der Gymnasiast, in Mathematik zu glänzen, doch als er zwölf, dreizehn Jahre alt wurde, begann ihn sein Enthusiasmus für Literatur und Theater in solchem Maße zu beherrschen, dass daneben alles andere in den Hintergrund trat.
Deutliche Distanz zwischen Sohn und Vater: Marcel und David Reich im Strandbad Wannsee
© Marcel Reich-Ranicki/Andrew Ranicki
Bezeichnend ist, dass ihn beide Leidenschaften ziemlich genau parallel zu Hitlers Machtübernahme erfassten. Sicherlich hätten seine spezifische Sensibilität, Intelligenz und Erregbarkeit Reich-Ranicki auch ohne derart katastrophale Zeitumstände auf dem einen oder anderen Weg zur Literaturkritik geführt. Doch die Besessenheit, mit der sich der Heranwachsende gerade vom Winter 1932/33 an der Bühne und den Büchern widmete, ist aufschlussreich. Reich-Ranicki selbst hat sich die Diagnose gestellt: »Von einer feindlichen, bestenfalls frostigen Welt umgeben, sehnte ich mich, bewusst oder unbewusst, nach einer Gegenwelt.« Er nennt das Theater sein »Asyl«, seine »Zuflucht« und spricht, um seine tiefe emotionale Abhängigkeit sowohl von der Literatur als auch vom Theater zu unterstreichen, programmatisch von »Liebesgeschichten«31, die ihn mit beidem verbanden. Ende 1932 schenkte ihm seine Mutter eine Eintrittskarte zu einer Wilhelm-Tell-Inszenierung von Jürgen Fehling im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Mit diesem Abend sind die Würfel für die kommenden Jahre und letztlich für Reich-Ranickis Leben gefallen – lässt man die Unterbrechungen durch den Zweiten Weltkrieg und den folgenden, fünf Jahre währenden Ausflug in die Politik beiseite.
Hingerissen und begeistert von seinem Erlebnis als Zuschauer, stöberte er nach seiner Rückkehr aus dem Theater im Bücherschrank der Eltern eine Schiller-Ausgabe auf und fing umgehend zu lesen an. Der Band beginnt mit dem Text der Räuber – also, wie es der Zufall will, mit einem Schauspiel, das unter anderem von einem gütigen, aber weltfremden und hilflosen Vater handelt, der von seinem jüngsten Sohn für seine offenkundige Schwäche verachtet wird. Reich-Ranicki weist in Mein Leben auf die Parallele zur eigenen Familienkonstellation nicht hin, aber dem vom Theater heimgekehrten, aufgeregt lesenden Marcel dürfte diese Entsprechung – bewusst oder unbewusst – nicht entgangen sein. Zumindest wäre es sehr überraschend, wenn ihn als Heranwachsenden das Fehlen einer starken, bewunderten Vaterfigur nicht insgeheim beschäftigt und er keine besondere Empfänglichkeit für eine literarische Behandlung dieses Themas entwickelt hätte. Er hat also durch eine glückliche Fügung die Literatur von Beginn an als ein Medium kennengelernt, in dem ureigene Lebensprobleme beschrieben und dadurch begreifbarer gemacht werden: Tua res agitur. Und noch Jahrzehnte später vertrat er als Literaturkritiker beharrlich die Ansicht, dass es zu den vornehmsten Aufgaben der Literatur gehört, dem Leser das eigene Seelenleben transparenter und verständlicher zu machen.
ENDE DER LESEPROBE