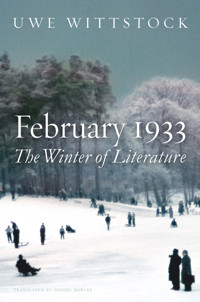17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es ging rasend schnell. Der Februar 1933 war der Monat, in dem sich auch für die Schriftsteller in Deutschland alles entschied. Uwe Wittstock erzählt die Chronik eines angekündigten und doch nicht für möglich gehaltenen Todes. Von Tag zu Tag verfolgt er, wie das glanzvolle literarische Leben der Weimarer Zeit in wenigen Wochen einem langen Winter wich und sich das Netz für Thomas Mann und Bertolt Brecht, für Else Lasker-Schüler, Alfred Döblin und viele andere immer fester zuzog. Montag, 30. Januar. Joseph Roth will die Nachrichten, die der Tag bringen wird, nicht mehr in Berlin abwarten. Schon früh morgens fährt er zum Bahnhof und nimmt den Zug nach Paris. Thomas Mann in München derweil kümmert sich die kommenden zehn Tage kaum um Politik, dafür umso mehr um seinen Vortrag über Richard Wagner. Immer ganz dicht an den Menschen, entfaltet Uwe Wittstock ein Mosaik der bedrohlichen Ereignisse unmittelbar nach Hitlers «Machtergreifung», die auch für die Literaten in Deutschland in die Katastrophe führten. Er vergegenwärtigt die Atmosphäre dieser Tage, die von Angst und Selbsttäuschung unter den Schriftstellern, von Passivität bei den einen und Entschlossenheit bei den anderen gezeichnet ist. Wer schmiegt sich den neuen Machthabern an, wer muss um sein Leben fürchten und fliehen? Auf der Grundlage von teils unveröffentlichtem Archivmaterial entsteht ein ungeheuer dichtes Bild einer ungeheuren Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
UWE WITTSTOCK
Februar 33
Der Winter der Literatur
C.H.Beck
Zum Buch
Es ging rasend schnell. Der Februar 1933 war der Monat, in dem sich auch für die Schriftsteller in Deutschland alles entschied. Uwe Wittstock erzählt die Chronik eines angekündigten und doch nicht für möglich gehaltenen Todes. Von Tag zu Tag verfolgt er, wie das glanzvolle literarische Leben der Weimarer Zeit in wenigen Wochen einem langen Winter wich und sich das Netz für Thomas Mann und Bertolt Brecht, für Else Lasker-Schüler, Alfred Döblin und viele andere immer fester zuzog.
Montag, 30. Januar. Joseph Roth will die Nachrichten, die der Tag bringen wird, nicht mehr in Berlin abwarten. Schon früh morgens fährt er zum Bahnhof und nimmt den Zug nach Paris. Thomas Mann in München derweil kümmert sich die kommenden zehn Tage kaum um Politik, dafür umso mehr um seinen Vortrag über Richard Wagner. Immer ganz dicht an den Menschen, entfaltet Uwe Wittstock ein Mosaik der bedrohlichen Ereignisse unmittelbar nach Hitlers «Machtergreifung», die auch für die Literaten in Deutschland in die Katastrophe führten. Er vergegenwärtigt die Atmosphäre dieser Tage, die von Angst und Selbsttäuschung unter den Schriftstellern, von Passivität bei den einen und Entschlossenheit bei den anderen gezeichnet ist. Wer schmiegt sich den neuen Machthabern an, wer muss um sein Leben fürchten und fliehen? Auf der Grundlage von teils unveröffentlichtem Archivmaterial entsteht ein ungeheuer dichtes Bild einer ungeheuren Zeit.
Über den Autor
Uwe Wittstock ist Literaturkritiker und Buchautor. Bis 2018 war er Redakteur des Focus, für den er heute als Kolumnist schreibt. Zuvor hat er als Literaturredakteur für die FAZ (1980–1989), als Lektor bei S. Fischer (1989–1999) und als stellvertretender Feuilletonchef und Kulturkorrespondent für die Welt (2000–2010) gearbeitet. Er wurde mit dem Theodor-Wolff-Preis für Journalismus ausgezeichnet. www.uwe-wittstock.de
Inhalt
Ein Schritt über die Klippe
Der Monat, in dem sich alles entschied
Der letzte Tanz der Republik
Samstag, 28. Januar
Die Hölle regiert
Montag, 30. Januar
Äxte an der Tür
Dienstag, 31. Januar
Fremdblütige Machwerke
Donnerstag, 2. Februar
Die genähte Zunge
Freitag, 3. Februar
Weiß nicht, was tun
Samstag, 4. Februar
Beerdigung im Regen
Sonntag, 5. Februar
Sitzungsroutine
Montag, 6. Februar
Hässliche, kleine, gewaltsame Naturen
Freitag, 10. Februar
Schutzstaffel für Schriftsteller
Sonntag, 12. Februar
Männer in Schwarz
Montag, 13. Februar
Fieber und Flucht
Dienstag, 14. Februar
Die Tür zuschlagen
Mittwoch, 15. Februar
Die kleine Lehrerin
Donnerstag, 16. Februar
Ich gehe. Ich bleibe
Freitag, 17. Februar
Kein Schatz im Silbersee
Samstag, 18. Februar
Was soll das Schreiben noch?
Sonntag, 19. Februar
An die Kasse!
Montag, 20. Februar
Ziemlich gute Tarnung
Dienstag, 21. Februar
Die nächsten Wochen überleben
Mittwoch, 22. Februar
Minister zu Gast
Freitag, 24. Februar
Bürgerkriegsgericht und Polizeischutz
Samstag, 25. Februar
Reiseempfehlungen
Montag, 27. Februar
Die Diktatur ist da
Dienstag, 28. Februar
Aus der Welt gefallen
Mittwoch, 1. März
Die falsche Mutter
Freitag, 3. März
Nicht aufmachen!
Samstag, 4. März
Stimmabgabe
Sonntag, 5. März
Die Einsamkeit des Emigranten
Montag, 6. März
Mut, Angst und Feuer
Dienstag, 7. März
Lauter Abschiede
Mittwoch, 8. März
Unerwartete Attacken
Freitag, 10. März
Letzte Tage
Samstag, 11. März
Abfahrten
Montag, 13. März
Der Anblick dieser Hölle
Mittwoch, 15. März
Wie es weiterging
33 Lebensabrisse
Nachwort
Dank
Benutzte Literatur
Personenregister
Bildnachweis
In Erinnerung an Gerta Wittstock (1930–2020), die im Februar 33 zwei Jahre alt war
Ein Schritt über die Klippe
Der Monat, in dem sich alles entschied
Das hier sind keine Heldengeschichten. Es sind Geschichten von Menschen, die in extreme Gefahr gerieten. Viele von ihnen wollten die Gefahr nicht wahrhaben, sie unterschätzten sie, sie reagierten zu langsam, kurz: Sie machten Fehler. Natürlich kann jeder, der heute in Geschichtsbüchern blättert, sagen, sie seien Narren gewesen, wenn sie 1933 nicht begriffen, was Hitler für sie bedeutete. Doch das wäre unhistorisch gedacht. Wenn der Satz, Hitlers Verbrechen seien unvorstellbar, einen Sinn hat, dann gilt er zuallererst für seine Zeitgenossen. Sie konnten sich nicht vorstellen, sie konnten allenfalls ahnen, wozu er und seine Leute fähig waren. Vermutlich gehört es zur Natur eines Zivilisationsbruchs, schwer vorstellbar zu sein.
Es ging rasend schnell. Zwischen dem Regierungsantritt Hitlers und der Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat, die alle wesentlichen Bürgerrechte außer Kraft setzte, vergingen vier Wochen und zwei Tage. Nur diesen Monat brauchte es, um einen Rechtsstaat in eine Gewaltherrschaft ohne Skrupel zu verwandeln. Das große Töten begann erst später. Aber im Februar 33 entschied sich, wen es treffen würde: wer um sein Leben fürchten und fliehen musste und wer antrat, um im Windschatten der Täter Karriere zu machen. Noch nie haben so viele Schriftsteller und Künstler in so kurzer Zeit ihr Land verlassen. Auch von dieser ersten Fluchtwelle bis Mitte März wird hier erzählt.
Die politische Ausgangslage, die Hitlers Machtübernahme ermöglichte, ist von Historikern unterschiedlicher Couleur aus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben worden. Ein paar Faktoren spielen in allen Analysen eine Rolle: der wachsende Einfluss extremistischer Parteien, der das Land spaltete. Eine überhitzte Propaganda, die den Keil immer tiefer trieb und Kompromisse blockierte. Dazu die Unentschlossenheit und Schwäche der politischen Mitte. Der bürgerkriegsartige Terror von rechts und links. Der grassierende Judenhass. Das Elend der Weltwirtschaftskrise. Der Aufstieg nationalistischer Regime in anderen Ländern.
Heute liegen die Dinge anders, glücklicherweise. Doch zu vielen Faktoren finden sich Parallelen: die wachsende Spaltung der Gesellschaft. Die Dauerempörung im Netz, die den Keil immer tiefer treibt. Die Ratlosigkeit der bürgerlichen Mitte, wie die Lust am Extremismus wieder einzufangen ist. Die wachsende Zahl der Terrortaten von rechts und manchmal von links. Der zunehmende Judenhass. Die Risiken für die Weltwirtschaft durch Finanz- und Coronakrise. Der Aufstieg nationalistischer Regime in anderen Ländern. Vielleicht also kein schlechter Zeitpunkt, um sich vor Augen zu führen, was nach einer fatalen politischen Fehlentscheidung mit einer Demokratie geschehen kann.
Im Februar 33 gerieten nicht nur Schriftsteller und Künstler in Gefahr. Vielleicht war die Situation für andere noch bedrohlicher. Das erste Todesopfer der Nazis, gleich in der Nacht nach Hitlers Vereidigung zum Reichskanzler, war der preußische Polizeioberwachtmeister Josef Zauritz, ein, wie die Vossische Zeitung schrieb, treuer Republikaner und Gewerkschaftsmann. Auch von dem Mord an ihm wird hier erzählt. Aber über Schriftsteller und Künstler im Februar 33 wissen wir unvergleichlich mehr Persönliches als über jede andere Gruppe. Ihre Tagebücher und Briefe wurden gesammelt, ihre Notizen archiviert, ihre Erinnerungen gedruckt und von Biografen mit detektivischem Ehrgeiz durchleuchtet.
Ihre Erfahrungen zeigen stellvertretend, wie es denen erging, die Rechtsstaat und Demokratie zu verteidigen suchten. Sie zeigen, wie schwer es fällt zu begreifen, wann aus dem gewohnten Leben ein Überlebenskampf wird und ein historischer Augenblick existentielle persönliche Entscheidungen verlangt.
Für alles, was hier erzählt wird, gibt es Belege. Es ist ein Tatsachenbericht, auch wenn er sich ein paar Interpretationsfreiheiten herausnimmt, ohne die sich historische oder biografische Zusammenhänge nicht erzählen lassen. Selbstverständlich kann in diesem Mosaik nicht alles nachgezeichnet werden, was Schriftstellern und Künstlern damals geschah. Thomas Mann, Else Lasker-Schüler, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Ricarda Huch, George Grosz, Heinrich Mann, Mascha Kaléko, Gabriele Tergit, Gottfried Benn, Klaus und Erika Mann, Harry Graf Kessler, Carl von Ossietzky, Carl Zuckmayer oder die Akademie der Künste in Berlin – sie alle, die hier auftreten, sind nur Beispiele. Ein Gesamtpanorama wäre zu groß für jedes Buch.
Manche Laufbahn, die hoffnungsvoll startete, erholte sich von diesem Monat nicht mehr. Allzu viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen verstummten und verschwanden fast spurlos. Eine lebensentscheidende Wende war es für alle.
Der letzte Tanz der Republik
Samstag, 28. Januar
Berlin friert schon seit Wochen. Bald nach Silvester hat scharfer Frost eingesetzt, selbst die größten Seen, Wannsee und Müggelsee, sind unter kompakten Eisdecken verschwunden, und nun hat es auch noch geschneit. Carl Zuckmayer steht in seiner Dachwohnung am Schöneberger Stadtpark vorm Spiegel. Er trägt seinen Frack und zerrt die weiße Fliege über dem Hemdkragen zurecht. Die Aussicht, heute in Abendgarderobe aus dem Haus zu gehen, ist nicht verlockend.
Zuckmayer hat keine Leidenschaft für große Feste, meistens langweilt er sich und bleibt gerade so lange, bis er ohne viel Aufhebens mit Freunden in irgendeine Kutscherkneipe verschwinden kann. Aber der Presseball ist das bedeutendste gesellschaftliche Ereignis der Berliner Wintersaison, ein Schaulaufen der Reichen, Mächtigen und Schönen. Es wäre ein Fehler, sich dort nicht sehen zu lassen, der Ball ist gut für seinen Ruf als vielbeschäftigter Nachwuchsstar im Literaturgeschäft.
Zuckmayer erinnert sich viel zu genau ans Elend seiner ersten Autorenjahre, als dass er solche Gelegenheiten links liegen ließe. Wenn er ganz abgebrannt war, hat er als Schlepper gearbeitet und abenteuergierige Berlinbesucher nach der Sperrstunde von den Straßen gefischt, um sie zu den illegalen Tingeltangelbars in den Hinterhöfen zu lotsen. In manchen davon waren die Mädchen halb nackt und nicht zimperlich, wenn es um die Wünsche der Gäste ging. Einmal hat er sich auf dem nächtlichen Tauentzien sogar als Dealer versucht mit ein paar Kokaintütchen in der Tasche. Doch davon ließ er schnell die Finger, er ist ein robuster Bursche und nicht ängstlich, aber dieses Geschäft war ihm zu gefährlich.
Seit dem Fröhlichen Weinberg ist das vorbei. Nach vier hochpathetischen und gründlich missratenen Dramen, die allesamt durchfielen, wagte er sich an seinen ersten Komödienstoff heran, eine deutsche Screwball-Comedy um eine heiratswillige Winzertochter in der rheinhessischen Provinz, Zuckmayers Heimat. Im Milieu der Weinbauern und -händler kennt er jedes Detail. Das Ganze geriet ihm unter den Händen zu einer Art Volksstück, jeder Tonfall stimmte, jede Pointe saß. Erst waren sich die Berliner Bühnen zu gut für so ein ländliches Lustspiel. Doch als das Theater am Schiffbauerdamm kurz vor Weihnachten 1925 die Uraufführung riskierte, zeigte der scheinbar federleichte Schwank überraschend seine Krallen: Der größte Teil des Publikums brüllte vor Lachen, ein kleinerer Teil aber vor Zorn über den satirischen Biss, mit dem sich Zuckmayer über das völkische Geschwätz verbohrter Kriegsveteranen und Korpsstudenten lustig machte. Deren Wut machte den Fröhlichen Weinberg umso bekannter und den Erfolg umso größer: Er wurde ein echter Bühnenrenner, vielleicht das meistgespielte Stück der zwanziger Jahre, und verfilmt wurde er außerdem.
Jetzt, sieben Jahre später, stehen gleich drei Stücke von Zuckmayer auf den Spielplänen der Berliner Theater: Die Freie Volksbühne bringt Schinderhannes, am Rose-Theater in Friedrichshain zeigen sie seinen sensationell erfolgreichen Hauptmann von Köpenick und im Schillertheater Katharina Knie. Für die Tobis arbeitet er an einem Märchenfilm, und bald will die Berliner Illustrirte mit dem Vorabdruck seiner Erzählung Eine Liebesgeschichte beginnen, die gleich danach als Buch herauskommen soll. Die Dinge laufen glänzend für ihn. Es gibt nicht viele Schriftsteller, die mit Mitte dreißig so viel Erfolg haben wie er.
Von seiner Dachterrasse aus sieht er die Lichter Berlins, vom Funkturm bis zur Kuppel des Doms. Die Wohnung ist, neben seinem Haus bei Salzburg, das er von den Tantiemen für den Fröhlichen Weinberg gekauft hat, Zuckmayers zweiter Wohnsitz. Sie ist überschaubar, ein Arbeitszimmer, zwei winzige Schlafzimmerchen, Kinderzimmer, Küche, Bad, mehr nicht, aber er liebt sie und vor allem den Blick über die Dächer der Stadt. Er hat sie Otto Firle abgekauft, dem Architekten und Grafiker, von dem unter anderem der fliegende Kranich stammt, das Signet der Lufthansa. Inzwischen ist Firle zum Lieblingsarchitekten der wohlhabenden Berliner Groß- und Bildungsbürger avanciert und baut keine Dachwohnungen mehr aus, sondern entwirft reihenweise Villen. In zwei Jahren wird Firle – aber das kann Zuckmayer an diesem Abend natürlich nicht ahnen – auf dem Darß an der Ostsee ein Landhaus bauen für einen zu Geld und Macht gekommenen Minister namens Hermann Göring.
Der letzte Samstag im Januar gehört dem Presseball, das ist seit Jahren Berliner Tradition. Sein Verlag, Ullstein, hat Zuckmayer die Ehrenkarten geschickt, seine Frau Alice hat sich daraufhin umgehend auf die Suche nach einem neuen Abendkleid gemacht. In diesem Jahr ist seine Mutter für eine Woche aus Mainz zu Besuch gekommen, auch sie trägt heute ein neues Kleid. Er hat es ihr zu Weihnachten geschenkt, silbergrau mit Spitzeneinsatz. Für sie ist es der erste große Berliner Ball, er kann ihre Aufregung spüren.
Doch jetzt wollen sie erst einmal in ein gutes Restaurant. Der Abend wird noch lang werden, es ist besser, so eine Ballnacht nicht zu früh zu beginnen und keinesfalls mit nüchternem Magen.
*
Klaus Mann hat, was die Gestaltung des Abends angeht, aufs falsche Pferd gesetzt: ein Maskenfest bei einer Frau Ruben im Westend, sehr normal und mies. Er fühlt sich fehl am Platz.
Er ist jetzt seit drei Tagen in Berlin und wohnt wie immer in der Pension Fasaneneck. Bei Werner Finck im Kabarett Katakombe traf er Moni, seine Schwester, die ihm dann die Einladung zu dieser Frau Ruben eingebrockt hat. Fincks Programm fand er schwach, ohne Schwung, aber immerhin hat er auf der Bühne Kadidja wiedergesehen, die scheue der beiden Wedekind-Schwestern, er mag sie, sie ist fast so etwas wie eine Ex-Schwägerin.
Neuerdings besucht Klaus Mann häufiger Kabaretts, schon aus professionellem Interesse, schließlich ist er jetzt in München selbst an einem beteiligt, der Pfeffermühle, die seine Schwester Erika zusammen mit Therese Giehse und Magnus Henning gegründet hat. Mit Erika schreibt er Couplets und Sketche, Erika, Therese und zwei andere stehen auf der Bühne, Magnus macht die Musik. Klaus kann Anregungen für neue Texte gut gebrauchen, aber die Nummern der Katakombe gaben für ihn nichts her, und als Fincks Schauspieler anfingen, ihn von der Bühne herunter mit eingestreuten Sticheleien und improvisierten Witzchen aufzuziehen, wurde es ihm zu dumm, und er ging noch vor Programmschluss.
Mit dem Maskenfest von Frau Ruben macht er ebenfalls kurzen Prozess. Statt sich weiter zu langweilen, geht er sehr früh, obwohl er weiß, wie ungezogen das ist. Ein lahmer Abend – dann doch lieber zurück zur Pension, wo er sich zur Abendunterhaltung eine Portion Morphium spendiert. Und zwar eine große.
*
Im Erfurter Reichshallentheater findet heute die Premiere von Brechts Lehrstück Die Maßnahme mit der Musik von Hanns Eisler statt. Doch die Polizei bricht die Aufführung der Kampfgemeinschaft der Arbeitersänger ab mit der Begründung, das Stück sei «eine kommunistisch-revolutionäre Darstellung des Klassenkampfes zur Herbeiführung der Weltrevolution».
*
Als Carl Zuckmayer mit Alice und seiner Mutter vor den Zoo-Sälen eintrifft, ist auf den ersten Blick alles wie in den vorangegangenen Jahren. Über 5000 Besucher werden erwartet, davon 1500 geladene Gäste mit Ehrenkarten so wie er. Die anderen, das sind die Schaulustigen, die horrende Eintrittspreise zahlen, um sich für eine Nacht unter die Prominenz des Landes zu mischen.
Im Foyer schieben sich die Ankommenden erstmal an zwei prächtigen Wagen vorbei, einem Adler-Trumpf-Kabriolett und einem DKW-Meisterklasse, beide auf Hochglanz poliert, die Hauptpreise der Tombola für die Wohlfahrtskasse des Berliner Pressevereins. Gleich hinter dem Eingang teilt sich der Menschenstrom auf, aus den verschiedenen Sälen und Gängen sind Tango, Walzer, Boogie-Woogie zu hören. Zuckmayer lenkt seine beiden Damen in Richtung Walzer. Für nahezu jede gastronomische Vorliebe ist gesorgt, es gibt Bars mit Club-Atmosphäre, plüschige Caféstuben und Biertheken oder ruhigere kleine Nebensäle, in denen Solo-Musiker spielen.
Am luxuriösesten dekoriert ist die große, zwei Stockwerke hohe Marmorhalle, frische Blumen überall, von den Brüstungen hängen prächtige alte Perserteppiche herab. Auf der Tanzfläche vor der Bühne mit dem Orchester drehen sich die Paare. Von oben, von der Galerie aus, kann man zuschauen, wie sich die Promenade der Besucher zwischen den Seitenlogen des Saals und den langen Tischreihen in der Mitte hindurchschiebt.
Die elegantesten Damen tragen in diesem Jahr helle Farben, das ist nicht zu übersehen. Und zum Dernier Cri gehört offenbar das lange Abendkleid mit kleinem Dekolleté, aber tiefem Rückenausschnitt bis zur Taille oder sogar darüber hinaus.
Zuckmayer schert aus dem Besucherstrom aus, sobald sie die Ullstein-Loge erreichen. Hier ist es luftiger, weniger gedrängt, und die Kellner verschaffen ihm und seinen Begleiterinnen gleich Tisch, Gläser und Getränke. «Trinken Sie, trinken Sie nur», begrüßt sie einer der Verlagsdirektoren, «wer weiß, wann Sie wieder in einer Ullstein-Loge Champagner trinken werden.» Damit spricht er aus, was alle mehr oder weniger spüren, aber keiner so recht wahrhaben will.
Gegen Mittag ist das Kabinett Kurt von Schleichers, der erst Anfang Dezember Reichskanzler wurde, zurückgetreten. Eine lächerlich kurze Amtszeit, keine zwei Monate, die dem Land außer neuen Machtintrigen buchstäblich nichts eingebracht hat. Verlorene Zeit während einer der übelsten Wirtschaftskrisen. Am Abend kam dann die Nachricht, Paul von Hindenburg, der Reichspräsident, habe ausgerechnet Schleichers Vorgänger Franz von Papen mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Die Ratlosigkeit der Politiker ist mit Händen zu greifen. Papen ist Mitglied der Zentrumspartei, aber ohne nennenswerte Machtbasis im Parlament. Wie Schleicher ist er nur von Hindenburgs Gnaden und per Notverordnung ins Amt gekommen, nachdem die Parteien gegen die Extremisten von KPD und NSDAP keine Mehrheit mehr zustande brachten. Aber dem aufgeblasenen, politisch ahnungslosen Papen ist eher ein Putsch zuzutrauen als das Geschick, die Republik zu einigermaßen stabilen demokratischen Verhältnissen zurückzuführen.
Schon im vergangenen Sommer hat er, ebenfalls nur gedeckt durch eine Notverordnung, die preußische Regierung abgesetzt. Seither wird das größte Land des Reichs von kommissarischen Kabinetten verwaltet, die der Reichsregierung unterstehen. Schon das war eine Art Staatsstreich, «Preußenschlag» genannt, der die föderalen Fundamente des Reichs untergrub – mit dem Ergebnis, dass jetzt, nach Schleichers Rücktritt, auch Preußen ohne Führung dasteht.
Die Regierungsloge im Marmorsaal liegt gleich neben der von Ullstein. Zuckmayer kann von seinem Platz aus bequem hinüberschauen, sie ist nahezu verwaist. Die Kellner drücken sich unbeschäftigt zwischen leeren Plüschsesseln herum, ungeöffnete Sektflaschen ragen aus den Eiskübeln. In den vergangenen Jahren hielten hier die Minister oder Staatssekretäre Hof, um wie zufällig Verleger und Leitartikler ins Gespräch zu ziehen und ihnen die Welt aus ihrer Sicht zu erklären. Doch selbst für solche lockeren Regierungsgeschäfte fühlt sich jetzt offenbar niemand mehr zuständig.
Bleibt das Vergnügen, im Gedränge nach prominenten Gesichtern Ausschau zu halten. Die hohe, asketische Gestalt Wilhelm Furtwänglers, Dirigent der Berliner Philharmoniker, ist leicht auszumachen, dazu der strenge, immer etwas melancholisch blickende Arnold Schönberg, der im Festgetümmel einen seltsam deplatzierten Eindruck macht. Gustaf Gründgens und Werner Krauß sind offenbar gleich nach ihrer Vorstellung aus dem Schauspielhaus am Gendarmenmarkt gekommen, wo sie derzeit als Mephisto und Faust auftreten. Auch der kahle Schädel Max von Schillings’ zeigt sich, eines Komponisten, von dem schon lange nichts Neues mehr zu hören war und der neuerdings als Präsident der Preußischen Akademie der Künste amtiert.
Ein Fotograf stört und bittet Zuckmayer kurz aus der Loge zu einem Gruppenfoto in einer seltsam zusammengewürfelten Besetzung: zwei junge Schauspielerinnen, dazu die Operndiva Mafalda Salvatini und Professor Bonn, ein Wirtschaftsmann und Regierungsberater, der als Rektor der Handelshochschule eine ziemlich alberne goldene Amtskette mit Medaillon über der Brust trägt.
Kurz taucht Josef von Sternberg, der Regisseur des Blauen Engels, aus der Menge auf, standesgemäß umgeben von blutjungen, blonden Starlets. Marlene Dietrich ist ohne ihn in Hollywood geblieben. Zuckmayer hatte damals am Drehbuch des Blauen Engels mitgearbeitet und dabei Heinrich Mann kennengelernt, von dem die Romanvorlage Professor Unrat stammt. Er mag den steifen alten Knaben und bewundert sein Buch. Allerdings machte sich Mann in seinen Augen zum Affen mit seinen Versuchen, anstelle von Marlene Dietrich seine damalige Geliebte Trude Hesterberg für die Hauptrolle durchzusetzen. Mit seiner überkorrekten Handschrift schrieb er kleine Briefe an die Produzenten, die mehr über seine Vernarrtheit in die Hesterberg verrieten als über deren Qualitäten als Schauspielerin.
Zurück in der Ullstein-Loge läuft Zuckmayer einem untersetzten, quirligen Mann in die Arme: Ernst Udet mit seiner Begleiterin Ehmi Bessel. Udet und Zuckmayer sind hell begeistert, sie kennen sich schon seit dem Krieg. Zuckmayer wurde damals oft als Beobachter in den vordersten Frontlinien eingesetzt, oder er reparierte unter Beschuss zerrissene Telefonleitungen. Er ist ein Mann mit guten Nerven. Doch mit Udet würde er sich nie vergleichen. Udet ist ein Kampfflieger mit dem Auftreten eines Matadors, elegant, übermütig, unbekümmert – eine Mischung aus Lausbube und Revolverheld. Als sie sich zum ersten Mal trafen, hatte es Udet mit zweiundzwanzig Jahren bereits zum Führer einer Fliegerstaffel gebracht und wurde von den Generälen mit Orden behängt wie ein Opfertier mit Blumenschmuck. Er schoss seine Gegner im Luftkampf Mann gegen Mann ab. Ein moderner Ritter, der ins Turnier reitet, süchtig nach Adrenalin. Bei Kriegsende hatte er zweiundsechzig Maschinen vom Himmel geholt, nur ein einziger deutscher Flieger war noch erfolgreicher gewesen in diesem tödlichen Geschäft, sein Kommandant Manfred von Richthofen, der «Rote Baron». Doch der war ein paar Monate vor Kriegsende durch Beschuss vom Boden aus gestorben und später durch einen Kommandanten namens Hermann Göring ersetzt worden. Der war zwar kein so talentierter Pilot, hatte aber ein sicheres Händchen für die richtigen politischen Verbindungen.
von links nach rechts: Ernst Udet, Ehmi Bessel und Carl Zuckmayer auf dem Berliner Presseball, 1933
Vor allem Zuckmayers Mutter ist von Udet hingerissen. Alice kennt ihn schon länger und weiß, welchen draufgängerischen Charme er hat. Als echtes Showtalent ist Udet auf seinen düsteren Kriegsruhm nicht angewiesen. Inzwischen tritt er bei Kunstflugshows in ganz Europa und Amerika auf, zeigt Sturzflüge, Spiralen, Loopings, bei denen er den Propeller abstellt. Oder er fliegt so knapp über der Grasnarbe, dass er mit der Tragfläche Taschentücher vom Boden aufhebt. Er ist und bleibt ein fröhlicher Hasardeur. Die Ufa hat ihn für sich entdeckt und in einigen Abenteuerfilmen mit Leni Riefenstahl zusammengespannt, für die er im Hochgebirge auf Gletschern landet oder mit seiner Maschine durch einen Hangar hindurchfliegt, während sich die Umstehenden entsetzt zu Boden werfen. Die Berliner Klatschblätter lieben Udet, seine Affären mit Schauspielerinnen wie Ehmi Bessel, seinen stadtbekannten amerikanischen Sportwagen, einen Dodge, und seine öffentlich zelebrierten Freundschaften mit Filmstars wie Riefenstahl, Lilian Harvey oder Heinz Rühmann.
Mit Udet kann man sich nicht langweilen, aber über den Krieg spricht Zuckmayer mit ihm nie, stattdessen trinken sie, wenn sie sich treffen. Auch jetzt wechseln sie vom Champagner zum Cognac. Udet fällt überrascht auf, wie viele Ballgäste ihre Orden und Abzeichen zum Frack tragen: «Schau dir die Armleuchter an.» In den vergangenen Jahren ging es beim Presseball noch ziviler zu. Plötzlich legt man offenbar Wert auf eine militärische Vergangenheit. Auch Udet trägt den höchsten seiner Orden, Pour le Mérite, doch da er nie gern macht, was alle machen, lässt er ihn in seiner Tasche verschwinden. «Weißt du was», schlägt er Zuckmayer vor, «jetzt lassen wir beide uns die Hosen runter und hängen unsere nackten Hintern über die Logenbrüstung.»
Alice und Ehmi sind sofort alarmiert. Sie trauen den Männern einiges zu, zumal wenn sie betrunken sind und sich gegenseitig hochschaukeln. Tatsächlich knöpfen sie sich sofort die Hosenträger los. Aber Alice kennt ihre Rolle für solche Momente, sie bittet die beiden flehentlich darum, keinen Skandal zu machen, und so können die Männer, ohne ihr Gesicht zu verlieren, auf weitere Entblößungen verzichten.
Irgendwann nach Mitternacht machen Spekulationen die Runde, Hitler solle zum Reichskanzler ernannt werden. Es ist eine simple Rechnung: Wenn Hindenburg die Regierung endlich wieder auf eine halbwegs solide parlamentarische Basis stellen, aber die SPD weiterhin auf keinen Fall beteiligen will, bleibt für ihn und Papen im Grunde nur die NSDAP als Partner. Hitler aber ist, das hat er kategorisch klargemacht, als Chef der größten Reichstagsfraktion nicht bereit, sich mit einem Ministerposten zufriedenzugeben. Er beansprucht die Kanzlerschaft, oder er bleibt in der Opposition. Alles oder nichts.
Solche Überlegungen machen den Ball nicht heiterer, es wird getanzt und getrunken wie in früheren Jahren, aber es bleibt das unbehagliche Gefühl, etwas Unabsehbares komme auf sie alle zu. Es herrscht eine seltsam künstliche Lustigkeit. Inzwischen ist der Sonntag längst angebrochen, Udet lädt Zuckmayer und seine beiden Begleiterinnen noch zur Nachfeier in seine Wohnung ein. Sein auffälliger Dodge steht vor den Zoo-Sälen wie eine Reklametafel in eigener Sache. In der Eiseskälte draußen wirkt er nüchtern, aber alle wissen, er ist es nicht. Zuckmayer und seine Frau halten lieber ein Taxi an. Nur Ehmi und Zuckmayers Mutter haben den Mut, sich von Udet im Wagen mitnehmen zu lassen, und berichten nachher aufgekratzt, sie seien eigentlich gar nicht gefahren, sondern wie durch die Straßen geflogen.
Udets Wohnung ist voller Trophäen aus Ländern, in denen er schon gedreht hat. Gleich im Flur hängen ein ausgestopfter Nashorn- und ein Leopardenkopf, dazu ein paar Geweihe. Es gibt in der Wohnung auch einen Schießstand, manche Zeitungen haben schon berichtet, Udet würde Freunden, die blindes Vertrauen zu ihm haben, die Zigarette aus dem Mund schießen. Doch das ist etwas für Herrenabende, heute bittet Udet seine Gäste an eine kleine Bar, die er sich eingerichtet hat, seine «Propellerbar», und unterhält die Damen mit Anekdoten aus Fliegerleben und Filmgeschäft. Zwischendurch nimmt Zuckmayer Udets Gitarre von der Wand und singt ein paar seiner Trinklieder, wie damals, als er durch Berliner Kneipen zog, um sich als Bänkelsänger eine Mahlzeit zu verdienen.
Es sind gutgelaunte, aber nicht unbeschwerte Morgenstunden, denn letztlich sind sie ein Abschied. Nur einmal noch werden sich Zuckmayer und Udet nach dieser Nacht wiedersehen. 1936 braucht Zuckmayer bereits beträchtlichen Mut und eine Portion Leichtsinn, um von seinem Haus bei Salzburg nach Berlin zu reisen. Die Nazis haben nicht vergessen, wie effektvoll er sich im Fröhlichen Weinberg und im Hauptmann von Köpenick über das Militär lustig macht, und seine Stücke und Bücher längst auf ihre Verbotslisten gesetzt. Doch Zuckmayer lässt sich nicht abhalten und fährt trotzdem, um Schauspielerfreunde zu treffen, Werner Krauß, Käthe Dorsch und auch Ernst Udet. Der bezeichnet sich zwar immer als einen unpolitischen Menschen, aber drei Monate nach der Nacht des Presseballs ist er in die NSDAP eingetreten und hat im Luftfahrtministerium unter dem alten Staffelkommandanten Göring Karriere gemacht.
Es wird eine traurige letzte Begegnung in einem kleinen, unauffälligen Restaurant. Die beiden schwelgen noch einmal in Erinnerungen, aber dann beschwört Udet seinen Freund, das Land so schnell wie möglich zu verlassen: «Geh in die Welt und komm nie wieder.» Auf Zuckmayers Frage, weshalb er bleibe, antwortet Udet, die Fliegerei sei nun mal sein Ein und Alles, und spricht von den ungeheuren Möglichkeiten als Pilot, die ihm seine Arbeit für die Nazis bietet: «Ich kann da nicht mehr raus. Aber eines Tages wird uns alle der Teufel holen.»
Im November 1941 erschießt sich Udet in seiner Wohnung in Berlin. Göring hat ihn für die Misserfolge der Luftwaffe in der Luftschlacht um England verantwortlich gemacht, irgendeiner muss der Sündenbock sein. Bevor Udet sich umbringt, schreibt er mit roter Kreide an die Stirnwand seines Bettes, als Vorwurf gegen Göring: «Eiserner, Du hast mich verlassen!»
Die Nazis geben seinen Tod als Unfall aus, und Zuckmayer hört davon im Exil auf seiner Farm in Vermont. Die Nachricht beschäftigt ihn, wie er sich später erinnert, lange, bis er sich schließlich an den Schreibtisch setzt und in knapp drei Wochen den ersten Akt seines Stücks Des Teufels General schreibt. Es ist die Geschichte eines charismatischen Luftwaffengenerals, der Hitler verachtet, ihm aber dient aus falsch verstandener Liebe zu Deutschland und zur Fliegerei. Als der Krieg zu Ende ist, ist das Stück fertig. Es wird zu einem der größten Erfolge Zuckmayers.
*
Kadidja Wedekind fühlt sich unbehaglich. Sie lässt sich vom Strom der Besucher durch die Ballsäle schieben, stolz, mit nur einundzwanzig Jahren schon zu den geladenen Gästen zu gehören, zur Literaturprominenz. Doch das Gedränge auf den Gängen ist ihr nicht recht. Sie bleibt gern für sich und im Hintergrund. Sie beobachtet lieber aus der Distanz, als sich zwischen anderen vorankämpfen zu müssen.
Kadidja Wedekind im Jahr 1932
Derartige Schüchternheit kennt sonst keiner in ihrer Familie. Ihre Eltern, Tilly und Frank Wedekind, gehörten früher zu den Größten der deutschen Theaterwelt, sie waren immer gut für ein bisschen Spektakel. Vater Frank, der schon 1918 starb, ist ein unermüdlicher Provokateur gewesen, ein Theaterberserker, der in seinen Stücken mit Vorliebe gegen die verklemmten Anstandsregeln der braven Bürger anteufelte. Es gab kein Tabuthema, das er nicht auf die Bühne brachte: Prostitution, Abtreibung, Onanie, Sadismus, Homosexualität. Er verfügte über das unfehlbare Talent, jederzeit und überall aus dem Stand heraus einen Skandal entfesseln zu können. Selbst Freunde waren vor seinen Temperamentsausbrüchen nicht sicher. Tilly ist über einige Jahre hinweg eine vielgefragte Schauspielerin gewesen, die vor allem in den Stücken ihres Mannes auftrat und in der Rolle von Wedekinds Lulu glänzte, eines ungehemmt triebhaften Mädchens, das die Männer zu ihrer Lust ebenso missbraucht, wie sie sich von den Männern missbrauchen lässt. Gemeinsam hätten Tilly und Frank das Leben eines bewunderten und auch gefürchteten Theaterpaares genießen können. Doch Wedekind machte seiner Frau – und damit auch sich selbst – das Leben zur Hölle mit Anfällen rasender Eifersucht. Zweimal hat er Tilly bis zu Selbstmordversuchen getrieben. Jetzt ist sie seit fünfzehn Jahren verwitwet.
Kadidjas Schwester Pamela, fünf Jahre älter, hat einiges geerbt vom Temperament der Eltern und auch von deren Talenten. Sie fühlte sich von früh an wohl auf der Bühne, hat eine gute Stimme und tritt gern mit den Liedern ihres Vaters auf, die sie zur Laute singt wie er früher selbst. Sie hat alles, was Kadidja fehlt, Mut, Initiative, Durchsetzungskraft. «Pamela ist», notiert Kadidja einmal in ihr Tagebuch, «eine ganz starke Persönlichkeit und ist ungeheuer begabt; ich muss bescheiden in den Hintergrund treten vor ihr.»
Nach dem Tod des Vaters 1918 lernten Pamela und Kadidja in München die ältesten Kinder der Manns kennen, Erika und Klaus. Sie wohnten fast in der Nachbarschaft, von einem Haus zum anderen war es zu Fuß keine halbe Stunde. Die Mann-Geschwister waren hingerissen vom Können Pamelas und sofort verliebt in sie. Kadidja war noch zu jung und konnte mit den anderen nicht mithalten. Die drei bildeten ein frühreifes, den Erwachsenen etwas unheimliches Trio und schaukelten sich hoch zu immer neuen dandyhaften Gesten. Klaus, der sich schminkte und keinen Hehl daraus machte, schwul zu sein, verlobte sich 1924 mit Pamela und schrieb in zwei Wochen das Kammerspiel Anja und Esther, das voller Anspielungen steckte auf die lesbische Liebelei zwischen Pamela und Erika. Das Stück war nicht viel wert, nur eine Skizze, keine durchdachte Arbeit: Ein paar Internatsschüler schwelgen in ihrer melancholischen Suche nach Liebe und Lebenssinn. Aber Gustaf Gründgens, eines der großen Theatertalente des Landes, war davon begeistert, schickte ein stürmisches Telegramm und überzeugte die drei, das Jugendwerk zusammen mit ihm auf die Bühne zu bringen und damit durch ganz Deutschland zu touren.
Das Stück wurde brutal verrissen, die Rezensenten verziehen dem Sohn des großen Thomas Mann keine Jugendsünde. Aber die Theatersensation war perfekt und jeder Saal ausverkauft. Das rasante Treiben der Dichterkinder und ihre schwer durchschaubaren erotischen Verstrickungen heizten die Neugier des Publikums an, zumal Erika dann auch noch Gründgens heiratete, obwohl der sich bekanntermaßen eher zu Männern hingezogen fühlte. Für ein paar Wochen waren die vier in allen Feuilletons und bunten Blättern, sie zupften an den Fäden, und alle Zeitungen sprangen wie die Marionetten. Wer oder was hätte die wilden, die gierigen, die haltlosen zwanziger Jahre besser verkörpert als diese Ménage-à-quatre?
Kadidja kann und will mit dem Lebenstempo ihrer Schwester nicht Schritt halten. Auch ihre Mutter, die immer seltener an den großen Bühnen und für die wichtigen Rollen engagiert wird, stürzt sich in immer neue Liebeleien. Eine Zeitlang ist Udet, der Flieger, den Kadidja in der Loge des Ullstein Verlags gesehen hat, Tillys Favorit gewesen. Auch Zuckmayer, der mit Udet zusammensitzt, hat ihre Mutter ab und zu besucht, Kadidja war damals zwölf, und Zuckmayer spielte Cowboy und Indianer mit ihr. Sie überfiel ihn schon beim Reinkommen im halbdunklen Flur, sprang ihm vom Wäscheschrank ins Genick, mit einem langen Küchenmesser in der Hand, um ihn zu skalpieren.
Seit ein paar Jahren hat ihre Mutter jetzt allerdings ein festeres Verhältnis mit einem Arzt, der zugleich Schriftsteller ist, er heißt Gottfried Benn. Tilly ist ziemlich vernarrt in ihn, aber Benn hält sie auf Distanz. Wenn er endlich mal Zeit für sie hat und mit ihr ausgeht, ist Tilly aufgeregt wie ein Mädchen. Sie hat sogar den Führerschein gemacht, ein kleines Kabriolett gekauft, einen Opel, und im Sommer mit Benn Ausflüge ins Grüne gemacht. Einmal war auch Benns Tochter Nele mit dabei, mit ihr verstand sich Kadidja bestens.
Doch diesen düsteren Benn mag Kadidja nicht. Sie hat ihn mal in seiner Berliner Wohnung an der Belle-Alliance-Straße, Ecke Yorckstraße besucht, die er auch als Praxis nutzt. Zugegeben, er ist ein interessanter Mann, aber letztlich findet sie ihn ekelhaft. Im Grunde versteht sie nichts von dem Verhältnis zwischen Benn und ihrer Mutter. Als sie einmal in der Nacht unangekündigt nach Hause kam, waren alle Zimmer hellerleuchtet, aber niemand zu finden, bis Hans Albers aus dem Schlafzimmer ihrer Mutter trat.
Für sie sind solche Affären nichts. Kadidja denkt anders, sie will vor allem ein guter Mensch sein, der anderen das Leben leichter macht. Allerdings fehlt ihr oft die nötige Energie dazu, sie versteht nicht, woher die anderen jeden Tag die Kraft nehmen, an ihre Arbeit zu gehen. Schon in der Schule war das ein Problem für sie, und erst recht, als sie 1928 auf die Kunsthochschule in Dresden ging. Sie könne, bestätigten ihr die Lehrer, eine beachtliche Malerin werden, wenn sie mehr arbeite. Aber ihr fällt das wahnsinnig schwer, Selbstdisziplin und Fleiß sind nicht ihre Stärken, das weiß sie.
Am glücklichsten hat sie sich während der Ferien in Ammerland am Starnberger See gefühlt. Eine Schauspielerfreundin ihrer Mutter, Lilly Ackermann, hat dort ein Haus, und vor ein paar Jahren hat Kadidja regelmäßig die Zeit bei ihr verträumt oder mit Georg gespielt, Lillys Sohn. Der war damals erst zehn, aber das machte Kadidja nichts. Mit ihm gründete sie aus einer Laune heraus ein Kaiserreich namens Kalumina. Hier, in diesem Traumreich, sollte es endlich mal nach ihren Vorstellungen gehen. Ihr Wille war Gesetz, und also ließ sie sich von Georg und seinen Freunden zur Kaiserin Carola I. krönen. Zusammen entwarfen sie eine Fahne und eine Verfassung, Georg wurde zum Generalstabschef ernannt und musste eine Armee aufbauen. Drei Wochen lang ging das so, und als sie sich in den nächsten Ferien wiedersahen, bastelten sie weiter an ihrer Phantasiewelt.
An diese Zeit erinnert sie sich, als sie sich auf die Fortsetzung ihres Studiums an der Berliner Akademie vorbereiten soll. Sie ist an Emil Orlik empfohlen worden, zu dessen Schülern George Grosz gehört. Aber schon der Versuch, eine Mappe mit ihren Arbeiten aus Dresden zusammenzustellen, ist für sie das pure Grauen. Von jedem einzelnen Blatt stinkt sie die blanke Unlust an. Lieber setzt sie sich hin und schreibt die Geschichte ihres Kaiserreichs Kalumina auf. Das könnte ein Roman werden, denkt sie. Schließlich geht es um uralte, klassische Themen: den Abschied von der Jugend, die Mühen des Erwachsenwerdens, die ersten Vorahnungen der Liebe. Schon ihr Vater hat immer einen Roman schreiben wollen, aber es ist ihm nie gelungen. Umso größer ihr Ehrgeiz, und zum ersten Mal entwickelt sie Selbstdisziplin und Willenskraft. Sie spürt, in ihrem Manuskript bekommen die alten Themen wie von allein einen neuen, einen luftig leichten Zauber.
Kadidja hat, zur eigenen Überraschung, ein Talent bei sich entdeckt, von dem sie nichts ahnte. Sie kann schreiben. Sie hat, wenn man ihr Zeit lässt, Poesie. Auch der Scherl Verlag ist überzeugt von ihrem Können und hat ihr Buch ins Programm genommen: Kalumina. Der Roman eines Sommers. Tausend Mark Vorschuss! Neunhundert Mark davon gibt sie an ihre Mutter weiter, die als Schauspielerin immer weniger verdient und bereits heimlich Schmuck versetzen musste, um die Miete bezahlen zu können.
Viel wichtiger als Geld ist Kadidja ihr frisch aufgekeimtes Talent samt der Hoffnung, dass es künftig auf eine günstige Witterung trifft und wachsen kann. Alle Bekannten, denen sie im Ballgetümmel zwischen den Logen und Tischen in die Arme läuft, machen ihr Mut. Erst will sie gar nicht glauben, was sie hört, ist verlegen und beschämt wie so oft. Doch dann amüsiert sie sich immer besser. So viel Zuspruch kann man nicht widerstehen. Für einen Moment lässt sie sich davon überzeugen, dass vielleicht auch sie etwas Besonderes sein kann. Sie spürt ungeahnten Mut, ja Übermut: Ich bin, denkt sie, ich bin die Kaiserin des Presseballs.
*
Auch Erich Maria Remarque hat der Einladung nicht widerstehen können. Zumal er gerade fertig geworden ist mit der Rohfassung eines neuen Romans, der Drei Kameraden. Er gönnt sich ein wenig Entspannung nach zäher Arbeit. Schon seit Monaten wohnt er nicht mehr in Deutschland, doch gibt es noch immer eine Menge Dinge, die er in Berlin zu erledigen hat. Also ist er hergefahren, um Leute zu treffen, Termine abzuhaken und sich zum Schluss durch das Ballgewühl zu kämpfen.
Er sieht Zuckmayer in der Ullstein-Loge, aber der scheint an diesem Abend nur Augen und Ohren für Ernst Udet zu haben. Remarque und Zuckmayer kennen sich seit ziemlich genau vier Jahren: Als Remarque 1928 mit seinem Kriegsroman Im Westen nichts Neues nahezu fertig war, schickte er das Manuskript zuerst an den bedeutendsten deutschen Verlag, an S. Fischer, doch der winkte ab. Bei Ullstein dagegen waren die Lektoren begeistert und brachten den ganzen Konzern auf Trab, um dem Buch den Start zu ermöglichen, den es in ihren Augen verdiente: Erst wurde es in der Vossischen Zeitung, die zu Ullstein gehörte, in Fortsetzungen vorabgedruckt. Als der Roman dann in die Buchhandlungen kam, zog die Berliner Illustrirte, ebenfalls Teil des Ullstein-Konzerns, ihren üblichen Erscheinungstermin um ein paar Tage vor, von Sonntag auf Donnerstag, um pünktlich zum Erstverkaufstag einen Artikel des Ullstein-Autors Zuckmayer über Remarques Buch zu bringen.
Es war keine Rezension im gewöhnlichen Sinne, es war auch keine der üblichen Lobhudeleien unter Autorenkollegen. Zuckmayers Artikel war ein Trommelwirbel, eine Fanfare, ein Fanal und dazu noch eine Prophezeiung: «Es gibt jetzt ein Buch, geschrieben von einem Mann namens Erich Maria Remarque, gelebt von Millionen, es wird auch von Millionen gelesen werden, jetzt und zu allen Zeiten … Dieses Buch gehört in die Schulstuben, die Lesehallen, die Universitäten, in alle Zeitungen, in alle Funksender, und das alles ist noch nicht genug.»
Im Westen nichts Neues erzählt die Geschichte eines Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs, vom Notabitur 1914 bis zu seinem Tod 1918. Remarque hatte sie in knappen, unpoetischen und doch gefühlsgeladenen Sätzen aufgeschrieben, hat von der Panik und dem Sterben in den Schützengräben berichtet, von dem Grauen, ganze Nächte im Trommelfeuer detonierender Granaten zuzubringen, vom Wahnsinn der Sturmangriffe ins feindliche Maschinengewehrfeuer hinein und von den Bajonettschlächtereien im Nahkampf.
Zuckmayer hatte vieles davon selbst erlebt, aber nie eine tragfähige Sprache dafür gefunden. Umso mehr begeisterte ihn nun Im Westen nichts Neues: «Das ist es, was Remarque hier gibt, zum ersten Mal ganz klar und unverwischbar – was in diesen Menschen vorging, was innen geschah …» Der Roman gab den wirren, mörderischen, nervenzerreißenden Erfahrungen einer ganzen Generation eine literarische Form und machte sie so endlich mitteilbarer. Das war für Zuckmayer – und er ahnte: nicht nur für ihn – so etwas wie die Befreiung von einem Albdruck. «Wir alle haben immer wieder erlebt, daß man über den Krieg nichts sagen kann. Es gibt nichts Kläglicheres, als wenn einer seine Kriegserlebnisse erzählt. Deshalb schweigen wir und warten … Hier aber, bei Remarque, ist zum erstenmal das Schicksal selbst Gestalt geworden. Das ganze. Das, was dahinter war, darunter brannte – das, was bleibt. Und so geschrieben, so geschaffen, so gelebt, daß es mehr wird als Wirklichkeit: Wahrheit, reine, gültige Wahrheit.»
Tatsächlich ging es Hunderttausenden so wie Zuckmayer. Nicht nur ehemaligen Frontkämpfern, sondern auch anderen, die keine Soldaten gewesen waren, aber begreifen wollten, mit welchen Erlebnissen diese Veteranen lebten. Schon nach wenigen Wochen hatte der Roman eine Auflage von einer halben Million erreicht, noch im selben Jahr wurde er in sechsundzwanzig Sprachen übersetzt. Ein Welterfolg.
Und eine Provokation für alle, die Krieg und Soldatentod zu beschönigen versuchten, vor allem also für Deutschnationale und Nationalsozialisten. Sie kämpften gegen Roman und Autor mit populistischen Lügen, die stur wiederholt und so der Öffentlichkeit eingehämmert wurden: Das Buch entwürdige die Gefallenen, verhöhne ihr Opfer fürs Vaterland, ziehe alles Edle des Soldatentums in den Dreck. Remarque sei, da er selbst nur sieben Wochen an der Front und danach schwer verwundet im Lazarett war, ein Hochstapler, der am Krieg nicht wirklich teilgenommen habe, ja den Krieg gar nicht kenne. Da er ursprünglich Remark hieß, nannten sie ihn einen Volksverräter, der sein Pseudonym Remarque ausgerechnet aus der Sprache Frankreichs, der Sprache des Erbfeindes, entlehnte. So einer habe kein Recht, über das Heldentum der Männer zu schreiben, die ihr junges Leben für Deutschlands Ehre hingaben.
Die Propagandaschlacht eskalierte, als die amerikanische Verfilmung von Im Westen nichts Neues 1930 in die deutschen Kinos kam. Am Tag nach der Premiere schickte Goebbels in Berlin und anderen Städten seine SA-Schläger in die Kinos, die Stinkbomben warfen, weiße Mäuse aussetzten, Zuschauer bedrohten oder verprügelten, bis die Vorstellungen abgebrochen werden mussten. Doch anstatt Film und Publikum zu schützen, knickten die Behörden ein und verboten nach fünf Tagen weitere Aufführungen «wegen Gefährdung des deutschen Ansehens». Goebbels feierte triumphal den ersten großen Kampagnenerfolg der Nazis: «Es war ein Kampf um die Macht zwischen marxistischer Asphaltdemokratie und deutschbewußter Staatssittlichkeit. Und zum ersten Male haben wir in Berlin die Tatsache zu verzeichnen, daß die Asphaltdemokratie in die Knie gezwungen wurde.»
Monate später wird der Film doch noch in erheblich gekürzter Fassung freigegeben. Aber das kann Remarques Enttäuschung über sein Land nicht mehr besänftigen. Und egal, was er tut, sagt oder schreibt, er bleibt ein Lieblingsfeind der Rechten. Glücklicherweise hat ihn Im Westen nichts Neues zu einem reichen Mann gemacht. Er kauft eine Villa am Lago Maggiore in der Schweiz, wenige Kilometer von Ascona entfernt, und lässt Deutschland, das ihm immer fremder wird, hinter sich.
Nach dem Presseball bleibt Remarque deshalb nur noch für eine kurze Nacht im Hotel. Wer nach Schleicher der neue Kanzler wird, betrifft ihn im Grunde gar nicht mehr, genauso wenig wie die Frage, ob dieser Ball der letzte Tanz der Republik war. Sonntagfrüh setzt er sich gleich nach dem Frühstück in seinen Wagen, einen Lancia Dilambda – er liebt schnelle Autos und hohes Tempo –, und startet Richtung Schweizer Grenze. Es ist eine lange, kalte Fahrt, von Nord nach Süd quer durch das winterliche Deutschland. Erst knapp zwanzig Jahre später wird er seine Heimat wiedersehen.
Erich Maria Remarque im Jahr 1929
In ein paar Wochen schon geben Emigranten seine Adresse am Lago Maggiore untereinander weiter wie einen Geheimtipp. Remarque ist als großzügiger Mann bekannt. Er gibt den Flüchtlingen Unterschlupf, drückt ihnen Geld in die Hand, besorgt für sie Fahrkarten nach Italien oder Frankreich. Ernst Toller besucht ihn. Auch der jüdische Journalist Felix Manuel Mendelssohn ist unter den Gästen. Er wohnt ein paar Tage bei ihm, Mitte April wird er ganz in der Nähe von Remarques Grundstück in einem Graben tot aufgefunden, Schädelbruch. Ist er gestürzt oder wurde er erschlagen? Die Schweizer Zeitungen schreiben von einem Unfall. Thomas Mann, der die Meldungen liest, ist sich sicher: Es war ein missglückter Nazi-Anschlag, die Attentäter haben den jungen Mendelssohn im Dunkeln «wahrscheinlich für Remarque gehalten».
Die Hölle regiert
Montag, 30. Januar
Joseph Roth will die Nachrichten, die der Tag bringen wird, nicht mehr abwarten. Gleich morgens fährt er zum Bahnhof und nimmt den Zug nach Paris. Der Abschied von Berlin fällt ihm leicht. Jahrelang hat er für die Frankfurter Zeitung als Reporter gearbeitet, das Unterwegssein ist ihm zur Gewohnheit geworden. Seit Jahren lebt er jetzt in Hotels oder Pensionen. «Ich glaube», hat er mal etwas großsprecherisch behauptet, «daß ich nicht schreiben könnte, wenn ich einen festen Wohnsitz hätte.»
Vor vier Monaten, Ende September 1932, ist Roths Radetzkymarsch erschienen. Ein meisterhafter Roman, der, wie Thomas Manns Buddenbrooks, über mehrere Generationen hinweg vom Verfall einer Familie erzählt: von den Trottas, die unter Franz Joseph I., dem Herrscher Österreich-Ungarns, aufsteigen und im Ersten Weltkrieg mit ihm untergehen. Es ist eines seiner wichtigsten Bücher, Roth hat hart daran gearbeitet und hätte also Grund, sich mit politischen Äußerungen zurückzuhalten, um keinen gegen sich aufzubringen und den Verkauf des Romans in Deutschland nicht zu gefährden.