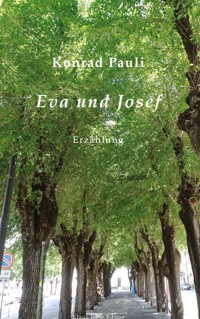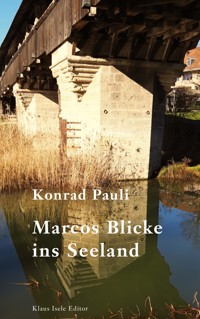
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Kindheit und Jugend, die stellvertretend erzählt wird für viele andere, die in den 1950er Jahren aufgewachsen sind - in einer kleinen Stadt in der Nähe von Bern. Oder anderswo in der Schweiz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Den Übertritt in die Sekundarschule hatte Marco geschafft. Am Montag Schulbeginn. Die neuen Lehrer, Lehrerinnen. Anweisungen, werbendes Drohen, Befehle, nur unzulänglich getarnt als Wunsch. Dazu Materialien, Hefte. Beschriftungen und geweckte Erwartungen. Der Sorgfaltswille vor dem Setzen des ersten Strichs, nichts darf misslingen am Anfang. Doch nicht zu sehr gezögert, sonst ist das Missgeschick da. Nicht alles lässt sich ausradieren. –
Am zweiten Tag die erste Religionsstunde. Der alte Lehrer als Respektsperson auf dem Katheder, vornübergebeugt, wie verwachsen mit dem spröden Lack des wurmstichigen Holzes. Das Katheder, eine Art Festung für lebenslang eingeübte, schliesslich zementierte pädagogische Gewissheiten und Strategien, wohl noch älter als der Mann selbst. –
Irgendwann fällt Marco auf, dass der Lehrer die längste Zeit schon geredet hat – doch eher vor sich hin, in sich hinein. Marco, dem alles neu ist, ahnt nicht, dass der Lehrer, was er sagt, schon tausendmal vorgetragen hat. Die Stunde ist zu Ende, andere folgen. Drei Tage später die zweite Religionsstunde. Alles scheint sich zu wiederholen, doch Marco wird unversehens vor die Klasse befohlen und aufgefordert, zu berichten, was der Lehrer die Stunde zuvor erzählt hat, dabei ist inzwischen eine Ewigkeit vergangen. Man spürt, die ganze Klasse ist froh, dass es Marco und keinen anderen erwischt hat. Er muss nun ausbaden, wovon der Rest verschont worden ist, vorläufig. Wie gelähmt verharrt die Klasse, alle suchen eine Deckung – ja nicht auffallen durch eine falsche Bewegung. Der Lehrer lässt ihn zappeln, gibt ihm genüsslich die Chance, die zu ergreifen Marco niemals imstande sein wird. Zumindest heute nicht. Längst weiss er, dass die Schamröte ihn fest im Griff hat. Im Boden versinken wäre ein Ausweg, die Rettung. Man lässt ihn hängen. Dieser Kelch geht an ihm nicht vorbei. Und mit wohlbedachter, eingeübter Resignationsgeste vom Lehrer endlich das erlösende, vernichtende Wort: Dann gehst du an den Platz – und du kriegst eine Drei! Das Kind nun in der Angst, in die Primarschule zurückversetzt zu werden.
Natürlich wusste Marco, dass man nicht stehlen darf. Der liebe Gott, hatte man ihm eingebläut, sieht alles. Das leuchtete ihm ein, denn, wenn Gott allmächtig ist (und welchem Gott spräche man diese Eigenschaft und Fähigkeit ab), gibt es nichts, das seinem Auge verborgen bleibt. Als Marco nun im Lebensmittelgeschäft von Frau Storz stand, musste sein Gewissen auf ihn nicht aufgepasst, musste Gott ihn eine Weile ausser Acht gelassen haben, denn die Versuchung türmte sich wie ein Riese vor ihm auf. Vergeblich hielt er Ausschau nach Abwehrkräften. Frau Storz, eine grosse, stattliche Frau mit pechschwarzem, hochgeknoteten Haar, musste, um die Bestellung zu holen, in den Nebenraum. Die gewöhnlich entbehrten Süssigkeiten brannten sich vom Ladentisch her dem Kind ins Gemüt, trübten den Verstand und vernichteten alle Gebote. Frau Storz raschelte in Papieren und Schachteln und würde nun gleich zurückkommen. Wann, wenn nicht jetzt, rumorte es im Kind. Ohne es zu wollen, ohne sein Dazutun schnellte sein Arm nach vorn, spreizten sich die Finger und klaubten das Päckchen mit den Zuckerzigaretten aus dem Gestell. Frau Storz war wieder da, und Marco hatte Angst, sie könnte seine brennende Hand sehen und das in seiner Jackentasche nachknisternde Päckchen hören. War in ihrem Blick eine Frage? Bloss schnell weg – um die Stirn zu kühlen. Den Gedanken, in letzter Sekunde seine Tat zu beichten, hatte er verworfen. Ein Dieb wäre er ohnehin gewesen, mit unabsehbaren Folgen. Auch hätte er sich lächerlich gemacht. Dies alles bedachte er erst draussen – und freute sich auf den Zucker. Die einzige Schwierigkeit war, dass Vater und Mutter ihn nicht beim Rauchen erwischten. Der liebe Gott – sollte ihm, was zu erwarten war, die Tat doch nicht verborgen bleiben – , würde ihm verzeihen. Schliesslich hatte er ihn in eine Versuchung geführt, der er nicht gewachsen war. Zumal Marco nicht die Absicht hatte, eine Diebeskarriere aufzubauen.
Heinz, einer aus seiner Klasse, schlug vor, in den Wald zu gehen. Der Wald lag nahe, die Kinder durften dorthin gehen, wann immer sie wollten. Die üblichen Spiele: Tannzapfenwerfen auf Baumstämme. Mal siegte der eine, mal der andere. Es war ein Spiel, keine Rivalität. Genauso wie das Knebeln: Man schlug einen gespitzten Stock in den Boden – und der andere versuchte seinen Stock so zu schlagen, zu platzieren, dass der gesetzte Stock zum Liegen kam. Das gab einen Punkt. Auch das war ein Spiel, das Geschicklichkeit verlangte. – Plötzlich zog Heinz ein Päckchen Parisienne aus der Tasche, elend zerknittert, aber noch halbvoll. Geschickt, als sei er darin geübt, entzündete er das Streichholz, hielt es an die lässig in den Mundwinkel geschobene Zigarette und entfachte so die Glut, das Glimmen. Er tat so, als sei das altersgerecht und beinah das höchste Glück. Nun musste auch Marco mithalten und ins Rauchabenteuer einsteigen – es war für ihn das erste Mal. Glut, Rauch – das kannte er vom eigenen Herd zu Hause, von Waldfeuern – aber eine Zigarette? Sie schmeckte gar nicht schlecht. Und das bisschen Husten gehörte dazu – schliesslich hatte er den Bonus des Anfängers. Heinz klaubte aus dem Päckchen zwei weitere Glimmstengel, dann noch mal zwei – das Päckchen müsse unbedingt geleert werden. Nun also widerwillig, aber tapfer voran, bis sich Übelkeitsgefühle meldeten. – Wochen später starb der Vater von Heinz. Zwei Kinder blieben mit der Mutter zurück. Heinz wollte tapfer sein, war es auch, als er mit Tränen in den Augen hervorwürgte: Glaub mir, es macht mir nichts aus, dass ich keinen Vater mehr habe.
Kaum zu glauben war’s für den Jungen, dass man für den Einkauf von einem Tag zum andern nicht mehr anzustehen und seine Wünsche vorzubringen brauchte. In einem alten Gebäude mit grauer Schindelverkleidung war der erste Selbstbedienungsladen eröffnet worden. Ohne Kontrolle durfte man zwischen den Auslagen herumgehen, durfte stehen bleiben, ohne in Verdacht zu geraten. Man durfte ungehindert nach Dingen greifen und sie in den Metallkorb legen. Keiner schien ein Auge darauf zu haben, ob sich der Kunde nicht etwa ein Stück wegsteckte in die Hosentasche. Aber seltsamerweise schien das Vertrauen, das die Geschäftsleitung dem Kunden entgegenbrachte, eben dies zu verhindern. Doch anfänglich beschlich den Kunden allemal das Gefühl, man könnte ihn verdächtigen, etwas Unrechtes zu tun, zumal wenn er in abgelegenen Ecken verweilte und sich umschaute. Ein wenig hatte er das Bedürfnis, seine Ehrlichkeit zu demonstrieren – seht her, ich habe nichts in der Tasche. So, als wäre seine Ehrlichkeit nicht das Selbstverständliche, als müsse er sie gleichsam öffentlich beglaubigen lassen.
Unverhofft kam einmal eine grosse Ausfahrt. Der Bruder hatte den Töff, eine ausrangierte Rostmaschine, heimgebracht, man wusste nicht von wo. Aber der Tank war, so der Bruder, halbvoll – und Marco durfte auch mal losrattern. Ein neues, erhebendes Gefühl für ihn, den Velofahrer; einfach aufzusitzen, sich festzuhalten und das Gas aufzudrehen. Die Maschine dröhnte und gehorchte, riss ihn vom Platz und trug ihn davon über den staubigen Feldweg dem Walde zu. Ungewohnt rasch schrumpften die Distanzen. Wofür er zuvor viele Minuten gebraucht hatte, benötigte nun bloss zwei Atemzüge. Beim Waldeingang überm holprigen, wurzelübersäten, steilen Pfad entfaltete das Rost-Ungetüm seine ganze Kraft und Fähigkeit. Einem wilden, durchgebrannten Pferd gleich wollte es ihn abschütteln, aber er liess nicht locker, wollte ihm den Meister zeigen. Hei, wie das voranging auf dem Waldboden zwischen den Stämmen. Er war nicht zu bremsen, drehte Runde um Runde. Spitz fuhren ihm Zweige ins Gesicht, hart stiess ihm das Holpern in den Hintern – Marco war, als würde er zum Flug ansetzen.
Später, wieder am Waldrand, bereit zur Heimfahrt. Von weither sah er den Polizisten heranfahren. Marco schaltete den Motor aus, als wäre dies jetzt noch eine Hilfe. Der Polizist hielt – auch er stellte den Motor ab. Marco hatte sofort verstanden, sah keinen Ausweg und fand keine Ausrede. Den Jungen streifte der Gedanke: Sähe sich der Uniformierte unwidersprochen von Anfang an im Recht, so wäre er womöglich fähig zum Mitleid. Das Übliche: Strenger Blick, bohrende Fragerei und das Verdikt: Absteigen, den Töff unverzüglich nach Hause stossen! Zu Fuss gewann die Welt auf einmal ihre Weiten zurück.
Einen Grund gab’s immer, sich Auslauf zu verschaffen. Selbstgewählte Aufträge adelten das Unternehmen mit der notwendigen Ernsthaftigkeit. Den Hinweis fand Marco in einer Jugendzeitschrift. Und der Junge, war er nur ausdauernd genug, konnte sich Lorbeeren holen. So wenigstens war zu lesen in den Teilnahmebedingungen. Also bestellte er das Büchlein und fuhr los. Linde, Eiche, Kirschbaum – das war nicht schwierig; von seinen Ausfahrten kannte er eine Menge davon. Im Büchlein war der Gegenstand seiner Suche abgezeichnet. Also hielt er bei der Linde an der Weggabelung, verglich ein Lindenblatt mit dem gezeichneten im Büchlein, war sich der Übereinstimmung sicher – und trug die verlangten Daten ein: Standort und Uhrzeit. Auch weniger leicht Auffindbares fügte er hinzu, schickte bald das Büchlein ein und bekam umgehend die Goldene Späher-Nadel zugeschickt. So war sein Sammeleifer geweckt.
Vom Wetter hörte Marco im Radio. Der Vater neckte den Jungen mit dem Hinweis, das Wetter finde auch morgen statt – und zwar draussen. Auf seine Weise wandte sich Marco nun dem Wetter zu und versuchte Ordnung ins Geschehen zu bringen. In einem Heft zog er Kolonnen und wählte ein paar Signaturen, die einzustehen hatten für Sonne, Wolken, Regen, Schnee. Morgens, mittags, abends nahm er die Bewertung vor, was jeweils den Tageswert, den Tages-Durchschnitt ergab. Auch die Temperaturwerte kamen dazu. Die drei Werte zusammengezählt und durch drei geteilt – das ergab den Durchschnitt. Eine Knacknuss für seine mathematischen Fähigkeiten waren Negativwerte in der kalten Jahreszeit. Aber er kriegte das hin. – Einen Tag verglich er mit dem andern, eine Woche mit der vorangegangenen. Diesen Monat mit jenem. Las er zu gegebener Zeit die Wetterzusammenfassung in der Zeitung, freute er sich über seine eigene, wie er sagte, exakte Wissenschaft.
Ein ungutes Gefühl hatte Marco von Anfang an. Nicht gerne trat er vor die Klasse, kam sich jedesmal vor wie ohne Kleider. Und das Blut schoss in den Kopf, wollte nicht mehr zirkulieren. Aber der Auftrag war klar. Eine Geschichte hatte er vorzubereiten und dann vorzutragen. Marco ging auf die Suche, zappelte jedoch in Hilflosigkeit. Selbst die Rücksprache mit den Eltern brachte ihn nicht voran. Mutter verwies ihn auf Vater, der ein paar Bücher im Schrank hatte – aber alle Geschichten waren seitenlang und unverständlich fürs kindliche Gemüt. Ein mit Grossbuchstaben bedrucktes Kleinkinderbuch kam schliesslich zum Vorschein, darin die mit einer lustigen Zeichnung geschmückte Geschichte von den Drei kleinen Schweinchen. Sie tummelten sich auf freiem Feld und purzelten über ein altes Fass. So klein der kleine Junge auch war, er griff nach dem Spatz in der Hand und verzichtete notgedrungen auf die Taube auf dem Dach. Er las die Geschichte, las sie nochmals und nochmals. Dann ging er aus dem Haus, wählte den Feldweg und erzählte sich die Abenteuer der kleinen Schweinchen. Er stolperte über Steine und Gedächtnislücken, verrannte sich in Sackgassen, kehrte um und eilte zum Buch zurück, las die Geschichte nochmals und stopfte die Lücken. Wusste er nicht, wo aus, wo ein, erfand er kühn Übergänge und hatte am Ende vergessen, ob sie so auch im Buch standen. – Endlich kam der Tag seines Auftritts. Bis nach der Zehnuhrpause fieberte er darauf hin. Für anderes hatte er weder Auge noch Gehör. Nun stand Marco vor der Klasse, die froh war, ein paar Minuten unbehelligt zu sein und von ihm unterhalten zu werden. Das Blut schoss erwartungsgemäss zu Kopf, auch die Hitze – er schluckte das Herzklopfen nur mit halbem Erfolg hinunter, zudem wusste er nicht, wohin mit den feuchten Händen. Aber er musste hier durch, es gab kein Zurück. Das Gedächtnis spielte ihm keinen Streich. Und am Ende hiess es, er habe das nicht schlecht gemacht, bloss müsse er das nächstemal schon eine etwas anspruchsvollere Geschichte auswählen.
Locker war die Hand des älteren Lehrers und kurzum einsatzbereit. Selbst wenn er nicht Unterricht hatte, aber trotzdem im Schulhaus war, schmälerte das seine Autorität, seinen Einflussbereich in keinster Weise. Eine weibliche Stellvertretung wehrte sich und kämpfte an diesem Tag gegen Widerstände in der Klasse, kam nicht voran und verlor zusehends den Boden unter den Füssen. Sie musste bestehen oder untergehen. Von der Schülerschar war keine Hilfe zu erwarten. Behauptete sie sich nicht, so war es für sie nicht schade – so das ungeschriebene Gesetz. In ihrer höchsten Not, herausgefordert, ja verbal angerempelt von einem Mitschüler, eilte sie aus dem Zimmer und holte den Klassenlehrer. Wieder zurück, zeigte sie auf den plötzlich in sich zusammengesunkenen Jungen und überliess erleichtert die Massregelung dem Lehrer. Der sagte kein Wort, winkte den Sünder bloss mit einem Fingerzeig zu sich – und verabreichte ihm die zwar erwartete, in ihrer Unmittelbarkeit dennoch überraschende Ohrfeige; so rasch und heftig, dass der Junge ein paar Schritte gegen die Ecke taumelte und im Papierkorb zu sitzen kam. Das war lustig anzusehen, aber nicht das geringste Kichern machte sich Luft – vereinzelte Schüler pressten rechtzeitig die flache Hand auf den Mund. Wortlos verliess der Klassenlehrer das Zimmer, der Junge rappelte sich auf und torkelte mit glühender Wange an seinen Platz. Endlich konnte die Dame das Unterrichten fortsetzen. Indessen verpuffte ihr Anliegen ungehört im Raum.
Man wusste also Bescheid, hütete sich zukünftig vor Falschverhalten und nahm sich Manches vor. Gleichwohl schnappte die Falle wieder zu. Es gab Die jodelnden Schildwachen, ein Gedicht von Carl Spitteler. Wachsoldaten, ein strammer Major – versteckter Zündstoff allemal. Geeignet war das Gedicht für eine szenische Aufführung: mit Erzähler und drei Schildwachen. Die hatten einen Pulverturm zu beschützen. Der Major bläute ihnen den Auftrag, das korrekte Verhalten ein – sonst Strahl und Hagel gibt’s etwas! Auch deshalb, weil er im nahen Gasthof seinen halben Roten ungestört trinken wollte. Die drei Soldaten im Klassenzimmer kamen nun an die dramaturgische Kernstelle, wo sie zu singen hatten. Und eben dies gelang ihnen nicht. Alle lachten über die nicht gelingen wollende Fröhlichkeit; die Situation geriet ausser Rand und Band. Mächtig, gleichsam als funkensprühender Major, baute sich nun der Klassenlehrer vor den drei kichernden Soldaten auf, wollte den im Gedicht verlangten Jodel erzwingen – und verabreichte jedem eine Ohrfeige, dass es im Innern sang, als beteiligten sich alle himmlischen Heerscharen. Die Ruhe und Ernsthaftigkeit war wieder hergestellt, und zaghaft setzten die Stimmchen ein. Lauter, ausgelassener, hiess es nun, aber die Kehlen waren wie verklebt.
Süssigkeiten waren Mangelware. Die zwei Stückchen Schokolade gelegentlich waren wie ein Tropfen auf den heissen Stein. Zweimal im Jahr machte Mutter Schokoladencrème. Sie schmeckte herrlich, genug war es aber nie. Zum Glück lebte Marco in einem Städtchen mit einer Zuckerfabrik. Im Herbst, wenn die hohen Traktorräder über weite Asphaltstrecken die Erde der Rübenfelder in die Luft schleuderten und die Zuckerrüben in langen Wagenkolonnen herangeführt wurden, überschwemmte dieser unvergessene Rüben-Schnitzel-Geruch die Gegend. Ohne ihn hätte das jahreszeitlich Wesentliche gefehlt.
Gerüche holten auch vergessene Erinnerungen hervor. Das Areal der Zuckerfabrik war eingehüllt in weissen Dampf – der Wind spielte mit ihm. Eine Gegend, die es zwangsläufig zu erforschen galt. Rasch hatte man gelernt, welche Wege man gehen durfte, welche Rampen und Stege zu besichtigen erlaubt waren, wo man geduldet war und wo man aufgehalten wurde.
Verbotenes wurde oft gestattet, wenn der Arbeiter ein Auge, besser noch beide zudrückte und sich höchstens zur Warnung aufraffte, man solle aufpassen. Man passte auf, stolperte nirgends in ein Fettnäpfchen, grüsste freundlich und tat so, als gehöre man dazu. Den einen und andern Arbeiter kannte man, er war der Vater eines Mitschülers – man grüsste, wollte bloss rasch vorbeischauen. Keiner der Erwachsenen ärgerte sich über solche jugendliche Wohlerzogenheit. Sie wirkte wie ein Freipass, öffnete sozusagen alle Pforten.
Endlich fand man den Ort der Orte. Hier wurde der Zucker in mächtige Zuckerplatten gepresst und gestapelt. Es gehörte zum Arbeitsvorgang, dass immer wieder eine Zuckerplatte zu Boden fiel und in Stücke zerbarst. Auf dem Boden häuften sie sich in verschwenderischer Fülle. In Mengen, die zu Hause beim Zuckervorrat niemals erreicht wurden. Hier lag der Zucker am Boden, zum Aufwischen bereit. Hurtig der Griff nach einem kleinen Brocken, in den Mund mit ihm und zugebissen, dass es knirschte. Es war klar, hier durfte man nicht bleiben. Also rasch noch den Mund aufgesperrt für’s letzte freie Plätzchen. Dann nichts wie weg. Anderntags wieder hin, und der Arbeiter sagte vieldeutig-unmissverständlich, mitnehmen dürfe man nichts, er habe aber nichts dagegen, wenn man die Zuckerstücke in den Hosen- und Jackentaschen zum Verschwinden bringe. Nicht zweimal musste man dies den Kindern sagen. Fortan rückten sie in den Hosen mit den grössten Taschen an – und die Jacke war trotz hereinbrechender Frühlingswärme eine taschenreiche Winterjacke. Bloss der Magen rebellierte manchmal. Wieder draussen, kam’s vermehrt vor, dass man ein Gebüsch ersehnte, um sich würgend dahinter zu verstecken.
Mit Mutter ging Marco zum Einschreiben für den Schuleintritt. Zum erstenmal sah Marco ein Schul- und Klassenzimmer von innen. Was ihm zuerst auffiel, war der dicke Hals von Fräulein Blum. Als Frucht seiner Erziehung würgte er das Bedürfnis ab, dies der Mutter sogleich zu sagen. Draussen aber vermeldete er dies – und die Mutter nahm es lächelnd hin. Nach einigen Wochen war der Hals der Lehrerin kein Stein des Anstosses mehr – Marco wollte oder durfte ihr sogar die Mappe nach Hause tragen. Sonst gut im Schritt, wollte ihm an der Seite der Lehrerin der Rhythmus abhanden kommen. Allein mit ihr, überschwemmte ihn die Befangenheit. Fräulein Blum sagte dies und das – Marco schluckte, gab knappe Auskunft. Fräulein Blum lächelte. Womöglich genoss sie es, dergestalt die Überlegene zu sein. Marco trug die Mappe, sah sich mittendrin im Weltgeschehen – und war froh, sie endlich abgeben zu können und den Wunsch der Lehrerin erfüllt zu haben. In ihm freilich nistete nun der Wunsch, auch Lehrer zu werden. So eine Mappe! Und diese Macht über den Stoff und das Geschehen im Klassenzimmer!
Aber am Ende des Schuljahres trieb ihn die Aufforderung der Lehrerin arg in die Enge und machte ihn schwitzen. Jedes Mädchen, jeder Junge musste einzeln zum Lehrerinnenpult gehen, dort zwecks Stabilität und zur Beruhigung den rechten Arm auf das Pult winkeln – und ein Lied singen. Ein gelerntes zwar, das aber, so exponiert vor der Klasse, im Hals steckenblieb oder bestenfalls zum dünnsten Ton schrumpfte. Wer die Sache hinter sich hatte, hockte erlöst und schmunzelnd auf dem Stuhl, wer noch antreten musste, steckte in seiner Steifheit wie in einem Korsett. Schräg sass die Lehrerin als Expertin auf dem Stuhl, hörte das Lied, ohne ihm zu lauschen, hielt bloss den Stift in der Hand, um am Ende die Beurteilung aufs Blatt zu setzen. Denn bald gab es die Zeugnisnoten.
Einmal in der Woche hatte Marco ein Vierpfundbrot zu holen. Gab’s noch altes Brot, musste zuerst dies gegessen werden. Während man ins alte, halb vertrocknete Brot biss, liebäugelte man bereits mit dem prächtigen, frischen Laib. Mit anderem war’s auch so. Es hatte genug, aber man ging sparsam damit um. Doch heute war der grosse Tag, der Tag der Verschwendung. Seit drei Wochen war das Militär im Städtchen stationiert. Einer Fliegerabwehreinheit hatte Marco zugeschaut und beobachtet, wie rasch und griffsicher die Stellungswechsel vollzogen wurden; er war beeindruckt von der herrschaftlich befehlenden Stimme des Leutnants – ein wenig taten ihm die Soldaten leid, die auf ein solches Signal reagierten wie Automaten. Aber so, hiess es, sei das Militär. Gehorsam wurde nicht eine Sekunde in Frage gestellt. Plötzlich kam Bewegung in diesen Tag. Es hiess, der Wiederholungskurs gehe zu Ende, die Truppe sei am Aufräumen. Was bedeutete, dass, wer wollte, die Militärküche aufsuchen und sich eindecken durfte mit Esswaren, welche die Truppe übrig hatte. Marco ging also hin, eilte über den glitschigen Boden durch den dichten Dampf, der fürs letzte Mittagessen aus den riesigen Kochkesseln entstieg – Marco musste sich nicht erklären, durfte bloss hoffen. Seinen Milchkessel hatte er dabei und für alle Fälle eine Tasche. Der Kessel war rasch gefüllt mit Suppe – und in die Tasche kamen Brot, Schokolade, Biskuits. Gekrönt wurde die Geschenkserie mit einem Kessel Konfitüre. Erdbeer-Rhabarber: die Lieblingskonfitüre nicht nur des Jungen. Ein kaum angebrochener Fünfliterkessel! Ein Erfolg ohnegleichen.
Marco dachte an die Sonntage, die man im Bergwald mit Bechern verbrachte, die mit Erdbeeren zu füllen waren. Erdbeeren gab’s zwar viele, aber die kleinen Dinger, die es von Mal zu Mal vorzogen, gleich im Mund zu verschwinden, wollten kaum den Boden bedecken, geschweige denn den Becher füllen. Ein Glas Erdbeerkonfitüre war eine Kostbarkeit. Der Suppenkessel, die Tasche und der Konfitürenkessel strapazierten zwar Marcos Transportfähigkeit, aber er mobilisierte alle seine Reserven, um die Schätze heil nach Hause zu bringen. Das Lob, das er dort bekam, wärmte das Gemüt und beflügelte seine Gedanken über Tage.
Eine Zeitung gab’s dreimal die Woche. Marco konnte zwar lesen, verstand aber wenig. Das Nichtverstandene, auch kaum Geahnte, war voller Rätsel und brannte intensiv in den Gedanken. Selbst die Schwarzweissfotos hüteten ihr Geheimnis. Die Welt war gross und weit, man wusste das, ohne ihre Grösse und Weite zu ermessen. Faszinierend genug, dass es da draussen, hinter den Hügeln am Ende der Ebene, hinter den Wäldern noch etwas gab. Aber mit dem Buch Wunder der Welt ging’s noch weiter hinaus. Bildchen gab’s zu sammeln und einzukleben. So bekam der Kilimandscharo ein Gesicht, und auch die Menschen im brasilianischen Urwald und auf Papua Neuguinea. Die leeren Felder trugen schon den Titel, man wusste, dass hier ein Eisberg, dort ein Kanada-Bär hingeklebt werden wollte, erfuhr, wo der Affenbrotbaum zu platzieren war, las etwas von den Pyramiden und vom Eiffelturm – aber all diese Dinge und Wunschorte hatten kein Gesicht, waren bloss ein Versprechen, erregten umso mehr die Vorstellungskraft.
Wie gerne hätte Marco gewusst, was es mit den Niagara-Fällen auf sich hatte, wie gerne hätte er den Indianer zumindest auf dem Bildchen leibhaftig vor sich gehabt. Dafür sah er die weiten Mulden und scharf geschnittenen Dünen der Sandwüste und blickte aus sicherem Abstand in den Rachen des Krokodils. Wunder der Welt – Manches blieb in den Anfängen stecken. Nicht alle Felder vermochte Marco zuzukleben. Sie gähnten ihn an und rumorten in ihm als Leere. Er besetzte sie mit Möglichkeiten, malte sich aus, was er in der Antarktis und anderswo zu sehen bekäme.
Eine neue Zeit brach an. Es hiess, eine Bäckerei habe einen Teeraum, ein Tea-Room eingerichtet, und dort könne man teilhaben am Spektakulären. Marco konnte sich das nicht entgehen lassen, schlich sich verstohlen heran, um einen Augenschein zu nehmen. Schon vormittags sassen im Teeraum Frauen beim Kaffee. Und weit hinten, oben in der Ecke, war auf einem Brett ein Kasten installiert – das sei, wie es hiess, ein Fernseher. Ein Blick also in die Ferne. Die unbekannte Ferne, die auf einmal in die nächste Nähe gerückt war. Marco übernahm die Namen ungeprüft. Ein Fernseher war ein Fernseher. Aber das Kind war hier unerwünscht und fehl am Platz. Es störte, auch wenn es schwieg. Marco verstand. Der Fernseher war etwas für Privilegierte, für Erwachsene, ausnahmslos für Frauen. Und bald ging das Gerücht, dorthin gingen vormittags nur Frauen, die zu faul waren fürs Kochen, die neuerdings das Mittagessen in der Konservenbüchse kauften und mit der Vorbereitung huschhusch fertig waren. Alle andern Frauen sonnten sich in ihrem Fleiss und führten ihre Tüchtigkeit vor, indem sie sich aufgehoben fanden in jener Gruppe, die es sich nicht so leicht machte.
Marco hatte doch hingeschaut in die Fernsehecke hoch oben, hatte Schwarzweisses sich bewegen sehen – eben wie im Film. Ein Mann mit glatt nach hinten gekämmtem, crèmeglänzendem Haar umarmte eine Frau, bog ihren Kopf nach hinten, womit sie einverstanden zu sein schien, und näherte sich mit seinem Mund ihren Lippen, die nichts anderes mehr tun wollten, als das andere Lippenpaar aufgepresst zu bekommen. Das war Leidenschaft. Dann wurde das Kind weggeschickt – die Frauen assen Gebäck und machten sich breit auf ihren Stühlen. Marco ging hinaus in einen sonnigen Vormittag – Grelles mischte sich mit Schwarzweissem; er blinzelte und versuchte, sich in den vertrauten Bezirken zurechtzufinden. Vorläufig gehörte das Leidenschaftliche den Erwachsenen. Marco wollte auch erwachsen werden und fürchtete sich gleichzeitig davor.
Nur immer hinterm Papier sitzen und Aufgaben erledigen mochte der Junge nicht. Zwar brauchte man ihn nicht zu mahnen, er tat, was zu tun war, las auch gerne in einem Buch oder einer Zeitschrift, aber den Auslauf suchte er draussen, wenn auch vorerst bloss in der Nähe. Von einer Aprikose behielt er den Stein – und als er getrocknet war, begrub er ihn im Garten, so nahe an einer Bretterwand, dass man beim Hacken und Umgraben nicht so rasch auf ihn stiess. Vorsichtshalber schob er einen Stecken nach mit einem Schildchen und dem Hinweis, hier wachse ein Aprikosenbäumchen. Der Stein hatte keine Eile. Jahreszeiten gingen ins Land. An seinen Baum dachte Marco nicht immer. Aber der Stein liess ihn nicht im Stich. Was da lange Zeit später hervorkam, ein Stämmchen und Blätter bildete, war unzweifelhaft ein Aprikosenbäumchen. Weil es sich so frisch und stattlich entwickelte, kam keiner auf den Gedanken, es gehöre nicht hierher und müsse ausgerissen werden. An der Holzwand las der Junge Grösse und Wachstum ab – auch griff das Bäumchen seitlich aus und versprach für die ferne Zukunft reiche Ernte. Marco war stolz: Seht her, das ist mein Bäumchen, bald ein Baum. Dass es so sich formt, ist mein Verdienst. Man liess ihn gewähren.
Inzwischen hielt er Ausschau nach anderer Beschäftigung. Mutter wehrte sich mit Erfolg dagegen, ihm einen Teil eines Gartenbeets abzutreten für eigene Plantagen. Die winzigkleine Ecke, die ihn gnädigerweise zufrieden stellen sollte, verleidete ihm bald. Grub er ein Schäufelchen voll, stiess er sogleich an Grenzen, die zu überschreiten ihm verboten waren. Diese Verbote lähmten jeglichen Ansatz und allen Schwung. Stets sass ihm einer im Nacken – oder er erspähte Mutters Blick hinterm Vorhang. Den Garten gab Marco auf – aber das Aprikosenbäumchen gedieh.
Später verlockte ihn eine Ecke am Ende der vielerorts aufgebrochenen Steinterrasse zwischen Haus und Linde. Uralt und mächtig war der Baum und verschwenderisch sein Blütenduft; seine Wurzeln bohrten sich gegen das Haus wie Höcker oder Hebekrane, hoben das Erdreich, brachen ein in vordem Festgefügtes und brachten zwangsläufig auch das Muster der Pflastersteine in Aufruhr. Hier entdeckte Marco sein neues Tätigkeitsfeld und war gleich Feuer und Flamme. Schaufel und Hammer waren rasch zur Hand – zunächst lockerte er die Pflastersteine, nahm sie heraus und ebnete die Erde und den Untergrund neu. Marco sah sich als Architekt und Erneuerer. Er setzte Stein um Stein, vertiefte notfalls das Loch, in das der Stein zu liegen kam, stützte ihn seitlich ab und klopfte ihn fest. In die Zwischenräume stopfte er Erde, wischte die Steine blank und fühlte sich dabei wunderbar. Hatte das Leben einen Sinn – hier war er mit Händen zu greifen. Doch unversehens, kaum hatte Marco sein Erneuerungswerk abgeschlossen, steuerte Mutter heran und überschwemmte ihn mit ihrem Entsetzen, was er da angerichtet habe. Siehst du denn nicht, protestierte er. Doch, aber hör’ sofort auf damit und tu es nicht noch einmal. An seinem geglückten Werk konnte Marco so keine Freude mehr haben. Später reiften an seinem Bäumchen drei Aprikosen.
Mit Marco hatte die Barrierewärterin ihre liebe Müh. Mit einigem Kraftaufwand musste sie die Schranken hoch- und herabkurbeln. Frau Staub sass in ihrem Holzhäuschen, hatte zu beiden Seiten ein Fensterchen und kannte den Fahrplan genau. Die Lage von Bahnhof und Strasse war so, dass der letzte Wagen des einfahrenden Zuges zumeist noch auf dem Übergang zu stehen kam – und Frau Staub war aus Gewohnheit und Pflichtgefühl stets darauf bedacht, die Schranke früh, in den Augen der Kinder viel zu früh, zu senken. Das gab Wartezeiten. Hinzu kam, dass im Herbst, wenn über viele Tage hin die Güterzüge die Zuckerrüben heranbrachten, die Schranken erst recht lange geschlossen waren. Man blieb dann sozusagen im Regen oder Nebel stehen. Die Geduld, zu der die Autofahrer gezwungen wurden, kannten die Kinder nicht. Mit dem Fahrrad setzten sie auf ihre Waghalsigkeit und vertrauten auf ihre Wendigkeit. Die Strasse, über die vier Gleise führten, war so breit, dass es zwei Schrankenpaare brauchte, die sich gegeneinander senkten. Nicht exakt sekundengleich schlossen sie die Lücke. Sah Marco diese Lücke, schätzte er sie meisterhaft ab, ob das andere Strassenufer auf den Flügeln einer kleinen oder mittelgrossen Frechheit noch zu gewinnen wäre. Marco wurde so zum Akrobaten. Frau Staub kurbelte, was das Zeug hielt, aber nicht rasch genug, um den Jungen noch zu stoppen. Frau Staub überschüttete den Davoneilenden mit einer wütenden Wortlawine – erst später kam es Marco in den Sinn, sie könne dies auch aus Angst vor einem Unfall getan haben.