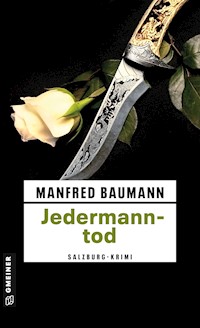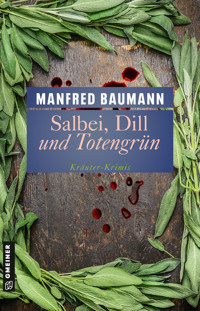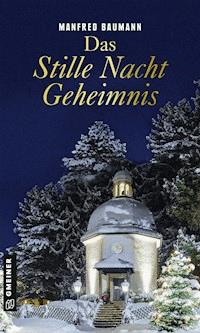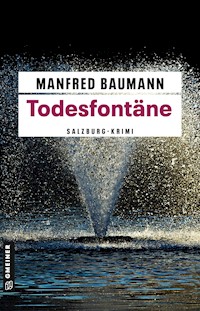Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Martin Merana
- Sprache: Deutsch
Magische Fäden. Puppen tanzen. Zauberhaftes Spiel. Das berühmte Salzburger Marionettentheater. Wo Papageno und Pamina Besucher aus der ganzen Welt verzücken, hängt jetzt eine junge Frau in den Puppenkulissen. Lucy, der Liebling der Truppe. Erdrosselt. Kommissar Merana beginnt zu ermitteln. Er stößt auf Intrigen hinter den Theaterfassaden, doch die Spur führt auch zu Kreisen politisch rechter Verschwörung. Und plötzlich ist auch Meranas Leben in Gefahr …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Baumann
Marionettenverschwörung
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Salzburger Marionettentheater
ISBN 978-3-8392-6060-9
Zitat
Ich fragte ihn, ob er glaubte, daß der Maschinist, der diese Puppen regierte, selbst ein Tänzer sein, oder wenigstens einen Begriff vom Schönen im Tanz haben müsse?
Heinrich von Kleist, Über das Marionettentheater, 1810
*
I may win on the roundabout
Then I’ll lose on the swings
In or out, there is never a doubt
Just who’s pulling the strings
I’m all tied up to you
But where’s it leading me to?
Sandie Shaw, Puppet on a String, 1967
0
Ich kann nicht sprechen.
Ich habe zwar einen Mund, aber ich kann ihn nicht bewegen.
Dabei hätte ich viel zu erzählen.
Man kann auch mit den Händen reden. Mit den angewinkelten Ellbogen. Mit den hochgezogenen Schultern. Man kann allein mit der richtigen Neigung des Kopfes alles ausdrücken. Freude, Abneigung, Furcht, Nachdenklichkeit, Neugierde. Sogar mit den zappeligen Beinen kann man reden. Aber ich kann es nicht. Jetzt nicht. Ich kann die Beine nicht bewegen, nicht die Hände, nicht den Mund. Nicht von alleine.
Ich bin eine Puppe. Ich hänge an Fäden. Ich brauche jemanden, der mich führt.
Ich bin neu hier.
Inzwischen kenne ich schon einige von den anderen. Die Prinzessin mag ich besonders, wenn sie anmutig den Kopf zur Seite dreht, um dem Flötenspiel des Prinzen zu lauschen. Ich schaue ehrfürchtig auf den Obersten der Priester, wenn er mit majestätischem Schritt der Schar der Eingeweihten vorangleitet. Ich lache über den gefiederten Kerl, wenn er mit seiner Vogelschar über die Bühne tanzt.
Sogar die große Schlange kenne ich schon, vor der ich mich am Anfang etwas fürchtete. Dabei schaut sie doch lustig aus mit den Drachenwarzen auf der Nase.
Sie alle hängen neben mir. Auch sie können nicht sprechen.
Aber könnten wir von alleine reden, würden wir jetzt den Mund weit aufreißen. Ich würde die Arme in die Höhe schnellen lassen und die Hände vors Gesicht schlagen. Mein ganzer Körper würde beben und schreien. Denn wo eben nichts war, eine leere Stelle zwischen Lichttraverse und Bühnenboden,hängt jetzt eine neue Figur.Mit großer Wucht ist sie von oben herabgestürzt und mit dumpfem Knall zwischen uns gelandet. Eine riesige Gestalt. Sie hat nur einen einzigen Faden. Nicht acht wie die bis zur Schwanzspitze bewegliche Schlange. Noch nicht einmal drei wie die ungelenkigen Tempeldiener. Der Faden ist nicht am Kopfende befestigt, nicht ans Handgelenk geknüpft, um sie zu führen. Der Faden ist um den Hals der großen Figur geschlungen. Ein mächtiger Faden. So dick wie meine Arme.
Wann kommt einer der Spieler, der mich vom Haken nimmt? Der das Holzkreuz erfasst, damit ich den Kopf herumwirbeln kann. Der die Fäden bewegt, damit meine Arme nach oben schnellen! Um mein Schaudern auszudrücken über das Grauen, das unversehens zwischen uns getaucht ist. Von oben herabgedonnert, aus dem Nichts. Und das jetzt neben uns hängt mit aufgerissenem Mund. Mit geschwollener Zunge zwischen blutroten Lippen, in einem hellen Gesicht, das mir bekannt ist. Dessen fröhliches Lachen mir so vertraut ist. Dessen Augen mir immer mit Frühlingsleuchten entgegenfunkelten, voll Tatendrang und Freude. Augen, die jetzt erstarrt sind, erstorben wie stumpfe Kohlenstücke in lebloser bleicher Asche. Wer hilft mir, mein Entsetzen hinauszuschreien und meinen Schmerz?
Dienstag, 23. April
Ein helles Etwas huscht vorüber, wie ein Stück Stoff, ein bleiches Tuch, das der Wind kurz aufbläht. Merana hebt den Kopf und lugt durch die geöffneten Vorhänge nach draußen. Das helle Gebilde entpuppt sich als Möwe. Sie spreizt ihre Flügel, landet mit den Beinen voran auf dem Geländer des Balkons. Der gelbe Schnabel schimmert im Dunst der Morgendämmerung. Merana wälzt sich aus dem Bett, greift nach dem Morgenmantel. Vorsichtig öffnet er die Balkontür. Er will das Tier nicht gleich verscheuchen. Der Vogel scheint die Nähe von Menschen gewohnt zu sein. Neugierig beäugt er die Gestalt im blauen Mantel, die aus dem Dunkel des Hotelzimmers ins Freie tritt. Langsam nähert sich Merana den Querstreben der Balkonumrahmung, legt die Hände darauf. Das Metall fühlt sich kühl an, feucht. Die Möwe beobachtet ihn, ruckt mit dem Kopf, verharrt auf ihrem Platz. Der Himmel über dem Hotel prangt in sattem Grau, durchzogen von dunklen Schlieren, ein düsterer Anblick. Die dichte Dunstdecke ringsum zeigt sich schon heller. Das Morgenlicht wird stärker. Laut Wetterbericht wird die Sonne in zwei bis drei Stunden große Schneisen in den Nebel reißen. Dann wird die Stadt in vollem Licht erstrahlen. Langsam beugt sich Merana vor, schiebt den Oberkörper so weit wie möglich über das Geländer, dreht den Kopf nach links. Zwischen den schemenhaften Häuserumrissen ist die Spitze des Michel auszumachen, ein Teil der Kuppel ist zu sehen, und die obere Rundung der goldenen Uhr. Wäre der Nebel lichter, könnte er vom Balkon des Hotelzimmers sogar die geschwungene Treppe zwischen den Säulen erkennen, über deren Stufen er gestern nach oben gestiegen ist.
Zusammen mit Jennifer.
Heute ist sein dritter Tag in Hamburg. Gestern, am Ostermontag, hat Jennifer ihn auf ihrer Tour durch die Innenstadt auch zur Kirche geführt. Sie befanden sich plötzlich mitten in einem Fest. Auf dem großen Platz vor der Kirche waren Tische aufgestellt, dicht gefüllt mit Feiernden. Eine Band spielte auf einer provisorisch errichteten Bühne nahe an der Kirchenmauer. An den Verkaufsständen wurden Würste angeboten, Bouletten, Gemüseauflauf, Salate, Kaffee und Kuchen, Getränke. Merana hätte gerne ein kühles Bier getrunken, aber Alkohol wurde nicht ausgeschenkt. Organisiert wurde das Fest von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Pfarrgemeinde. Die Einnahmen kamen Obdachlosen zugute. Auch die waren Teil des Festes, hockten in kleinen Grüppchen oder vereinzelt zwischen den übrigen Gästen. Manche blickten misstrauisch, hielten grimmig die Hände um ihre Gläser gekrallt. Andere lachten und zeigten offenherzig ihre Freude an der Aufmerksamkeit, die man ihnen an diesem Feiertag widmete. Merana war überrascht gewesen, als sie die Stelle erreicht hatten. Der Platz war wie eine Insel, die sich plötzlich im Meer der Stadthäuser auftat. Die bunte Schar der an schlichten Holztischen versammelten Feiernden verlieh dem Platz samt seiner Umgebung einen nahezu dörflichen Charakter. Beherrscht wurde das Ambiente vom großen Gotteshaus, von der evangelischen Hauptkirche Sankt Michaelis, eines der Wahrzeichen der Hansestadt. Der markante Turm war jahrhundertelang gut sichtbare Markierung für Seefahrer, die mit ihren Schiffen auf der Elbe nach Hamburg segelten.
Nicht weit von der Michaelis-Kirche entfernt trifft man auf die spektakulären Glasbauten der neu errichteten HafenCity. Sie schicken sich an, das Bild des modernen Hamburgs zu prägen, sich zum neuen Erkennungszeichen aufzuschwingen. Aber noch thront das alte Wahrzeichen über den Glaspalästen, noch überragt sie der alte »Michel«, wie die Hamburger liebevoll ihre Kirche nennen.
Merana war auch vom Inneren des Gebäudes beeindruckt. Ein weiter, heller, lichtdurchfluteter Raum bietet sich dem Betrachter, nicht so protzig überladen wie manche Barockkirchen in Österreich und im süddeutschen Raum, die er kennt. Am meisten überwältigt war er von der Aussicht. Vor allem die Sicht auf die Elbe und den riesigen Hafen war unbeschreiblich.
Jetzt, vom Balkon des Hotels aus, kann er nur wenig in der Ferne erkennen. Er überlegt kurz, den gefiederten Kollegen alleine zu lassen und sich wieder ins warme Zimmer zu verziehen. Doch er bleibt. Und er wird für sein Ausharren belohnt. Der dichte graue Schleier wird durchlässiger. Nach wenigen Minuten sind bereits schemenhafte Konturen auszumachen. Was eben noch formloses graues Gebilde war, verwandelt sich langsam zu Umrissen von imposanten Windrädern, von gigantischen Kränen, die ihre kolossalen Stahlarme in den Himmel recken wie furchterregende Weltraummonster aus einem Science-Fiction-Film. Weit unter ihm vermeint Merana, einen mächtigen, lang gezogenen Schatten auszumachen, der geräuschlos durch den Nebel gleitet. Im nächsten Moment spaltet sich die graue Wand, gibt den Blick frei auf ein riesiges Containerschiff. Wie ein urzeitlicher Koloss schiebt sich das schwimmende Ungetüm über das Wasser der Elbe, begleitet von Schleppern, deren schwache Umrisse er mehr erahnen kann, als sie tatsächlich auszumachen.
Merana ist zum ersten Mal in Hamburg. Auf den Anblick des berühmten Hafens mit seinen Schiffen und Kränen hat er sich am meisten gefreut. Und natürlich auf Jennifer. Sie hat ihn am Sonntag vom Flugplatz abgeholt, ihn zum Hotel gebracht. Am Nachmittag suchten sie den Jungfernstieg auf, mengten sich mitten unter die vielen Einheimischen und Touristen, ließen sich auf den voll besetzten Steinstufen am Ufer nieder. Jennifer besorgte einen Imbiss von einer der vielen Verkaufsbuden. So saßen sie fast zwei Stunden lang auf den warmen Steinplatten, löffelten Glasnudeln mit Fisch und Thaisoße aus Pappbechern. Sie redeten, lachten, genossen die beiderseitige Nähe und ließen dazwischen immer wieder den Blick über das Wasser der Binnenalster streifen, erfreuten sich am Anblick der Boote und der großen weißen Fontäne in der Mitte des Areals. Später wechselten sie in ein nahes Lokal an einem der Kanäle mit Blick auf das imposante Rathaus. Viel mehr bekam er an seinem ersten Tag von Hamburg allerdings nicht mit. Was beide an diesem ersten Nachmittag und Abend vor allem wollten, war miteinander reden.
Sie hatten sich über ein halbes Jahr nicht gesehen. Bei ihrer Verabschiedung in Salzburg hatte Jennifer gesagt: »Besuchst du mich bald einmal in Hamburg?« Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt ist er hier, um sein Versprechen einzulösen.
Ein scharfes Krächzen reißt ihn aus seinen Gedanken. Der Seevogel neben ihm zuckt mit den Flügeln. Ein weiterer Schrei, dann stößt sich der Vogel vom Geländer ab, nimmt Kurs nach unten, in Richtung Hafen. Der Flügelschlag der startenden Möwe wirkt wie ein Rückzugszeichen für die Nebelwände. Immer größer werden die hellen Flecken in der grauen Umgebung. Am linken Rand von Meranas Blickfeld schieben sich die dunklen Zacken eines Gebäudes aus dem Dickicht der Schwaden. Die geschwungene aufsteigende Silhouette eines prächtigen Bauwerkes wird sichtbar. Wegen dieses Kunsttempels kommt mittlerweile die halbe Welt nach Hamburg. Vor Meranas Augen schält sich die Kontur der berühmten Elbphilharmonie aus dem Nebel. Wie eine überdimensionale futuristische Schmuckschatulle mit kleinen Juwelen auf der dunklen Außenhaut ragt sie über die Gebäude am Fluss. Merana freut sich wie ein kleines Kind. Er hat das Konzerthaus seit seiner Ankunft nur aus der Entfernung gesehen. Den direkten Blick aus der Nähe wollte er sich aufsparen für die Hafenrundfahrt, zu der ihn Jennifer in drei Stunden abholen wird. Und vor allem wollte er sich den Eindruck für heute Abend bewahren. Da würde er nicht nur staunend vor der ungewöhnlichen Fassade des Gebäudes stehen. Heute Abend würde er das Haus auch in dessen Innerem erleben. Bei einem Konzert! Die Musikveranstaltungen in der Elbphilharmonie sind heiß begehrt, man muss monatelang auf Tickets warten. Merana konnte Jennifer lange nicht mitteilen, wann er tatsächlich nach Hamburg käme. Zu viel war in letzter Zeit geschehen, hielt ihn auf Trab. Auch das Ende seines komplizierten Prozesses vor der Disziplinarkommission war schwer abzuschätzen gewesen. Erst vor knapp vier Wochen konnte Merana den Termin für seinen Besuch endgültig zusagen. Er muss sie heute Abend fragen, wie sie es geschafft hat, noch Karten zu ergattern. Er wirft einen Blick auf das prunkvolle Konzerthaus in der Ferne, dann kehrt er zurück ins Zimmer. Das dumpfe Dröhnen eines Schiffshorns ist zu vernehmen, gleich darauf ein helleres. Der Hafen erwacht zum Leben. Der Digitalwecker neben dem Bett zeigt 06.15 Uhr. Das Hotel verfügt über einen Swimmingpool und einen Fitnessraum. Beides will er noch nützen. Um halb acht würde er frühstücken und warten, bis Jennifer ihn abholt.
»Einem Verrückten in die Karten schauen, was bringt das?« Der Spruch steht außen auf einem der Fenster des Caféhauses. Er stammt von Thomas Bernhard. Sibylle kennt das Zitat. Doch sie liest die Zeilen jedes Mal aufs Neue, ehe sie eintritt. Und jedes Mal sucht sie nach einer originellen Antwort. Aber ihr fällt nie mehr ein als: Das bringt gar nichts! Auch wenn du das Blatt kennst, weißt du bei Verrückten nie, welche Karte sie als Nächstes ausspielen. Sie schmunzelt, schüttelt den Kopf und öffnet mit Schwung die beiden Eingangstüren zum Café Classic.
»Guten Morgen. Es gibt frischen Topfenstrudel.«
Die Chefin des Hauses lächelt ihr zu. Ihr Mann hantiert am Tresen an der Espressomaschine. Zwei Kellnerinnen sind im hinteren Bereich des Cafés unterwegs.
»Wunderbar, den Strudel nehme ich. Und dazu einen Cappuccino.«
Sie hat sich zwar vorgenommen, heute nichts Süßes zu essen. Aber bei Topfenstrudel kann sie nicht widerstehen. Sie holt sich eine Zeitung, nimmt Platz an einem der Fenstertische. Sie schaut nach draußen. Der Himmel über dem Hotel Bristol schimmert türkis. Die großen Magnolienbäume auf dem Makartplatz stehen seit Tagen in voller Pracht. Wie Millionen heller Tropfen hängen die Blüten an den Zweigen, verwandeln die Baumkronen zu wolkengleichen märchenhaften Gebilden. Trotz des dichten Blütenmeers ist von Sibylles Platz aus die Mitte des Areals gut einzusehen. Dort prangt eine imposante Bronzeskulptur, die »Caldera«, ein Werk des englischen Bildhauers Anthony Cragg. Die eruptive Kraft, die die Form dieser Bronzeskulptur ausstrahlt, erinnert Sibylle an den gestrigen Abend. Sie zieht unwillkürlich die Luft ein, heftiger, als sie wollte. Ein belebendes Frösteln kriecht über ihre Haut. Auch sie war gestern förmlich explodiert. Ihr eigener Schrei hallt immer noch in ihr nach. Lustvoll und zugleich erschreckend. Sie schüttelt sich, verscheucht die Gedanken an gestern Abend. Sie lehnt sich zurück, versucht, die morgendliche Atmosphäre ringsum zu genießen. Sibylle mag dieses Kaffeehaus. Sie sitzt im Sommer gerne an einem der Tische im pittoresken Innenhof. Das Café liegt in einer von Touristen gern besuchten Umgebung. »Tanzmeisterhaus« hieß das Gebäude Anfang des 18. Jahrhunderts, weil dessen damaliger Besitzer Franz Gottlieb Spöckner hier Unterrichtsstunden für Tanzwillige aus adeligen Kreisen abhielt. Eine Art Dancing Stars für hochwohlgeborene Perückenträger. Aber die altehrwürdigen Mauern hätten es wohl niemals zu einem längeren Eintrag in die Geschichtsbücher geschafft, wenn nicht der ehemalige Vizekapellmeister der Salzburger Hofmusik, Leopold Mozart, sich 1774 endgültig eingestehen musste, dass die Wohnung in der Getreidegasse für die Familie mit zwei inzwischen erwachsenen Kindern viel zu eng war. Also übersiedelte er im Herbst desselben Jahres samt Gattin Anna Maria, Tochter Maria Anna und Sohn Wolfgang Amadeus vom linken auf das rechte Salzachufer und bezog Quartier im Gebäude am Makartplatz, der damals Hannibalplatz hieß. Wolfgang Amadeus, das längst zum Mann gereifte Wunderkind, verbrachte einige Jahre in diesem Haus, ehe er nach Paris und schlussendlich nach Wien abrauschte. All dies und vieles mehr aus Leben und Schaffen des Salzburger Genius loci können Besucher erfahren, wenn sie durch die Museumsausstellungsräume schlendern. Sibylle kennt das Gebäude seit ihrer Kindheit. Ihre Eltern haben sie oft zu Konzerten in Mozarts Wohnhaus mitgenommen. Das ist sicher mit ein Grund, warum sie heute noch gerne hierherkommt. Sie schwelgt gerne in Erinnerungen.
Sie liebt das Café auch, weil man auf viele Bekannte trifft, auf Musiker, Schauspieler, Künstlerkollegen. An den Makartplatz grenzen einige bedeutende Salzburger Kulturstätten. Schräg gegenüber von Mozarts Wohnhaus liegt das Landestheater, daneben der Eingang zum Mirabellgarten. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Musikuniversität Mozarteum, gefragt bei Studierenden aus aller Welt. Direkt an das Landestheater schließt das alte Mozarteum mit seinen Konzertsälen an, und nicht zuletzt auch Sibylles eigene Wirkungsstätte, das Salzburger Marionettentheater.
Auch jetzt am frühen Morgen ist das Caféhaus bereits gut gefüllt. Sibylle erkennt unter den Gästen eine Maskenbildnerin aus dem Landestheater im Gespräch mit einem jungen Mann, der einen Cellokoffer bei sich hat. Ein schon leicht ergrauter Hochschulprofessor kramt am Zeitungsstand und entscheidet sich schließlich für den »Standard« und die »Süddeutsche«. Die Caféhauschefin nähert sich, stellt Tasse und Mehlspeise auf den Tisch. Sibylle greift zur Gabel, sticht ein Stück ab und kostet. Schon beim ersten Bissen durchflutet sie ein Glücksgefühl. Jawohl! So muss ein Topfenstrudel schmecken.
»Hallo, Sibylle, dich habe ich ja schon lange nicht mehr hier gesehen.« Die Frau, die sie mit wohlklingender Stimme anspricht, kam eben durch die Tür. Neben Sibylle steht eine etwa 50-jährige hagere Person in dunklem Pullover und hellem Rock. Der um den Kopf gekordelte aschblonde Zopf verleiht ihr ein Aussehen, das Sibylle immer vage an eine ukrainische Politikerin erinnert. Tymoschenko oder so ähnlich heißt die.
»Und du trägst eine neue Brosche! Sehr hübsch. Ist das Jade?«
»Nein, Malachit.«
»Ah, interessant. Steht dir jedenfalls ausgezeichnet. Passt wunderbar zu deinen Augen.«
Die Frau setzt sich an den Nachbartisch.
»Wie läuft es denn mit euren Proben?«
»Danke der Nachfrage, Dorothea. Wir hängen wie immer ein wenig hinterher. Aber du weißt ja, wie das ist. Unser regieführender Jungstar wird schon genug Dampf machen, um uns rechtzeitig bis zur Premiere in Hochform zu bringen.«
Die Zopfträgerin lacht. »Ja, wir haben an unserem Haus derzeit auch einen Jungstar, der meint, das Theater von Grund auf neu erfinden zu müssen. Er hält sich für einen zweiten Frank Castorf. Aber Herumbrüllen alleine wird nicht reichen, um Karriere zu machen. Naja, wir werden sehen.«
Sie bestellt zwei Eier im Glas und einen Kräutertee.
»Ich bin schon sehr gespannt auf eure Neuproduktion. Wird es eine öffentliche Generalprobe geben?«
Sibylle nickt. »Es ist noch nicht ganz entschieden, aber vermutlich.«
Ein Lächeln schleicht sich in die leicht verhärmten Züge der hageren Frau. »Du denkst doch dann an mich?«
Sibylle hat schon den nächsten Bissen im Mund, kann nur nicken.
So ist das in Salzburg. Jeder hofft, irgendwen zu kennen, und kennt dann tatsächlich wen, der irgendwen kennt, der weiß, wie man irgendwie zu Freikarten kommt. Besonders begehrt sind natürlich Generalprobenkarten für Aufführungen der Salzburger Festspiele. Nicht nur im Sommer. Auch zu Ostern und zu Pfingsten.
Auch ihr ist es vor Kurzem gelungen, über eine befreundete Flötistin an eine Generalprobenkarte für die Osterfestspiele zu gelangen. Festspielopernkarten kosten in Salzburg ein kleines Vermögen. Knapp 500 Euro hat man zu berappen, wenn man ganz vorne sitzen will. Und für die allerletzte Reihe blättert man auch noch über 200 Euro hin. Da freut man sich als Opernliebhaberin schon wie ein Kind vor dem Weihnachtsbaum, wenn man hin und wieder eine Generalprobenkarte ergattert. Zum Nulltarif. Sie war im Großen Festspielhaus, Rang Mitte, vierte Reihe: »Lohengrin«. Und kein Geringerer als Weltstar Jonas Kaufmann sang die Titelrolle.
Gott sei Dank war die Lohengrin-Generalprobe am Vormittag. Abends hätte Sibylle die Gelegenheit zum Opernbesuch gar nicht wahrnehmen können. Sie haben im Marionettentheater fast drei Wochen durchgespielt. Jeden Abend Vorstellung, manchmal zusätzlich am Nachmittag. Der Einsatz hat sich ausgezahlt. Die Osterzeit schwemmt immer eine besonders große Anzahl an Touristen nach Salzburg. Nicht nur Tagestouristen, die mit dem Bus ankommen, sich von Fremdenführern durch die Getreidegasse und über die Plätze treiben lassen, die noch schnell die Mozartstatue und die Festung fotografieren und dann wieder verschwinden. Nein, zu Ostern kommen viele Gäste nach Salzburg, die gerne länger bleiben, die einiges an Geld ausgeben, die in den Geschäften einkaufen, sich auch manch kulturellen Genuss gönnen. Heuer war die Auslastung im Marionettentheater besonders hoch, nahezu jede Vorstellung während der Osterzeit war ausverkauft. Auch die gestrige Abschlussmatinée mit Mozarts »Zauberflöte« war gut gefüllt. Abends gab es keine Vorstellung mehr. Das gesamte Ensemble hat aufgeatmet. Der erste freie Abend nach 18-tägigem Vorstellungsmarathon.
Sie schaut auf die Uhr. Um Himmels willen! Schon zwei Minuten vor neun. Vor lauter Schwärmen in alten Erinnerungen und Topfenstrudel- und Lohengringenüssen hat sie völlig die Zeit übersehen. Die Zopfträgerin am Nachbartisch nippt an ihrem Tee, blickt von einem Stapel Noten auf. »Giuseppe Verdi. Il trovatore«, ist auf der obersten Seite zu lesen. Dorothea Haselberg ist seit fast 30 Jahren eine wichtige Stütze im Chor des Landestheaters.
Sibylle winkt der Chefin, vergisst nicht, Grüße und Worte des Lobes an die Frau Mama auszurichten, gibt reichlich Trinkgeld und huscht hinaus.
Heute hat sie keinen Blick für das Haus Makartplatz Nummer 1, direkt gegenüber dem Landestheater. Es ist das Geburtshaus von Christian Doppler. Gleich zwei Marmortafeln auf dem Gebäude weisen darauf hin. Der Physiker, der den nach ihm benannten »Doppler-Effekt« entdeckte, wurde hier 1803 geboren. Manchmal bleibt Sibylle vor der Schautafel stehen, vertieft sich kurz in das Porträt des Wissenschaftlers und noch länger in die Auslagen der Parfümerie, die im Erdgeschoss des Gebäudes liegt. Heute hetzt sie daran vorüber und ist keine zwei Minuten später am Eingang zum Marionettentheater. Die Verwaltungsräumlichkeiten liegen im ersten Stock. Während sie die Eingangstür aufschließt, hört sie schon das Läuten des Telefons. Sie tritt ein, lässt ihre Tasche auf den Boden fallen, eilt zum Schreibtisch, hebt ab.
»Salzburger Marionettentheater, guten Morgen.«
Am anderen Ende der Verbindung ist eine Frau mit südländisch klingendem Akzent, die nach Karten für heute Abend fragt. Sibylle erklärt, dass heute keine Vorstellung stattfindet. Die nächste Aufführungsserie beginne aber schon morgen.
»Ist es … äh, possibile … vedere in die Internet?«
»Si, certo, signora.« Sie buchstabiert der Anruferin die Webadresse und legt auf. Gleich darauf klingelt es erneut. In der nächsten Viertelstunde betreut sie fünf Anrufer und versucht, deren Fragen zu beantworten. Dann stellt sie die Anlage auf »Mobil« um, steckt das tragbare kleine Telefon ein und begibt sich zur Toilette. Als sie zurückkehrt, hebt sie ihre Tasche vom Boden auf. Sie fröstelt. Der Heizkörper ist kalt. Soll sie ihn aufdrehen? Nein, es reicht, dass sie ihre dicke Jacke noch anhat. Es ist ruhig im Haus. Sie lässt sich auf einen der abgewetzten Biedermeierstühle nieder und legt die Beine hoch. Sie liebt diese Stille. Manchmal bleibt sie abends nach einer Vorstellung länger im Haus. Es gibt immer etwas zu tun. Kleidungsstücke an den Puppen ausbessern. Entwürfe für neue Kostüme erstellen. Mailnachrichten begeisterter Besucher beantworten. Aber meist sitzt sie einfach nur da und saugt die Stille des alten Hauses ein wie kühlen, dickflüssigen Wein. Vielleicht würde sie auch heute länger bleiben als geplant. Sie hat Anita versprochen, den Vormittagsdienst für sie zu übernehmen. So konnte die Sekretärin mit ihrem neuen Freund auf der Skihütte übernachten und braucht erst gegen Mittag in Salzburg zu sein. Sie würde vielleicht nach Anitas Ankunft eine Stunde dranhängen. Sie hat ja noch die venezianische Gondel zu reparieren. Bei der letzten Vorstellung von »Hoffmanns Erzählungen« war der silberne Bugbeschlag abgebrochen. Im selben Moment fällt ihr ein, dass sie noch etwas zugesagt hat. Ihr ist gestern während der Vorstellung aufgefallen, dass Tamino im zweiten Akt Probleme hatte, die Flöte anzusetzen. Vielleicht war eine der Halterungen für die Fäden lose. Gestern nach dem Ende des österlichen Vorstellungsmarathons hat jeder im Team nur mehr alle viere von sich gestreckt. Keiner brachte die Energie auf, sich um die Behebung eines technischen Gebrechens zu kümmern. Aber jetzt fühlt Sibylle sich besser. Sie wird das gleich in Angriff nehmen. Sie drückt sich aus dem Stuhl hoch, überprüft, ob sie das mobile Telefon eingesteckt hat, und verlässt das Büro. Der angrenzende Gang führt direkt zum hinteren Bühneneingang. Auf dem Boden neben der Tür entdeckt sie ein Tuch. Sie hasst Schlamperei. Nicht umsonst trägt sie im Team den Spitznamen »Madame Blitzblank«, nur weil sie darauf drängt, dass jeder seine Sachen dort aufbewahrt, wo sie hingehören. Sie hebt das Tuch auf. Ein schwaches Aroma steigt plötzlich in ihre Nase. Sie hält das Stück Stoff näher ans Gesicht. Der Geruch kommt ihr vertraut vor. Wer hat das wohl liegen lassen? Sie steckt das Tuch in die Tasche ihrer Jacke und betritt den Raum. Sie dreht das Arbeitslicht an und steigt die schmale gewundene Treppe hinunter bis zur Plattform mit dem Lichtregiepult. Sie muss ganz nach unten, bis zum Bühnenboden, denn einige der Puppen aus der Zauberflöte hängen auf dem Querbalken der Vorderbühne. Sie ist noch nicht am Ende der zweiten Treppe angekommen, da bleibt sie erschrocken stehen. Der groteske Anblick, der sich ihr bietet, verblüfft sie. Zwischen den Marionetten hängt ein Körper, der dort nicht hingehört. Er ist größer als die anderen Puppen, eine riesige monströse Erscheinung neben den kleinen Theaterfiguren. Das Bühnenarbeitslicht ist gedämpft, wirft nur einen schwachen Schimmer auf das grauenvoll verzerrte Gesicht der Figur. Sibylles Herzschlag setzt für eine Sekunde aus. Das ist ein Mensch, eine Frau! Die geschwollene Zunge hängt ihr seitlich aus dem Mund. Im nächsten Moment erkennt Sibylle, wer die Gestalt ist. Als würde ein unsichtbarer Spieler an einem Faden ziehen, zuckt Sibylles Kopf zur Seite, ihr Mund wird weit aufgerissen, und heraus quillt ein Schrei. Gleich darauf noch einer. Durch das halbdunkle Rund des Theaters schrillt Sibylles hysterisches, panikerfülltes Kreischen.
»Hey, marvelous!«
»Che bello …«
»Wao! Net schlecht, die Hütten …«
Ein kollektiver Aufschrei der Bewunderung macht sich in der Schar der Besucher breit, übertönt das Rattern des Dieselmotors des Ausflugsbootes. Erstaunen in verschiedenen Sprachen und Stimmungslagen, jubelnd, ehrfurchtsvoll, ergriffen, aus dem Mund eines Bayern auch ein wenig flapsig.
»Sapperlot, do haben de Hamburger Bazi endli oamoi was Saubers zsambracht! Is eh Zeit wordn!«
Die Barkasse ist eben aus dem schmalen Kanal gebogen, verlässt den Bereich der alten Speicherstadt, erhöht im breiten Fahrwasser der Elbe das Tempo und hält auf das markante Gebäude zu, das mit seiner blitzenden Glasfassade auf dem Sockel des alten Kaispeichers wie eine überdimensionale Krone prangt.
»Mami, ist das die Elphi?«
»Ja, mein Schatz!«
»Hey, dann mache ich gleich ein Foto. Selfie mit Elphi …«
Die aufgeweckte Zehnjährige zückt ihr Handy und versucht eine passende Position einzunehmen, um sich mit der Elbphilharmonie im Hintergrund im Bild festzuhalten.
Die Kleine hat ihrer Mutter schon von Beginn der Fahrt an Löcher in den Bauch gefragt.
Jennifer hat Merana kurz nach neun abgeholt. Sie waren zu Fuß unterwegs. Der Elbehafen liegt nicht weit vom Hotel entfernt. Ihr Ziel waren die Landungsbrücken zwischen Niederhaven und dem St. Pauli Fischmarkt. Sie waren nicht die Einzigen am Ufer. Tausende tummelten sich an den Piers. Hier ist die Anlegestelle für die großen Fahrgastschiffe, für imposante Ausflugsboote genauso wie für Linienfahrzeuge.
»Bevor wir starten, musst du unbedingt ein Fischbrötchen zu dir nehmen«, hat Jennifer gelacht, und auf die Verkaufsbuden gedeutet, die sich am Pier entlangziehen. »Was willst du? Makrele, Seelachs, Bismarckhering, Nordseekrabben, Kräutermatjes?«
Er entschied sich für Hering. Sie aßen beide im Stehen Fischstücke samt Weißbrotscheiben aus zusammengerollten Servietten und achteten darauf, nicht von den Besucherströmen überrollt zu werden. Jennifer wies auf eine große Fähre, die an ihnen vorbeizog. »Das ist die Linie 62, die nehmen wir am Nachmittag in Richtung Finkenwerder. Wir steigen aber schon in Övelgönne aus. Und weißt du, was dich da erwartet, mein Lieber?«
Merana hatte keine Ahnung.
»Sandstrand! Und das am Ufer der Elbe! Badegäste. Blühender Oleander in großen Eimern. Strandbars mit Sonnenliegen und Cocktails. Das ist fast wie Rio de Janeiro. Nur dass du hier nicht auf den Zuckerhut blickst, sondern auf Kräne, die große Lasten schwenken, und Containerschiffe, die an dir vorüberziehen. Das ist Hamburger Romantik pur!«
Er lachte. »Einen Caipirinha samt Blick auf Kräne nehme ich gerne. Aber sonst muss ich passen. Ich habe keine Badehose dabei.«
Dann sind sie zur Hafenrundfahrt aufgebrochen. Jennifer hat sich für eine der kleineren Barkassen entschieden. Mit den kleineren Booten ist es auch möglich, die engen Kanäle zu befahren, die durch die alte Speicherstadt führen. Merana war neugierig, den Komplex der historischen Lagerhäuser von der Perspektive des Wassers aus zu sehen. An Land hatte er gestern schon einige Eindrücke gewinnen können. Seit 1991 stehen die Gebäude unter Denkmalschutz, hat Jennifer ihm erklärt, und seit 2015 ist das gesamte Areal von Speicherstadt und Kontorhausviertel auf der UNESCO-Welterbeliste eingetragen.
»Da wart ihr aber spät dran«, hatte er gestern feixend bemerkt. »Die Salzburger Altstadt hat das UNESCO-Prädikat schon 1997 bekommen.«
Er hatte viel erfahren bei diesem Rundgang. Dass man die Kanäle, die Wasserverbindungen, in Hamburg Fleet nennt. Dass die riesigen Speicher früher vor allem für die Lagerung von Kaffee, Tee und Gewürzen gebraucht wurden. Dass die Backsteinarchitektur im neugotischen Stil ausgeführt ist. Und dass die Lagerhäuser auf Tausenden von Eichenpfählen stehen. Die alten Gebäude werden auch heute noch genutzt, für Museen, Agenturbüros, Lokale und einige auch für Teppichgeschäfte.
Wie selbstverständlich hat Jennifer beim Einsteigen seine Hand genommen und gleich nach der Abfahrt ihren Kopf an seine Schulter gelegt.
Sind wir uns in diesen Tagen näher gekommen?, fragt Merana sich, während die Barkasse über das Wasser glitt und der Bootsführer über Lautsprecher die Besonderheiten der Umgebung erklärte. Er hat den Eindruck, sie sind einander schon bei ihrer ersten Begegnung in Salzburg sehr nahe gewesen, ohne, dass beide es aussprachen. Dennoch war er leicht nervös, als er vorgestern in Hamburg aus dem Flugzeug gestiegen war und sich fragte: Wie würde die Begegnung ablaufen? Wie würde Jennifer reagieren? Sie sind einander vor einem halben Jahr in Salzburg erstmals begegnet. Die äußeren Umstände dieses Zusammentreffens waren von tragischen Umständen begleitet gewesen, von großer leidvoller Erfahrung für beide. Jennifer war es, die bei der Verabschiedung sagte: »Es wäre schön, einander wiederzusehen.«
Würde dieses Gefühl sich halten, auch über den Zeitraum eines halben Jahres? Doch die Spur von Unsicherheit verflog in dem Moment, als sie in der Empfangshalle des Hamburger Flughafens auf ihn zueilte, ihn fest an sich drückte. Sie küsste ihn auf die Wange, hängte sich bei ihm ein, plauderte drauflos, als hätten sie sich erst gestern verabschiedet.
Als sie vor Wochen über seinen Besuch sprachen, hatte sie ihm angeboten, bei ihr zu wohnen. Doch er wollte lieber ins Hotel. Da konnte er sich zurückziehen, falls ihm die plötzliche Nähe doch zu viel wurde. Sie hatte das auf der Stelle akzeptiert, hatte nicht versucht, ihn umzustimmen.
»Stooooop!« Ein helles Kreischen fegt über die Köpfe der Passagiere hinweg. »Maaaami! Der Kapitän muss sofort anhalten!« Fast alle Gesichter der Ausflügler im Boot wenden sich der hysterisch schreienden Zehnjährigen zu. Sie fuchtelt mit den Armen. Ihre Hände sind leer. Eben hat sie noch ein Handy gehalten. »Es ist mir ins Wasser geplumpst! Sofort anhalten!«
Die Kleine ist schwer zu beruhigen. Es dauert einige Zeit, bis sie die Erklärung ihrer Mutter akzeptiert, dass man jetzt weder anhalten noch eine Truppe von Tauchern herbeikommandieren kann, um nach dem Handy zu suchen.
»Da hättest du besser achtgeben sollen! Ich habe dir gesagt, beuge dich nicht zu weit über die Reling! Jetzt ist es weg.«
Das Gesicht des Mädchens ist zu einer Schnute verzogen. Plötzlich hellt es sich auf. »Kriege ich jetzt ein neues Handy? So ein cooles, wie Sandra eines hat?«
Merana bekommt die Antwort der Mutter nicht mehr mit. Er hat sich zur Seite gedreht, um ein paar Schnappschüsse zu machen. Er versucht, die Elbphilharmonie in einer Linie mit dem Turm der alten Michaeliskirche im Hintergrund aufs Bild zu bannen. Dann schießt er Großaufnahmen der gewölbten Glaselemente auf der Außenhaut. Diese Glaskörper verleihen dem Gebäude das Aussehen eines überdimensionalen Kristalls. Wie in einem riesigen Zauberspiegel reflektiert sich darin die Umgebung. Dort oben würde er heute Abend sein, und zusammen mit Jennifer ein wohl unvergessliches Konzert genießen.
Das Smartphone in seiner Hand vibriert. Er beendet die Kamerafunktion und liest die eingegangene Message. Sie kommt von seiner Stellvertreterin, Chefinspektorin Carola Salman.
»Schlechte Nachrichten?«, fragt Jennifer, als sie seinen Gesichtsausdruck wahrnimmt. Er nickt.
»Musst du auf der Stelle zurück?«
Er schüttelt den Kopf. »Nein, morgen früh wird reichen.«
Er blickt wieder zur spektakulären Fassade des Gebäudes. Um 20 Uhr würde das Konzert beginnen.
Die fünfte Symphonie von Gustav Mahler steht auf dem Programm und dazu im ersten Teil ein berühmtes Lied und das gleichnamige Streichquartett von Franz Schubert. »Der Tod und das Mädchen«. Merana seufzt. Das passt zur eingegangen Nachricht. Er bemüht sich, seiner Begleiterin zuliebe die düstere Stimmung in seinem Inneren zu verscheuchen. Es gelingt ihm nur schwer.
Mittwoch, 24. April
Das Summen der Triebwerke ist einlullend. Er hat vergangene Nacht wenig geschlafen. Der Kaffee, den ihm die Flugbegleiterin im Pappbecher reicht, ist Gott sei Dank heiß und stark. Er hat kurz vor dem Abflug nochmals mit seiner Stellvertreterin telefoniert. Carola Salman hat ihm spätabends eine Mail zum aktuellen Ermittlungsstand übermittelt. Er kippt die Sitzlehne zurück, trinkt vorsichtig den heißen Kaffee in kleinen Schlucken, gibt den leeren Becher zurück an die hilfsbereite Stewardess. Er denkt an das tote Mädchen.
An jenes, das man gestern Morgen auf der Bühne des Salzburger Marionettentheaters fand. Und auch an jenes von gestern Abend. An das Mädchen aus dem Gedicht von Matthias Claudius, dessen Text Franz Schubert zu einem Lied verwandelt hat.
Vorüber! Ach vorüber!
Geh wilder Knochenmann!
Ich bin noch jung, geh Lieber!
Und rühre mich nicht an.
Lied und Text haben Merana schon früher berührt. Er hat es oft für sich zu Hause auf CD gehört, und einmal auch im Konzertsaal erlebt, bei einem Liederabend der Salzburger Festspiele.
Aber gestern bei der Darbietung in der Elbphilharmonie war er besonders ergriffen, wissend, dass in der Salzburger Gerichtsmedizin die Leiche einer jungen Frau liegt, die wenige Stunden davor noch mitten im blühenden Leben stand.
Ich bin noch jung, geh Lieber …
Er ist nicht vorübergegangen, der Knochenmann. Er war kein Lieber. Er hatte seinen Job zu erledigen, musste sie mitnehmen, die junge Frau, weil irgendjemand zuvor ihr Leben ausgelöscht hat. Lucy Salmira, 20 Jahre alt. Ein wahrer Sonnenschein, wie einige Theaterkollegen bemerkt hatten, deren Vernehmungsaussagen er gelesen hat. Und er, Kommissar Martin Merana, Leiter der Fachabteilung Mord/Gewaltverbrechen, befindet sich auf dem Weg zurück, um herauszufinden, wer für den grauenvollen Mord an der jungen Puppenspielerin verantwortlich ist.
Jennifers Worte von gestern Abend kommen ihm in den Sinn. Sie saßen nach dem Konzert noch in der Harbour Bar, im zwölften Obergeschoss der Elbphilharmonie. Sie ließen die Eindrücke des Konzertes nachklingen, genossen gleichzeitig den fantastischen Ausblick auf den nächtlichen Hamburger Hafen, eine Komposition aus dunklem Wasser, mystischen Gebäudeschemen und magischen Lichtern.
Jenifer hat das Champagnerglas gehoben. In ihren Augen lag ein rätselhaftes Schimmern.
»Wenn dich heute nicht diese schreckliche Nachricht erreicht hätte, dann hätte ich dich sicher gefragt, ob du vielleicht die letzte Nacht nicht im Hotel, sondern doch mit mir verbringen willst. Aber jetzt ist es wohl besser so.«
Wir werden noch mehr Nächte haben, war er versucht zu sagen, viele Tage, viel Zeit. Aber er hat nichts gesagt. Er hat schon einmal mit einer Frau darüber geschwärmt, wie viel wunderbare Zeit noch vor ihnen liege. Viele Sommer, viele Winter. Und dann war die Katastrophe passiert, keine drei Tage später. Blut ist geflossen. Ein Leben wurde vernichtet. Und diese Katastrophe hat ihn aus der Bahn geworfen. In seinem Wüten aus uferlosem Schmerz wäre er fast zugrunde gegangen. Deshalb wollte er gestern nicht aussprechen, dass sie noch viel Zeit vor sich hätten. Er hatte es schmerzhaft anders erlebt. Die alten Wunden in ihm sind immer noch nicht ganz verheilt. Er hat sich nur über den Tisch gebeugt und sie geküsst. Innig, lang, wohltuend.
Er wollte damals nach der Katastrophe den Dienst quittieren. Er war drauf und dran, alles hinzuschmeißen. Aber ein Mordfall, in den er sich aus zutiefst persönlichen Gründen hineinziehen ließ, half ihm unversehens halbwegs in die Spur. Und er lernte im Lauf der Ermittlungen Jennifer kennen. Hätte er vor einem halben Jahr aufgegeben, wären sie einander nie begegnet.
»Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir befinden uns in einer Reisehöhe von rund 20.000 Fuß, das heißt 6.000 Meter über Boden. Die Ankunft wird planmäßig erfolgen. Derzeit haben wir Wolken über Salzburg. Es herrscht leichter Regen bei 19 Grad Celsius.« Die Stimme aus dem Lautsprecher wiederholt das Gesagte auf Englisch. Der Kapitän und die Besatzung wünschen eine gute Reise.
Leichter Regen. Der berühmte Salzburger Schnürlregen erwartet ihn.Was sonst! In Hamburg ist er bei Sonnenschein gestartet. Daheim empfängt man ihn mit trübem Wetter. Vielleicht kann er davor noch ein paar Minuten schlafen. Er schließt die Augen.
Sie landen kurz nach 11 Uhr. Carola trifft ihn am Ausgang.
»Wie war es in Hamburg?«
»Schön.«
»Wie geht es Jennifer?«
»Gut.«
Mehr ist ihm nicht zu entlocken. Die Chefinspektorin kennt ihren Chef. Er würde ihr später vielleicht mehr erzählen. Jetzt ist sein Fokus voll auf den Fall gerichtet. Sie öffnet die Wagentür. Er verstaut das Gepäck. Dann machen sie sich auf den Weg in die Innenstadt.
Sie parken das Auto im Innenhof des benachbarten Mozarteums. Die Straßen sind nass, doch der Regen hat inzwischen aufgehört.»Salzburger Marionettentheater«, ist in der Rundung des Torbogens am Eingang zu lesen. Wer die tatsächlichen Hauptrollen in diesem Haus spielt, erschließt sich schon an der großen, straßenseitig gelegenen Auslage. Puppen in allen Größen begrüßen den Besucher, von den Figuren der Trappfamilie aus »Sound of Music« bis zur sternflammenden Königin der Nacht aus der »Zauberflöte«.
Es passt zum spielerischen Flair der Umgebung, dass die gläsernen Flügeltüren am Eingang unvermittelt aufschwingen, als würden sie durch Geisterkraft geöffnet. Die Vorstellung, eine unsichtbare Hand sei hier auf magische Art am Werk, hat auch mehr Reiz als die simple Erklärung eines Bewegungsmelders.
Sie nehmen im Parterre nicht den Eingang zu Theaterfoyer und Zuschauerraum. Carola führt ihn die breite Treppe hinauf zur ersten Etage. Die Stiege ist breit, verläuft geschwungen. Die Steinfliesen sind abgewetzt. Noch ehe die Chefinspektorin die Hand zur Klingel führt, wird die hohe Eingangstür geöffnet. Eine Dame in Kostüm erwartet sie. Sie reicht Merana kaum bis zum Kinn. Das Gesicht ist schmal, umrahmt von gewelltem grauen Haar, das ihr auf die Schultern fällt. Ende 50, würde man vielleicht schätzen, aber Merana weiß, dass die Frau schon auf die 70 zugeht. Er kennt die Theaterleiterin von Berichten aus den Zeitungen, Charlotta von Sonnenthal, seit fast 30 Jahren im Haus, seit zehn Jahren Prinzipalin des Unternehmens.
»Grüß Gott, Frau Chefinspektorin, guten Tag, Herr Kommissar.« Sie reicht beiden die Hand. Der Druck ihrer Finger ist fest, stark, so wie der Blick, mit dem sie auf die Ankömmlinge schaut. Sie versucht, einen gefassten Eindruck zu vermitteln. Disziplin gehört wohl zu ihren Grundtugenden. Aber den erschöpften Eindruck, den die dunklen Ringe unter den Augen vermitteln, kann sie nicht vollständig kaschieren. Sie deutet mit eleganter Handbewegung hinter sich, bittet die beiden einzutreten. Sie stehen im Vorzimmer. Der Raum ist zugleich Sekretariat. Zwei vollgestellte Schreibtische mit großen Bildschirmen, Regale mit Ordnern, aufgestapelte Bücher, Theaterplakate und Bilder an den Wänden. Auch wenn man dem Raum auf den ersten Blick ansieht, dass er Büroarbeiten dient, erinnert er dennoch an ein Empfangszimmer in alten herrschaftlichen Häusern. So wie das anschließende Zimmer, dessen Tür weit offen steht. Alles ein wenig heruntergekommen, aber immer noch Eleganz versprühend, die behagliche Atmosphäre von unaufdringlicher Nostalgie.
»Die anderen sind schon unten, so wie Sie es wünschten, Frau Chefinspektorin. Ich darf vorausgehen.«
»Frau von Sonnenthal …«
Sie verlangsamt den Schritt, bleibt stehen, als hätte der Wind eine dahinschwebende Feder sanft gebremst. Das Lächeln, das sie ihm entgegenschickt, ist ein wenig schief. »Lassen Sie bitte das ›von‹ weg, Herr Kommissar. Adelsprädikate sind in Österreich seit dem Aufhebungsgesetz von 1919 ohnehin verboten. Das ›von‹ setzen nur gerne Journalisten mancher Zeitungen immer wieder vor meinen Nachnamen, weil sie offenbar der Ansicht sind, eine leicht abgehalfterte Adelige passe gut als Chefin für ein schon ein wenig aus der Mode gekommenes Haus mit jahrhundertealter Tradition. Sie können gerne Charlotta zu mir sagen, so wie alle hier.«
Er versucht, das Lächeln zu erwidern.
»Gerne … Frau Charlotta. Nur eine kurze Frage, bevor wir zu den anderen kommen. Ich habe dem Bericht meiner Kollegen entnommen, dass die Eingangstür zu diesem Trakt abgeschlossen war, als Frau …«, er warf einen schnellen Blick auf seine Unterlagen, »… Frau Lercher die Tote gestern fand. Wer außer den Ensemblemitgliedern hat einen Schlüssel zu den Räumlichkeiten des Theaters?«
»Nur unsere Putzfrau.« Sie zögert. Dann fasst sie sich mit der Hand an die Stirn. »Und dann gibt es noch einen Reserveschlüssel, der hängt beim Portier des Landestheaters. Das hat sich als praktisch erwiesen, falls jemand von uns den Schlüssel vergessen hat und sonst niemand im Haus ist.« Sie wirft der Chefinspektorin einen entschuldigenden Blick zu. »Sorry, Frau Doktor Salman. Das habe ich gestern völlig vergessen. Ich war leider zu durcheinander.«
Sie dreht sich wieder um, geleitet sie in den Korridor hinter dem Sekretariat.
Der Gang teilt sich. »Bühne. Zutritt für Unbefugte nicht gestattet«, steht auf einer weiß gestrichenen Tür. Sie führt zu einer steilen Treppe, die nach unten weist. Sie erreichen eine Plattform. Deren vorderer Teil wird von einem eindrucksvollen Regiepult beherrscht. Einer der großen Monitore zeigt eine Landschaft mit fantastisch wirkenden Bäumen, offenbar ein Teil des Bühnenbildes. Sie sind im Innenleben des Theaters. Eines richtigen Theaters, wie Merana mit einem schnellen Rundumblick feststellt. Nur viele Details sind wesentlich kleiner, als man es von ähnlichen Stätten gewohnt ist. Kleinere Traversen, kürzere Seilzüge, kleinere Bühnenbilder und Scheinwerfer. An den Wänden hängt Werkzeug. Gerätschaft, mit dem man an den Puppen hantieren kann. Zwei Brücken überspannen den Bühnenraum, dessen Spielfläche unter ihnen liegt.
»Da müssen wir hinunter.« Die Theaterleiterin geht voraus, steigt eine weitere, noch engere, Treppe hinab. Merana und Carola folgen ihr. Auf halber Höhe öffnet sich der Blick nach draußen in den Zuschauerraum. Dort bemerkt Merana einige Personen. Es sind die wartenden Mitglieder des Ensembles. Sie gesellen sich dazu. Die Theaterchefin stellt den Kommissar vor. Die Chefinspektorin ist den meisten von der ersten Befragung bekannt.
»Hat sich bei jemandem von Ihnen seit unserer gestrigen Vernehmung etwas ergeben, das uns weiterbringen könnte?« Carola Salman blickt in die Runde.
Allgemeines Kopfschütteln. Es herrscht Schweigen, das ein wenig betreten wirkt.
»Soweit ich dem Protokoll Ihrer Aussagen entnommen habe, war am Ostermontag vormittags Matinée«, mischt sich Merana ein. »Abends war vorstellungsfrei. Dennoch befand sich Lucy Salmira im Theater. Haben Sie eine Ahnung, warum?«
»Sie hat geübt.« Die Stimme der Prinzipalin ist leise. Merana schaut sie fragend an.
»Lucy ist erst …« Sie räuspert sich, versucht ihrer Stimme festen Klang zu verleihen.
»Pardon, ich muss mich erst an die schreckliche Gewissheit gewöhnen, dass sie nicht mehr bei uns ist. Lucy … war erst seit gut einem halben Jahr bei uns. Sie wollte von Anfang an größere Rollen spielen. Aber eine Puppe gut zu führen, das braucht Zeit, das braucht Geduld und viel Training. Sie war sehr ehrgeizig. Sie war oft an spielfreien Abenden hier und hat geübt, was ihr die Kollegen im Lauf der Wochen beigebracht haben.«
»Hat sie vorgestern bei der Matinée-Vorstellung mitgespielt?«
»Ja, sie konnte einige der einfacheren Puppen bedienen. Die Tiere, die zu Taminos Flötenspiel tanzen. Die Gruppe der Mohrensklaven in Sarastros Dienst. Sie hat auch beim Kulissenwechsel geholfen.«
Merana nickt. Er versucht, sich die junge Frau in diesem Ambiente vorzustellen. Er hat Lucys Bild in der vergangenen Nacht lange auf sich wirken lassen. Er vertiefte sich in die Aufnahmen vom Tatort und noch eindringlicher in die Privatbilder, die ihm Carola übermittelt hatte. Sie zeigen eine lachende, fröhliche junge Frau. Elfenhaft.
Ein schmales Gesicht, heller Teint, umrahmt von dunklen Locken.
»Ich möchte mir gerne die Stelle anschauen, wo man Lucy fand. Wenn möglich auch in der vorgefundenen Lichtstimmung.«
»Ich kümmere mich darum. Die Stimmung ist abgespeichert.« Ein breitschultriger Mann mit auffälliger Hornbrille löst sich aus der Gruppe. Ein leichter Akzent ist ihm anzuhören. Marek Slavik, 55, geboren in Brünn, wenn Merana sich aus den Eintragungen im Vernehmungsprotokoll richtig erinnert. Der Brillenträger drängt sich durch den Eingang, der den Zuschauerraum mit dem Bühnenbereich verbindet. Carola und Merana folgen, dahinter die Prinzipalin.
Es ist eng hinter der Bühne. Merana muss mehrmals den Kopf einziehen, um nicht gegen einen Träger zu krachen. Licht flammt auf, weißes Licht von schräg oben, blaues von der Seite. Links und rechts am Bühnenende hängen kleinere Gebilde im Halbdunkel. Schemenhafte Wesen. Unbeweglich. In der Mitte der Szenerie, vom Scheinwerferlicht besser erfasst, baumeln größere Gestalten an schimmernden Fäden. Sie werfen gespenstische Schatten auf die eigentümliche Kulissenumgebung. Merana fühlt sich wie in einer bizarren nächtlichen Märchenlandschaft und zugleich wie in einem unheimlichen Figurenkabinett. Es scheint ihm, als käme jeden Moment Leben in die seltsamen Wesen ringsum. Gleich würden sie die Arme heben, die Köpfe drehen und die aufgemalten großen Augen auf den Eindringling richten. Und vielleicht würden sie sich in Bewegung setzen, würden ihre Formation auflösen und den neu Angekommenen einkreisen. Wie ein Rudel hungriger Wölfe. Lauernd. Bereit zuzupacken. Aber nichts von dem geschieht. Die Puppen verharren reglos. Mit starren Gesichtern. Stumm. Ohne Leben. Merana tritt einen kleinen Schritt zurück, geht in die Hocke, hält sein Gesicht in Augenhöhe zu den reglosen Figuren. Zwischen diesen Gestalten hing vorgestern Nacht eine Gestalt, die nicht in diese Umgebung gehörte. Eine Leiche. Der tote Körper der 20-jährigen Lucy Salmira. Er stellt sich die schaurige Szenerie vor. Plötzlich zögert er. Etwas irritiert ihn. Er holt sein Handy aus der Tasche, öffnet die Datei mit den Tatortfotos. Er vergleicht sie mit dem Anblick, der sich ihm jetzt bietet.
»Die Figuren sind nicht dieselben.« Er dreht das Handy zur Theaterchefin.
»Eine Puppe fehlt.« Er vergrößert den Ausschnitt.
Charlotta Sonnenthal schaut auf das Display.
»Ja, das ist die Puppe, mit der Lucy geübt hat. Aber die gehört nicht zum Ensemble der Zauberflöte. Hier hängen nur Puppen, die wir heute Abend für die Vorstellung brauchen.« Sie wirft einen schnellen Blick zu Carola. »Die Frau Chefinspektorin meinte, das sei …«
»Ja, das geht in Ordnung«, kommt ihr Meranas Stellvertreterin zu Hilfe. »Thomas Brunner und seine Leute sind gestern spätnachts fertig geworden. Wir haben den Tatort heute früh freigegeben. Von unserer Seite spricht nichts dagegen, dass heute wie geplant die Vorstellung stattfindet. Außer du hast Einwände, Martin.«
Nein, hat er nicht. Wenn das Team in seiner Abwesenheit entschieden hat, die Spurenerhebung am Tatort sei abgeschlossen, dann passt das auch für ihn.
»Wo ist die Puppe jetzt? Kann ich sie sehen?«
»Natürlich. Sie hängt oben.«