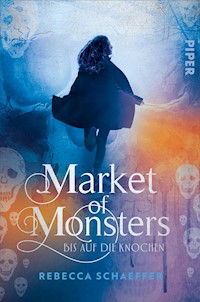
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Von der Jägerin zur Gejagten
Nita stammt aus einer Familie von Jägern. Sie handeln auf dem Schwarzmarkt mit Trophäen von Monstern aller Art. Ein lukratives Geschäft, denn viele glauben, sie könnten deren übernatürliche Fähigkeiten in Form von Pulvern, Blut oder anderen Körperteilen auf sich übertragen. Doch als Nitas Mutter ein »Monster« lebend mit nach Hause bringt, das wie ein ganz normaler junger Mann aussieht, verhilft Nita ihm zur Flucht. Ein folgenreicher Schritt: Wenig später wird sie entführt und landet als Sensation auf einem Schwarzmarkt, denn Nita selbst ist auch nicht ganz menschlich …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Market of Monsters 1« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Übersetzung aus dem kanadischen Englisch von Jürgen Langowski
© Rebecca Schaeffer 2018
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Not Even Bones«, Houghton Mifflin Harcourt, New York/Boston 2018
Published by Arrangement with Rebecca Schaeffer
c/o New Leaf Literary & Media, Inc., 110 West 40th Street, Suite 2201, New York, NY 10018 USA
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Silas Manhood / Trevillion Images und FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Danksagung
Triggerwarnung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für alle, die wissen, dass die Grenze zwischen Gut und Böse unschärfer ist, als die meisten Menschen zugeben wollen.
1
Nita starrte den Toten auf dem Küchentisch an. In mittleren Jahren, irgendwo zwischen pummelig und übergewichtig, lässiger Geschäftsanzug mit Nickelbrille, deren silberfarbene Bügel mit den grauen Schläfen verschmolzen. Äußerlich war er von anderen Menschen praktisch nicht zu unterscheiden – innerlich sah die Sache natürlich ganz anders aus.
»Schon wieder ein Zannie?« Nita warf ihrer Mutter einen finsteren Blick zu und verschränkte die Arme vor der Brust, während sie die Leiche noch einmal betrachtete. »Das ist nicht mal ein Lateinamerikaner. Ich dachte, wir sind nach Peru umgezogen, um in Süd- und Mittelamerika Unnatürliche zu jagen. Chupacabras, Pishtacos und so.«
Es war nicht so, dass Zannies besonders häufig vorkamen, aber Nita hatte im vergangenen Jahr, als sie noch in Südostasien gelebt hatten, im Laufe weniger Monate eine ganze Reihe von ihnen seziert und sich darauf gefreut, hier mal etwas Neues unter das Messer zu bekommen. Hätte sie Interesse daran gehabt, immer wieder die gleichen Unnatürlichen aufzuschneiden, dann hätte sie genauso gut darum bitten können, bei ihrem Dad in den Staaten bleiben und Einhörner verarbeiten zu dürfen.
Ihre Mutter zuckte mit den Achseln und hängte die Jacke über eine Stuhllehne.
»Ich habe einen Zannie gesehen, also habe ich ihn gleich getötet. Ich meine, er stand direkt vor mir. Wie hätte ich da widerstehen können?« Die schwarz-roten Strähnen wippten nach vorn, als sie mit einem leichten Lächeln den Kopf neigte.
Unschlüssig trampelte Nita von einem Fuß auf den anderen und betrachtete die Leiche noch einmal. Schließlich seufzte sie. »Dann soll ich ihn jetzt zerlegen und für den Verkauf abpacken?«
»Braves Mädchen.« Ihre Mutter grinste.
Nita ging um den Toten herum. »Könntest du mir helfen, ihn in den Sektionsraum zu bringen?«
Ihre Mutter krempelte die Ärmel hoch, dann schleppten sie den rundlichen, überraschend schweren Leichnam gemeinsam durch den Flur und legten ihn nebenan auf den glatten Metalltisch. Mit den weißen Wänden und den Leuchtstoffröhren ähnelte der Raum einem Operationssaal in einem Krankenhaus. Ordentlich aufgereiht warteten Skalpelle und Knochensägen in den Regalen, vor einer Kiste mit Glasgefäßen stand eine Waage, um die Organe zu wiegen. Eine Flasche mit Formaldehyd in einer Ecke verbreitete den Gestank des Todes. Der Geruch drang sogar aus dem Raum heraus und setzte sich in Nitas Kleidung fest. Sie fand es auf eigenartige Weise beruhigend. Wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen.
Wenn Nita ehrlich war, musste sie allerdings zugeben, dass die meisten ihrer Gewohnheiten und Entscheidungen schlechte Anzeichen waren.
Ihre Mutter zwinkerte ihr zu. »Alles bereit.«
»Es ist fast Mitternacht«, protestierte Nita nach einem Blick auf die Uhr.
»Und?«
»Irgendwann will ich auch mal schlafen.«
»Das kannst du später immer noch.« Ihre Mutter tat den Einwand händewedelnd ab. »Es ist ja nicht so, als hättest du einen Grund, früh aufzustehen.«
Nita zögerte, nickte und nahm es hin. Es war zwar schon Jahre her, seit ihre Mutter beschlossen hatte, gegen die Gesetze zu verstoßen und Nita von der Schule zu nehmen, doch noch immer meldete sich ein Instinkt in ihr, der sagte, sie dürfe nicht zu spät ins Bett gehen. Das war aber albern, denn selbst wenn sie noch zur Schule gegangen wäre, für eine Sektion hätte sie den Unterricht jederzeit sausen lassen. Das Sezieren machte nämlich Spaß.
Es tat gut, den weißen Laborkittel wieder anzuziehen. Damit fühlte sie sich wie eine echte Wissenschaftlerin an einer anerkannten Universität oder in einem Labor. Manchmal setzte sie der Vollständigkeit halber sogar die Schutzbrille auf, obwohl es gar nicht nötig war.
»Wann ziehst du wieder los?«
Ihre Mutter wusch sich die Hände im Waschbecken. »Noch heute Nacht. Als ich diesen Hübschen hier geholt habe, hab ich einen Tipp bekommen. Ich fliege nach Buenos Aires.«
»Pishtacos?«, fragte Nita mit verhaltener Hoffnung. Sie hatte noch nie die Gelegenheit bekommen, einen Pishtaco zu sezieren. Wie veränderten sich ihre Körper wohl, da sie sich doch ausschließlich von menschlichem Körperfett ernährten? Allein die Aussicht darauf, einen Pishtaco zu zerlegen, hatte Nita überzeugen können, nach Peru umzuziehen. Ihre Mutter wusste, womit man sie ködern konnte.
»Warte mal, in Argentinien gibt es doch gar keine Pishtacos«, wandte Nita mit gerunzelter Stirn ein.
Ihre Mutter lachte. »Keine Sorge, es ist sogar noch besser.«
»Nicht schon wieder ein Zannie.«
»Nein.«
Ihre Mutter trocknete sich die Hände ab und kehrte in die Küche zurück. Im Gehen rief sie: »Ich fahre gleich zum Flughafen. Wenn alles gut läuft, bin ich übermorgen wieder hier.«
Nita folgte ihr und fand ihre Mutter am Küchentisch, die Füße mitsamt Stiefeln auf den Tisch gelegt, wie sie eine Flasche Pisco aus dem Kühlschrank aufschraubte und einen Schluck nahm. Es war kein Cocktail und keine Mischung mit Mineralwasser, sondern der unverdünnte Schnaps. Nita hatte ihn einmal probiert, als sie allein zu Hause gewesen war, weil sie dachte, es sei die angemessene Weise, ihren siebzehnten Geburtstag zu feiern. Der Pisco brannte zwar nicht so stark in der Kehle wie Whisky, Wodka oder Sake, aber er wirkte schnell und wuchtig. Als ihre Mutter gekommen war, hatte Nita das Gesicht weinend gegen die Wand gepresst, weil es einfach nicht aufhören wollte. Ihre Mom hatte gelacht und sie leiden lassen. Später zeigte sie Nita die Fotos von der Wand, an der eine Menge Sabber klebte.
Seitdem hatte Nita die Hausbar nicht mehr angerührt.
»Oh, Nita, noch etwas.« Ihre Mutter stellte den Pisco auf den Tisch.
»Ja?«
»Rühr den Kopf nicht an. Auf den Kerl ist eine Fangprämie von einer Million Dollar ausgesetzt, die ich gern kassieren würde.«
»Ich bin ziemlich sicher, dass diese ›Tot oder lebendig‹-Geschichte seit dem Untergang des Wilden Westens nicht mehr gilt.« Nita blickte den Flur hinunter zu dem Raum mit dem Toten. »Wenn du nur den Kopf des Kerls anbietest, wirst du wegen Mordes angeklagt.«
»Vielen Dank, dass du mich auf diesen wichtigen Umstand aufmerksam machst.« Ihre Mutter verdrehte die Augen. »Was täte ich nur ohne dich?«
Nita zuckte zusammen. »Ähm …«
»Der Zannie wird von der peruanischen Polizei wegen Kriegsverbrechen gesucht. Er hat unter der Regierung Fujimori der Geheimpolizei angehört.«
Das war nicht weiter überraschend. Praktisch alle Zannies auf der Welt wurden wegen irgendeiner Art von Kriegsverbrechen gesucht. Wenn einem die eigene Biologie schon sagte, man müsse Menschen foltern und ihre Schmerzen essen, war die Berufswahl ziemlich eingeschränkt.
Da fiel Nita etwas ein – in der letzten Ausgabe von Nature hatte ein Aufsatz über Zannies gestanden, den sie unbedingt hatte lesen wollen. Irgendjemand, der eindeutig weniger Zannies seziert hatte als Nita, aber über eine bessere Ausrüstung verfügte, hatte eine detaillierte Analyse zu der Frage veröffentlicht, auf welche Weise Zannies die Schmerzen konsumierten. Es gab alle möglichen Theorien darüber, dass Schmerz relativ sei, weil die gleiche Verletzung von zwei verschiedenen Menschen oft ganz unterschiedlich wahrgenommen werde. Die Wissenschaftler hatten die Zannies untersucht – war die Schwere der Verletzung entscheidend, oder ging es ihnen vor allem um das individuelle Schmerzempfinden der betreffenden Menschen?
Sie hatten nachweisen können, dass die Zannies neben physischem auch emotionalen Schmerz konsumieren konnten, doch da war die Wirkung bedeutend schwächer. Im Gehirn überlagerten sich die Rezeptoren für emotionalen und physischen Schmerz, daher ergab sich die große Frage, warum sich die Zannies davon ernährten, anderen Menschen große körperliche Schmerzen zuzufügen, während sie von starkem seelischem Leiden weitaus weniger profitierten. Insgeheim dachte Nita, es liege daran, dass bei körperlichem Schmerz außerdem noch die Signale der Nozizeptoren hinzukamen, doch sie war neugierig, was andere dazu dachten.
Ihre Mutter hatte nicht bemerkt, wie Nitas Gedanken abschweiften, und sprach weiter. »Eine ganze Reihe interessierter Parteien haben beträchtliche Kopfgelder auf ihn ausgesetzt. Im Gegensatz zur Regierung legen sie keinen Wert darauf, dass er lebt und vor Gericht gestellt wird.« Ihre Zähne blitzten kurz auf. »Den Wunsch erfülle ich ihnen gern.«
Damit stand sie auf, stellte den Pisco weg und zog die weinrote Lederjacke an. »Schaffst du es, ihn zu verpacken, bis ich wieder da bin?«
»Ja, ich glaube schon«, antwortete Nita.
Ihre Mutter küsste sie auf die Stirn. »Was täte ich nur ohne dich, Anita?«
Ehe sich die Tochter eine Antwort zurechtlegen konnte, war die Mutter schon zur Tür hinaus. Ein Knarren und ein Knall, und dann wurde es still in der Wohnung. Wenn ihre Mutter wegfuhr, hatte Nita manchmal das Gefühl, sie nehme mehr mit als nur die Geräusche. Sie hatte eine Ausstrahlung, eine beinah greifbare Energie, die das ganze Apartment ausfüllen konnte. Ohne sie war es dann leer. Als wäre alles Leben aus dem Haus gewichen und hätte nur einen toten Zannie zurückgelassen.
Was ja auch den Tatsachen entsprach. Nita wandte sich ihrem neuen Projekt zu und gestattete sich ein kleines Lächeln. Ein Pishtaco oder ein Chupacabra wäre besser gewesen, aber sie freute sich trotzdem auf diesen Zannie.
Als Erstes leerte sie seine Taschen. Eine altmodische Uhr, ein paar brasilianische Reais (aber keine peruanischen Soles, was seltsam war) und eine Brieftasche. Nita betrachtete sie eine Weile und legte sie schließlich ungeöffnet auf das Tablett. Die Kreditkarten hatte ihre Mutter sowieso schon herausgenommen und so viel Geld wie möglich abgehoben, um sie anschließend wegzuwerfen. Darüber hinaus befanden sich in einer Brieftasche meistens auch Ausweise und Clubmitgliedskarten – lauter Dinge, die ihr etwas über die Person verrieten, die sie sezierte.
Eines hatte Nita schon vor langer Zeit gelernt: Sie wollte gar nichts über denjenigen wissen, dessen Körper sie zerlegte.
Es war besser, sich vorzustellen, es sei gar kein Mensch. Eigentlich traf das sogar zu. Das hier war ein Zannie.
Mit einem Gummiband raffte Nita ihre Haare zu einem aufgeplusterten Pferdeschwanz zusammen. Leider wuchsen sie wuschelig und kringelig und standen seitlich ab, statt ordentlich zu fallen. Im Schein der Leuchtstoffröhren waren sie nicht mehr mittelbraun, sondern beinahe orangefarben. Niemand sonst hätte sie für orangefarben gehalten, aber Nita bestand darauf. Sie mochte diese Farbe.
Sie setzte erst eine medizinische Maske auf und rückte sie bis knapp unter die mit Sommersprossen bedeckten Wangenknochen und danach die Schutzbrille. Zuletzt streifte sie sich Gummihandschuhe über und rollte das Wägelchen mit dem Werkzeug zu dem Metalltisch, auf dem die Leiche lag. Sie steckte sich die Hörer in die Ohren und startete die Disney-Playlist.
Zeit, mit der Arbeit zu beginnen.
Nita konnte sich kaum daran erinnern, irgendwann mal nicht von Toten fasziniert gewesen zu sein – vielleicht lag es daran, dass es in ihrem Zuhause so viele davon gegeben hatte. Soweit sie wusste, hatten ihre Eltern schon immer die Leichen von Unnatürlichen erworben und die Teile über das Internet verkauft. Genauer gesagt, im Darknet. Schwarzmarkt-Organhändler warben nicht auf eBay für ihre Ware. Das hätte nur dazu geführt, dass man einen kurzen Besuch von der INHUP bekam, von der International Non-Human Police, und anschließend lange Zeit im Gefängnis saß.
Früher war Nita immer im Sezierraum herumgelaufen und hatte ihren Eltern die leeren Gefäße gebracht. Ein großes Becherglas für das Herz, kleine Ampullen und Beutel für das Blut. Später hatte sie alles beschriftet und ins Regal gestellt. Manchmal hatte sie die Behälter angestarrt, die Teile von Leuten, die sie nie kennengelernt hatte. Die reglos in Formaldehyd schwimmenden Herzen hatten etwas Beruhigendes. So friedlich. Sie schlugen nicht mehr, kein rhythmisches Pochen, kein Lärm. Nur Stille.
Manchmal betrachtete sie auch die Augen, die zu ihr zurückstarrten. Direkt und offen. Nicht wie bei lebenden Menschen, deren Blicke unstet flackerten, wenn sie logen, und die eine ganze Unterhaltung in einen einzigen Augenaufschlag packen konnten. Das Problem war leider, dass Nita nicht verstand, was sie sagten. Da war es schon besser, wenn die Leute tot waren. Dann waren die Augen nicht mehr so hintergründig.
Es dauerte die ganze Nacht und den größten Teil des folgenden Tages, bis Nita den Zannie verarbeitet, die Organe in Behälter mit Formaldehyd oder Gefrierboxen gepackt und den Sektionsraum gesäubert hatte, damit alles wieder wie neu glänzte.
Die Sonne schien, und sie war überhaupt nicht müde. Deshalb ging sie in ihren Lieblingspark über den Klippen, von denen aus sie das Meer sehen konnte. Tropenbäume mit großen glockenförmigen Blüten neigten sich wie Baldachine über die Bänke. Die Mauer, die die Besucher daran hindern sollte, über die Klippe in das weit unten funkelnde Wasser zu stürzen, war mit blau-weißen Mosaiken verziert. Auf einigen Bänken lagen vergessene Zeitungen. Boulevardblätter berichteten: Penelope Alvarez sieht mit fünfundvierzig wie fünfundzwanzig aus. Gute Hautpflege oder etwas »Unnatürliches«? Seriöse Zeitungen fragten: Soll Peru der INHUP beitreten? Die Vor- und Nachteile einer extraterritorialen Polizei für Vorfälle, die mit Unnatürlichen zusammenhängen.
Peru hatte sich als eines von sehr wenigen südamerikanischen Ländern noch nicht der INHUP angeschlossen. Auf jedem Kontinent gab es einige Staaten, die draußen blieben, damit die Schwarzmarkthändler einen Rückzugsort behielten, an den sie fliehen konnten, wenn die INHUP ihnen auf den Fersen war. Gewisse Personen bezahlten die Politiker gut dafür, dass es auch so blieb.
Weit entfernt von den anderen Parkbesuchern suchte sich Nita einen Sitzplatz. Im Schatten einer Engelstrompete schlug sie die medizinischen Fachzeitschriften mit den Berichten über die Unnatürlichen auf.
Manchmal war es frustrierend, die Artikel über dieses Thema zu lesen und dabei genau zu wissen, dass sie in gewissen Punkten falschlagen. Viele Unnatürliche hatten sich »geoutet« und wurden von der Welt anerkannt, doch die meisten versteckten sich, weil sie Angst vor der öffentlichen Meinung hatten. Wenn die Zeitschriften erklärten, die Zannies seien die einzigen Unnatürlichen, die immaterielle Dinge wie Schmerzen aßen, wünschte sich Nita, sie könnte den Autoren vor Augen führen, dass es Wesen gab, die Erinnerungen, starke Emotionen und sogar Träume konsumierten. Die INHUP hatte diese Lebensformen nur noch nicht offiziell anerkannt. Die Behörde war sehr geübt darin, Schadensbegrenzung zu betreiben, und ein Teil ihres Bemühens, dem Rassismus und der Diskriminierung von Unnatürlichen entgegenzuwirken, bestand darin, den Menschen zu verschweigen, wie viele verschiedene Typen es gab.
Außerdem hinderte das solche Leute wie Nitas Mutter daran, allzu viele Informationen über die Unnatürlichen zu gewinnen. Manchmal jedenfalls.
Nita vertrödelte den Nachmittag im Schatten des Baums und verschlang die medizinischen Forschungsberichte wie Süßigkeiten, bis die Sonne so niedrig stand, dass sie kaum noch lesen konnte.
Als sie nach Hause zurückkehrte, wurde sie mit einem Schwall von Kraftausdrücken empfangen.
Mit eingezogenem Kopf schlich sie in den Flur. Ihre Mutter war unberechenbar, wenn sie sich über irgendetwas aufregte. Nita war schon mehr als einmal zum Ziel des mütterlichen Unmuts geworden und hatte keine Lust, diese Erfahrung zu wiederholen.
Ihre Mutter zu ignorieren, war allerdings noch gefährlicher. Deshalb tappte Nita in die Küche.
»Was machst du da?« Fassungslos betrachtete sie das Chaos.
Ihre Mutter schob sich eine Haarsträhne hinter das Ohr und schenkte Nita ein schiefes Lächeln. Rings um sie waren leere Kartons und Verpackungsmaterial wie Blasenfolie und Styroporstreifen auf dem Boden verstreut. Auf dem Küchentisch lag eine Pistole. Nita fragte sich, was das zu bedeuten hatte.
»Ich möchte die Zannieteile spätestens morgen verschicken. Wir haben etwas Neues, und ehrlich gesagt, die Wohnung ist nicht groß genug, um so viele Teilstücke zu lagern.« Ihre Mutter lächelte kurz.
Das konnte Nita nur bestätigen. Der Sektionsraum war bereits voll, obwohl sie nur einen einzigen Zannie zerlegt hatten. Für eine zweite Leiche war kein Platz mehr.
»Etwas Neues, ja? Das heißt wohl, es ist gut gelaufen, oder?«
Nitas Mutter lachte. »Kann es mit Unnatürlichen, die nicht auf der Liste stehen, überhaupt gut laufen?«
Eine bestimmte Untergruppe derjenigen, die allgemein bekannt waren, stand auf der Liste der »gefährlichen Unnatürlichen«, die nur überleben konnten, indem sie andere Leute ermordeten. In den INHUP-Mitgliedsländern war es kein Verbrechen, sie zu töten, sondern galt als »vorwegnehmende Selbstverteidigung«. Doch bei allen, die nicht auf dieser Liste standen, also bei den harmlosen Unnatürlichen (Nitas Erfahrung nach war das die weitaus größte Gruppe), bedeutete es ein Schwerverbrechen, sie umzubringen.
Ihre Mom erbeutete meistens Unnatürliche, die auf der Liste standen. Meistens.
Nita wusste, dass ihre Mutter wahrscheinlich auch viele Leute getötet und verkauft hatte, die nicht böse oder gefährlich gewesen waren. Darüber dachte sie lieber nicht allzu gründlich nach, weil, na ja, sie ohnehin nichts daran ändern konnte.
Außerdem waren sie längst tot, wenn sie bei Nita ankamen. Und da sie sowieso schon tot waren, wäre es eine Schande gewesen, die Leichen nicht zu sezieren.
Ach ja, richtig …
»Was hast du denn nun mitgebracht?« Nita bahnte sich einen Weg durch die Kartons zum Kühlschrank, nahm die Reste vom vergangenen Abend heraus und schob sie in die Mikrowelle.
»Etwas ganz Besonderes. Ist schon im Sektionsraum.«
Nitas Finger zuckten, das eingebildete Skalpell in ihrer Hand machte eine Bewegung wie bei einem Y-Schnitt. Sie freute sich auf den gemächlichen, entspannenden Abend, nur sie und die Leiche. Die präzisen Schnitte bei der Autopsie, die Behälter voller Organe im Rücken, die wie ganz persönliche, eigenartige Schutzengel über sie wachten.
Voller Vorfreude schauderte sie. Manchmal fürchtete sie sich vor sich selbst.
Die Mutter beobachtete Nita aus dem Augenwinkel. »Ich muss schon sagen, der hier war tatsächlich ein Problem.«
Mit dem Essen aus der Mikrowelle setzte sich Nita an den Küchentisch. »Oh, wirklich?«
Ihre Mutter lächelte, und Nita machte sich auf eine spannende Geschichte gefasst. »Am Anfang war es gar nicht so schwer. Buenos Aires war wunderschön, und dem Tipp nachzugehen, war auch kein Problem. Sogar die Beschaffung unseres neuen … ich weiß noch nicht mal, wie ich ihn nennen soll.«
Nita zog die Augenbrauen hoch. Ihre Mutter kannte jeden Unnatürlichen, das war ihr Job. Dieser hier musste also ein wirklich seltenes Exemplar sein.
»Egal.« Ihre Mutter setzte sich neben sie. »Es war nicht weiter schwierig, ihn zu bekommen. Die Sicherheitskräfte waren kein Hindernis, das war schnell erledigt. Das Problem bestand eher darin, ihn hierher zu schaffen.«
Kein Wunder, die Fluggesellschaften mochten es nicht, wenn man einen Toten ins Gepäckfach stopfte.
Ihre Mutter zwinkerte verschwörerisch. »Aber dann dachte ich, na ja, ich kann doch einfach so tun, als sei er ein normaler Passagier. Ich habe ihn in einen Rollstuhl gesetzt, und die Fluggesellschaft hat überhaupt nichts gemerkt.«
»Wie … in einen Rollstuhl?« Nita runzelte die Stirn. »Warum ist denen nicht aufgefallen, dass er sich nicht bewegt oder geatmet hat oder so, als sie ihm auf seinen Platz geholfen haben?«
Sie lachte. »Oh, er ist ja gar nicht tot. Ich habe ihn nur ordentlich betäubt.«
Wieder zuckten Nitas Finger, doch dann hielt sie inne. Nicht tot.
Unsicher lächelte sie ihre Mutter an. »Und du hast ihn in mein Zimmer gesperrt?«
»Ja, ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, den Käfig einzubauen. Das war eine komplizierte Sache. Wusstest du, dass gar keine Käfige in Menschengröße mehr hergestellt werden? Und die Handschellen musste ich in einem Sexshop kaufen.«
Nita saß eine ganze Weile schweigend da, ihr Lächeln war wie eingefroren. Dann stand sie auf und schob sich durch die Kisten zum Sektionsraum.
Ihre Mutter folgte ihr. »Der hier ist ein bisschen ungewöhnlich. Er ist sehr wertvoll, deshalb möchte ich ihm kein Blut abzapfen und so, bevor wir die Organe entfernt haben.«
Nita hörte nicht zu. Sie hatte schon die Tür geöffnet und betrachtete ihn.
Ein Teil ihres schönen, sterilen weißen Zimmers wurde jetzt von einem großen Käfig beansprucht, der in der Wand verschraubt war. Die Tür hatte ihre Mutter mit Kette und Vorhängeschloss gesichert. Drinnen lag ein Junge mit dunkelbraunen Haaren bewusstlos und zusammengekrümmt auf dem Boden. Angesichts der geringen Größe des Käfigs war das vermutlich auch die einzige Möglichkeit, wie er liegen konnte.
»Was ist das?« Nita wartete darauf, dass ihre Mutter die schrecklichen Dinge aufzählte, die er getan hatte, um zu überleben. Vielleicht fraß er Neugeborene und war fünfhundert Jahre alt und nicht achtzehn oder neunzehn, wie sein Aussehen nahelegte.
Ihre Mutter zuckte mit den Achseln. »Ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt.«
»Aber was für eine Art Unnatürlicher ist er denn?« Unwillkürlich hob Nita die Stimme, beherrschte sich aber sofort wieder. »Ich meine, du weißt doch sicher, was er tut, oder?«
Ihre Mutter lachte. »Eigentlich tut er gar nicht viel. Er ist ein Unnatürlicher, so viel ist sicher, aber ich glaube kaum, dass man äußerliche Hinweise auf ihm entdecken kann. Ein Sammler in Buenos Aires hat ihn gehalten.«
»Warum … warum wollen wir ihn dann haben?«, bohrte Nita. Sie war selbst überrascht, wie dringend sie die Antwort hören und einen Grund finden wollte, der den Käfig in ihrem Zimmer und den schmächtigen, zusammengekauerten Körper des Jungen rechtfertigen konnte. Seine Jeans und das T-Shirt waren mit irgendetwas bekleckert. Nita fragte sich, ob es Blut war.
»Ah, na ja, angeblich schmeckt er köstlich. Er hat wohl irgendwas an sich. Der Sammler hat Ampullen mit seinem Blut – aber bloß winzige Ampullen und keine Beutel – für zehntausend pro Stück verkauft. US-Dollar, keine Soles oder Pesos. Letztes Jahr wurde eine seiner Zehen versteigert und erzielte eine sechsstellige Summe. Nur für eine einzelne Zehe.«
Ihre Mutter grinste breit und zeigte ihr die Zähne, ihre Augen strahlten bei der Aussicht, wie viel Geld sie mit dem ganzen Körper verdienen konnten. Nita fragte sich, wie hoch die Lebenserwartung des Burschen sein mochte. Ihre Mutter hatte lieber Geld in der Hand als Gewinn in der Zukunft, deshalb nahm Nita an, dass der Junge nicht mehr lange lebendig in Gefangenschaft bliebe.
»Ich habe ihn online gestellt, und wir haben sofort einen Käufer für eine weitere Zehe gefunden. Deshalb habe ich mir die Freiheit genommen, sie abzuschneiden und zu versenden, solange wir noch in Argentinien waren.«
Es dauerte einen Augenblick, bis Nita begriff, was ihre Mutter gerade gesagt hatte. Dann senkte sie den Blick, und richtig, die Füße des Burschen waren nackt und blutig. Ein Fuß war notdürftig mit Verbänden umwickelt, die sich rot färbten, weil das Blut durchsickerte.
Ihre Mutter tippte sich mit dem Finger ans Kinn. »Das einzige Problem ist, dass seine Teile frisch sein müssen – na ja, so frisch, wie es eben möglich ist. Wir verkaufen zuerst die Extremitäten, je nachdem, wie die Bestellungen eingehen. Er müsste auch ohne sie überleben können. Das Blut zapfen wir ab, wenn wir sie entnehmen, das können wir dann getrennt verkaufen. Die inneren Organe und so, das bieten wir alles später an, sobald es sich herumgesprochen hat. Das dürfte aber nicht lange dauern.«
»Willst du ihn wirklich hier behalten und Stücke aus ihm herausschneiden, während er noch lebt?« Nitas Gedanken rasten, sie konnte nicht ganz fassen, was ihre Mutter da sagte.
»Genau.«
Nita wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Mit lebenden Menschen hatte sie noch nie zu tun gehabt. Sonst kümmerte sie sich um die Toten.
»Ist er auch nicht … gefährlich?«, fragte sie – und konnte sich nicht von den Verbänden um die fehlenden Zehen losreißen.
»Sicher nicht.« Ihre Mutter schnaubte. »Er hatte einfach nur Pech bei der Genlotterie. Soweit ich sagen kann, wollen ihn alle nur essen, aber er kann sich nicht besser verteidigen als ein normaler Mensch.«
Der Junge im Käfig regte sich und wollte sich umdrehen und sie ansehen. Es zog Nita das Herz zusammen. Es war ein so jämmerliches Bild.
Ihre Mutter klopfte ihr auf die Schulter, bevor sie sich abwandte. »Wir werden einen Haufen Geld mit ihm verdienen.«
Nita nickte und ließ den Käfig keine Sekunde aus den Augen. Vom Flur aus rief ihre Mutter, sie solle dabei helfen, die Kartons in der Küche zu sortieren und die Zannieteile zu verpacken.
Da hob der Junge den Kopf und suchte Nitas Blick. Seine graublauen Augen waren vor Angst geweitet. Er hob eine Hand, hielt aber inne, weil ihn die Handschellen behinderten.
Er schluckte schwer und sah Nita unverwandt an.
»Ayúdame«, flüsterte er.
Hilf mir.
2
Nita war keine herzlose, mörderische Organdiebin.
Das war ihre Mutter.
Nita hatte noch nie jemanden getötet. So sollte es auch bleiben.
Warum hat Mom ihn nicht umgebracht, ehe sie zurückgekehrt ist? Hätte sie ihn vorher getötet, dann hätte Nita ihn nicht so sehen müssen. Sie hätte sich einfach einreden können, er sei eines natürlichen Todes gestorben. Oder sie hätte ihrer Mutter die Schuld geben und es wie üblich abtun können: Tja, jetzt ist es zu spät, um noch etwas zu ändern. Doch er lebte, er war in ihrer Wohnung, und damit musste sie sich auseinandersetzen.
Mit der lebenden, atmenden Person, die ihre Mutter töten wollte.
Und Nita sollte den Jungen zerlegen. Bei lebendigem Leibe.
Wie wäre es wohl, jemanden aufzuschneiden, der kreischend verlangte, man solle damit aufhören?
»Nita?« Mom kam aus der Küche und spähte um die Ecke. Nita wurde bewusst, dass sie mehrere Minuten lang im Flur gestanden und ins Leere gestarrt hatte. »Stimmt was nicht?«
»Er lebt noch«, wandte Nita ein.
»Ja. Na und?« Moms Stimme klang ein wenig gereizt, und ihr Blick wurde hart. Nita bekam den Eindruck, auf dünnem Eis zu wandeln.
»Er spricht.« Sie ließ die Schultern kreisen, das Unbehagen rührte eher von dem Blick ihrer Mutter als von irgendetwas anderem her.
Die Miene ihrer Mutter entspannte sich wieder. »Oh, mach dir deshalb keine Sorgen, meine Liebe. Er wird nicht lange da sein. Bald liegt er auf deinem Tisch, und wer einmal dort ist, redet nicht mehr mit dir, oder?«
Auch wenn ihr beinahe übel wurde, nickte Nita und freute sich über das Bemühen ihrer Mutter, ihr die Unsicherheit zu nehmen. »Ja.«
Ihre Mutter sah sie wohlwollend an. »Weißt du, wenn du willst, kann ich ihm auch gleich die Zunge herausschneiden. Ich habe Zangen dafür – ich kann sie herausreißen. Dann musst du dir keine Sorgen mehr machen, dass er wieder reden könnte.«
»Schon gut, Mom.« Nita rang sich ein Lächeln ab. »Ist schon gut.«
»Wenn du meinst …« Ihre Mutter betrachtete sie forschend und seufzte schließlich. »Also gut. Wollen wir dann ein paar Zannieteile einpacken?«
Nita nickte, dankbar für den Themenwechsel.
Den Rest des Nachmittags über füllten sie die Kartons. Ihre Mutter hatte Bestechungsgelder gezahlt, damit sie unbeanstandet ins Lagerhaus der Familie in den Staaten gelangten. Dort kümmerte sich dann ihr Vater um alles Weitere. Er organisierte den Online-Verkauf, die Lagerung und den Versand, während ihre Mutter für die Beschaffung zuständig war. Ihr Vater war auch ihre wichtigste Tarnung, sollte die INHUP jemals herumschnüffeln. Nita war sicher, dass es über ihre Mutter kilometerlange Akten gab – sie besaß einen fünfzig Zentimeter hohen Stapel mit ausländischen Pässen, Führerscheinen und Kreditkarten. Nitas Ansicht nach war so etwas zwangsläufig mit einer dicken Strafakte verbunden.
Soweit sie das wusste, hatte ihr Vater dagegen eine makellos reine Weste. Tagsüber arbeitete er als Rechtsberater in Chicago, abends verkaufte er Körperteile im Internet. Nita vermisste ihn und ihr Zuhause in dem erbärmlichen Chicagoer Vorort, der genau genommen zwei Autostunden von Chicago entfernt war. Sie war nicht mehr zu Hause gewesen, seit sie vierzehn geworden war.
Sie fragte sich, was ihr Vater zu dieser Situation sagen würde. Hätte er Einwände dagegen, dass ihre Mutter einen lebenden Unnatürlichen mit nach Hause gebracht hatte? Und sogar einen harmlosen?
Es war eine Sache, wenn ihre Mutter einen Zannie oder ein Einhorn auf Nitas Tisch legte. Die waren Monster, die nur leben konnten, indem sie andere Leute umbrachten. Und die Welt stimmte darin überein – deshalb gab es ja diese Liste mit den gefährlichen Unnatürlichen. Es galt nicht einmal als Verbrechen, sie zu töten. Damit rettete man sogar Leben.
Aber jemand wie dieser Junge in dem anderen Zimmer? Wie konnte man so etwas rechtfertigen?
Seufzend wischte sich Nita den Schweiß von der Stirn, als sie die nächste Kiste zuklebten. Ganz egal, wie lange sie darüber nachdachte, sie fand keine Rechtfertigung dafür, den Jungen zu ermorden.
Na ja, abgesehen vom Geld.
»Ich glaube, wir brauchen noch mehr Versandkartons.« Ihre Mutter fuhr sich mit gespreizten Fingern durch die Haare. Auf den manikürten Nägeln spiegelte sich das Licht. Schwarz und Rot und Gelb, als hätte jemand versucht, ein Feuer mit einer Decke zu ersticken.
Nita schenkte sich ein Glas Saft ein. »Sieht wohl so aus.«
»Ich glaube, wir haben uns eine Pizza verdient. Willst du auch?«
Und ob sie das wollte.
Nach dem Essen bemerkten sie, dass sie kaum noch Wasser in Flaschen hatten. Das Leitungswasser war ungenießbar, wenn man es nicht abkochte, und Nitas Mutter mochte den Geschmack ohnehin nicht. Seit ihrer Ankunft vor einigen Wochen hatte sie immer wieder versprochen, sie werde einen UV-Strahler besorgen, um das Wasser selbst zu reinigen, doch bisher hatte sie noch nichts unternommen.
Ihre Mutter stand seufzend auf und wischte sich die Pizzakrümel vom Schoß. »Ich gehe runter in den Laden und hole eine Fünfliterflasche. Wenn ich zurück bin, fang ich mit dem Jungen an.«
»Womit denn genau?«
»Ich habe vor einer Stunde sein Ohr verkauft«, erklärte ihre Mutter grinsend.
Nita fuhr auf. »Willst du es heute Abend abschneiden?«
»Na klar.«
»Aber du kannst es erst morgen verschicken.« Sie mied den Blick ihrer Mutter. »Dann wäre es praktischer, es erst morgen früh abzuschneiden. Wenn doch die Frische so wichtig ist, wie du sagst.«
Ihre Mutter kniff die Augen zusammen. Nita wollte den Drang unterdrücken, nervös herumzuzappeln. Es gelang ihr aber nicht.
Schließlich flüsterte sie kleinlaut: »Ich möchte nicht, dass er die ganze Nacht kreischt. Ich kann dann nicht schlafen.«
Lachend warf ihre Mutter den Kopf zurück, dann kam sie zu ihr und klopfte Nita auf den Rücken, ein wenig fester als nötig. Nita stolperte einen Schritt vorwärts.
»Anita, du hast völlig recht.« Ihre Mutter ging grinsend zur Tür. »Wir machen das morgen früh.«
Zitternd stand sie da, nachdem die Tür mit einem Knall und einem Klicken ins Schloss gefallen war. So verharrte sie einige Minuten, bis sich ihr Atem beruhigt hatte, dann nahm sie ein Stück Pizza und ging in den Sektionsraum.
Als sie die Tür öffnete, hockte der Junge im Schneidersitz im Käfig und beobachtete sie. Vorsichtig näherte sie sich ihm. Aus der Nähe konnte sie erkennen, dass die Flecken auf seiner Kleidung tatsächlich Blut waren.
Sie legte die Pizza so nahe vor die Gitterstäbe, dass er die Finger hindurchschieben und ein paar Stückchen abreißen konnte. Eilig wich sie zurück, weil sie fürchtete, er werde sie anfallen, wenn sie ihm zu nahe kam. Nicht, dass er viel ausrichten konnte, weil er im Käfig angekettet und der Käfig an der Wand verankert war. Trotzdem blieb sie vorsichtig.
»Gracias.« Er betrachtete die Pizza und leckte sich über die Lippen.
»De nada.« Nita staunte, wie belegt ihre Stimme klang.
Unsicher blieb sie noch eine Weile stehen und wusste nicht recht, was sie als Nächstes tun sollte. Logisch betrachtet, war es keine gute Idee, mit ihm zu sprechen. Sie wollte nichts über ihn wissen, falls – wenn – sie ihn sezierte. Andererseits wäre es seltsam gewesen, ihm Essen zu geben und danach einfach wegzugehen.
Nun zeigte sich, dass es ihr tatsächlich an so etwas wie Sozialkompetenz mangelte. Gab es überhaupt eine Etikette für so eine Situation?
Wahrscheinlich nicht.
Er schob die Finger durch die Gitterstäbe und riss die Spitze des Pizzastücks ab. Wegen der Handschellen konnte er den Mund mit den Händen nicht erreichen, deshalb musste er sich weit vorbeugen, um zu essen. Er kaute langsam, aber nach dem ersten Bissen saß er nur da und starrte die Pizza an. Sie fragte sich, ob er die Salami nicht mochte.
»Cómo te llamas?«, fragte er, ohne den Blick zu heben. Sein Akzent klang eindeutig argentinisch, das gesprochene y verschwamm ein wenig zu einem sh, sodass es klang wie: »Cómo te shamas?«
Sein Akzent war jedoch nicht schwer zu verstehen, ganz im Gegensatz zu Nita selbst. Ihr Vater stammte aus Chile, und sie hatten bis zu ihrem sechsten Lebensjahr in Madrid gelebt. Deshalb war ihr Spanisch eine hoffnungslose Mischung aus beiden Akzenten. Manchmal konnten die Peruaner im Lebensmittelladen sie überhaupt nicht verstehen.
»Nita.« Sie zögerte. »Y tu?«
»Fabricio.« Er sprach sehr leise. »Ich heiße Fabricio Tácunan.«
»Fabricio?« Nita konnte sich nicht zurückhalten zu sagen, wie eigenartig sie das fand. »So wie bei Shakespeare oder so?«
Jetzt hob er den Kopf und runzelte die Stirn. »Verzeihung?«
Nita wiederholte es langsam und gab sich Mühe, akzentfrei zu sprechen.
Dieses Mal verstand er es. Er zog die Augenbrauen hoch, und seine Stimme klang ein wenig anders. Neugieriger, nicht mehr so traurig. Er sprach so leise, sie musste sich bemühen, überhaupt etwas zu hören. »Wer ist Shakespeare?«
»Äh …« Nita überlegte. Kam Shakespeare in lateinamerikanischen Lehrplänen etwa gar nicht vor? Wenn der Junge – denk bloß nicht an seinen Namen, sonst entsteht eine Bindung, und was dann? – wirklich der Gefangene eines Sammlers gewesen war, dann hatte er möglicherweise nie eine Schule besucht. »Ein englischer Schriftsteller im sechzehnten Jahrhundert. Ich glaube, eine seiner Figuren hieß Fabrizio. Es ist … ich dachte wohl bloß, es sei ein sehr alter Name.«
Er zuckte mit den Achseln. »Das weiß ich nicht. Wo ich herkomme, ist er recht häufig. Ein Angestellter meines Vaters heißt auch so, er schreibt ›Fabrizio‹ allerdings mit z, also wie die Italiener.«
Fabricio betrachtete sein Hemd mit den getrockneten Blutkrusten und schluckte. »Er hat sich mit z geschrieben.«
Oh.
Zu viele Informationen. Nita wollte nichts davon wissen.
Warum musstest du auch mit ihm reden?, schalt sie sich. Das machte alles, was später kam, nur schlimmer.
Als sie gehen wollte, hielt er sie auf. »Nita.«
Sie zauderte, blieb stehen und sah sich über die Schulter zu ihm um. »Ja?«
»Was wird mit mir geschehen?«
Er zerrte an den Handschellen und beugte sich im Käfig vor. Die angespannte Miene, die Kopfhaltung, die Falte auf der Stirn, die geweiteten blauen Augen, alles an ihm verriet, dass er Angst hatte.
Sie wandte sich ab. »Das weiß ich nicht.«
Es war eine Lüge. Sie wollte es nur nicht vor ihm zugeben.
3
Als sie in die Küche zurückkehrte, wartete ihre Mutter schon auf sie.
Ohne Wasser.
Unsicher blieb Nita in der Tür stehen. Ihre Mutter betrachtete sie mit kaltem Blick, die Hand lag in der Nähe der Pistole. Beiläufig, nicht demonstrativ. Nicht, dass ihre Mutter jemals eine Waffe gebraucht hätte. Sie bevorzugte Gift.
»Nita, du hast doch hoffentlich nicht mit ihm geredet, oder?«
Nita schüttelte den Kopf und starrte den Boden an. Sie zog die Schultern hoch und hätte sich am liebsten in ein Loch verkrochen. Nitas Mutter hatte eine gefährliche Aura, das war eine unausgesprochene lauernde Drohung, wenn sie wütend war. Nita hätte es ihren Eltern gegenüber nie zugegeben, doch insgeheim fürchtete sie sich vor ihrer Mutter. In ihrem ganzen Leben hatte sie sich ihr nur ein einziges Mal widersetzt.
Als Nita zwölf gewesen war, hatten sie in der Nähe von Chicago gelebt und gearbeitet. Ihre Mutter hatte versucht, in das Daktpelzgeschäft einzusteigen. Dakte waren kleine, flauschige, liebenswerte Fellknäuel, die manche Menschen als Haustiere hielten, und sie waren völlig harmlos. Ihre Mutter brachte Käfige voller Tiere mit nach Hause, erklärte aber nie, woher sie stammten. Jeden Abend, wenn die Eltern im Bett waren, schlich Nita in den Keller hinunter, brachte die Käfige in die rund um die Uhr geöffnete Tierklinik und bat die Mitarbeiter, die Dakte dem Tierschutz oder einem Tierheim zu übergeben. Manchmal hatten sie die Dakte gescannt und anhand der Mikrochips festgestellt, dass sie aus den Gärten verschiedener Besitzer gestohlen worden waren.
Nitas Mutter war nicht begeistert gewesen. Eines Tages kam sie nicht mit lebenden, sondern mit einem Käfig voller toter Dakte nach Hause. Daraufhin spülte Nita fünf Pfund reine pulverisierte Einhornknochen durch die Toilette (das Zeug wirkte besser als Kokain und machte noch viel schneller süchtig). Die toten Dakte brachte sie trotzdem in die Tierklinik.
Es gefiel Nitas Mutter ganz und gar nicht, dass ihre Tochter moralische Bedenken entwickelte. Nachdem ihr Vater sie alle beruhigt und den Plan, Daktpelze zu verkaufen, zu den Akten gelegt hatte, war Nitas Mutter immer noch nicht zufrieden gewesen. Sie vergiftete das Daktfutter in der Tierhandlung, worauf alle Dakte in der Umgebung starben. Da die Mutter wusste, dass Nita dazu neigte, alles zu ignorieren, was sie nicht direkt vor der Nase hatte, legte sie eine Woche lang die Kadaver in Nitas Bett.
Die Strafaktion endete erst, als Nita weinend auf der Vordertreppe zusammenbrach und ihre Mutter anflehte, damit aufzuhören. Ihr Vater stimmte zu und sagte Nitas Mutter, das schmälerte ihren Gewinn. Zu dieser Zeit zerlegte Nita bereits die meisten Leichen, die hereinkamen, doch sie war emotional so sehr am Boden zerstört, dass sie schon seit einer Woche nicht mehr gearbeitet hatte. Der finanzielle Aspekt überzeugte ihre Mutter dann doch, damit aufzuhören.
Allerdings stand nun eine unausgesprochene Drohung im Raum: Falls Nita sich jemals wieder gegen ihre Mutter stellen sollte, würde die Strafe noch viel, viel schlimmer ausfallen.
Nita schluckte und schob die Erinnerungen beiseite. »Warum sollte ich denn mit ihm reden? Ich wüsste ja gar nicht, worüber.«
»Natürlich hast du nicht mit ihm geredet, sozial bist du ja sowieso eher unfähig.« Ihre Mutter machte einen Schritt auf sie zu. Beinahe wäre Nita zusammengezuckt. Sie beherrschte sich mit knapper Not. »Wenn du versuchen solltest, mit dem Jungen zu reden, könntest du am Ende noch Sympathien für ihn entwickeln. Das kann ich nicht gebrauchen. Und ich kann dir versprechen«, ein abruptes, böses Lächeln, »das willst du auch nicht erleben.«
»Ich habe ihm etwas zu essen gegeben.« Nita zuckte mit den Achseln und bemühte sich, äußerlich gleichmütig zu bleiben, während in ihr alles schrie, sie solle weglaufen, so weit und so schnell sie konnte, und niemals zurückschauen. »Er hat sich bedankt, ich habe gesagt, keine Ursache, und dann bin ich gegangen.«
Nach einem langen, prüfenden Blick setzte ihre Mutter ein herablassendes Lächeln auf. »Das ist gut. Es ist immer von Vorteil, höflich zu sein.«
Nita wollte sich ein Lächeln abringen. Es gelang ihr aber nicht. »Ich bin müde. Ich würde jetzt gern ins Bett gehen, wenn du nichts dagegen hast.«
Ihre Mutter entließ sie mit einem Händewedeln. »Aber erst musst du noch Wasser holen. Ich hatte jetzt doch keine Lust, mich selbst darum zu kümmern.«
Also traute ihre Mutter ihr nicht. Sie hatte dort gesessen und gelauscht und wusste jetzt, dass Nita sie angelogen hatte.
Wie schön.
»Gut.«
Es war immer das Beste, ihrer Mutter zu gehorchen.
Auf dem Weg nach draußen schnappte sich Nita den Sweater und eine Tasche und schloss die Tür gewissenhaft hinter sich zu. Dann erst holte sie tief Luft und lehnte sich mit geschlossenen Augen an die Tür. Sie fühlte sich, als balancierte sie auf einem Hochseil. Ein falscher Schritt, und sie konnte links oder rechts abstürzen. Das Problem war nur, dass sie nicht genau wusste, wohin sie stürzen würde. Sie wusste nur, dass es übel enden konnte.
Ob ihre Mutter Fabricio töten würde, während Nita unterwegs war und sie nicht stören konnte?
Nein, natürlich nicht. Aber sie könnte damit anfangen, weitere Körperteile abzuschneiden.
Nita schluckte und ballte die Hände zu Fäusten. Wäre das wirklich so schrecklich? Es war ja nicht Nitas Schuld – sie musste etwas erledigen und konnte nichts ändern. Sie konnte es einfach verdrängen.
Andererseits musste sie ihn immer noch zerteilen, wenn alles vorbei war. Die ängstlichen blauen Augen herauslöffeln und in einen Behälter legen.
Nita atmete aus, nachdem sie unwillkürlich die Luft angehalten hatte. Es wäre eine Verschwendung, jetzt aus Fabricio Körperteile herauszuschneiden.
Sie ging den Flur hinunter zur Treppe, um im Laden einzukaufen.
Draußen war es dunkel und diesig, doch die Straßenlaternen warfen halbwegs genügend Licht auf die Straße. Sie lebten in einem schönen Viertel von Lima, mitten im Miraflores-Distrikt, und sie machte sich trotz der späten Stunde keine allzu großen Sorgen um ihre Sicherheit.
Die abendliche Wärme schmeichelte der Haut, ein sanfter Wind wehte den Duft von etwas Scharfem aus einem benachbarten Restaurant herüber. Sie waren erst seit einem Monat in Lima, und bisher mochte sie es. Zweifellos war das einer der angenehmeren Orte, an denen sie sich bisher niedergelassen hatten.
Nita und ihre Mutter zogen oft um. Sie suchten sich einen zentralen Standort auf einem Kontinent, und dann bereiste ihre Mutter alle benachbarten Länder und jagte die Unnatürlichen, die sie töten und verkaufen konnte. Viele Jahre lang hatten sie das in den USA getan, bevor sie nach Vietnam, Deutschland und jetzt nach Peru umgezogen waren.
Sie kam an der offenen Tür eines Restaurants vorbei und bemerkte zwei amerikanische Touristen, die gerade einen Kellner heruntermachten. Die Frau knurrte etwas auf Englisch, worauf der Kellner sie mit versteinertem Lächeln anstarrte, den Kopf schüttelte und versuchte, ihr in einer Mischung aus gebrochenem Englisch und Spanisch zu erklären, dass er sie nicht verstand.
»Dann holen Sie jemanden, der mich versteht!«, fauchte die Frau und wandte sich an ihren Mann. »Man sollte doch glauben, dass die Leute hier Englisch sprechen.«
Nita verdrehte die Augen und ging weiter. Warum dachten die Amerikaner immer, alle anderen müssten ihnen entgegenkommen und ihre Sprache lernen? Sie waren in Peru. Warum lernten die Amerikaner nicht Spanisch?
Diese hochnäsige Haltung sah sie überall. Touristen stahlen Töpferwaren und Münzen aus deutschen Burgen, einfach weil sie es konnten. Reiche Männer flogen nach Ho-Chi-Min-Stadt und glaubten, sie könnten mit ihrem Geld für eine Nacht jemanden kaufen und mit ihm tun, was sie wollten, ganz egal, was die Gesetze des Landes sagten.
Nita ging an dem Restaurant vorbei und folgte der Straße.
Unter einer Erinnerungstafel für den Kampf gegen die Spanier hielt sie an. Sie dachte an die spanischen Konquistadoren, die vor fünfhundert Jahren durch Südamerika gezogen waren und auf der Suche nach Gold den ganzen Kontinent rot gefärbt hatten.
In ihrer Brust regte sich ein unbehagliches Gefühl. Sie war nervös. Die Tafel erwähnte Pizarro, den Mann, der wie eine blutige Sichel durch Peru gefahren war. Er hatte die Inka – die Herrscher des Inkavolks – als Geiseln genommen und als Lösegeld einen Raum voller Gold verlangt. Nachdem ihm die Inka das Gold gegeben hatten, hatte er sie aber trotzdem getötet.
Pizarro war nicht einmal der Schlimmste unter den Konquistadoren. Christoph Kolumbus hatte den indigenen Menschen die Hände abgehackt, wenn sie nicht Monat für Monat genügend Gold lieferten.
Genau wie ihre Mutter, die Fabricio die Zehen abschnitt.
Nein.
Darüber wollte sie nicht weiter nachdenken.
Also ignorierte sie die nervige kleine Stimme, die ihr sagte, sie hätte nicht das Recht, die Touristen als überhebliche Ärsche zu bezeichnen, solange ihre Mutter glaubte, sie könnten einfach so die Unnatürlichen töten und deren Körperteile meistbietend verkaufen.
Sie steuerte die kleine Bodega und nicht den riesigen Supermarkt an. Das immer überfüllte große Geschäft mochte sie nicht. Ständig sprach sie jemand an, die Leute atmeten in ihrer Nähe, gelegentlich berührte sie sogar jemand im Vorbeigehen. Das ertrug sie nicht.
Die Bodega war kleiner, dort musste sie manchmal sogar wirklich mit der Person an der Kasse sprechen, aber das Angenehme war, dass sie nicht so viele Körper in bedrängender Nähe um sich spürte. Außerdem gab es in der Bodega nie eine Warteschlange an der Kasse.
Als sie bezahlte, wanderte Nitas Blick zu dem Fernseher, der auf der anderen Seite des Raumes auf einem Tisch stand. Auf dem Gerät lagen Packungen mit Toilettenpapier und Kleenex-Tüchern. Es war ein altes, kastenförmiges Gerät, irgendjemand hatte die Nachrichten eingeschaltet.
»Die Debatte über die Frage, ob Einhörner auf die Liste der gefährlichen Unnatürlichen gesetzt werden sollen, wird heute fortgesetzt, nachdem die INHUP den dritten Sitzungstag für die Erörterung des Vorschlags eröffnet hat.«
Als die Erinnerungen erwachten, lächelte Nita. Das war eine der wenigen Gelegenheiten gewesen, bei denen ihre Mutter sich wirklich fürsorglich gezeigt hatte. Ein Mann mit blondem Haar und dornigen, kreisförmigen Tätowierungen hatte ihr in einem Laden die Haare gezaust, und ihre Mutter hätte ihn beinahe auf der Stelle erschossen. Sie hatte Nita weggezerrt, ehe der Mann ihr weiter zusetzen konnte. Ihre Mutter hatte es nie ausgesprochen, aber Nita wusste, dass dieses Seelen fressende Einhorn tot war. Er würde nie wieder eine Jungfrau anrühren. Sie hatte den Vorrat an frisch gemahlenen Einhornknochen gesehen.
Mit einem leisen Schnaufen schüttelte Nita den Kopf. Man konnte vieles über ihre Mutter sagen, aber sie liebte Nita. Es mochte eine beängstigende Form der Liebe sein, aber sie war da. Das war wichtig. Man konnte es nur leicht vergessen, weil ihre Mutter so misstrauisch und so geldgierig war.
Ein Reporter interviewte einen Wissenschaftler, der etwas über die Genetik der Unnatürlichen sagte.
»Auch die Einhörner bilden eine Gruppe von Unnatürlichen, die durch rezessive Gene entstehen. Das bedeutet, diese Wesen können sich mit Menschen fortpflanzen, sodass die genetischen Anlagen möglicherweise generationenlang schlafen werden, bis unter den passenden Begleitumständen zwei äußerlich völlig normale Eltern ein Monster in die Welt setzen. Nicht nur die Neigung zum Unicornismus ist erblich«, fuhr der Mann auf dem Bildschirm fort. »Das Gleiche gilt auch für andere Spielarten wie Zannies, Kappa und Ghule. In gewissem Maße sogar für Vampire.«
Nita dachte an die Zannieteile in ihrer Wohnung. Sie fragte sich, wie viele Menschen das Wesen im Laufe seines Lebens gefoltert hatte, um seine Gier nach Schmerzen zu stillen. Es war ein guter Gedanke, denn sie hatte keinerlei Schuldgefühle, ein solches Monster aufzuschneiden, und bewunderte ihre Mutter sogar, weil sie es getötet hatte.
»Dr. Rodón, könnten Sie uns den Vorschlag erläutern, den Sie bei der INHUP eingereicht haben?«
»Genmanipulation. Jede Spezies hat eine einzigartige Reihe von Genen. Sobald sie völlig entschlüsselt sind, müsste es leicht sein, die richtigen Erbinformationen zu finden und abzuschalten. Wenn wir sie schon vor der Geburt entdecken, können wir alle gefährlichen, von Menschen geborenen Unnatürlichen ausmerzen.«
Der Verkäufer reichte Nita lächelnd das Wasser. Sie riss es ihm förmlich aus der Hand und stürmte aus dem Laden. Diesen Blödsinn wollte sie keine Sekunde länger anhören müssen.
Außerdem hasste sie Menschen.
Sie sah durchaus ein, dass das eine wirkungsvolle und sogar humane Art und Weise wäre, die Population an Monstern zu vermindern. Sie wusste aber auch, dass es Menschen gab, die es zu weit treiben würden. Die Menschen trieben es immer zu weit. Wie lange würde es dauern, bis die Leute damit begannen, auch die Gene von harmlosen Unnatürlichen zu isolieren und sie ebenfalls zu eliminieren? Etwa die Auren, die einfach nur biolumineszent waren? Oder die Meerjungfrauen? Oder das, was Fabricio war?
Oder sogar Nita und ihre Mutter?
4
Am nächsten Morgen wachte Nita auf, weil jemand schrie.
Sie riss sich die Bettdecke herunter und griff nach dem Skalpell, das immer auf dem Nachttisch bereitlag. Als sie aus dem Bett steigen wollte, verhedderte sie sich in der Decke und landete mit einem Knall auf den Knien.
Das Schreien wurde schrill und verwandelte sich in ein gedehntes, grässliches Kreischen.
Keuchend befreite sich Nita und rappelte sich auf. Sie schlich hinaus, das Skalpell vor sich haltend, und steuerte die Quelle des Lärms an. Das Kreischen wurde durch das Klirren von Metall unterbrochen, dann schleifte und quietschte etwas Schweres auf dem Linoleumboden, und ihre Mutter fluchte heftig. Nita blieb fast das Herz stehen.
Ihre Mutter hatte sie nicht bloß auf die Probe gestellt, als sie erklärt hatte, sie werde Fabricio ein Ohr abschneiden. Sie tat es wirklich. In diesem Moment.
Der Sektionsraum war voller Blut. Es war auf die sauberen weißen Wände und den Boden gespritzt. Sogar in dem zornigen Gesicht ihrer Mutter waren einige Tropfen gelandet, und über Fabricios Wangen liefen rote Tränenspuren. Er hatte im Käfig den Kopf so weit wie möglich zurückgenommen, die Beine angezogen und die Füße gegen die vordere Seite des Käfigs gestemmt. Er wiegte sich hin und her, um zu verhindern, dass ihre Mutter ihn erwischte. Das Vorhängeschloss lag auf dem Boden, doch die Käfigtür war zugefallen, und Fabricio hielt sie geschlossen, indem er die verbliebenen Zehen um den Rahmen legte und zog.
Nitas Mutter hatte eine Spritze, die vermutlich ein Betäubungsmittel enthielt. Er riss sie ihr mit einer abrupten Bewegung der Schulter aus der Hand, sie fiel im Käfig auf den Boden. Mit einem Ellenbogen zerdrückte er sie, der Inhalt verteilte sich zwischen den Glassplittern auf dem Boden.
Beide drehten sich um, sobald Nita hereinkam. Nita zuckte zusammen, als sie Fabricios Gesicht sah. Ihre Mutter hatte offensichtlich versucht, ihm das Ohr im Schlaf abzuschneiden, und er war mitten im Schnitt aufgewacht. Sein Ohr war halb abgetrennt, und dann war das Messer abgerutscht und hatte einen tiefen roten Kratzer auf der Wange hinterlassen.
Unwillkürlich machte sie einen Schritt, weil sie es unterbinden wollte, sie wollte irgendetwas tun, und öffnete den Mund, um zu protestieren. Dann schloss sie ihn wieder.
Nita, du kannst das nicht verhindern. Du kannst ihn nicht retten.
Wenn du Mitgefühl zeigst, wird deine Mutter dafür sorgen, dass du es bereust.
Sie wird mich nicht verletzen, protestierte Nita. Das hieß aber nicht, dass es nicht noch viel schlimmere Dinge gab, die ihre Mutter ihr antun konnte. Die Erinnerung an die kleinen toten Körper in ihrem Bett drängte sich in den Vordergrund. Sie schob sie weg.
Während sie sich selbst überredete, nichts zu unternehmen, ließ sie die Hände sinken und wandte den Blick ab. An Blut und klaffende Wunden war sie gewöhnt, doch dieser Hoffnungsfunke in Fabricios Augen war schwer zu ertragen. Sie wollte nicht warten, bis dort nur noch Enttäuschung zu sehen war.
»Nita.« Ihre Mutter richtete sich auf und schlenkerte das Blut von den Fingern. »Guten Morgen.«
»Guten Morgen.« Nita überlegte. »Willst du dir das Ohr holen?«
»Ja. Leider kooperiert er nicht.« Ihre Mutter winkte sie zu sich. »Hilf mir mal.«
Nita zögerte nur einen Sekundenbruchteil, ehe sie gehorchte. »Was kann ich tun?«
Fabricios Blick brach, in seinen Augen waren nur noch Angst und Schrecken zu erkennen. Nita sah lieber nicht genau hin.
Ihre Mutter holte eine neue Spritze, vermutlich ebenfalls mit einem Betäubungsmittel gefüllt. »Ich versuche, ihn festzuhalten. Du musst ihn ruhigstellen.«
Mit zitternden Händen nahm Nita die Spritze entgegen, ohne Fabricio anzuschauen. So war es doch besser, oder? So litt er nicht unter Schmerzen, wenn ihm das Ohr abgenommen wurde.
Nita wollte ihn nicht mehr schreien hören.
»Warum hast du ihn nicht betäubt, bevor du angefangen hast?«, fragte sie. Nur mühsam gelang es ihr, das Zittern ihrer Hände zu verbergen.
Ihre Mutter zuckte gleichgültig mit den Achseln. »Ich dachte, ich könnte es einfach abschneiden, wenn ich schnell genug bin.«
Nein, dachte Nita, als sie das kleine Lächeln sah, das um die Lippen ihrer Mutter spielte. Daran hast du nicht im Traum gedacht. Du wolltest, dass es so kommt, damit ich aufwache und gezwungen bin, dir zu helfen.
Ende der Leseprobe





























