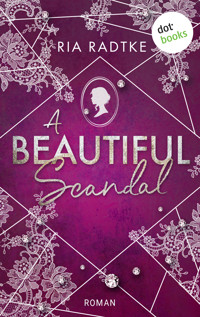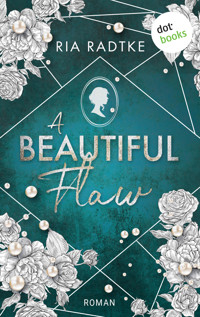Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Aconite Institute
- Sprache: Deutsch
Um ihre Liebe zu retten, stellt sie sich dunklen Mächten: Der fesselnde Fantasyroman »Matching Souls« von Ria Radtke jetzt als eBook bei dotbooks. Das Studium am sagenumwobenen Aconite Institute hat Runa verändert: Sie ist sich ihrer wahren Identität bewusst geworden. Und sie ist ihrem Mentor Kyril nähergekommen. Doch Runas Fähigkeit, als Schattenspringerin die Seelen Verstorbener ins Jenseits zu geleiten, ruft dunkle Mächte auf den Plan: Zuerst wird sie des Instituts verwiesen. Dann verschwindet Kyril auf einer Wanderung durch die schottischen Lowlands spurlos. Als er wenig später völlig gebrochen zurückkehrt, keimt in Runa ein schrecklicher Verdacht auf: Ist der Mythos von den grausamen Pariahs – ausgestoßene Schattenspringer, die in einem unterirdischen Höhlensystem hausen – doch wahr? Sind sie es, die Kyril in ihre Gewalt gebracht haben? Und was muss sie opfern, um ihre große Liebe zu retten? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Mitreißende Romantasy mit »Matching Souls« von Ria Radtke – Fans von Stella Tack, Sarah Sprinz und Nikola Hotel werden sich in dieses Buch verlieben; das Hörbuch ist bei SAGA Egmont erschienen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das Studium am sagenumwobenen Aconite Institute hat Runa verändert: Sie ist sich ihrer wahren Identität bewusst geworden. Und sie ist ihrem Mentor Kyril nähergekommen. Doch Runas Fähigkeit, als Schattenspringerin die Seelen Verstorbener ins Jenseits zu geleiten, ruft dunkle Mächte auf den Plan: Zuerst wird sie des Instituts verwiesen. Dann verschwind et Kyril auf einer Wanderung durch die schottischen Lowlands spurlos. Als er wenig später völlig gebrochen zurückkehrt, keimt in Runa ein schrecklicher Verdacht auf: Ist der Mythos von den grausamen Pariahs – ausgestoßene Schattenspringer, die in einem unterirdischen Höhlensystem hausen – doch wahr? Sind sie es, die Kyril in ihre Gewalt gebracht haben? Und was muss sie opfern, um ihre große Liebe zu retten?
»Matching Souls« erscheint außerdem als Hörbuch und Printausgabe bei SAGA Egmont, www.sagaegmont.com/germany.
Über die Autorin:
Ria Radtke sieht im Schreiben die Magie unserer Zeit. Dieser Zauber geht auch von ihren erfolgreichen Fantasy- und Liebesromanen aus.
Die Website der Autorin: riahellichten.de/
Die Autorin bei Facebook: facebook.com/Riahellichtenautorin/
Die Autorin auf Instagram: @ria_schreibt
Bei dotbooks erscheint außerdem ihr Roman »Spirit Dolls« als eBook.
***
eBook-Ausgabe März 2024
Copyright © der Originalausgabe 2024 Ria Radtke und SAGA Egmont
Copyright © der eBook-Ausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de).
Dieser Roman wurde im Rahmen des Stipendienprogramms der VG Wort in NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Paulina Ochnio unter Verwendung von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-831-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Matching Souls«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Ria Radtke
Matching Souls
Roman – Aconite Institute 2
dotbooks.
Ich glaube, wenn der Tod unsere Augen schließt, werden wir in einem Lichte stehen, von welchem unser Sonnenlicht nur der Schatten ist.
Arthur Schopenhauer
Für Sandra und Katrin. Ihr wisst, warum <3
PLAYLIST
Thin – Aquilo
Complete Mess – 5 Seconds of Summer
Fall Into Me – Forest Blakk
I Get to Love You – Ruelle
Rescue – James Bay
Dawning of Spring – Anson Seabra
Bleed You Still – Greyson Chance
If The World Was Ending – JP Saxe (feat. Julia Michaelis)
Wait for You – Tom Walker
River – Bishop Briggs
Work Song – Hozier
Breathe Life – Jack Garratt
Bones – Josh Record
Love Is Fire – Freya Ridings
Hey Jude – The Beatles
PROLOG
Edinburgh, 18. Dezember 1590
Er starrt mich selbst durch das Leichentuch hindurch an. Da ist Hohn in seinem Blick, den ich nicht sehen, aber spüren kann. Hinter dem kleinen vergitterten Fenster liegt seine verhüllte Gestalt und wartet. Auf den Tod, auf ein neues Leben, auf mich.
Ich schlinge die mageren Finger um die Stäbe und beobachte ihn. Das Salz brennt auf meiner Haut und vom Gift sind meine Sinne träge, trotzdem prickelt mein Körper erwartungsvoll. Bis zuletzt warst du zu stolz, um mir zu geben, was ich wollte, murmle ich in mich hinein. Und trotzdem wirst du mir bald dienen – mit Haut und Haaren, mit Fleisch und Blut.
Stimmen dringen vom Gebäude gedämpft in den Hof und lassen mich zusammenzucken. Eilig verberge ich mein Gesicht unter der Kapuze, drücke mich an die efeubewachsene Mauer und lausche. Mein schwaches Herz pocht mit aller verbliebener Kraft gegen meinen Brustkorb. Mit der Angst steigen Bilder in mir auf, die ich schon so lange vergessen will: ein Junge in einem der Stadthäuser Edinburghs, die sich halb verfallen gegen den Flodden Wall drücken; überfüllt, schmutzig und dunkel. Stroh auf dem Boden, Flöhe in den Laken, Doktoren mit spitzen Masken und Leichen, die niemand abholt. Sie verfolgen mich wie ein Fluch. Aber ich werde nie wieder krank sein und ich werde niemals hilflos dahinsiechen wie meine Eltern und Geschwister.
»Bald«, flüstere ich mir selbst zu, als spräche ich mit einem ungeduldigen Kind. »Bald ist es so weit.«
Einer gestohlenen Leiche rennt man nicht hinterher, wenn sie verschwindet. Nicht einmal, wenn sie plötzlich wieder zu laufen beginnt.
Die Stimmen verklingen und ich mache mich bereit, noch ein letztes Mal meine Kräfte zu sammeln, um in das private Sezierzimmer zu gelangen. Aber noch bevor ich die Augen geschlossen habe, zerschneidet ein klirrendes Geräusch die Stille des Abends: Das Gitter ist fort und eine Gestalt lässt sich aus dem Fenster in den Hof fallen; sie trägt nur ein Leichenhemd und hat sich ein Gefäß unter den Arm geklemmt. Er.
Ich erstarre und will ihm folgen, doch meine Beine versagen. Das Gift hat sie taub gemacht und es wird dauern, bis die Wirkung nachlässt.
Da läuft mein neues Leben davon.
Bis er verschwunden ist, sehe ich ihm nach, dann drehe ich mich zu dem jetzt offenen Fenster um. Es führt in das Reich des Mediziners – Labor, anatomische Sammlung, Seziersaal. Und alles unter der Leitung eines Mannes, durch dessen Hände jede Woche Dutzende Leichen gehen. Ich brauche so schnell wie möglich Ersatz, denn ich habe keine Zeit mehr – vielleicht muss ich für eine vorübergehende Lösung einen Kompromiss eingehen. Ein paar Jahre sollten reichen, um die Wundärzte der Stadt zu beobachten und von ihnen zu lernen. Aber dann …
Neuer Mut keimt in meiner Brust und ich atme auf. Meine Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Edinburgh, im Winter 2016
Die Bäume stehen am Straßenrand Spalier, wie um mir Mut zuzusprechen, aber helfen können sie mir nicht. Je weiter wir gen Norden fahren, desto kälter wird es. Ich kenne diese Gegend gut. Fast drei Stunden lang sieht man nichts als die zerklüftete Küste und das endlose Meer.
Vor ein paar Monaten fand ich das alles noch aufregend, ich wollte unbedingt wissen, wohin mein Vater so heimlich aufbricht. Unbemerkt, wie ein Detektiv auf geheimer Mission, bin ich in den Kofferraum geklettert. Er war so wütend, als er mich entdeckt hat, und ich glaube, er will mich bestrafen, indem wir wieder und wieder hierher zurückkehren.
Als die belebten Straßen Edinburghs in Sicht kommen, würde ich am liebsten die Autotür aufreißen und flüchten, von der Fernstraße in ein Wohngebiet, in einen Hinterhof oder in eine der engen Gassen. Irgendwohin. Stattdessen sitze ich stumm neben meinem Vater und beobachte, wie die Landschaft an mir vorbeizieht. Es hat etwas Beruhigendes, sich selbst nicht zu rühren, während die Umgebung in Bewegung ist. So werde ich es machen: die Luft anhalten und warten, bis alles vorbeigeht. Dieser Ausflug oder das ganze Leben.
In der Ferne zieht sich die Forth Bridge wie ein feines Spinnennetz über das Meer. Ansonsten gibt es hier nichts. Nur das endlose Grau des Himmels, das sich in den wogenden Wassermassen spiegelt. Wir steigen aus und ich friere. Nicht, weil die Hand meines Vaters kühl in meiner liegt, und nicht, weil der Wind an meiner dünnen Sommerjacke zerrt. Sondern von innen heraus.
In der Ferne erspähe ich die Villa: Herrschaftlich thront sie über dem Wasser wie ein Märchenschloss. Aber die Zeit der Märchen ist längst vorbei. Immer, wenn die Sonne das alte Gemäuer in weiches Licht taucht, denke ich an die glücklichen Tage zurück, die ich hier verbracht habe. Erinnerungen aus einem ganz anderen Leben. Jetzt ist die Villa zu einer Fata Morgana geschrumpft, sichtbar am Horizont und doch unerreichbar für mich.
Mein Vater festigt seinen Griff und zerrt mich am Arm weiter. Ich wehre mich nicht, denn es macht ohnehin keinen Unterschied. Wir steigen die Stufen hinab, die versteckt hinter Büschen und Geröll in die Höhle führen. Man findet sie nur, wenn man danach sucht. Und in der Einöde der Lowlands sucht niemand nach ihnen, niemand außer uns.
Unter der Erde ist es wärmer, weil kein Wind weht. Vielleicht auch, weil wir uns der Hölle nähern. Wenn es eine Hölle gibt, dann stelle ich sie mir jedenfalls so vor: Treppen und Wege und Bänke und kleine Tische – alles in den Stein gehauen von Zwergenhänden, wie es scheint. Aber keiner ist jemals dort. Es gibt nur uns und das Grauen, das in den düsteren Winkeln lauert.
Wie immer sagt mein Vater kein Wort. Das ist auch nicht nötig, denn unsere Besuche laufen stets nach dem gleichen Muster ab: Wir kommen allein her, wenn meine Mutter verreist und mein Bruder mit Freunden aus der Schule verabredet oder beim Debattierclub ist. Nie verraten wir irgendjemandem, wo wir hingehen. Was sollten wir auch sagen? Für diesen schrecklichen Ort gibt es keine Worte.
Je länger wir durch die verzweigten Gänge irren, desto dunkler wird es und desto näher scheinen die Wände zu kommen. Immer tiefer steigen wir in das Höhlenlabyrinth hinab. Das ist das letzte Mal, sage ich mir bei jedem Schritt. Du wirst nie wieder hierherkommen. Wenn du nur noch heute überstehst, hast du es geschafft. Danach läufst du weg, weit weg.
Ich werde kaum etwas vermissen, nur meinen großen Bruder, mit dem ich fast alles teilen kann. Aber vielleicht kommt man irgendwann in ein Alter, in dem man keine Brüder mehr braucht. Und auch keine Eltern. Überhaupt niemanden. Dann kann einen auch niemand verletzen.
Mit dieser Überlegung fasse ich einen Entschluss. Ich denke an alles Schöne in meinem Leben, an die aufregenden ersten Jahre meiner Kindheit und an meinen Bruder. Ich versuche sogar, mir auszumalen, was vielleicht noch vor mir liegt: Ich werde fremde Länder bereisen, Bösewichte bezwingen und Jungfrauen retten – vielleicht nicht ganz so wie in Kyrils Abenteuerromanen, aber doch irgendwie gleich.
All diese Gedanken schließe ich in mir ein wie einen Schatz, dann verriegle ich die Tür zur Schatzkammer, werfe den Schlüssel in einen tiefen Graben und errichte Stein für Stein eine Mauer um mein Schloss. Schließlich eine zweite, die noch höher ist, und immer so weiter. Die Stimmen können mir nichts anhaben, genauso wenig wie die kalten Hände, die sich aus dem Schatten nach mir ausstrecken. Das Schweigen meines Vaters trifft mich nicht und auch nicht dessen zielstrebiger Gang. Alles, was mich ausmacht, habe ich gut versteckt. Ich bin gar nicht mehr hier.
Aurel Ironmonger ist tot, also können ihm die Geister auch nichts anhaben.
Fremde Träume
AUREL
Sieben Jahre später
Meine Finger zittern, als ich die silbrig glänzende, verkorkte Phiole aus dem Regal nehme. Andere Leute verbringen ihre Abende mit Netflix oder, wenn sie auf charmante Weise altmodisch sind, mit einem Buch.
Auch ich verliere mich in einer anderen Welt, in einem Leben, das nicht mir gehört. Nur, dass ich das wortwörtlich tue: Ich kann mich in die Erinnerungen anderer Leute flüchten.
Ich atme die feuchte, heiße Luft des Tepidariums tief ein. Exotische Duftnoten nach Vanille und Geranium füllen mein Bewusstsein, aber für mich beschwören sie den Gestank von Unrat und Kohlerauch hinauf. Den bestialischen Odem, der Edinburghs Straßen füllte, bevor eine moderne Kanalisation gebaut wurde. Und obwohl das ausladende, mit Palmen und Orchideen bepflanzte Gewächshaus fast vollständig aus Glas besteht, hat es etwas Dunkles, Bedrückendes an sich.
Bibliothek der Seelen nenne ich diesen Raum, wenn ich mich sentimental fühlte. Die Bezeichnung ist nicht ganz korrekt, denn auch, wenn mir hier fremde Seelen begegnen, sammle ich eigentlich bloß Erinnerungen. Ich kenne jemanden, der mir das unter die Nase reiben würde und der überhaupt mein ganzes Leben in einer verlassenen, aus der Zeit gefallenen Villa ziemlich schwülstig fände. Aber immer, wenn ich mir sein Lächeln ausmale – ein bisschen schiefer, ein bisschen zurückhaltender als meines –, wünsche ich mir, eine Seele würde doch nur aus Erinnerungen bestehen. Denn dann wäre er hier. In meinem Animarium.
Ich vertreibe den unverbesserlichen Klugscheißer aus meinen Gedanken und taumele mit der Phiole zurück zu der Sitzgruppe aus Weidengeflecht vor der Fensterfront. Mit einer flirrenden Staubwolke falle ich in das Kissen. Dann ziehe ich mein Handy aus der Hosentasche und stelle den Wecker so ein, dass er in zehn Minuten klingelt. Vielleicht ist das nicht genug, aber gestern waren es neun und allein die zweistellige Zahl jagt mir einen eisigen Schauer über den Rücken.
Es ist ein sonniger Vormittag, einer der ersten im neuen Jahr, und damit genau das richtige für Gamma, den ich so genannt habe, weil er Nummer drei in meiner Sammlung ist. Aber der schlanke Buchstabe des griechischen Alphabets passt auch sonst gut zu dem ausgezehrten, blassen Mann.
Ein letztes Mal gleitet mein Blick durch die vertraute Umgebung, bleibt an lieb gewonnenen Gegenständen hängen, wie um sich festzuhalten: ein Foto von Mum, Kyril und mir hinter beschlagenem Glas. Ein fast völlig zerlesener Brief von Linda in einer gläsernen Schatulle auf dem Pflanztisch.
Ich bin Aurel Ironmonger, sage ich mir stumm, neunzehn Jahre alt, ich lebe in Prenbogle Hall, und ich werde immer noch ganz genau derselbe sein, wenn ich zurückkehre. Dann ziehe ich den Korken aus der Phiole. Und bin in einer anderen Zeit; bin jemand anderes und durchlebe seine Erinnerungen.
Die fremden Gefühle ergießen sich über mich wie im Rausch. In der Stille schmecke, rieche, ertaste ich sie, noch bevor ich die Augen öffne, und wie immer, wenn ich in eine Erinnerung eintauche, sind meine Sinne wund. Erst wund und dann taub. Als auch die Taubheit allmählich nachlässt, schärfen sie sich wieder. Und dann überrollt mich der Schmerz: Ich schmecke bittere Galle auf meiner Zunge und mein Körper krampft, sehnt sich nach der wohltuenden Wärme des Laudanums, die meine Wirbelsäule hinabströmen und scheinbar bis in jeden Knochen sickern würde. Beißender Rauchgeruch steigt mir in die Nase.
Ich öffne die Augen, aber die Zeit läuft viel zu schnell. Also zwinge ich die Millisekunden, sich auszudehnen, und versuche, die Umgebung so zu betrachten, als wäre ich zum ersten Mal hier: eine einfache Wohnstube mit glimmenden Kohlen im Kamin. Ich sitze an dem Schreibpult in der Ecke des Zimmers und betrachte meine Hände. Sie sind mager, so wie alles an mir. Selbst der schlichte Stuhl wirkt unter meiner knochigen Gestalt wie ein Thron. Nicht nur mein Körper ist ausgehungert; obwohl ich es mir eigentlich nicht leisten kann, lebe ich allein, seit ich meine Anstellung verloren habe. Das Opium macht die Einsamkeit erträglicher. Und es macht mich menschlicher – stiehlt meine Gabe, die mir ohnehin schon immer verhasst war. All das Leid, all den Tod, habe ich mit Tinte und Feder auf Papier gebannt.
Meine Gedichte – wild beschriebene lose Blätter – stapeln sich zwischen ungeöffneten Briefen auf dem Tisch. Sie sind in Gälisch verfasst und jetzt, wo das siebzehnte Jahrhundert vor der Tür steht, interessiert sich niemand mehr dafür. Als Poet habe ich Nöte, die ich als Dienstbote nicht kannte. Trotzdem möchte ich mein Gedeih und Verderb nie wieder in die Hände eines Herren legen. Wenn man erst einmal in den Besitz eines Menschen übergegangen ist, ist man seiner Willkür ausgeliefert und diesen Gedanken erträgt mein freiheitsliebender Geist nicht länger.
Ich stehe auf, werfe den Mantel über und trete auf die ungeteerte Straße hinaus. Die Apotheke hat noch geöffnet, und vielleicht kann ich meine Taschenuhr für eine Flasche Laudanum verpfänden. Der Apotheker kennt mich gut. Er verkauft mir das Gift, und er warnt mich vor seinen Tücken, obwohl es dafür längst zu spät ist. Als ich sein Geschäft verlasse und um die Ecke biege, ist es dunkel; der Wind hat die Laterne vor dem Haus des Apothekers ausgeblasen. Ich schlage den Kragen meines abgewetzten Mantels hoch und ziehe den Kopf ein, aber ich friere noch immer. Mit zitternden Fingern umklammere ich das kostbare Fläschchen in meiner Tasche, dann ziehe ich es heraus und trinke einen Schluck der bitteren Flüssigkeit – bald wird mir wärmer sein.
Da ertönen Schritte hinter mir und die Kälte weicht einer dunklen Vorahnung, die sich mit jedem Herzschlag steigert, bis ich nur noch animalische Angst verspüre. Der Anchor Close ist schmal und dunkel, die Stufen rutschig unter meinem Tritt. Hinter mir werden die Schritte schneller, und ich renne, aber ich weiß, dass ich ein leichtes Opfer bin, zu schwach, um rechtzeitig die Sicherheit meiner Wohnung zu erreichen. Ich schließe die Augen und male mir meine Stube bis ins Detail aus: die kalten Kohlen, das Papier, die Gedichte. Nichts geschieht, mein Geist ist zu zerstreut, um die Bilder wirklich heraufzubeschwören, das Opium hat ihn über die Jahre träge gemacht.
Jemand packt mich von hinten, umklammert mich so fest, dass ich mich nicht rühren kann, und stülpt mir einen Sack über den Kopf. Mein Angreifer überwältigt mich mit sonderbarer Sanftheit. Ich liege am Boden, in all dem Unrat, und kann nichts mehr sehen. Die kratzige Jute drückt sich an meinen Mund und meine Nase. Ich muss husten, aber ich bekomme keine Luft – jemand sitzt auf meinem Brustkorb. Panik flutet mein Bewusstsein und die Gedanken überschlagen sich. Aber gleichzeitig bin ich ganz ruhig. Derselbe, derselbe, derselbe.
Ich habe keine Ahnung, wo dieses eine Wort herkommt, doch ich klammere mich daran. Es ist mein Anker.
Und dann ist es vorbei. Ich spüre keinen Schmerz mehr, dafür eine Sehnsucht, die ich nur allzu gut kenne. Hier will ich nicht mehr sein, ich möchte nach Hause. Dieser Wunsch wird immer stärker, gerade weil ich weiß, dass er unerfüllbar ist. Jemand hebt mich hoch, lädt mich in einen Karren, bringt mich weg. Als ich endlich wieder etwas sehen kann, bemerke ich holzvertäfelte Decken, verziert mit Schnitzereien, darunter Ränge wie im Theater. Und über mir das Gesicht eines fremden Mannes. Er nimmt ein Skalpell zur Hand. Mo Chreach.
Ich bin am Leben, will ich ihm entgegenschreien. Blut fließt durch meine Adern, mein Herz schlägt und mein Körper ist noch warm.
Die Stimme von Paul McCartney erlöst mich und holt mich zurück. Hey Jude, don’t make it bad … Sie gehört nicht in diese Zeit und ich sollte nicht wissen, wie der Song weitergeht. Wer Jude ist, oder die Beatles. Erst recht nicht, dass mein Bruder dieses Lied auf voller Lautstärke abgespielt hat, wenn sich unsere Eltern wieder einmal stritten. Aber das tue ich. Und im nächsten Moment bin ich zurück in der Gegenwart und in meinem eigenen Leben.
Seelenpflaster
RUNA
Statt mich darüber zu freuen, wieder zu Hause zu sein, fühle ich mich fremd an dem Ort meiner Kindheit.
Hätte ich gewusst, dass nichts mehr dasselbe sein würde, wenn ich vom Aconite Institute nach Flat Holm zurückkehre, hätte ich mich vor zwei Monaten vielleicht doch von der Insel verabschiedet. Von meiner Heimat und von meinem alten Leben. Die Wellen branden zwar wie immer an die Küste – ihr gleichmäßiges Rauschen dringt durch die Fenster des Cottages in mein Zimmer –, dennoch ist etwas anders. Ich lausche auf die eigentümliche Melodie der Insel und auf das auf- und abschwellende Möwengeschrei im Wind.
Es dauert eine Weile, bis ich verstehe, dass ich es bin, die sich verändert hat.
Ich sehe zu Kyril, der in meinem Bett schläft. Sein Brustkorb hebt und senkt sich in gleichmäßigem Rhythmus. Wie immer muss ich gegen den Drang ankämpfen, ihn zu wecken. Einerseits könnte ich ewig hier sitzen und ihn beobachten, andererseits jagt mir die Einsamkeit Angst ein. Und diese Angst macht mich schwach, sie stiehlt mir Kraft, die ich nicht habe und doch brauche, um sie mit Menschen in Not zu teilen. Mit Menschen, die sonst sterben. Kaum zu fassen, dass es inzwischen alltäglich für mich geworden ist, den Rufen Sterbender zu folgen und ihre Seelen ins Jenseits zu geleiten, obwohl mein Leben vor wenigen Monaten noch verhältnismäßig normal war. Aber ich habe mich mit meinen Pflichten als Schattenspringerin abgefunden, so wie man sich wohl irgendwann mit allem Unvermeidlichen abfindet. Oder vielleicht hat schlicht Kyrils Verantwortungsbewusstsein auf mich abgefärbt.
Zitternd streiche ich ihm eine dunkelblonde Locke aus der Stirn. Meine zerstochenen Fingerkuppen sind rau, trotzdem lasse ich die Hand an seiner Wange ruhen. Der Dreitagebart macht ihn älter, genau wie die Schatten unter seinen Augen, die entweder den kurzen Nächten oder der neuen Verantwortung als Warden geschuldet sein müssen. Vielleicht auch beidem.
Bei seinem Anblick zieht sich mein Brustkorb schmerzhaft zusammen, und Sehnsucht überrollt mich in einer stürmischen Welle. Nach diesem trostlosen Winter, dem einsamen Weihnachtsfest und den langen, dunklen Tagen wünsche ich mir sehnlichst den Frühling und den Sommer herbei. Ich möchte nur für eine Nacht vergessen können. Neben Kyril aufwachen und ohne Angst liegenbleiben. Das Morgengrauen verschlafen, bis die Sonnenstrahlen durch die Vorhänge fallen und wärmend über unsere bloßen Körper tanzen.
Ich ziehe meine Hand zurück und Kyril schlägt die Augen auf. »Guten Morgen, Fawn«, murmelt er verschlafen und lächelt schief. Ein einzelner Schmetterling torkelt mit schwerfälligem Flügelschlag durch meinen Bauch. Dann klärt sich Kyrils verschleierter Blick plötzlich und sein Lächeln erstarrt. »Was ist los?«
Ich schlucke meine wirren Gedanken hinunter. Reflexartig schüttle ich den Kopf. Nichts. Alles.
»Ist das etwa der Moment, in dem du dich fragst, wie der nervige Typ in dein Bett kommt?«
Kyril kennt die Dämonen, die mich nachts heimsuchen. Zumindest die meisten. Und er versucht unermüdlich, sie zu vertreiben. »Als wir uns das erste Mal begegnet sind, hast du nicht gerade ein Geheimnis daraus gemacht, wie wenig du von mir hältst. Weißt du noch? Zum Glück hast du deine Meinung bald geändert.«
Ich erinnere mich nicht. Aber das könnte ich ihm niemals sagen.
»Nicht so bald«, flüstere ich, lasse mich von Kyril unter die Bettdecke ziehen und versuche, die Tatsache zu ignorieren, dass jede unserer gemeinsamen Sekunden gestohlene Zeit ist. Wenn ich bei ihm bin, will ich einfach glücklich sein.
Auch wenn ich kaum noch weiß, wie sich das anfühlt.
***
Lang kann ich nicht geschlafen haben, als ich von einem vertrauten Ziehen geweckt werde. Ruckartig stehe ich auf. Die kalte Luft des zugigen Zimmers umfängt mich und lässt mich Kyrils warmen Körper erst recht vermissen. Ich schaue zurück und es versetzt mir einen Stich, zu wissen, dass er wahrscheinlich nicht mehr da sein wird, wenn ich zurückkehre. Aber das ist unser Los, meines wie seines. Bestimmt warten auch auf ihn heute Nacht noch Menschen, die nach ihm rufen, damit er ihre Seelen hinübergeleitet, wenn ihre letzte Stunde geschlagen hat. Eilig ziehe ich mich an, öffne die Nachttischschublade und nehme eine zierliche gehäkelte Puppe heraus. Eine Spirit Doll. Noch ist sie anonym, hat weder einen Namen noch eine Geschichte. Aber das wird sich heute Nacht ändern. Neben der Puppe stecke ich mein kleines Nähetui ein, mehr brauche ich nicht. Ich trete aus dem Lichtkegel des Mondes, der ins Zimmer scheint, dann gebe ich dem drängenden Gefühl nach.
Ich lande in einer Gasse hinter einem Pub, in einer der heruntergekommeneren Gegenden von Cardiff. Ein Mädchen liegt vor mir auf dem Boden. Sie ist jung, vielleicht so alt wie ich. Trotz der kühlen Nacht trägt sie nur ein Kleid. Ich beuge mich zu ihr hinunter. Ihr Atem riecht nach Alkohol, wahrscheinlich war sie feiern. Was dann passiert ist, weiß ich nicht, aber es ist jetzt auch nicht wichtig. Blut sickert aus einer Wunde am Kopf durch ihr helles Haar und läuft ihre Schläfe hinunter. Mir wird übel, aber ich verdränge das Unwohlsein, blende es aus, genau wie alle anderen Gefühle.
Als meine Knie auf das feuchte Kopfsteinpflaster prallen, spüre ich keinen Schmerz. »Shh. Ich will dir helfen.«
Ich glaube, sie versteht mich instinktiv. Das tun sie eigentlich immer, die meisten halten mich für einen Engel oder so. Wenn sie wüssten.
Ich nehme die Schere aus dem Nähetui und ziehe die Einmalhandschuhe an. Jede Faser meines Körpers drängt mich, das Mädchen zu berühren. Aber ich darf nicht nachgeben, denn das wäre ihr Todesurteil.
Nachdem ich eine der verklebten Haarsträhnen abgeschnitten habe, betrachte ich das Mädchen, nehme ein Stück Kreide aus dem Etui und markiere die Stelle ihrer Verletzung auf der Puppe. Durch den Analogiezauber wird später alles, was ich mit der Puppe mache, auf das Mädchen übergehen. Ich greife nach dem Cuttermesser und schneide das Garn auf. Die Fremde starrt mich aus glasigen Augen an, aber sie reagiert nicht. Noch ist die Puppe nicht mit ihr verbunden, noch habe ich den Köder für ihre Seele nicht ausgelegt. Doch sie ist verwirrt und wird wachsam, das spüre ich, denn das schmerzhafte Ziehen in meiner Magengegend lässt nach, als ich die Haarsträhne um die gehäkelte Puppe wickle. Sie ist die entscheidende Verbindung. Mit feinen Stichen nähe ich jetzt den Schnitt, das Mädchen zuckt nicht einmal zusammen. Dann ziehe ich die Handschuhe aus und berühre sie mit meinen bloßen Fingern. Meine Hand liegt an ihrer Wange, die klebrig vom Blut ist und viel zu kalt. Ich blende den Gedanken aus und rufe mir stattdessen Kyrils Lächeln in Erinnerung. Das ist der schwierigste Teil: alles zu vergessen und sich selbst in einer Erinnerung zu verlieren. Ich denke daran, wie wir auf dem Calton Hill standen, das nächtliche Lichtermeer der Stadt zu unseren Füßen. Er umarmt mich und verspricht mir, dass alles gut werden wird. Ich zittere vor Aufregung und vor Glück. Jetzt konzentriere ich mich auf das Glück. Es rinnt durch meine Finger wie Sand, doch ich halte es fest. Lasse den Moment in mir erblühen und immer größer werden, bis Hoffnung mich hell durchströmt. Dann erst erlaube ich der Seele des Mädchens, mir ihre Geschichte zu erzählen. Sie heißt Louise Bray. Sie war heute Abend im Club und jemand hat sie bedrängt. Als sie sich gewehrt hat, wurde sie zusammengeschlagen. Daran kann ich nichts mehr ändern. Aber etwas anderes steht in meiner Macht: Louise wird heute Nacht nicht sterben.
Als ich die Augen wieder öffne, liegt sie immer noch in der schmutzigen Gasse, ihr Gesicht ist nach wie vor blutbesudelt. Aber in ihren Augen bemerke ich einen neuen Glanz. Ich schlucke, weil mir plötzlich schwer ums Herz wird. Es ist, als hätte sich eine unsichtbare Last auf meine Schultern gesenkt.
Ich zwinge mir ein Lächeln auf die Lippen, streiche sanft über Louises Wange und flüstere: »Geh nach Hause. Es wird alles gut werden.«
Genau das wird sie tun, ich weiß es. Und von der Verletzung wird morgen kaum noch etwas zu sehen sein. Schwerfällig stehe ich auf, löse das Haar von der Puppe, die ich wieder einstecke, weil ich es nicht übers Herz bringe, sie in den Müllcontainer zu werfen, der an der Hauswand steht. Meine Gedanken schwirren einen Moment lang haltlos durcheinander, während ich mich von Louise entferne. Es sollte sich gut anfühlen, zu helfen. Jemanden zu retten, der zum Tode verurteilt war, und das, indem ich ein bisschen von meiner eigenen Kraft abgebe. Ihm eine einzige glückliche Erinnerung zu überlassen, wenn ich noch genügend andere habe. Aber ich spüre nur bedrückende Leere.
Ich biege um die Ecke, die Straße ist verlassen und die Laternen sind längst erloschen. Mit einem Wimpernschlag bin ich wieder zu Hause.
Mein Bett ist leer, aber noch warm. Ich lege mich hinein, ziehe mir die Decke bis zum Kinn und denke nach. Calton Hill. Irgendetwas ist auf dem Calton Hill geschehen, etwas Schönes, aber ich weiß nicht mehr, was. Diesen Teil meines Lebens trägt jetzt Louise in sich.
Neuanfänge
KYRIL
Mein Vater ist kein schöner Anblick, wenn er sich aufregt. Ich kann nichts für solche Gedanken, sie kommen einfach. Und helfen mir, die Tage zu überstehen, in denen er mich herumkommandiert wie einen Hund.
Vor Elizabetas Porträt läuft er auf und ab und fuchtelt dabei wild mit den Händen. Die junge Frau auf dem Gemälde, das er nicht hat abhängen lassen, scheint uns zu beobachten. Noch immer weiß ich nicht genau, ob sie ein Engel oder ein Dämon war, aber ich bin sicher, dass ihre Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Im Grunde sieht alles in Octavians altem Büro noch aus wie vor wenigen Wochen, und ich glaube nicht, dass Kieran je auf die Idee gekommen ist, der Anblick der verstaubten Regalwände und der Ölgemälde mit Szenen aus grausamen biblischen Geschichten könnte verstörend auf mich wirken. Das tut er zwar, aber ich habe hier trotzdem nichts verändert, weil dieser Raum für alles steht, was Runa und ich durchmachen mussten. Dafür, dass wir überlebt haben und dafür, dass wir es gemeinsam geschafft haben.
Obwohl ich heute Nacht bei ihr war, vermisse ich sie. In letzter Zeit habe ich ständig das Gefühl, dass es niemals genug ist, egal, wie oft wir uns sehen. Wir sind zusammen, aber jeder ist in seinem eigenen Kopf gefangen, in seiner eigenen Welt mit all ihren Problemen.
»Es obliegt deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das Analogiezauberverbot eingehalten wird!«, donnert mein Vater. Nachdem im letzten Jahr offensichtlich wurde, wie mächtig die Puppen sind – dass sich mit ihrer Hilfe Seelen manipulieren lassen, dass man mit ihnen heilen oder schaden kann –, lag auf der Hand, dass sie verboten wurden. »Ich will auf dem Institutsgelände keine einzige vermaledeite Puppe sehen, hast du verstanden?«
Ich nicke stumm, dabei würde ich ihm am liebsten entgegenschreien, dass ihn das alles nichts angeht. Dass es in der Natur des Menschen liegt, zu helfen, zu heilen, wo er kann. Und dass er kein Recht hat, mir irgendwas vorzuschreiben, weil er Mitgefühl und Liebe längst nicht mehr kennt. Ob meinem Vater klar ist, dass er jetzt auch seinen ältesten Sohn verloren hat? Er wird allein sterben und ihm wird niemand mit einer Spirit Doll zu Hilfe kommen, wenn es so weit ist. Wenn er das realisiert, wird es für Reue zu spät sein.
Trotzdem sollte ich sein Verbot durchsetzen. Nicht ihm zuliebe, sondern weil ich es für gefährlich halte, wenn die Schattenspringer, die eigentlich nur Begleiter ins Jenseits sein sollten, in das Gleichgewicht von Leben und Tod eingreifen. Dass die Konsequenzen unberechenbar sind, hat sich ja bei Octavian deutlich genug gezeigt. Und ich bin sicher, dass die meisten meiner Studentinnen und Studenten nicht einmal wissen, wozu Spirit Dolls imstande sind. Die Puppe, die mein Vater wutentbrannt auf meinen Schreibtisch geschleudert hat, stammt jedenfalls nicht aus dem Institut. Ich habe sie erst heute Morgen in einem kleinen Cottage auf der windumtosten Insel Flat Holm gefunden. Und das beunruhigt mich fast noch mehr, denn ich bezweifle, dass Runa sie nur aus wissenschaftlichem Interesse angefertigt hat.
»Unser Gespräch ist beendet«, schließt mein Vater. »Ich brauche dir ja wohl nicht zu sagen, dass es ratsam wäre, wenn du uns nicht blamierst, bis in drei Wochen der Ältestenrat einen neuen Warden wählt.«
Uns?, denke ich. Eigentlich spricht er immer nur von sich. Wann waren wir das letzte Mal eine Familie? Mum lebt ihr eigenes Leben in Kalifornien, ich sehe sie höchstens an Weihnachten, aber selbst dafür hatte sie letztes Jahr keine Zeit. Und mein kleiner Bruder Aurel … ist fort. Doch ich widerspreche nicht und mein Vater wendet sich zum Gehen. Erst als die schwere Eichenholztür mit einem dumpfen Krach hinter ihm ins Schloss fällt, lasse ich mich erschöpft auf den Ledersessel am Schreibtisch sinken.
Morgen kommen die letzten Studierenden aus den Weihnachtsferien zurück ans Institut und ich möchte ihnen zeigen, dass hier jetzt ein anderer Wind weht: Die Zeiten der Wildjagd und der pompösen Reden sind vorbei.
Meine erste Amtshandlung als Interimswarden ist ein gemeinsamer Ausflug, eine Wanderung durch die Lowlands im Umland Edinburghs. In der Nähe von Cramond hatte meine Familie früher einen Sommersitz, bevor Prenbogle Hall verkauft wurde, daher kenne ich mich in der Gegend gut aus. Wir werden ein Stück entlang des Berwickshire Coastal Path wandern, denn einige der Neulinge haben noch nicht viel von den Stränden und Klippen der schottischen Küste gesehen, weil sie aus entlegeneren Teilen des Vereinigten Königreichs kommen. Ich hoffe, dass ein gemeinsamer Ausflug von Anfang an das Wir-Gefühl stärkt, nachdem Octavian viel zu lange alles darangesetzt hat, die Schattenspringer zu Konkurrenz und Missgunst anzustiften.
Ich schiebe den Streit mit meinem Vater gedanklich beiseite und stehe auf, um in der Bibliothek nach einer geeigneten Wanderkarte zu suchen, die ich für die Studierenden kopieren könnte. Die Route habe ich minutiös geplant, um unwegsames Gelände, auf dem es gelegentlich Gebirgsstürze gibt, zu meiden.
Aber als ich die Stufen zum Avicenna Quad nehme, befällt mich plötzlich eine sonderbare Sehnsucht: Mit einem Mal bin ich wieder im letzten Studienjahr, schreibe an meiner Abschlussarbeit und rechne damit, jeden Moment auf meinen besten Kumpel Tris zu stoßen, um mit ihm ein Ale im Brass Monkey trinken zu gehen. So wie damals, an dem folgenschweren Tag vor dreieinhalb Monaten, als sich alles verändert hat. Ein Schauer rieselt meinen Nacken hinunter und wie von selbst wandert mein Blick zum schmiedeeisernen Tor des Parks. Die Grabsteine im Schatten der alten Platanen kann ich selbst von hier aus erahnen. Und dann ist der Gedanke plötzlich da: Wenn du könntest, würdest du die Zeit zurückdrehen? Würdest du etwas anders machen?
Fragen wie diese beschäftigen mich seit Wochen. Seit Tristrams Beerdigung, obwohl ich mich schon lange vorher von ihm verabschiedet habe. Sie quälen mich in den seltenen Stunden, in denen ich bei Runa bin und keiner von uns auf einer nächtlichen Mission ist. Sie quälen mich noch mehr, wenn ich alleine bin. Wenn alles anders gekommen wäre, würde Tris noch leben, aber Runa hätte ich nie getroffen. Was ist schlimmer – gar nichts zu fühlen oder viel zu viel?
Spontan ändere ich die Richtung und schlendere auf den Park zu. Die Rehe grasen friedlich und heben nicht einmal den Kopf, als ich das Tor öffne. Ich hoffe inständig, dass sie bald unbehelligt hier leben können und die grausamen Traditionen des Initiationsrituals ein Ende haben. Aber diese Entscheidung wird wohl nicht mehr in meinen Händen liegen.
Kurz bevor ich die Bank erreiche, ruft jemand meinen Namen. Ich schmunzle beim vertrauten Klang der Stimme und drehe mich um.
Lali steht vor mir, rückt ihre Brille zurecht und streicht sich etwas atemlos eine lange schwarze Haarsträhne aus dem Gesicht. »Hab ich dich erwischt, du überaus wichtige und beschäftigte Person.«
»Glaub mir, ich hab mir das nicht so ausgesucht«, erwidere ich.
»Schon klar.« Sie atmet tief durch und verschränkt die Arme. Für einen Moment wirkt es so, als wüsste sie nicht, was sie sagen soll. Was ich mir bei Lali Prasad beim besten Willen nicht vorstellen kann. »Wie geht es ihr?«
Ich starre meine ehemalige Kommilitonin nur für einen Sekundenbruchteil verständnislos an.
»Runa natürlich!« Lali schüttelt ungeduldig den Kopf.
»Gut«, antworte ich ein bisschen zu schnell. »Denke ich. Soll ich ihr etwas ausrichten?«
Lali wirkt resigniert. »Nein, aber du kannst deinem Vollpfosten von einem Vater ausrichten, dass sie fehlt. Ich vermisse sie, wir alle vermi–«
»Ich weiß«, entgegne ich und schneide ihr damit das Wort ab. Eine Spur zu harsch, aber ich kann nicht anders: Ich vermisse sie ja selbst am meisten. »In drei Wochen wird der neue Warden gewählt. Dann wird sich einiges ändern, dann kommt sie zurück. Ganz bestimmt.« Ich glaube mir das zwar selbst kaum, aber das ist alles, was ich Lali im Moment bieten kann.
»Ich nehme dich beim Wort.« Sie dreht sich um und verschwindet so stürmisch, wie sie gekommen ist. Ich kann es ihr nicht verübeln. Die Verantwortung, die auf meinen Schultern lastet, ist einfach zu groß und wenn ich ehrlich bin, kann ich es selbst nicht erwarten, sie endlich abzugeben.
Versprechen
RUNA
Im Gegensatz zu meinen Nächten, die immer zu kurz sind, ziehen sich die Tage auf Flat Holm endlos in die Länge. Heute ist Dienstag und trotz der schlimmen Kopfschmerzen, die mich seit der Nacht quälen, werde ich zum Einkaufen mit dem Boot nach Cardiff rüberfahren wie jeden Dienstag – das Highlight meiner Woche. Statt mich länger mit dem Geld meines verstorbenen Vaters – das genau genommen Kyril gehört – über Wasser zu halten, habe ich mein Sparbuch geplündert, das Mum in der Kommode im Wohnzimmer aufbewahrt. Sie wird es mir nachsehen müssen. Aber schon als ich aus dem Haus trete, wird mir klar, dass ich meine Pläne vergessen kann: Ich bin auf die Touristenboote angewiesen, die zwischen der Insel und dem Mermaid Quay in der Cardiff Bay verkehren, doch die See ist heute viel zu unruhig. Ich weiß, dass das Boot nicht kommen wird, trotzdem setze ich mich auf die Stufen der in die Klippen gehauenen Steintreppe, die unweit des Leuchtturms zum Strand hinunterführt, und schaue auf das Meer hinaus. Von hier aus kann ich das Festland sehen, das dennoch unerreichbar ist. Es kommt mir vor, als wollte das Schicksal mich verhöhnen. Wow, die Einsamkeit hat dich ganz schön zynisch gemacht, spottet meine innere Stimme. Sie hat recht; ich bin zynisch geworden – und verzweifelt.
Ich denke daran zurück, wie ich mich neulich sogar nach Cardiff teleportiert habe. Nachts natürlich, alles andere wäre zu riskant. Die Supermärkte hatten längst geschlossen, aber mein Ziel war ohnehin ein anderes: eine verlassene Straße im Furness Close. Hinter den Fenstern des schlichten Hauses mit verklinkerter Fassade brannte noch Licht. Ein Baby schrie und mir blieb beinahe das Herz stehen, als mir klar wurde, dass es tatsächlich Rose war. Kurz darauf trat Mum mit meiner Schwester auf dem Arm ans Fenster, ohne mich zu bemerken. Auch ich habe eilig weggesehen, allerdings nicht schnell genug.
Rose hat jetzt blonde Haare, genau wie Mum. Ob sie inzwischen krabbelt und vor sich hin brabbelt? Bestimmt sagt sie schon Dadoder Dada.
Tränen steigen mir in die Augen und ich verdränge die Erinnerung mit aller Kraft. Vielleicht kommt das Boot morgen wieder, sage ich mir. Aber in Wahrheit kommt es vielleicht auch erst nächste Woche. Frustriert ziehe ich die Kapuze meiner Wachsjacke tiefer ins Gesicht und beschließe, später im Cottage eine ganze Tafel Schokolade zu verdrücken. Ich habe mir einen Vorrat in Mums alter Speisekammer angelegt. Aber auch Schokolade kann nicht verhindern, dass ich unglücklich bin. Meine Gedanken kreisen immer nur darum, dass ich meine Zeit auf dieser Insel verschwende. Egal, wie vielen Menschen ich nachts helfe. Ich fühle mich wie eine Kerze, die langsam, aber sicher herunterbrennt. Die Buffy-DVDs stapeln sich in einem Regal in meinem Zimmer, aber ich kann sie nicht mehr ansehen, weil es zu sehr wehtut. Manchmal lasse ich den Soundtrack auf meinem Laptop laufen. Auch das tut weh, doch dieser Schmerz ist auszuhalten, er ist traurigschön.
Ich stoße die Haustür des Cottages auf, die ich nie abschließe, weil außer mir selten jemand hier ist, vor allem im Winter. Vielleicht auch, weil ich sowieso nichts zu verlieren habe.
Statt der Tafel Schokolade überwinde ich mich und ziehe mich um: Leggings, Trainingsjacke und Laufschuhe. Joggen ist, abgesehen vom Schwimmen, der einzige Sport, den man auf dieser verdammten Insel treiben kann. Leider richtet die frische Luft kaum etwas gegen meinen dröhnenden Schädel aus. Wahrscheinlich habe ich in der Nacht komisch gelegen und mir einen Nerv eingeklemmt oder mich irgendwo gestoßen.
Weil die grauweißen Heringsmöwen in den Süden gezogen sind und vor Ende des Monats nicht zurückkehren werden, ist es zu dieser Zeit des Jahres besonders still. Ich laufe an den Ruinen des alten Krankenhauses vorbei, das im vorletzten Jahrhundert als Quarantänestation für Cholerakranke diente. Dabei überkommt mich der vor Selbstmitleid triefende Gedanke, dass ich hier auch irgendwie in Quarantäne bin. So, als hätte ich im Herbst absichtlich meine Kommilitonen in Gefahr gebracht – meine Freunde und sogar den Menschen, der mir auf der Welt am wichtigsten ist.
Aber auch wenn es keine Absicht war, ist meine Strafe gerecht. Tris ist gestorben und es tröstet mich nicht, dass unzählige andere Leben gerettet werden konnten. Das Schlimmste ist, dass mir der Gedanke, dass ich nur bekommen habe, was ich verdiene, immer weniger abwegig erscheint, je länger ich darüber nachgrübele. Das liegt an der Einsamkeit, sie bringt mich über kurz oder lang um den Verstand. Doch was, wenn wirklich alles allein meine Schuld ist? Eine ungute Vorahnung schnürt mir die Kehle zu.
Die ewige Gedankenspirale, die immer nur abwärts führt, wird vom Klingeln eines Handys unterbrochen. Einem sonderbar schrillen Geräusch im Vergleich zu der eintönigen Windsinfonie meiner Heimat.
»Hey, Lali!« Der unerwartete Anruf meiner besten Freundin ist eine willkommene Abwechslung an diesem öden Tag.
»Runa? Du musst sofort nach Edinburgh zurückkommen.«
»Was? Wieso, was ist denn los?«
»Kyril ist verschwunden.«
Mit diesem einen Satz stürzt meine Welt wie ein Kartenhaus zusammen. Das Herz klopft mir bis zum Hals, so heftig, dass mir speiübel wird. »Was soll das heißen, verschwunden?«, wiederhole ich ungläubig.
»Er war doch mit den Studierenden unterwegs, wandern an der Küste. Sie sollten eigentlich gestern Abend zurückkommen, aber …« Lalis Stimme bricht. »Wir haben die Polizei verständigt.«
Plötzlich dreht sich die Welt um mich herum schwindelerregend schnell. Ich schwanke und schaffe es gerade noch, nicht auf dem Fels zu landen, sondern im Gras. Das darf nicht wahr sein.
»Bestimmt gibt es eine simple Erklärung, aber ich wollte trotzdem, dass du Bescheid weißt.«
Lalis Worte beruhigen mich nicht, im Gegenteil. Alle denkbaren Horrorszenarien spielen sich jetzt vor meinem inneren Auge ab – eines schrecklicher als das andere: Kyril könnte von einem Bergrutsch überrascht worden sein. Vielleicht ist er gestürzt, vielleicht ist er verletzt, vielleicht ist er … Nein, das hätte ich gespürt, oder nicht? Außerdem war er mit etlichen Studierenden unterwegs, sicher hätte jemand Hilfe geholt? So viele Menschen können doch nicht einfach wie vom Erdboden verschluckt sein?
»Runa?«, fragt Lali unsicher. »Bist du noch da?«
Ich räuspere mich, trotzdem ist mein Hals so wund, dass ich nicht weiß, wie ich auch nur ein einziges Wort herausbekommen soll. »Ja«, krächze ich. »Ich … was soll ich –«
»Du kannst wieder in unserem –«, sie korrigiert sich, »in meinem Zimmer schlafen, wenn du willst.«
»Ich will nicht, dass du wegen mir Ärger bekommst.« Lalis Vorschlag rührt mich, aber in dem Apartment lauern zu viele Erinnerungen. Außerdem hat Kieran Ironmonger mehr als deutlich gemacht, dass ich am Institut nicht mehr erwünscht bin, und ich bezweifle, dass sich daran etwas geändert hat. »Ich glaube, ich nehme mir irgendwo ein Hotel.«
»Kommt gar nicht infrage.« Mit einem Mal ist meine Freundin wieder so energisch wie eh und je. »Du steigst jetzt bestimmt nicht allein irgendwo ab, auch nicht, wenn Runa Davies ja immer alles mit sich selbst ausmacht.«
Dass Lali wieder spotten kann, erleichtert mich irgendwie ein bisschen.
»Wir sind für dich da. Du kannst bei Chelsea bleiben, okay? Sie wohnt über dem Dominion Cinema in der Newbattle Terrace, im Hinterhaus. Was sagst du?«
Darüber muss ich nicht nachdenken, ich würde auch auf einer Parkbank schlafen, um bei Lali und Chelsea zu sein. Bei Kyril, bei meiner Familie. »Okay, ich packe meine Sachen und komme so schnell ich kann.«
»Pass auf dich auf, Süße.«
Ich nicke, obwohl Lali das nicht sehen kann, und unterdrücke die Schluchzer, die sich ihren Weg meine Kehle hinauf bahnen wollen. Mit einem atemlosen ins Handy gehauchten Kuss beende ich den Anruf.
Die nächste Stunde zieht an mir vorbei wie im Traum. Rastlos irre ich durch das Cottage und suche Sachen zusammen, die ich brauchen könnte, wenn ich mich höchstpersönlich auf die Suche nach Kyril mache – was ich definitiv vorhabe. Meine Wanderstiefel, wetterfeste Kleidung, einen Verbandskasten, vielleicht Nadel und Faden? Und natürlich einen Vorrat an selbst gehäkelten Spirit Dolls; in letzter Zeit habe ich mit verschiedenen Techniken experimentiert und Modelle entwickelt, die den menschlichen Körper immer detailgetreuer abbilden.
Der Wind rüttelt an den Fensterläden und für einen Moment halte ich inne. Das ist doch absurd! Wahrscheinlich sollte ich mich beruhigen und lieber versuchen, ein bisschen zu schlafen, denn wenn Kyril tatsächlich etwas zugestoßen ist, erwarten mich heute Nacht doppelt so viele Aufträge. Aber Schlaf ist so ungefähr das Letzte, an das ich jetzt denken kann. Vielleicht reagiere ich auch gerade über und es wäre besser, die Sache der Polizei zu überlassen? Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmt, also kann ich nicht einfach tatenlos herumsitzen. Mein Rucksack ist inzwischen so voll, dass sich der Reißverschluss kaum noch schließen lässt. Ich halte inne und nehme mein Portemonnaie vom Nachttisch. Der Streifen mit den Fotos, die Kyril, Lali und ich an einem meiner ersten Tage in Edinburgh geschossen haben – in einem Automaten bei Boots – ist schon etwas ausgeblichen. Ich liebe ihn trotzdem: Lali strahlt, mein Gesichtsausdruck wirkt irgendwie unentschlossen und Kyril guckt zwar ziemlich missmutig in die Kamera, hat aber niedlicherweise ein paar Sconeskrümel in den Mundwinkeln.
Inzwischen weiß ich, wie dieses Gesicht aussieht, wenn es lächelt. Wenn es glücklich ist oder besorgt, mich aufziehen oder vor der ganzen Welt beschützen will. Wenn es liebt. Lautlos laufen die Tränen über meine Wangen, ich gebe mir keine Mühe mehr, sie zurückzuhalten.
Aber ich spüre nicht nur Verzweiflung. Auch Wut breitet sich in meinem Bauch aus, immer heißer, bis ich glaube, verglühen zu müssen. Ein Gedanke, vielmehr ein Entschluss, kreist mir durch den Kopf und wird immer lauter, sodass er all meine Sorgen übertönt: Ich habe zu hart für uns gekämpft, um jetzt aufzugeben. Wir hatten zu wenige Nächte und noch weniger Tage.Und wenn ich dafür den Lauf des Schicksals ändern muss, ich schwöre dir, dass ich dich zurückhole, Kyril Ironmonger.
Lost and Found
AUREL
Der Whirlpool blubbert vor sich hin, mein Kopf ist angenehm benebelt und Wasserdampf steht so dicht im Zimmer, dass ich kaum die Hand vor Augen sehe. Ich betrachte meine Knie, die aus dem Schaumberg ragen, die Haut ist schon ganz rot. Wahrscheinlich könnte man hier drinnen ein Hähnchen dämpfen, trotzdem finde ich es immer noch zu kalt.
Aufgewirbelt von meinem eigenen Atem ziehen die dunstigen Schwaden in fantasievollen Mustern durch das Bad. Unweigerlich schweifen meine Gedanken ab. Immer sind es dieselben Tagträumereien, denn so angestrengt ich es auch versuche, mein altes Leben lässt sich nicht aussperren. Es kriecht unter dem kleinsten Türspalt hindurch. Meistens denke ich an Kyril, manchmal an Mum und in schwachen Momenten sogar an Linda. Ich bilde mir ein, dass sie mir gegenübersitzt, dass ich nicht ganz allein in einer luxuriösen Villa in den Lowlands lebe, wo ich mich vor meiner Familie verstecke, sondern mit meiner Freundin ein Wochenende irgendwo in einem Wellnesshotel verbringe. So wie ein ganz normaler junger Mann. Aber Linda ist nicht hier. Sie ist nicht einmal tot, sodass ich sie betrauern könnte. Es ist schlimmer als das.
Nach einer dreiviertel Flasche teurem, aber abgestanden schmeckenden Wein aus dem Keller von Brandon, dem alten Bibliothekar, glaube ich, eine kastanienbraune Haarsträhne auf der Wasseroberfläche zu entdecken. Sie treibt nah an mir vorbei und ich könnte sie berühren, wenn ich wollte. Aber ich tue es nicht, denn ich weiß, dass sie nur ein Trugbild ist; ein Traum. Und das ist gut so, denn im Traum kann Linda mich nicht verletzen.
Ich halte kurz inne und versuche vergeblich, meine Gedanken zu ordnen. Schließlich strecke ich doch die Hand nach dem silbrig schimmernden Flakon aus, der auf dem Stuhl neben dem Whirlpool steht. Meine Finger schließen sich um den Korken. An manchen Tagen fällt es mir schwer, das Glasfläschchen auch nur anzusehen. An anderen Tagen wiederum ist es mein Lebenselixier und ich kann gar nicht genug von den schillernden Lügen bekommen. Heute ist es wohl irgendwas dazwischen.
Ich stelle keinen Wecker, weil diese Erinnerung sowieso immer zu früh endet. Mit einem Seufzen ziehe ich den Korken heraus, schließe die Augen und gebe dem Schwindel nach, in dem sich alles, was ich bin, auflöst. Ich bin nur ein Jahr jünger, aber ein vollkommen anderer Mensch. Die Villa ist immer noch die Villa, doch sie wirkt weniger trostlos, denn sie ist voller Leben: Linda ist hier. Sie streift durch die Flure, sie läuft vor mir weg, um mich aufzuziehen. Genau genommen sehe ich nicht sie, sondern nur mich, aber inzwischen kenne ich die Geschehnisse dieses Tages so gut, dass mein Hirn automatisch das ergänzt, was nicht sichtbar ist – halb Erinnerung, halb Traum. Wir spielen Verstecken wie Kinder. Eigentlich sind wir das auch noch.
Ich finde Linda im kleinsten Raum des Hauses; einer staubigen Kammer, in der sich Kisten und Kartons bis unter die Decke stapeln. Brandon hat hier irgendwelche Belege aufbewahrt. Durch ein kleines Fenster weit oben fällt Tageslicht hinein, aber draußen dämmert es bereits. Als ich eintrete, erschreckt Linda mich und ich zucke zusammen, obwohl ich wusste, was passieren würde. Nicht nur, weil ich diesen Traum tatsächlich erlebt habe, sondern auch, weil es eben nicht meine Erinnerung ist. Es ist Lindas.
Sie kitzelt mich, bis ich vor Lachen keine Luft mehr bekomme, aber als ich sie wieder ansehe, sind da Tränen in ihren Augenwinkeln. Ihre Hände halten mein Gesicht ein bisschen fester als sonst, und ihre Lippen liegen an meinem Ohr. Sie flüstert heiser: »Ich will nicht wieder dahin zurück. Kann ich nicht einfach hierbleiben? Bitte.«
Mein Herz wird so schwer, dass ich kaum eine Antwort zustande bringe. Ich weiß, wovon sie spricht: vom Studium am Institut. Es verändert die Menschen. Linda ist zwei Jahre älter als ich und alles, was ich nur aus Erzählungen weiß, hat sie hautnah erlebt. Noch dazu kommt sie aus einem Elternhaus, in dem Perfektion gerade gut genug ist und es wenig Verständnis und noch weniger Liebe gibt. Sie wollte am Institut eine neue Familie finden, sehnte sich nach Zusammenhalt und Akzeptanz, aber sie kam vom Regen in die Traufe. Ich spüre schon lange, dass die Ausbildung und der Kampf um Bestnoten und Assistenzstellen sie langsam, aber sicher kaputtmachen. Also schlucke ich hinunter, was ich eigentlich erwidern wollte, und belüge sie: »Du kannst hierbleiben. Du kannst bleiben, solange du willst.«
Linda vergräbt ihr Gesicht in meiner Halsbeuge, es ist warm und nass. Eine Träne läuft in den Kragen meines T-Shirts. Aber als ich ihren Kopf anhebe, so zärtlich und gleichzeitig so bestimmt wie möglich, lächelt sie immer noch. Sie lächelt und sie weint. Ich weiß, dass sie alles auf einmal braucht – den Schmerz, das Lachen, das Leben. Unverfälscht und pur. Eigentlich pendelt ihr ganzes Leben zwischen Extremen.
Und obwohl eine leise Stimme in meinem Hinterkopf mich warnt, dass so etwas nie auf Dauer gut gehen kann, liebe ich sie. Ich liebe sie, wenn sie weint und wenn sie lacht und auch noch, wenn sie schreit. Ich bin stark genug, um das auszuhalten, sage ich mir. Tag für Tag. Die guten Momente machen alles wieder wett.