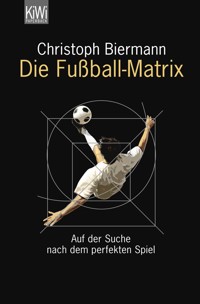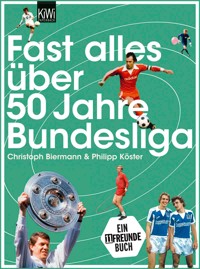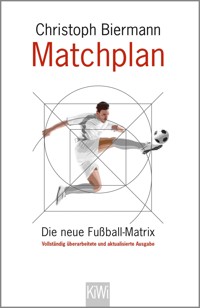
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
»Für jeden, der den heutigen Fußball besser verstehen will, ist dieses Buch Pflichtlektüre.« taz. Schon lange spricht man auch im Fußball von Digitalisierungsprozessen, aber nun ist die technologische Revolution in vollem Gange. Sie wird unser Verständnis des Fußballs auf eine Weise umwälzen, wie wir es uns früher nicht vorstellen konnten: das Spiel auf dem Rasen, das Scouting, die Trainingsmethoden, die Clubstrategien, die Berichterstattung der Medien, alles. Dieser neue Wettlauf im internationalen Fußballgeschäft ist auch einer zwischen den Großen mit den vollen Kassen und den Außenseitern, den Nerds und Regelbrechern, die mit ganz eigenen Ideen dem Fußball neue, überraschende Impulse geben. Wer in diesem Wettlauf mithalten will, braucht einen Matchplan, und das nicht nur im nächsten Spiel. Christoph Biermann hat sich inmitten dieser disruptiven Umwälzungen begeben, hat mit Wissenschaftlern, Trainern, Managern, Scouts und Psychologen in den großen deutschen Vereinen gesprochen und reiste nach England, Holland, Dänemark sowie in die USA und entdeckte den Fußball von heute noch einmal ganz neu. Eine Offenbarung für alle Fußballfans. Vollständig überarbeitete und aktualisierte Ausgabe 2020.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Christoph Biermann
Matchplan
Die neue Fußball-Matrix
Vollständig überarbeitete und aktualisierte Ausgabe
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Christoph Biermann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Christoph Biermann
Christoph Biermann, geboren 1960, ist Reporter beim Fußballmagazin 11 Freunde und arbeitete vorher für den SPIEGEL und die Süddeutsche Zeitung. Biermann gehört seit Jahren zu den profiliertesten Fußballjournalisten Deutschlands und hat zahlreiche Bücher zum Thema Fußball veröffentlicht. »Die Fußball-Matrix« wurde 2011 zum »Fußballbuch des Jahres« gewählt. 2013 erschien »Fast alles über 50 Jahre Bundesliga« (KiWi 1303), 2014 »Wenn wir vom Fußball träumen«.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Schon lange spricht man auch im Fußball von Digitalisierungsprozessen, aber nun ist die technologische Revolution in vollem Gange. Sie wird unser Verständnis des Fußballs auf eine Weise umwälzen, wie wir es uns früher nicht vorstellen konnten: das Spiel auf dem Rasen, das Scouting, die Trainingsmethoden, die Klubstrategien, die Berichterstattung der Medien, alles.
Dieser neue Wettlauf im internationalen Fußballgeschäft ist auch einer zwischen den Großen mit den vollen Kassen und den Außenseitern, den Nerds und Regelbrechern, die mit ganz eigenen Ideen dem Fußball neue, überraschende Impulse geben. Wer in diesem Wettlauf mithalten will, braucht einen Matchplan, und das nicht nur im nächsten Spiel. Christoph Biermann hat sich inmitten dieser disruptiven Umwälzungen begeben, hat mit Wissenschaftlern, Trainern, Managern, Scouts und Psychologen in den großen deutschen Vereinen gesprochen und reiste nach England, Holland, Dänemark sowie in die USA und entdeckte den Fußball von heute noch einmal ganz neu. Eine Offenbarung für alle Fußballfans.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zur Darstellung von Tabellen
Motto
Prolog
Das Abenteuer beginnt
Warum Meinungen nerven und Urteile danebenliegen
Gerechtigkeit für Vedad Ibisevic
Die wunderbare Welt der Fehlurteile
Die Macht des Zufalls
Den muss er machen!
Das Schicksal in der Unterhose
Die Tabelle lügt
Aufstand der Außenseiter
Im Land der Profiwetter
Der Mann, der Billy Beane sein wollte
Der modernste Klub der Welt
Revolution!
Mit Grips gegen Geld
Regelbrecher
Liquider Fußball
Standards auf Leben und Tod
Ein neues Bild des Spiels
Die Kunst der Videoanalyse
Der große Datenkater
Von der Strichliste zum Algorithmus
Expected Assists oder gar Pre Expected Goals Chains
Das Favre-Rätsel
Packing als Schweizer Messer
Kontrolle des Raums
Scouting im digitalen Raum
Der Scout als Held
Matchmetrics und das Sobiech-Paradox
Mit dem digitalen Filter
Die besten Daten der Welt – made in Laos
Der Wechselkurs des Transfergeschäfts
Pack den Spieler
Goalimpact oder: blindes Sehen
Die Kunst der Kaderplanung
Kognitiver Fußball
Schneller denken
Brain-Apps und Virtual Reality
Blaue Spieler
Strategien für die Zukunft
Strategiespiel
Bitte nichts Neues
Football, bloody hell
Ghosting und die beste Geschichte
Weiterlesen
Dank
Register
Da das Buch viele Tabellen enthält, empfehlen wir Ihnen das Querformat Ihres Displays zu nutzen.
»Wie sehr sich der Fußball verändert hat! Es ist alles komplizierter geworden – und schöner.«
Xabi Alonso
Prolog
Das Abenteuer beginnt
Im Frühsommer 2011 saß ich im Londoner Wembleystadion und hatte Tränen in den Augen, überwältigt von der Größe des Moments. Vier Jahrzehnte nachdem ich zum ersten Mal ein Stadion betreten hatte, wurde mir mit jeder Minute des Finales der Champions League deutlicher klar, dass ich nie zuvor ein so gutes Fußballspiel gesehen hatte. Manchester United, damals noch trainiert von Sir Alex Ferguson, war gegen den FC Barcelona des Trainers Pep Guardiola zwar großartig, aber letztlich chancenlos. Die Katalanen hatten fantastische Spieler, allen voran Lionel Messi, der zum Man of the Match gewählt wurde. Die hatte Manchester United zwar auch, doch an diesem Abend ging es nicht um die Kunst der Spieler allein, sondern darum, dass der FC Barcelona im größten Spiel des Jahres Fußball auf einer neuen Stufe der Evolution vorführte. Pep Guardiola brachte das Genie seiner Spieler so mit einem ausgefeilten Plan zusammen, wie ich das in dieser Perfektion noch nie gesehen hatte. Manchester United war, auch wenn sie nur mit 1:3 verloren, hoffnungslos unterlegen.
Obwohl geplant, war dieser Fußball leicht und frei, spielerisch und elegant. Er hatte kein drückendes Korsett, sondern schuf nur einen Rahmen für die Kreativität der Spieler. Er sah ganz neu aus, hatte aber tiefe Wurzeln, die bis ins Holland der 1960er-Jahre zurückreichen, als Johan Cruyff bei Ajax Amsterdam den »Totaalvoetbal« erst lernte und dann zu dessen Katalysator wurde. Von diesen Grundideen geprägt, war Cruyff nach Barcelona gekommen, wo er seine Spielprinzipien weiterentwickelte und damit die Nachwuchsarbeit des Klubs entscheidend prägte.
Im Spätsommer 2017 war ich wieder in London, diesmal nicht in einem Stadion voller überwältigt jubelnder Menschen, sondern im Konferenzraum eines Co-Working-Space am Themse-Ufer. Drum herum arbeiteten junge Leute mit so großer Ernsthaftigkeit wie demonstrativer Lockerheit an digitalen Projekten. Der Kaffee war gut, jeder durfte sich bedienen, und bald bestaunte ich auf einem Computerbildschirm eine große Vermählung. Ich konnte ein Fußballspiel aus unterschiedlichen Kamerapositionen anschauen, es sah fast aus, als wäre ein Ü-Wagen in das Laptop geschrumpft. Zu den Bildern ließen sich verschiedene Daten aufrufen, die von diesem Spiel erhoben worden waren, erfasst von den Spottern professioneller Datenfirmen oder von den Wärmebildkameras der Trackingsysteme. Jede Aktion auf dem Platz, jede Bewegung, jeder Weg war vermessen und gezählt worden. Bilder und Daten waren hier miteinander verbunden, wie ich das beim Fußball noch nicht gesehen hatte.
Das Unternehmen SBG hatte die Software ursprünglich für die Formel 1 entwickelt und arbeitet dort mit der Hälfte der Rennställe zusammen. Die Formel 1 ist das am stärksten technisierte Sportereignis auf diesem Planeten. An den Wagen sind Dutzende Sensoren angebracht, bei jedem Rennen werden zehn Terabyte Daten erhoben. An den Renntagen werten 200 Spezialisten den Informationsfluss aus, jedes Manöver auf der Strecke wird vorher durchgerechnet und analysiert. Im Herbst 2014 führte SBG die Software beim Rennen in Abu Dhabi den Scheichs des Emirats vor, die auch Besitzer von Manchester City sind. Als diese so etwas auch für den Fußball haben wollten, wurde das entwickelt, was ich nun in diesem fensterlosen Besprechungsraum bestaunte.
Vor zehn Jahren schrieb ich in meinem Buch »Die Fußball-Matrix« den Satz: »Fußball ist zu einem Spiel der Zahlen geworden.« Es sah damals so aus, dennoch stimmte es noch nicht. Ich war einer Täuschung aufgesessen, als ich erstmals vor den vielen Seiten voller Zahlen saß, die jedes Fußballspiel in der Bundesliga oder bei der Nationalmannschaft hervorbrachte. Jeder Schuss wurde gezählt, jeder Pass, jeder Sprint und vieles andere mehr. Aber es gab ein Problem: Die Zahlen und das Spiel kamen oft nicht zusammen. Sie standen sich teilweise ratlos gegenüber. Das galt auch für jene, die solche Daten erhoben, und jene, die das Spiel betrieben. Doch hier in London wurde mir klar, dass gerade etwas Revolutionäres passiert. Nicht nur die Menge an Daten war weiter gewachsen, sondern auch die Möglichkeit, sie zu erschließen, seit sich Informatiker und Statistiker angeleitet von Fußballexperten darüber hermachen. Noch ist nichts pfannenfertig, aber die Dinge liegen auf dem Tisch; wer sie nicht nimmt, ist selbst schuld. Ob wir es wollen oder nicht: Die digitale Wende des Fußballs hat längst begonnen.
Im Frühjahr 2017 fuhr ich auf einer Fähre vom isländischen Festland über den stürmischen Nordatlantik zur Insel Vestmannaeyjar, um Heimir Hallgrímsson zu treffen. Er war damals Nationaltrainer Islands, des Landes mit den wenigsten Einwohnern, das sich jemals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Auf Hallgrímssons altem Laptop waren keine abgefahrenen Analysetools, wie ich sie in London sehen sollte, die meisten seiner Spieler standen bei wenig glamourösen Klubs unter Vertrag, und sie spielten nicht in der Champions League – zu Auswärtsspielen flog die Nationalmannschaft Economy. Hallgrímsson zeigte mir seine kleine Insel, wo er damals sogar noch als Zahnarzt arbeitete, wenn es die Zeit zuließ. (Er entfernte mir auch den Zahnstein, aber das ist eine andere Geschichte.) Am nächsten Tag fuhr ich mit ihm durch die Hauptstadt Reykjavik, um ein paar Nachwuchsspiele anzuschauen. Man kann von Heimir Hallgrímsson so viel über Fußball lernen wie von Pep Guardiola, wenn auch auf andere Weise. Weil der Isländer mit weniger talentierten Spielern und in jeder Hinsicht begrenzten Ressourcen arbeiten muss, weiß er mit dem Mangel umzugehen. Das sorgt dafür, dass er aufmerksam für den kleinsten Vorteil ist, den er seiner Mannschaft verschaffen kann.
Der Nationaltrainer hatte sogar einen entscheidenden Vorteil gefunden und passt damit bestens zu den anderen ungewöhnlichen Helden dieses Buches. Da sind der englische Profiwetter, der sich den Klub seiner Kindheit gekauft hat, und der deutsch-amerikanische Wahlforscher, der Fußballmanager wurde. Es gibt den nordirischen Bankangestellten, der Borussia Dortmund brillant analysierte, und den struwweligen, stets unrasierten Scout des Klubs, der für eine siebenstellige Ablösesumme zum FC Arsenal wechselt. Man begegnet einem erratischen Trainer, der alle Statistiken aus den Angeln hebt, und zwei Bundesligaprofis, die zu Forschern des Spiels werden.
Ich habe sie nicht gesucht, diese ungewöhnlichen, die eigensinnigen und die schrägen Typen. Sie sind mir fast automatisch begegnet, als ich mich durch ein Terrain bewegte, das noch längst nicht abschließend kartografiert ist. Man erkennt sie schnell daran, dass sie mehr Fragen haben als Antworten und dass sie die Welt nicht erklären, sondern verstehen wollen. Sie sind Abenteurer, und das Abenteuer beginnt gerade. Sie alle treibt das Gleiche an wie Heimir Hallgrímsson: sich einen Vorteil zu verschaffen. Nur dass sie dazu eben Daten und die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen versuchen.
High-End-Fußball, wie ihn der FC Barcelona 2011 spielte, schlägt mich durchaus in den Bann, und auch die funkelnden Versprechungen des digitalen Zeitalters ziehen mich an. Aber eigentlich interessieren mich seit jeher vor allem die Underdogs und vor allem jene, die gewitzt mit dieser Rolle umgehen. Das war letztlich auch das, wonach ich suchte, als ich auf der weltweit größten Konferenz für Sports Analytics in Boston unterwegs war, bei einem winzigen Klub in Dänemark oder mit dem Hamburger Jörg Seidel sprach, der wenige Informationen in irritierend genaue Auskünfte verwandeln konnte.
Vor zehn Jahren schrieb ich auch den Satz: »Daten sind Teil einer längst noch nicht abgeschlossenen Entwicklung im Fußball, bei der sich das Spiel von einem der Meinungen in eines des Wissens verändert.« Darin drückte sich vor allem eine Hoffnung aus, denn Meinungen im Fußball nervten mich schon damals oft, weil sie so beliebig und austauschbar sind. Als ich den Satz schrieb, hatte ich aber noch keine Ahnung, auf welch abenteuerliche Weise wir Menschen zu unseren Urteilen kommen – nicht nur im Fußball. Deshalb geht es in diesem Buch auch darum, wie das anders und besser werden könnte, bei uns als Fans, aber auch bei den Verantwortlichen im Fußball. Denn die Zukunft im Fußball wird nicht einfach denen gehören, die über die Daten verfügen, sondern jenen, die aus Informationen die besten Schlüsse ziehen. Und darin unterscheidet sich der Fußball nicht von allen anderen Bereichen unseres Lebens.
Dieses Buch erschien Anfang 2018 als Paperback in Deutschland. Für die englische Ausgabe, die im Juli 2019 unter dem Titel »Football Hackers« erschien, habe ich es aktualisiert und noch einmal gründlich überarbeitet – und für diese Taschenbuchausgabe erneut. Das hat auch mit der ungeheuren Geschwindigkeit zu tun, in dem sich die Dinge verändern. Geschichte wird gemacht, und sie bleibt nicht stehen.
Berlin, Dezember 2019
Warum Meinungen nerven und Urteile danebenliegen
Zwei Fußballprofis sehen sich falsch bewertet und finden einen neuen Blick aufs Spiel. Wie wir auf Bestätigungsfehler hereinfallen und Ergebnisse von Fußballspielen überschätzen.
Gerechtigkeit für Vedad Ibisevic
Als ich Stefan Reinartz zum ersten Mal begegnete, war er 22 Jahre alt und spielte bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Wir trafen uns an einem Montagabend im Herbst 2011 bei einer Radiosendung in Köln, zu der er extra früher gekommen war, um mir etwas zu zeigen. Reinartz verunsichert die Menschen oft, wenn sie ihn das erste Mal treffen, denn er kann sein Gesicht gleichsam entleeren. Erst wenn er langsam eine Augenbraue hochzieht, ahnt man, dass sich hinter dieser verstörenden Ausdruckslosigkeit wohlmöglich ein ausgesprochen humorvoller, ja vielleicht sogar geradezu lustiger Mensch verbirgt. Doch damals wusste ich das nicht, und so kam es mir vor, als würde dieser nun wahrlich nicht kleine Mann wie ein Staatsanwalt vor mir stehen. In einer Mappe hatte er Benotungen von Bundesligaspielern mitgebracht, wie man sie an jedem Wochenende in vielen Ländern in Zeitungen und auf Websites findet. Sie waren das Beweismaterial für seine Anklageschrift. Mit dem leisen Unterton der Empörung breitete er sie vor mir auf einem Tisch aus und zeigte, dass die Leistung seines damaligen Mannschaftskameraden Renato Augusto, eines brasilianischen Nationalspielers, beim Unentschieden von Bayer gegen den SC Freiburg nach Ansicht der Lokalzeitung Kölner Stadt-Anzeiger »gut« gewesen war. Das Fußballmagazin kicker und Deutschlands größte Boulevardblatt Bild hingegen sahen seine Leistung als »mangelhaft«. Wäre Renato Augusto ein Schüler gewesen, hätte das seine Versetzung gefährdet. Insgesamt sah das Spektrum der Bewertungen in englische Schulnoten übersetzt so aus
Kölner Stadt-Anzeiger
Sport1
Rheinische Post
kicker
Bild
2
2,5
4,5
5
5
Dem Stürmer Vedad Ibisevic war es am selben Wochenende nicht anders ergangen, als er mit der TSG Hoffenheim in Bremen spielte. Auch bei ihm waren sich die Berichterstatter der Zeitungen und Internetportale nicht einig, ob seine Leistung nun gut war, ganz ordentlich oder schlichtweg mangelhaft:
Westdeutsche Zeitung
Sportal
Sport1
kicker
Bild
2
3
3,5
4
5
Reinartz hatte noch eine Reihe ähnlicher Beispiele mitgebracht und stellte mir als Vertreter seiner Berufskollegen die naheliegende Frage: »Wie kommen die Noten zustande?«
Das Verfahren war damit eröffnet, und mir war nicht ganz klar, ob er die Antwort darauf nicht längst wusste. Also erklärte ich ihm in beschwichtigendem Ton, dass einige Journalisten mit dem Schreiben ihres Spielberichts schon anfangen müssten, während die Partie noch läuft, damit er kurz nach Abpfiff fertig ist. Dass sie unter diesen Bedingungen gar nicht alle Details einer Partie mitbekommen könnten. Wenn sie Noten vergeben müssten, machten sie diese an einer oder zwei auffälligen Szenen eines Spielers fest, die sie mitbekommen oder vielleicht nur auf den Monitoren vor sich in der Wiederholung gesehen hätten. Doch selbst wenn man genug Zeit hätte, wie wollte man elf Spieler – oder vielleicht sogar 22 Kicker – angemessen bewerten? Zumal natürlich kein Bewerter bei der Mannschaftsbesprechung dabei gewesen sei und folglich nicht wissen könne, ob ein Außenbahnspieler deshalb so selten mit nach vorne gegangen sei, weil er nicht in Form war oder weil der Trainer es ihm aufgetragen hatte. Ich erzählte ihm, dass manche Reporter bei der Notenvergabe auf der Pressetribüne immerhin kleine Umfragen machten, Schwarmintelligenz im Stil von: »Reinartz, 3 oder 4?« Natürlich kommt es auch vor, dass einige Reporter schlichtweg keine Ahnung vom Spiel haben oder dass ihre Benotung Ausdruck politischer Winkelzüge ist. Dass sie also jene Spieler tendenziell besser bewerten, die ihnen ab und zu mal Informationen aus dem Innenleben der Mannschaft zustecken. Oder jene abstrafen, die dabei nicht mitmachen oder gar einen anderen Journalisten bevorzugen. Das passiert heute zwar deutlich seltener als früher, aber ganz ausgestorben ist diese Praxis nicht.
Insgesamt plädierte ich auf mildernde Umstände, und Reinartz schien damit einverstanden, wenn auch nicht zufrieden zu sein. Interessant fand ich aber, dass er es nicht generell infrage stellte, bewertet zu werden. Im Gegenteil: Bewertungen waren ein selbstverständlicher Teil seines Lebens. Reinartz war schon als Zehnjähriger zu Bayer Leverkusen gekommen und hatte von der U16 bis zur U21 in allen Jugendnationalteams des DFB gespielt. Als Nachwuchsspieler war er jeden Tag mit Urteilen über sich konfrontiert gewesen. Hatte er so gut trainiert, dass er am Wochenende eingesetzt werden würde? War seine Leistung ausreichend, um in der nächsten Altersklasse als Jugendspieler dabeizubleiben? Wie oft Reinartz im Laufe der Jahre wohl erlebt hatte, dass einer seiner Mitspieler für zu langsam, zu klein, für technisch nicht gut genug, taktisch mangelhaft oder mental zu schwach gehalten und deshalb aussortiert worden war? Nicht einmal alle Spieler, mit denen er noch 2010 in der U21-Nationalmannschaft gespielt hatte, schafften es in die Bundesliga.
Als Profi ging es weiter so: War er im Bundesligateam besser als sein Konkurrent auf dieser Position? War er vielleicht sogar besser als die meisten deutschen Spieler auf dieser Position und damit ein Kandidat fürs Nationalteam? Andererseits: Wäre es nicht sinnvoller, wenn er statt im Mittelfeld in der Abwehr spielen würde? Doch nichts davon stellte Stefan Reinartz infrage, seine Beschwerde über die offensichtlich fragwürdigen Benotungen in den Medien hatte eine andere Stoßrichtung: Wenn er schon ständig bewertet wurde, sollte das möglichst objektiv und gerecht sein. Wie sich zeigen sollte, hatte er damit für sich ein Lebensthema gefunden.
Offenbar war ich nach unserer ersten Begegnung freigesprochen worden. Wir blieben jedenfalls in Kontakt, telefonierten ab und zu mal oder liefen uns an seltsamen Orten über den Weg. Denn normalerweise trifft man auf Konferenzen über Spielanalyse keine aktiven Fußballprofis und meistens nicht mal ehemalige. Gut zwei Jahre nach unserem Gespräch meldete Reinartz sich mit dem Wunsch bei mir, »sie« würden gerne einen Kaffee mit mir trinken gehen, um mich »mal was zu fragen«. Als ich wissen wollte, wer denn »sie« seien, sagte er, das seien er und sein langjähriger Leverkusener Mitspieler Jens Hegeler, der damals bei Hertha BSC in Berlin spielte. Reinartz hatte auch gerade den Verein gewechselt, von Leverkusen zu Eintracht Frankfurt. Wir trafen uns an einem kalten Winternachmittag in einem Berliner Café, und dort entspann sich ein seltsames Gespräch. Die beiden begannen relativ umweglos, mich über den Gebrauch von Spieldaten im Fußball auszufragen. Letztlich interessierte sie vor allem eins: Gibt es Daten, die darüber Auskunft geben, wie man Spiele gewinnt? Muss man also weiter laufen, häufiger sprinten, genauer passen, mehr Torschüsse abgeben, um als Sieger vom Platz zu gehen?
Offenbar hatten Reinartz und Hegeler häufiger erlebt, dass Trainer solche Statistiken als Argumentationsgrundlage benutzten. Sie hatten Sätze gehört wie: »Wenn wir heute mehr Zweikämpfe als der Gegner gewinnen, werden wir gewinnen.« Oder dass sie mehr laufen oder mehr Sprints machen oder besser passen müssten, um den Gegner zu besiegen. Ich konnte ihnen nur die Antwort geben, die sie selbst schon kannten: Es war bestimmt nicht falsch, mehr zu laufen, besser zu passen und zu schießen, aber den Sieg quasi garantierende Parameter gab es nicht. Wenn Trainer ihnen so etwas erzählten, sei das Unfug.
Die beiden waren mit dieser Auskunft zufrieden und rückten anschließend langsam damit heraus, weshalb sie mich ausgefragt hatten. Gemeinsam waren sie nämlich zu dem Schluss gekommen: Wenn die bisherigen Daten nichts taugen, müssen bessere her! Ihre Grundidee dazu war, die Zahl überspielter gegnerischer Spieler zu ermitteln. Das Ergebnis ließen sie gerade durch einen Sportwissenschaftler überprüfen, den sie aus eigener Tasche bezahlten. Wie wir noch sehen werden, wurde daraus eine große Sache.
Ich fand es unglaublich, dass sich zwei aktive Bundesligaspieler daranmachten, mit neuen Daten den Fußball revolutionieren zu wollen. Dass sie darauf so viel Energie verwendeten, war auch Ausdruck eines sympathischen Bemühens um Gerechtigkeit. Es zeugte von Trotz gegenüber dem dummen Zeug, das sie sich als Spieler gelegentlich von Trainern hatten anhören müssen. Für mich gehörten die beiden damit zu jenen Spielern, von denen es in jeder Generation nur wenige gibt, die das Spiel nicht nur spielen, sondern auch verstehen wollen. Viele von ihnen werden später Trainer oder Manager, doch den Weg über die Analytik war bislang niemand gegangen.
Zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich erfuhren die deutschen Fernsehzuschauer dann, was mir Reinartz und Hegeler drei Jahre zuvor in Grundzügen erklärt und anschließend weiterentwickelt hatten. Unverhofft wurde ein Millionenpublikum vor dem Fernseher mit einem neuen Begriff konfrontiert: Packing. Dafür verantwortlich war der ehemalige Nationalspieler Mehmet Scholl, der damals als Fernsehexperte arbeitete. Er war so begeistert von dem Konzept, dass er die EM-Spiele anhand von Packing erklären wollte. Doch so richtig funktionierte das nicht, was auch daran lag, dass Scholl ein sehr komplexes Verfahren so zu vereinfachen versuchte, dass es nicht mehr schlüssig, sondern banal wirkte. Vielleicht wurde es schlicht zu wenig erklärt, auf jeden Fall blieb Packing unverständlich. Das war schade, denn wie wir noch sehen werden, kann man ungeheuer viel damit anfangen. Doch für nicht wenige Fans war Packing ein Musterbeispiel der verdammenswerten Entwicklung, dass etwas im Kern Einfaches wie Fußball von aufgeblasenen Wichtigtuern unnötig verkompliziert wurde.
Der Fußball lebt ganz entscheidend davon, dass jeder eine Meinung dazu haben darf. Oder anders gesagt: Fußball lebt davon, dass wir die Spiele und ihre Akteure bewerten dürfen. Noten für Fußballspieler sind in Medien auch deshalb so beliebt, weil wir anhand davon unsere eigenen Meinungen abgleichen können. Und leben wir nicht sowieso in einem Zeitalter des Castings und der Dauerbewertung, in der jeder Juror ist? Überall werden wir aufgefordert: »Sagen Sie uns Ihre Meinung! Was halten Sie von …?« Facebook, Twitter, Instagram und andere soziale Netzwerke sind Orte massenhafter Bewertung.
Weil Fußball ein emotionales Spiel ist, sind die Meinungen darüber oft nicht sorgfältig abgewogen, sondern gefühlsgesteuert. Wir wollen jene feiern, die entscheidende Tore für unsere Mannschaft schießen, und jene verdammen, wegen deren Fehlern wir an Niederlagen leiden. Fußball ist aber nicht nur ein wunderbar einfaches, emotional mitreißendes Spiel, sondern auch ungeheuer komplex. Interessanterweise wird Fußball sogar immer komplexer, je länger man sich damit beschäftigt.
Bei mir hat das im Laufe der Jahre dazu geführt, dass ich mich mit Bewertungen eher schwerer als leichter tue. Logisch wäre eigentlich das Gegenteil, schließlich hatte ich das Glück, Hunderte von Spielen auf höchstem Niveau sehen zu dürfen, und das Privileg, mich immer wieder mit großartigen Trainern, tollen Managern und interessanten Spielern austauschen zu dürfen. Ich habe aus nächster Nähe miterleben können, wie das Wissen über Fußball beständig größer geworden ist. Es kommt mir so vor, als ob wir stets Neues über das Spiel lernen und es besser verstehen. Die interessante Frage ist nur: Was machen wir damit?
Die wunderbare Welt der Fehlurteile
Jörg Schmadtke ist einer der erfolgreichsten Manager der Bundesliga des letzten Jahrzehnts, jedenfalls wenn man nicht auf Titelsammlungen oder Tabellenpositionen allein schaut. Denn Schmadtke ist, seit er 2001 bei Alemannia Aachen in der Zweiten Bundesliga erstmals Manager wurde, weder deutscher Meister geworden, noch hat er den Pokal geholt. Außergewöhnlich ist Schmadtkes Leistung, weil er überall beständig über den Möglichkeiten blieb. Er führte die hoch verschuldeten Aachener nämlich nicht nur ins Pokalfinale und dadurch in den Europapokal, sondern 2007 nach über drei Jahrzehnten in der Zweitklassigkeit sogar wieder in die Bundesliga. Als Schmadtke von 2009 bis 2013 Sportdirektor bei Hannover 96 war, qualifizierte sich der Klub zweimal für die Europa League und spielte die beste Bundesligasaison seiner Vereinsgeschichte. Den damaligen Zweitligisten 1. FC Köln führte er nicht nur in die Bundesliga zurück, sondern 2017 erstmals nach 25 Jahren wieder in einen internationalen Wettbewerb.
In der Bundesliga gibt es unterschiedliche Interpretationen des Jobs eines Sportdirektors, bei Schmadtke hat immer das Scouting von Spielern eine besondere Rolle gespielt. Oft war er quasi der Chefscout und selbst viel unterwegs, dabei gelang es ihm immer wieder, spektakuläre Stürmer zu verpflichten. Bemerkenswert ist, dass Schmadtke sich beim Scouting unbewusst einem der großen Probleme im Fußball stellt, den allgegenwärtigen Wahrnehmungsfehlern. »Ich habe früher meine Scouts manchmal losgeschickt und ihnen nicht gesagt, an welchem Spieler ich interessiert bin«, erzählte er mir, als wir uns in London an jenem Tag trafen, an dem der 1. FC Köln beim FC Arsenal den ersten internationalen Auftritt seit einem Vierteljahrhundert hatte. Dass Schmadtke seine Scouts so rätseln ließ, war kein schräger Test ihrer Fähigkeiten oder eine Gehässigkeit, um sie zu verunsichern. »Es ging mir darum, dass sie unvorbelastet ins Spiel gehen, und idealerweise sollte der beste Spieler für sie der sein, der mich interessierte.« Schmadtke verengte den Blick seiner Scouts also nicht, er öffnete ihn, indem er intuitiv versuchte, das zu vermeiden, was in der Verhaltensökonomie Confirmation Bias genannt wird. Wenn ein Scout weiß, dass sein Sportdirektor an einem bestimmten Spieler interessiert ist, wird er diesen vielleicht anders wahrnehmen, als wenn er unvoreingenommen auf das Spielfeld blickt. Wir neigen nämlich dazu, Informationen auszufiltern, die nicht in unser Weltbild passen.
Doch das ist nur eine Variante dieses Bestätigungsfehlers, den es in einer Fülle unterschiedlicher Ausdrucksformen gibt. Wenn ein Scout dynamisch-kämpferische Spieler besonders mag, wird er vielleicht eher dazu neigen, technische Schwächen oder Mängel im Spielverständnis zu übersehen oder zumindest unterzubewerten. Mag er hingegen elegante Fußballer, wird er bei denen eventuell dazu neigen, vorhandene Schwächen im Spiel gegen den Ball milder zu bewerten.
»Wenn mir kalt wird, wird es schwierig«, sagte Schmadtke. Dann werde er nämlich übellaunig, und das Urteil über einen Spieler, den er gerade beobachte, falle möglicherweise schlechter aus, als es an einem lauschigen Sommerabend der Fall wäre. Wie vielen Spähern mag es an einem verregneten Nachmittag in Osteuropa oder an einem eisigen Abend in Skandinavien ähnlich ergangen sein? Bibbernd und in mieser Stimmung übersahen sie vielleicht das raffinierte Spiel eines Außenverteidigers oder die Durchsetzungskraft eines Mittelstürmers, die dann zum Konkurrenten wechselten, weil dessen Späher bei Sonne und gutem Wetter kamen. Oder man überschätzt einen Spieler, weil man sich an einem lauschigen Frühsommerabend unter südlicher Sonne in einem mit gut gelaunten Zuschauern voll besetzten Stadion befindet.
In den letzten Jahren ist den Wahrnehmungsfehlern allenthalben viel Aufmerksamkeit geschenkt worden. Das hat nicht zuletzt mit der Arbeit des israelischen Ökonomen Daniel Kahnemann zu tun, der für seine Arbeit auf diesem Feld mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet wurde. Sein Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« war sogar ein globaler Bestseller. Er und andere Forscher haben inzwischen 188 Arten von Wahrnehmungsfehlern beschrieben, die teilweise miteinander verwandt oder verbunden sind. Immer sind sie auf die gleiche Ursache zurückzuführen: Wenn wir schnell denken, also nicht geduldig und analytisch, überschätzen wir uns und kommen zu Urteilen und Schlüssen, die schlichtweg nicht besonders gut sind. Sie sind damit sozusagen die übergeordnete Kategorie jener Probleme, die Stefan Reinartz und Jens Hegeler dazu brachten, ihre eigenen Spieldaten zu entwickeln. Wobei Daten allein nicht zwangsläufig zu besseren Urteilen führen, denn man kann auch sie wunderbar in Bestätigungsfehler verwandeln. Wenn man sich bei der Bewertung eines Spielers nämlich einfach jene Statistiken herauspickt, die den eigenen Eindruck bestätigen, und jene übersieht, die ihm widersprechen. Auch Trainer tun das mitunter, wenn sie mit Blick auf die Zahlen etwa kopfschüttelnd feststellen, dass ein Spieler deutlich weniger Zweikämpfe geführt hat als üblich, wie sie schon vermutet hatten, dafür aber vielleicht übersehen, dass dieser Spieler deutlich mehr Sprints angezogen hat, um gegnerische Passwege zu verstellen.
Als Fußballfan versteht man sofort, warum der große schweizerische Schriftsteller Max Frisch seine Romanfigur Theo Gantenbein sagen lässt: »Wir probieren Geschichten an wie Kleider.« Den Fußball kann man als eine gigantische Geschichtenfabrik betrachten, denn jede Saison ist wie eine Staffel einer großen Serie namens »Bundesliga«, »Champions League« oder »Weltmeisterschaft«. Sie entwickelt ihren eigenen Plot, und je mehr verrückte Wendepunkte die Geschichte hat, umso besser. Es gibt Außenseiter, die unverhofft zu Helden werden, ob Mannschaften oder Spieler. Jeder Wettbewerb, jede Liga, jeder Klub schreibt seine Story. Wer hat nicht die Geschichte von Leicester City geliebt, des größten Außenseiters, der jemals englischer Meister wurde? Und die seines Torjägers Jamie Vardy, dessen Karriere eigentlich schon gescheitert schien, als er in einem unterklassigen Amateurklub kickte und dabei eine elektronische Fußfessel tragen musste, weil er wegen Körperverletzung verurteilt war? Und es gibt jene Mannschaften, von denen es niemand erwartet, dass sie in eine Krise geraten. Wie ebenjener 1. FC Köln just in der Saison, als er endlich in den Europapokal zurückkehrte. Was übrigens dazu führte, dass Jörg Schmadtke den Klub im Laufe der Saison verließ. Als Max Frisch von den Geschichten sprach, die wir anprobieren wie Kleider, beschrieb er genau das, was in Köln passierte. Eben noch passte die Geschichte vom zwar eigensinnigen, aber genialen Manager mit dem perfekten Auge für Talente wie angegossen, dann musste schon die nächste her. In diesem Fall vom Manager, der zu eigensinnig geworden war und darüber den Blick für Spieler verloren hatte.
Als Sportvorstand des VfL Wolfsburg hingegen begann Schmadtke die alte Geschichte wieder fortzuschreiben. Hatte der Klub 2018 noch in der Relegation um den Klassenerhalt in der Bundesliga spielen müssen, erreichte er im Sommer 2019 die Europa League. Einen Spitzenstürmer hatte Schmadtke auch gleich wieder gefunden: den Holländer Wout Weghorst, der für knapp elf Millionen Euro aus Alkmaar kam und in seiner ersten Bundesligasaison gleich 17 Tore schoss.
Wie diese Geschichtenproduktion funktioniert, wissen wir von uns selbst. Wir versuchen schließlich auch, aus den vielen Momenten und Einzelwahrnehmungen unseres Lebens eine irgendwie schlüssige Erzählung über uns zusammenzubasteln. Was da erzählt wird, ist zudem in beständigem Wandel. Kaum jemand erzählt heute noch dieselbe Geschichte über sich wie vor zehn Jahren. Andere Umstände sind wichtiger geworden, während wir den Lebensweg weitergegangen sind, und deshalb schauen wir auch auf unsere Vorgeschichte wieder anders. Das ist übrigens nicht notwendigerweise eine Lüge oder eine mutwillige Verbiegung der Fakten, sondern einfach der tief verwurzelte Wunsch, alles in sinnvoll schlüssig erscheinende Geschichten zu packen. Auch dafür gibt es einen Begriff: Story Bias.
Schauen wir beim Fußball, welche Geschichten wir anprobieren, wenn Trainer von Spiel zu Spiel große taktische Veränderungen vornehmen, viele Spieler wechseln oder gar beides tun. Bei Pep Guardiola ist das inzwischen zum festen Bestandteil der Story über ein Genie geworden, das die Grenzen des Denk- und Machbaren im Fußball immer weiter hinausschiebt. Diese positive Wahrnehmung hat aber nicht zuletzt damit zu tun, dass die von Guardiola betreuten Teams meistens gewinnen. Das jedoch ließe sich auch dadurch erklären, dass Guardiola stets die teuersten oder zweitteuersten Mannschaften eines Landes trainiert hat, die den meisten Konkurrenten also wirtschaftlich klar überlegen waren. In Barcelona, München und Manchester arbeitete er daher mit den besten Spielern zusammen. Meistens hatten sie in den Jahren vor ihm schon gewonnen und taten es weiter, nachdem Guardiola weg war. Vermutlich hätten diese Teams die meisten Spiele auch ohne avancierte taktische Entscheidungen gewonnen.
Trainer, die taktische Variabilität bei Klubs versuchen, die nicht so wirtschaftsstark sind und folglich öfter mal als Verlierer vom Platz gehen, laufen hingegen Gefahr, eine andere Story verpasst zu bekommen. Bei ihnen heißt es schnell, »Sie haben ihre Mannschaft noch nicht gefunden« oder »Ihnen fehlt die klare Linie«. Im Englischen gibt es sogar einen eigenen Begriff dafür: Tinkerman. Das sind Trainer, die an Aufstellung und Taktik herumbasteln, und – man ahnt das schon – diese Bezeichnung ist nicht nett gemeint. Ein berühmter Tinkerman war Claudio Ranieri – bis er beim Sensationsmeister Leicester City zum Genie aufstieg, dem in Leicester sogar ein Denkmal gebaut wurde. Er spielte in jener Saison fast immer mit der gleichen Startaufstellung und setzte weniger Spieler ein als die meisten anderen Teams der Liga. Als er in der Saison darauf mit seiner Mannschaft in der Champions League spielte, aufgrund der Belastung häufiger die Startformation veränderte und erwartungsgemäß mehr Spiele verlor, stand er bald wieder unter dem Verdacht, an seiner Mannschaft herumzubasteln. Geschichten zu erzählen, gehört eben zur menschlichen Grundausstattung, und wir können dem kaum entgehen, selbst wenn wir wollten. Es ist aber nicht unbedingt hilfreich, wenn man Probleme analysieren und lösen will.
Wahrnehmungsfehler gibt es überall: bei der Arbeit, in den Beziehungen zu Menschen oder bei der Bewertung politischer Vorgänge. Und so finden sie sich in großer Zahl auch im Fußball. Die Clustering Illusion etwa lässt uns in der Häufung von Ereignissen vermeintliche Muster ausmachen. Wenn eine Mannschaft also in zwei Spielen hintereinander Gegentore nach Eckbällen oder Freistößen bekommen hat, beginnt mit Sicherheit eine Diskussion über die Anfälligkeit nach Standards. Bei späten Gegentreffern wird bestimmt über die körperliche Verfassung des Teams geredet. Das mag in beiden Fällen sogar richtig sein, aber nach wenigen Spielen können wir darüber keine haltbare Aussage machen, weil die Datengröße einfach zu klein ist.
Im Fußball besonders beliebt ist der Hindsight Bias, also der Rückschaufehler. Man kann ihn in einem Satz so zusammenfassen: Wir haben es hinterher immer schon vorher gewusst. Wenn eine Mannschaft überraschend an der Spitze steht oder unversehens im Abstiegskampf landet, denkt man wahrscheinlich irgendwann: Das hatte ich doch geahnt. (Was auch damit zu tun hat, dass wir unsere Fähigkeit zu urteilen sowieso ständig überschätzen.) Wir haben daher immer schon geahnt, dass aus einem Spieler etwas wird oder eben nicht. Gut, kaum jemand wird behaupten, dass er das Wunder von Leicester und den Aufstieg von Jamie Vardy zu einem Superstar vorausgesagt habe. Aber ansonsten haben wir eine starke Neigung, unsere Voraussagen besser in Erinnerung zu haben, als sie wirklich waren. Eine schöne Übung in Demut ist es daher, seine Voraussagen vor einer Saison mal aufzuschreiben und hinterher draufzuschauen.
In der Natur des Fußball als eines Spiels, in dem anders als im Basketball oder Handball schon ein Tor entscheiden kann, liegt es, dass Einzelereignisse in unserer Erinnerung stärker hängen bleiben. Fußball ist daher in der Wahrnehmung vieler Fans ein Spiel der großen Momente. Ein fantastisches Tackling, ein tödlicher Pass und natürlich der Fernschuss in den Winkel bleiben in Erinnerung. Diese Momente werden oft über Jahre weitererzählt, um sie ranken sich Mythen, und sie bestimmen unsere Wahrnehmung des Spiels. Der Begriff der Verfügbarkeitsheuristik beschreibt unsere Annahme, dass etwas wichtig sein muss, wenn man sich daran erinnert. So gibt es Stürmer, bei denen man sich vor allem an ihre vergebenen Großchancen erinnert. Oder man wird immer wieder an sie erinnert, weil sie in den sozialen Netzwerken immer wieder auf Vorlage kommen. In jedem Land gibt es andere Erinnerungen. Die größte vergebene Torchance der Bundesligageschichte geht auf den Dortmunder Stürmer Frank Mill, der bei einem Spiel beim FC Bayern nicht nur alleine auf den Münchner Torwart zulief, sondern Jean-Marie Pfaff auch noch umspielte, um dann aus fünf Metern Entfernung den Außenpfosten zu treffen. Das Gegenstück dazu in England ist eine vergebene Torchance von Liverpools Stürmer Ronny Rosenthal gegen Aston Villa. »Den hätte sogar meine Oma reingemacht«, heißt es dort bis heute.
Auch in einem Sportspiel wie Basketball gibt es natürlich Würfe, die Meisterschaften entschieden haben und unvergesslich geblieben sind. Aber wie sollen beim 102:93 einzelne Würfe die Story eines Basketballspiels definieren? Vielleicht ist auch so zu erklären, dass Spiele, in denen viele Punkte gemacht oder viele Tore erzielt werden, strukturierter und komplexer wahrgenommen werden als Fußball. Im Fußball hält man sich an Einzelmomenten fest und interpretiert das Spiel von dort. In den US-Sportarten funktioniert das nicht, und vielleicht erklärt auch das die Allgegenwart statistischer Analysen.
Nun könnte man sagen, dass all diese Wahrnehmungsfehler eben zur Folklore des Fußballs gehören und sogar einen Teil des Vergnügens ausmachen. Das ist aus der Perspektive des Fans nicht falsch, problematisch wird es nur, wenn wichtige Entscheidungen auf der Basis von Wahrnehmungsfehlern gefällt werden. Wenn also Manager, Trainer oder sonstige Entscheider eher passende Geschichten ausprobieren, als eine Situation sorgfältig zu analysieren, wenn sie also schnell denken und nicht langsam.
Das gilt vor allem im Zusammenhang mit der Mutter aller Wahrnehmungsfehler im Fußball, dem sogenannten Outcome Bias. Damit ist unsere Tendenz gemeint, Bewertungen vom Ergebnis her zu konstruieren und uns nicht mit den Intentionen zu beschäftigen. Einfacher gesagt: Wenn etwas geklappt hat, gehen wir eher davon aus, dass der Plan oder die vorangegangenen Entscheidungen richtig waren. Stimmte das Ergebnis nicht, müssen sie schlecht gewesen sein. Im Fußball schlägt das besonders durch, weil jedes Spiel ein Ergebnis hat, sogar ein in Zahlen messbares. Hat eine Mannschaft verloren, werden die Leistungen der Spieler oder die taktischen Entscheidungen der Trainer meistens deutlich kritischer gesehen als bei einem Sieg. Nun kann man einwenden, dass das doch, bitte schön, angemessen ist. Das mag sein, allerdings sind wir schon beim nächsten ganz großen Problem des Fußballs, denn zwischen Leistung und Ergebnis klafft oft genug eine Lücke.
Die Macht des Zufalls
Zufall spielt im Fußball eine größere Rolle, als wir wahrhaben wollen, inzwischen können wir ihn sogar berechnen. Und wenn Jürgen Klopp das getan hätte, wäre er vielleicht nie Trainer des FC Liverpool geworden.
Den muss er machen!
Als das Ende verkündet wurde, hatten alle Tränen in den Augen. Am 15. April 2015 saß Jürgen Klopp, damals noch Trainer von Borussia Dortmund, neben Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc im Presseraum des Dortmunder Stadions, und es wurde eine bewegende Pressekonferenz. Es galt, den Abschied von Jürgen Klopp zu verkünden, denn am Ende der Saison würde er den Verein verlassen, nach sieben Jahren mit zwei deutschen Meistertiteln, einem Pokalsieg und dem Erreichen des Finales der Champions League. Klopp würde einen völlig veränderten Klub hinterlassen: Als er gekommen war, war der BVB knapp der Insolvenz entgangen – nun stand er wirtschaftlich stark und in der ganzen Welt für seinen aufregenden Fußball bestaunt da.
Mit brüchiger Stimme sprach Watzke seinem Trainer »ewigen Dank« aus und beschwor ihre persönliche Freundschaft. Kurz standen sie auf, um sich zu umarmen. Dann sagte Klopp: »Für mich war immer klar: In dem Moment, wo ich nicht mehr der perfekte Trainer für diesen außergewöhnlichen Klub bin, würde ich es sagen. Ich war mir nicht sicher, dass ich es nicht mehr bin. Aber ich konnte es nicht eindeutig bejahen.«
Als sie das Ende einer Ära ankündigten, war der BVB Zehnter in der Bundesliga. Vor der Saison hatte Klopp den Abgang des Bundesliga-Torschützenkönigs Robert Lewandowski zum FC Bayern zu beklagen gehabt, des wichtigsten Spielers seiner Mannschaft. Die Dortmunder hatten nicht einmal eine Ablösesumme bekommen, weil sie den Polen bis zum Ablauf des Vertrags hielten. Er war durch den Torschützenkönig der Serie A ersetzt worden, den Italiener Ciro Immobile. Von Hertha BSC war der Stürmer Adrian Ramos gekommen, und Dortmunds Publikumsliebling Shinji Kagawa war von Manchester United zurückgekehrt, wo er sich nicht hatte durchsetzen können. Dazu kam noch der als hoch talentiert geltende Defensivspieler Matthias Ginter aus Freiburg. Die Transfers hatten insgesamt gut 50 Millionen Euro gekostet, für damalige Verhältnisse in der Bundesliga war das eine gewaltige Investition.
Die Saison begann spektakulär, wenn auch nicht auf eine Weise, wie Klopp sich das gewünscht hätte. Beim ersten Bundesligaspiel, an einem schönen Augustsamstag in Dortmund, ging der Gast aus Leverkusen schon nach neun Sekunden in Führung. Es war das schnellste Tor der Bundesligageschichte, am Ende siegte Bayer mit 2:0. Es war der missratene Auftakt einer schlimmen Hinrunde. An deren letztem Spieltag war der Tiefpunkt erreicht, Borussia verlor 1:2 in Bremen, und wäre die Niederlage nur ein Tor höher ausgefallen, hätte der Bundesligazweite des Vorjahres seine schlechteste Hinrunde seit fast drei Jahrzehnten als Tabellenletzter abgeschlossen. »Wir stehen da wie die Vollidioten«, stellte Klopp fest.
Doch nach dem Ende der Hinrunde veröffentlichte der Blogger Colin Trainor auf der englischen Website statsbomb.com eine wegweisende Analyse der Situation in Dortmund. Trainor lebt in der nordirischen Grafschaft Armagh und war weder Insider noch Fan des BVB, er hatte in jener Saison nicht mal ein Spiel der Borussen gesehen. Der Wirtschaftsprüfer bei einer Bank war einfach neugierig gewesen, warum eine der besten Mannschaften Europas der vorangegangenen Jahre plötzlich im Tabellenkeller gelandet war. Um die Situation zu analysieren, stützte er sich ausschließlich auf Spielstatistiken der Bundesligasaison.
»Der Gebrauch von Analytik kann uns zu beurteilen helfen, ob bestimmte Ergebnisse aus großen Fähigkeiten resultieren oder einfach zufälligen Umständen geschuldet sind«, schrieb Trainor. Auf der Suche nach einer Antwort im Dortmunder Fall kam er zu der Einschätzung, dass Klopps Mannschaft in der Hinrunde der Saison 2014/15 25 Tore hätte schießen müssen, während sie in Wirklichkeit nur 17 Treffer erzielt hatte. Eigentlich hätte sie auch nur 17 Gegentreffer hinnehmen dürfen statt der 26, die sie kassiert hatte. Anstelle eines Torverhältnisses von 18:26, das die Bundesligatabelle auswies, hätte es also 25:17 heißen müssen. Daraus folgte: Viele Spiele hätten anders ausgehen müssen, als es der Fall gewesen war. Aufgrund der aus diesen Ergebnissen abgeleiteten Expected Points (xPts) kam Trainor zu einem spektakulären Ergebnis: Klopps Mannschaft hätte nicht auf dem vorletzten, sondern auf dem vierten Platz stehen müssen.
Position
Mannschaft
xPts
Punktestand
Abweichung
1
Bayern München
41
45
+4
2
VfL Wolfsburg
30
34
+4
3
Bayer Leverkusen
30
28
–2
4
Borussia Dortmund
30
15
–15
5
Eintracht Frankfurt
26
23
–3
Quelle: statsbomb.com
Nur, wie kam dieser Typ aus Nordirland, der kein Spiel des BVB gesehen hatte, zu der verwegenen Behauptung, dass die Dortmunder 15 Punkte mehr hätten haben müssen?
Um das zu verstehen, müssen wir uns bewusst machen, dass Fußball ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten ist. Jeder Fußballfan hat irgendwann schon mal den Satz gesagt: »Den muss er machen!« Man würde diesen Satz sagen, wenn ein Stürmer aus fünf Metern unbedrängt aufs Tor köpft oder einen Ball nur noch ins leere Tor schieben muss. Wie Frank Mill oder Ronny Rosenthal. Über einen Schlenzer von der Strafraumkante ins lange Eck hingegen würden wir das nicht sagen. Wir gewichten Abschlüsse nämlich intuitiv danach, wie groß die Chance ist, dass sie ins Tor gehen. Wir tun das bei jedem Spiel, wenn wir mit anderen Fans darüber diskutieren, welche Mannschaft den Sieg verdient hat. Klar, das ist die Mannschaft mit den besseren Chancen!
Wir gehen das nicht systematisch an und versuchen die Größe einer Torchance genau zu quantifizieren, aber das ist möglich. Nehmen wir den einfachsten Fall: den Elfmeter. Die Chance, dass ein Elfmeter ins Tor geht, beträgt in der Bundesliga 74,69 Prozent. Von den 4561 Elfmetern, die von ihrem Start im Jahr 1963 bis zum 1. Januar 2018 verhängt wurden, gingen 3474 ins Tor. Der Rest, fast ein Viertel, wurde gehalten, flog am Tor vorbei oder wurde im Nachschuss verwandelt. Dieser Wert gilt übrigens mit minimalen Abweichungen in den meisten Wettbewerben, wo ebenfalls im Schnitt einer von vier Elfmetern nicht ins Tor geht.
Man kann dieses Verfahren für andere Situationen wiederholen, wenn man weiß, von wo aus Torschüsse abgegeben worden sind und aus welchen Spielsituationen heraus, denn es ist natürlich ein Unterschied, ob das aus dem Spiel heraus oder nach Freistößen passiert. Aufgrund der allgegenwärtigen Datenerhebung beim Fußball ist das heute bei den meisten Spielen internationaler Profiligen möglich. Wenn man von Zehntausenden Torschüssen aus Tausenden von Spielen erfasst hat, von welcher Stelle sie abgegeben wurden und ob sie zu Toren führten, ergibt sich eine besondere Karte des Spielfelds. Man kann dann nämlich ziemlich genau sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, von einem bestimmten Punkt aus ein Tor zu schießen.
Quelle: 21st Club
Diese Karte ist noch roh, auch ein paar rare Zufallstreffer finden sich hier, etwa von der Seitenauslinie auf Höhe des Strafraums. Sie tauchen dort sogar mit hohen Werten auf, weil von diesen Positionen fast nie Torschüsse abgegeben werden, aber mal ein Glückstreffer reingegangen ist. Auch ohne größere Rechenoperationen angestellt zu haben, sagt einem die Erfahrung, dass es für Torschüsse bessere und schlechtere Punkte auf dem Platz gibt. Bereits in den 1990er-Jahren forderte Volker Finke als Trainer beim SC Freiburg von seinen Spielern, dass sie nicht von außerhalb des Strafraums schießen sollten, weil dann die Wahrscheinlichkeit niedriger ist zu treffen als aus dem 16-Meter-Raum. Mit der obigen Karte, die es wegen fehlender Daten damals noch nicht geben konnte, hätte er es ihnen genau zeigen können.
Jedem Fan ist klar, dass es ein besonderes Ereignis war, als Marco Van Basten im Finale der Europameisterschaft 1984 das 2:0 gegen die Mannschaft der UdSSR erzielte. Denn der Holländer gab seinen Schuss aus »unmöglichem Winkel« ab, wie man gemeinhin sagt. Ganz unmöglich war er jedoch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sein Schuss von der Position an der Torauslinie kurz außerhalb des Fünfmeterraums ins Tor gehen würde, war äußerst gering. Wie hoch bzw. niedrig sie ist, kann man nun genau sagen: zwei Prozent. Wenn van Basten 50-mal von dort aus geschossen hätte, hätte er statistisch gesehen einmal getroffen. Klarer Fall: Den musste er nicht machen!
Wenn man nun alle Schüsse nimmt, die eine Mannschaft im Laufe eines Spiels abgibt, und schaut, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie ins Tor gegangen wären, erhält man einen Gesamtwert. Er wird Expected Goals genannt und xG abgekürzt. Der Schuss von van Basten gegen die UdSSR mit seiner Zwei-Prozent-Wahrscheinlichkeit würde mit 0,02 in die Rechnung eingehen, ein Elfmeter mit 0,75. Wir erinnern uns: Zu rund 75 Prozent ist ein Elfmeter ein Tor. Um den Wert genauer zu machen, wird die jeweilige Spiel- und Abschlusssituation in Rechnung gestellt. Schließlich ist ein Schuss aus zehn Metern gefährlicher als ein Kopfball, oder ein Schuss nach Konter bedeutet eine höhere Chance auf ein Tor, weil der Gegner dabei meist weniger geordnet ist, als wenn man auf eine stehende Abwehr zuspielt. Abschlüsse nach Standardsituationen werden ebenfalls eigengewichtet. Die Erfolgsquote je nach Spielsituation ist unterschiedlich, wie man in dieser Übersicht aus der Premier League sehen kann.
Aus dem Spiel
Konter
Ecken
Freistöße
Angriffe/Tore
6467/534
1116/166
1115/100
539/26
Erfolgsquote
8,26%
14,87%
8,97%
4,82%
Quelle: STATS
Natürlich spielt dabei eine Rolle, wie viele Spieler sich zwischen Torschützen und Tor befinden, wie wir noch genauer sehen werden. Man ahnt also, dass es komplexe mathematische Modelle braucht, um die Wahrscheinlichkeit genau zu erfassen.
Nun könnte man denken: Das ist alles schön und gut, es gibt aber bessere und schlechtere Spieler. Wenn Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Harry Kane schießen, ist die Chance auf einen erfolgreichen Torschuss höher als bei Berufskollegen, die nicht mit so einem sensationellen Talent gesegnet sind. Dieser Einwand ist richtig, es gibt Unterschiede, aber sie sind im Spitzenfußball erstaunlich gering. Der englische Fußballanalytiker Omar Chaudhuri, von dem auch die obige Schusskarte stammt, hat das am Beispiel von Cristiano Ronaldo nachgewiesen. Für das englische Beratungsunternehmen 21st Club hat er die 1490 Torschüsse untersucht, ausgenommen Elfmeter, die Ronaldo zwischen 2010 und 2017 im Trikot von Real Madrid bei Ligaspielen abgab. 13,3 Prozent seiner Schüsse trafen ins Tor, was etwas über dem Durchschnitt der spanischen Liga von 11,1 Prozent lag. Chaudhuri schloss daraus, dass einer der besten Stürmer der Gegenwart aufgrund seiner Klasse im Abschluss ein oder zwei Tore mehr pro Saison erzielt.
Außergewöhnlich macht ihn etwas anderes: Cristiano Ronaldo schießt viel häufiger aufs gegnerische Tor als alle anderen Stürmer; er kommt auf durchschnittlich fast sieben Abschlüsse pro Spiel, was ein unglaublich hoher Wert ist. Fast noch wichtiger ist aber: Er tut das zumeist aus guten Positionen, also von Positionen mit einem hohen Wert bei den