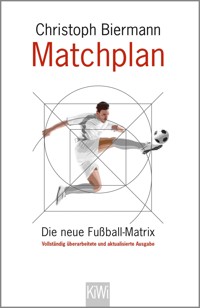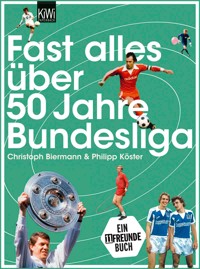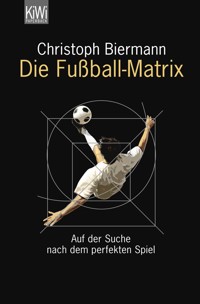
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Das aufregendste deutschsprachige Fußballbuch« (Frankfurter Rundschau) – der Bestseller jetzt als KiWi-Paperback Christoph Biermanns verblüffendes und außergewöhnliches Fußballbuch hat bei Lesern und Kritikern für Furore gesorgt. Der Autor hat sich auf die Suche nach dem perfekten Spiel und der Formel für den Sieg gemacht. Dazu hat er nicht nur mit Felix Magath über Schach gesprochen und sich mit Experten und Analytikern in Fußballdaten vertieft, sondern auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf das Spiel angewendet. Fußball ist das beste Spiel, weil seine Idee so einfach ist. Zugleich sind seine Möglichkeiten komplex und unerschöpflich. Diese Komplexität aber wird am Computer in ganz neuen Tiefen analysiert, seit das Spiel seine digitale Wende erlebt hat. Die Fortschritte werden die Suche nach Spielern revolutionieren und vermutlich auch unser Verständnis des Spiels selbst. Dieses Buch beschreibt den Stand der Dinge und zugleich das Entstehen einer neuen Fußballwissenschaft, die das Spiel nach bislang noch unbekannten Mustern durchsucht. Wir werden von alten Meinungen Abschied nehmen müssen, werden aber smartere Antworten darauf geben können, wie es zu Sieg und Niederlage kommt. Dieses Buch soll den Spaß am Fußball steigern helfen, weil es die Diskussionen darüber noch interessanter macht. Christoph Biermann, einer der profiliertesten Fußballjournalisten Deutschlands, widmet sich in seinen Artikeln und Büchern dem Spiel stets auf kenntnisreiche und unterhaltsame Weise. »Die Fußball-Matrix« mag heute noch wie Science-Fiction klingen, aber die dort beschriebenen Ideen werden im Fußball schon bald selbstverständlich sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
CoverTitelWidmungZitatProlog Fußball wie im HimmelKapitel 1 Der neue Weg zum SiegEin Fußballwunder in der Provinz – David am Ball – Vom Zauber der Zahlen – Statistik und Wahrheit – Der berechnete Spieler – Eine Idee macht KarriereKapitel 2 Die Digitalisierung des FußballsVom visuellen Gedächtnis zum optischen Speicher – Messi spielt sich selbst – Fußball als Spiel der Zahlen – Der gläserne Spieler Kapitel 3 Von der Berechenbarkeit des SpielsBestechungrechnen – Der Fluch der drei Punkte – Der verschwundene Heimvorteil – Spieltheorie vom Elfmeterpunkt – Die große WiderlegungsmaschineKapitel 4 KörpertuningFußball ist Schach – Die ratlose Suche nach der Fitness – Formel 1 vs. Monster-Trucks – Bordcomputer des Fußballs – Dark Side of the MoonKapitel 5 In Raum und ZeitFeldgrößen – »Verteidigen kann jeder« – Plan voll angreifen – SpeedfreaksKapitel 6 Superstars von morgenDas Rätsel der frühen Früchte – Talentsuche im Footbonaut – Anders lernenKapitel 7 Wahrscheinlichkeiten am BallVon der Wahrscheinlichkeitsrechnung zum langen Ball – Mathematiker am Tippzettel – High-End des WettensKapitel 8 Die hohe Kunst des FehleinkaufsMein Auto, mein Haus, mein Fußballstar – Video- und Datascouting – Im Cluster von ZidaneKapitel 9 Die Fußball-MatrixFußball als Modell – Im Schatten der Zahlen – Die Macht des ZufallsKapitel 10 Detail und ChaosDas Genie des Otto Rehagel – Führer in die Unwahrscheinlichkeit – DanksagungBuchAutorImpressum[Menü]
Für Theo, meinen Vater
[Menü]
»Sinnloser als Fußball ist nur noch eins: Nachdenken über Fußball.«Martin Walser
[Menü]
Prolog Fußball wie im Himmel
An diesem Maiabend des Jahres 1960 in Glasgow drängen sich 127000 Zuschauer auf den Rängen des Hampden Parks, um Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt spielen zu sehen. Die größte Menschenmenge, die jemals ein Europapokalfinale gesehen hat, ist erstaunlich leise. Es gibt keine Gesänge, keine Anfeuerungsrufe, sondern immer nur ein fast andächtiges Raunen, wenn den Stars um Alfredo di Stefano und Ferenc Puskás wieder ein kleines Kunststück am Ball gelingt. Wenn der Ball zu kreiseln beginnt, tut er das ohne die Dynamik, Athletik und Schnelligkeit von heute. Trotzdem ist es auch heute immer noch schön anzuschauen. Es gibt prasselnden Beifall für die sieben Tore der Spanier und die drei Treffer der Frankfurter, und immer spürt man die unschuldige und zutiefst ehrliche Freude des Publikums darüber, dass sie das hier sehen dürfen. »Die beste Vereinsmannschaft, die die Welt jemals gesehen hat«, sagt der Kommentator der BBC.
Zehn Jahre später sind die Bilder des WM – Endspiels zwischen Brasilien und Italien schon in Farbe, doch es stellt sich das gleiche Gefühl ein: So muss Fußball im Himmel sein. Hier sind es die Südamerikaner um Pelé, die mit ihren Kombinationen, mit ihrer Ballsicherheit und Dynamik einen neuen Standard setzen. 1986 ist es Maradona mit seinem Solo bei der Weltmeisterschaft in Mexiko gegen England, dem wahrscheinlich bestenDribbling aller Zeiten, das Lionel Messi im Trikot des FC Barcelona gegen Getafe auf gespenstische Weise fast exakt wiederholte.
2000 schaue ich in den belgischen und holländischen Stadien zu, wie Frankreich Europameister wird, und denke erneut, dass es kaum besser geht als mit dieser Mannschaft und diesem Zidane. Doch dann kommt 2009 der FC Barcelona, und erreicht er beim Gewinn der Champions League nicht Perfektion? Jetzt aber wirklich und endgültig!
Die Geschichte des Fußballs ist voll solcher Momente, in denen das Spiel ganz bei sich ist. Doch schon im nächsten Moment ist das perfekte Spiel verflogen, und die Suche danach beginnt von vorn. Immer aufwändiger wird sie, ständig neue Wege geht sie, und was dabei passiert, davon handelt dieses Buch.
Es erzählt von einer Recherche-Reise, die von Kalifornien über Nordbaden nach London, Wolfsburg, Barcelona und Mailand führt. Es beschreibt die digitale Wende des Fußballs und seine Verwandlung in ein Spiel der Zahlen. Es stellt die Entwicklung zu einem weniger zufälligen Spiel vor und gerät in Grenzbereiche, wo Fußball auf Science-Fiction trifft. Die Dinge ändern sich, während so viel über Fußball gesprochen und geschrieben wird wie nie. Doch einfach nur Meinungen zu haben ist passé. Heute geht es um Wissen – oder den Versuch, es zu erlangen.
Viele Fans schauen mit großer Sorge auf die vermeintliche Verwissenschaftlichung des Fußballs. Dabei hat sich nichts geändert. Die Idee des Spiels bleibt unschlagbar einfach, und zugleich sind seine Möglichkeiten komplex und unerschöpflich. Deshalb wird das Spiel auch nichts von seinem Zauber verlieren, wenn wir smartere Antworten darauf finden, wie es zu Sieg und Niederlage kommt. In Wirklichkeit macht es die Diskussionen darüber sogar noch aufregender und interessanter. Und die Bemühungen der Spieler, Trainer und Manager führen nur dazu, dass wir bald wieder andächtig und staunend dasitzen, weil wir einen neuen Moment der Perfektion erleben, der vermutlich nie übertroffen wird. Jedenfalls nicht bis morgen.
[Menü]
Kapitel 1 Der neue Weg zum Sieg
Ein Fußballwunder in der Provinz
Ich kam an einem jener Tage nach Hoffenheim, als der Trainingsplatz neben der Tankstelle am Ortseingang wieder mal eine internationale Pilgerstätte war. Vor dem Pressecontainer standen Journalisten aus Bosnien, die mit wackeligen Videokameras jeden Schritt ihres Landsmanns Vedad Ibiševi´c dokumentierten, der so viele Tore zur Hoffenheimer Sensation beigesteuert hatte. Drinnen machten sich Reporter aus Belgien und Frankreich Notizen, weil ihnen Assistenztrainer Peter Zeidler alles in fließendem Französisch erklären konnte. Auf dem Tisch lag ein dicker Ordner mit Zeitungsausschnitten. Die New York Times,der Observer aus London oder die italienische Gazzetta dello Sport waren schon da gewesen, und selbst japanische Zeitungen hatten über das Fußballwunder aus Deutschland geschrieben.
Nirgendwo auf der Welt konnte man sich in diesen Wochen im November 2008 dem Reiz der Geschichte vom Klub aus dem Dorf mit gut dreitausend Einwohnern entziehen, der dank eines schwerreichen Unternehmers, der als Jugendlicher selbst in diesem Verein gespielt hatte, in die höchste Spielklasse aufgestiegen war. Das allein wäre schon verblüffend genug gewesen, aber dieTSG1899 Hoffenheim spielte in ihrer ersten Bundesligasaison auch noch so mitreißend, dass sie am Endeder Hinserie den ersten Platz belegte. So etwas hatte es in Deutschland noch nie gegeben.
Trotzdem hatten der rasante Aufstieg des Klubs und sein Mäzen gemischte Reaktionen hervorgerufen. Gegnerische Fans hatten Dietmar Hopp teilweise heftig beleidigt. Sie warfen dem milliardenschweren Unternehmer vor, durch gewaltige Investitionen Hoffenheim einfach in die Bundesliga gekauft zu haben. Das war nicht ganz von der Hand zu weisen, denn vom langsamen Aufbau mit Nachwuchsspielern aus der Region war man in Hoffenheim irgendwann abgekommen und hatte viel Geld in junge Talente aus der ganzen Welt investiert. Statt aus Heidelberg oder Mannheim stammten sie nun aus Brasilien, Nigeria oder Frankreich. Doch mit den Siegen und den teilweise mitreißenden Auftritten waren die Beschwerden leiser geworden, weil die Mannschaft deutlich besser spielte, als es der Personaletat vorgegeben hätte. Dem Team von Trainer Ralf Rangnick gelang, was in der Finanzwelt Outperformance oder auch Overperformance genannt wird. Es war besser als der Markt, in diesem Fall als die Konkurrenz in der Bundesliga. Tabellenführer Hoffenheim ließ eine Halbserie lang, in der alles passte, namhafte Klubs wie den FC Bayern, Schalke 04, den Hamburger SV oder Werder Bremen hinter sich, die deutlich mehr für Spieler ausgaben. In der Wahrnehmung des Publikums wurden die anfangs skeptisch beobachteten Hoffenheimer zu einem David, der sich mit besonderer Raffinesse gegen die Goliaths der Branche durchsetzte.
In aller Welt lieben Fußballfans Geschichten von erfolgreichen Underdogs. Manchmal beschränken sich die Legenden auf einzelne Spiele, wie den deutschen Finalsieg bei der Weltmeisterschaft 1954 gegen die zuvor über vier Jahre unbesiegten Ungarn. Mal erzählen sie vom sensationellen Ausgang internationaler Turniere, wie dem Gewinn der Europameisterschaft 1992 durch Dänemark, die als Nachrücker quasi ohne Vorbereitung antraten. Zwölf Jahre später konnte der große Außenseiter Griechenland den Titel gewinnen, obwohl damit niemand gerechnet hatte.
Einzelne Spiele oder auch der Verlauf von Turnieren können maßgeblich vom Glück beeinflusst sein. Wenn Phänomene jedoch eine längere Halbwertszeit haben, reicht Zufall als Erklärung nicht mehr aus. Dann stellen sich die Fragen grundsätzlicher. Warum haben die Niederlande seit vier Jahrzehnten fast ununterbrochen eine hervorragende Fußball-Nationalmannschaft, obwohl das Land nur 16 Millionen Menschen hat, während das der traditionsreichen Fußballnation Rumänien mit fünf Millionen Einwohnern mehr nur hin und wieder gelingt? Wie hat es Norwegen in den neunziger Jahren bis auf Platz zwei der FIFA – Weltrangliste geschafft, obwohl dort sogar nur fünf Millionen Menschen unter klimatischen Bedingungen leben, die oft auch zum Fußballspielen nicht gut sind?
Im Vereinsfußball gibt es ebenfalls immer wieder Klubs, die ihre Möglichkeiten weit übertreffen. Diese werden eigentlich von der finanziellen Ausstattung bestimmt, von der Größe des Stadions und wie viele Zuschauer regelmäßig kommen, von der Wirtschaftskraft seiner Region und wie attraktiv ein Verein für Sponsoren ist. Mancherorts ist die Konkurrenz anderer Fußballklubs in der Nähe stark oder die anderer Sportarten. Manche Mäzene oder Vereinseigentümer gleichen bestehende Nachteile aus. Doch nimmt man all diese Faktoren zusammen, ergibt sich ein Rahmen – den einige Klubs regelmäßig sprengen.
Der AJ Auxerre schaffte es, sich mit dem knorrigen Trainer Guy Roux über fast drei Jahrzehnte in der französischen höchsten Spielklasse zu halten. Der Klub erreichte zwischendurch sogar die internationalen Wettbewerbe, trotz eines Standortes von nur 40000 Einwohnern, weit abgelegen in der französischen Provinz. DerFCWimbledon marschierte in den achtziger Jahren mit seinerCrazy Gangverrückter Spieler aus dem Amateurfußball in die erste Liga durch. Er hielt sich dort 14 Jahre und gewann sogar den englischen Pokal, dabei hatte der Klub aus dem Südwesten Londons die schlechtesten Zuschauerzahlen der Liga. Wie konnte ein Oberstudienrat für Sport, Geschichte und Gemeinschaftskunde namens Volker Finke den verschlafenen ZweitligistenSCFreiburg in die Bundesliga führen und dort etablieren? Warum tauchte Rosenborg Trondheim regelmäßig in der Champions League auf, und was macht man eigentlich im spanischen Städtchen Villarreal richtig, wo es der kleineFCebenfalls mehrfach in die Championsleague schaffte.
All diese Klubs glichen Konkurrenznachteile durch besondere Strategien aus, die manchmal bewusst gewählt waren und manchmal nur intuitiv. Auch bei meinem Besuch in Hoffenheim standen Beobachter am Trainingsplatz, die herausfinden wollten, ob es dort ebenfalls solche Strategien gab. Die Gruppe der finnischen Trainer und jene aus Kroatien wollten Erkenntnisse für die Arbeit mit ihren eigenen Mannschaften nutzen. Mit jedem Sieg hatten mehr Trainer angefragt, ob sie in Hoffenheim hospitieren dürften. Es hatte intern sogar kontroverse Diskussionen darüber gegeben, wie weit sie ihre Türen für Kollegen öffnen wollten. Rangnick war eher entspannt in dieser Frage gewesen, doch andere wollten nicht so gerne das preisgeben, was sie für ihre Betriebsgeheimnisse hielten.
So freute es mich, dass mir Manager Jan Schindelmeiser ausführlich die Arbeitsweise des Klubs erklärte und die Pläne für das neue Trainingszentrum zeigte, das damals noch in Bau war und inzwischen eines der modernsten der Welt ist. Außerdem machte Schindelmeiser eine kleine Führung durch das bestehende Gebäude. Als er dort Tür um Tür öffnete, wurde das zu einer Vorführung dessen, was Fußball heute auch ausmacht. Zehn Jahre zuvor wäre es kaum vorstellbar gewesen, dass im Kraftraum eines Bundesligisten ein Athletiktrainer wie Rainer Schrey sich nicht nur inmitten modernster Trainingsgeräte befindet, sondern mit zwei Ingenieuren auch noch die Programmierung einer sogenannten twall überarbeitet. An dieser Wand mit wechselnden Lichtern sollen die Profis ihre Reaktionsfähigkeit verbessern. Eine Etage tiefer saßen zwei junge Männer bei der Videoanalyse des kommenden Gegners, während ein Videobeamer Spielszenen an die Wand projizierte. Und im Keller, bei den Physiotherapeuten, war gerade Dr. Mosetter vom Bodensee zu Gast. Während der Spezialist für Myoreflextherapie am Hinterkopf von Verteidiger Andreas Beck hantierte, erklärte er, dass viele Fußballprofis allein durch eine falsche Körperhaltung an Schnelligkeit verlieren und zugleich verletzungsanfälliger werden.
Ein weiterer Betreuer in Hoffenheim war der Psychologe Hans-Dieter Hermann, der bei der Weltmeisterschaft 2006 zum Team von Jürgen Klinsmann gehört hatte und inzwischen einen Lehrstuhl für Sportpsychologie hat. Bernhard Peters, der ehemalige Nationaltrainer im Hockey, war offiziell Leiter der Nachwuchsabteilung. Für Rangnick war er aber auch – so erzählte der Trainer mir später – sein Spezialist für das Spiel mit dem Ball. Gemeinsam hatten sie Trainingsformen diskutiert, mit denen man Rangnicks Idee von Angriffsfußball am besten vermitteln konnte – und die von den Hospitanten aus ganz Europa nun aufmerksam protokolliert wurden. Es gab mit Helmut Groß auch einen Experten für das Spiel gegen den Ball, der eine ungewöhnliche Vorbildung mitbrachte. Inzwischen über sechzig Jahre alt, war er früher Ingenieur im Brückenbau und kannte Rangnick schon lange. Er hatte den damals jungen Trainer bereits vor zwanzig Jahren davon überzeugt, dass die Ära der Manndeckung vorbei sei.
Als ich auf Rangnick wartete, setzte sich Assistenztrainer Zeidler zu mir, und wir sprachen darüber, was die Arbeit in Hoffenheim ausmachte. Man merkte, dass die Erfolge nicht nur Spieler, sondern auch die Mitarbeiter auf einer Welle der Euphorie trugen. »Manchmal müssen wir aufpassen, dass wir nicht glauben, den Fußball neu erfunden zu haben«, sagte Zeidler. Aber es machte nicht den Eindruck, als ob sie in Hoffenheim den Boden unter den Füßen verloren hätten. Das Trainingszentrum wirkte eher wie eine unter Volldampf arbeitende Manufaktur für hochwertigen Fußball, in der Spezialisten eifrig herumwerkelten. Doch stand in Hoffenheim wirklich eine große Strategie dahinter, oder bestand sie einfach darin, möglichst viele neue Dinge auszuprobieren? Ins Wintertrainingslager der Saison 2008/2009 nahm kein Klub so viele Betreuer mit wie 1899 Hoffenheim. 29 waren es für 27 Spieler. 316 waren es ligaweit für 463 Profis, was eine enorme Zahl ist, die aber nur über den Umfang der Bemühungen Auskunft gibt, aber nicht über deren Qualität.
David am Ball
In der Wirtschaft kann man bei erfolgreichen Unternehmen unterscheiden, ob ihr Wettbewerbsvorteil gegenüber den Mitkonkurrenten eher produktionsmitteloder wissensbasiert ist. In Branchen mit einer großen Homogenität der Produktionsmittel haben oft die wirtschaftlich stärksten Unternehmen den Zugriff auf die besten Ressourcen. Das gilt auch für den Profifußball, denn die reichsten Klubs können die wertvollsten Produktionsmittel erwerben, also die besten Spieler.
Wer da nicht mithalten kann, der muss eine wissensbasierte Strategie entwickeln. David kann beim Kampf gegen Goliath dann zwischen zwei weiteren Ansätzen wählen. Er kann einen Mechanismus erschaffen, der Ressourcen von hoher Qualität deshalb für einen niedrigen Preis findet, weil Unsicherheit über deren zukünftige Leistungsfähigkeit besteht. Oder er veredelt seine Produktionsmittel. Auf den Fußball übertragen, bedeutet das: Wenn es einem Klub gelingt, bei den Transfers solche Spieler zu verpflichten, deren Fähigkeiten von der Konkurrenz unterschätzt oder unterbewertet werden, kann er dadurch Wettbewerbsnachteile ausgleichen. Oder er verbessert seine Spieler durch besonderes Training, durch taktische Raffinesse, gute psychologische Betreuung, so wie es SC Freiburg oder Wimbledon, Holland oder Norwegen auf ganz unterschiedliche Weise vorgemacht haben.
Längst ist die Welt des Fußballs geteilt. Es gibt jene, die auf ausgetretenen Pfaden gehen und Innovationen erst einsetzen, wenn sie anderswo getestet und etabliert worden sind. Das sind die Klubs, die sich darauf verlassen, dass ihre Produktionsmittel ausreichend sind. Und es gibt die anderen, die strategisch vorgehen und systematisch versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen. Sie sind in der Minderzahl, dabei müssten eigentlich alle im Fußball solche Anstrengungen unternehmen, weil die Rolle zwischen David und Goliath ständig wechselt.
Nur wenige Klubs wie Manchester United oder Real Madrid gehören durch ihre gewaltige Wirtschaftskraft immer zu den Riesen. Der FC Bayern mag in Deutschland ein Gigant sein, doch im Vergleich zur europäischen Spitze ist er schon nicht mehr ganz so groß, wie er in den letzten Jahren schmerzhaft spüren musste. Fußball lebt auch davon, dass die Rollen des Kleinen und Großen nicht fest vergeben sind, weshalb sich eigentlich alle auf die Suche nach einem strategischen Vorteil machen müssten.
Doch zur Wirklichkeit des Profifußballs gehört es auch, dass sich viele Manager in den Klubs über diesen Mechanismus nicht im Klaren sind. Sie strengen sich zwar bei der Rekrutierung von Spielern und der Suche nach dem richtigen Trainer an, mühen sich um die optimale medizinische Betreuung der Profis und um gute Jugendarbeit. Doch sie suchen nicht systematisch danach, worin ihr strategischer Vorteil bestehen könnte. Wenn ein kleiner Bundesligist das Gleiche tut wie der FC Bayern, nur mit weniger Geld, wird er kein David, sondern ein Goliath, der zu klein ist. Dabei gibt es immer wieder Innovationsmöglichkeiten. Zu ihrem Wesen gehört es aber, dass sie anfangs oft fantastisch und unmöglich zugleich wirken.
Vom Zauber der Zahlen
Die Geschichte von Walter Jakobs beginnt in einem abgeschiedenen Dorf im Bayerischen Wald, wo es sich in seiner Kindheit fast nur um Fußballstatistiken dreht. Viele Kinder begeistern sich für Ergebnislisten und Tabellen, doch bei Jakobs vergeht die Lust darauf im Laufe der Jahre nicht. Er studiert Wirtschaftswissenschaft, aber nach dem Abschluss des Studiums entschließt er sich, als Nachtwächter zu arbeiten. Denn so kann er ungestört seine Fußballberechnungen fortsetzen.
Die Tabellenspielereien werden zu komplexen Ermittlungen des Heimvorteils, Jakobs erstellt Charts über die Chancen des Torwarts beim Elfmeter oder klassifiziert die Effektivität von Torjägern im Ligavergleich. Doch je länger er an diesen statistischen Untersuchungen arbeitet, umso mehr nervt Jakobs es, wie leichtfertig im Fußball mit ungesicherten Informationen argumentiert wird. Trainer oder Spieler, die Experten im Fernsehen und Kolumnisten der Zeitungen haben zu allem eine vehement vorgetragene Meinung, aber Belege haben sie keine.
Also beschließt Jakobs, die Ergebnisse seiner Berechnungen zu veröffentlichen, und publiziert sie im Eigenverlag. Es finden sich einige wenige Leser, Jakobs fühlt sich durch das bescheidene Interesse ermutigt. Ein Verlag wird ebenfalls auf ihn aufmerksam und nimmt seine nun jährlichen statistischen Analysen ins Programm. Immer mehr Fußballfans stoßen darauf und sind begeistert. Die Bücher werden Bestseller, nur die Fußballbranche ignoriert Jakobs und seine Erkenntnisse. Hinter vorgehaltener Hand oder auch ganz offen sagen Trainer, Manager und Experten, dass sie ihn für einen Spinner halten. Wie kommt dieser komische Typ dazu, diese seltsame Fußballmathematik zu betreiben. Und wie kann er es sich auch noch herausnehmen, ihre Arbeitsweise zu kritisieren, weil sie angeblich nicht systematisch ist?
Er stellt Forderungen auf, wie man einen Elfmeter schießen soll, und sagt, welche Eckballvariante am erfolgversprechendsten ist. Er stellt Theorien zum Defensivspiel auf und glaubt zu wissen, wie man am effektivsten eine Mannschaft zusammenstellt. Er fordert überprüfbare Beweise, wo die Fußballbranche doch auf die Erfahrung von Hunderten von Spielen zurückblicken kann.
So vergehen fast zwei Jahrzehnte, bis sich der Manager von Arminia Bielefeld dazu entschließt, bei der Arbeit auf die Ansätze von Jakobs zurückzugreifen. Er hat schon lange dessen Bücher gelesen und richtet trotz der heftigen Widerstände fast aller im Klub seine Einkaufspolitik an den dort gemachten Überlegungen aus. Er will sich bei der Auswahl der Spieler nicht mehr allein auf das gute Auge seiner Scouts verlassen, des Trainers oder seine eigene Erfahrung. Bei Außenbahnspielern schaut er auf die von Jakobs errechnete Doppelpass-Flanken-Quote. Im defensiven Mittelfeld zieht er den Rebound-Faktor nach Jakobs in Betracht und im Spiel nach vorn die Visions-Quote.
Der Erfolg ist durchschlagend: Obwohl die Arminia zu den finanzschwächsten Klubs der Bundesliga gehört, landet die Mannschaft gleich im ersten Jahr im oberen Drittel der Tabelle und qualifiziert sich erstmals für den UEFA – Pokal. Auch in den kommenden Jahren hält sie sich dort und übertrumpft dabei Vereine, die deutlich höhere Etats haben. Offenbar hat die Arminia eine Strategie entwickelt, die sie im ungleichen Kampf gegen überlegene Gegner regelmäßig gut aussehen lässt.
Als ein renommierter Reporter ein Buch über den sensationellen Aufschwung der Arminia schreibt, wird auch die Bedeutung von Jakobs und dessen Statistiken für die Erfolge deutlich. So beginnt die Fußballbranche den verrückten Statistiker endlich ernst zu nehmen, und derFCBayern München ringt sich dazu durch, ihn als Berater unter Vertrag zu nehmen. Jakobs’ Ratschläge kombiniert mit den finanziellen Möglichkeiten des Klubs werden zu einem unschlagbaren Mix. In der Bundesliga und international triumphieren die Bayern. In den folgenden fünf Jahren gewinnen sie aber nicht nur jede Deutsche Meisterschaft, sondern dreimal auch die Champions League. Es ist die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte.
Inzwischen dürfte den meisten Lesern gedämmert sein, dass es sich bei dieser Geschichte vom Fan, der verzaubert von den Zahlen die Geschichte des Fußballs veränderte, um ein Märchen handelt. Denn der FC Bayern hat die Champions League seit 2001 nicht mehr gewonnen und auch fünf Meistertitel hintereinander noch nie. Arminia Bielefeld stand am Ende noch keiner Saison im ersten Drittel der Bundesliga und hat sich bislang noch für keinen Europapokalwettbewerb qualifizieren können. Von einem Statistiker namens Walter Jakobs haben wir so wenig etwas gehört wie vom Rebound-Faktor oder einer Visions-Quote. Und wie sollten die überhaupt im Fußball aussehen?
Die Frage ist berechtigt, doch es gibt eine Sportart, die von einem wie Walter Jakobs revolutioniert worden ist.
Statistik und Wahrheit
Bill James wurde 1949 in einem abgelegenen Ort in Kansas geboren, in dem außer ihm noch 208 weitere Einwohner lebten. Er mochte die Abgeschiedenheit, denn der Umgang mit Menschen fiel ihm schwer. »Ich habe schreiben gelernt, weil ich einer dieser Leute bin, die irgendwie nicht über die Möglichkeit der Kommunikation durch Lachen oder Gesten verfügen, sondern Worte benutzen müssen, um etwas sagen zu können, wofür andere Menschen gar keine Worte benötigten«, sagt er über sich.
Allerdings schrieb er keine Erzählungen, Romane oder Gedichte. James suchte sich einen seltsamen Gegenstand, um mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten. »Vielleicht wäre ich Schriftsteller geworden, wenn es Baseball nicht geben würde. Aber es gibt Baseball, und ich kann mir nicht vorstellen, über etwas anderes zu schreiben.« James befasste sich ausschließlich mit dessen berechenbarer Seite. Er interessierte sich für alles, was mit Statistiken zu tun hatte.
Selbst sein Wirtschaftsstudium münzte er in ein Baseballstudium um. Alles, was er dort lernte, wandte er direkt auf Baseball an. Und nach dem Ende der Zeit an der Universität und nach abgeleistetem Wehrdienst arbeitete James als Nachtwächter in einer Konservenfabrik. Dort konnte er sich in aller Ruhe über ellenlange Statistiken hermachen.
1977 veröffentlichte er seine erste Schrift. Sie hieß »Baseball Abstract«, umfasste 68 fotokopierte Seiten mit vielen Zahlen und wenig Text. Sie trug den Untertitel: »18 Kategorien statistischer Informationen, die Sie nirgendwo anders finden«. James schaltete in einer Sportzeitschrift eine winzige Kleinanzeige, verkaufte 75 Exemplare zu 3,50 Dollar das Stück. Durch den bescheidenen Erfolg fühlte er sich trotzdem unglaublich ermutigt.
In den folgenden fünf Jahren wuchsen die Umfänge des jährlich erscheinenden »Baseball Abstract«, und die Leserschaft vervielfachte sich. Schließlich nahm ein großes Verlagshaus die Publikation in ihr Programm auf, wo sie zum Bestseller wurde. So fand James im Laufe der Jahre eine Fülle von Nachahmern. Für die epidemisch werdende Ausdeutung von Baseballstatistiken entstand sogar ein neues Wort: Sabermetrics. SABR war die Abkürzung der Society for American Baseball Research, und diese Gesellschaft für die Erforschung des amerikanischen Baseballs ist eine Gruppe von Hobbywissenschaftlern, die sowohl die Historie des Spiels in allen Facetten als auch seine berechenbaren Seiten untersuchten. Es gab sie seit Beginn der siebziger Jahre, und Bill James wurde ihr Star.
Der streitbare Autor stellte aber nicht nur Statistiken auf, er zog daraus auch scharfe Schlüsse. »Eine ganze Menge des traditionellen Wissens über Baseball ist lächerlicher Mumpitz«, teilte er seinen Lesern mit. James verstand sich als Aufklärer im klassischen Sinn. Er wollte Licht in das Dunkel von Aberglauben und Halbwissen werfen, falsche Wahrheiten ausrotten und alle Baseballfans dazu bringen, dass sie sich nicht mehr mit dem Kram abspeisen ließen, den sie von Managern und Trainern, Journalisten und Experten vorgesetzt bekamen.
»Wenn Zahlen die Kraft von Sprache gewinnen, dann bekommen sie die Macht, all jene Dinge zu werden, die Sprache werden kann: Roman, Drama und Poesie«, schrieb er. Das klingt überspannt, aber James ging es darum, durch Statistik verborgene Wahrheiten zu enthüllen. Er wollte auf seine Weise zeigen, was auf der Bühne eines Baseballfeldes wirklich passiert.
Baseball ist seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein Profisport. Er wurde von Beginn an umfassend statistisch erfasst und galt immer schon als ein »Spiel der Zahlen«. Unsere klassische Fußballstatistik, die meist aus nicht mehr als der Aufstellung der beiden Mannschaften, Auswechselungen, Torschützen, Namen der Schiedsrichter, Verwarnungen, Platzverweisen und den Zuschauerzahlen besteht, nimmt sich kärglich im Vergleich zu den Box Scores des Baseballs aus. Die langen Zahlenreihen, die zu jedem Spiel die Zahl der Hits, Walks oder Runs jedes Spielers auflisten, geben dem Eingeweihten auch Hinweise darauf, wie das Spiel verlaufen ist und wer besonders gut gespielt hat.
James produzierte viele neue Statistiken, indem er aus dem bestehenden Material weitere Ableitungen machte. Er schuf Kategorien wie den Game Score, um die Leistung eines Werfers während eines einzelnen Spiels zu klassifizieren. Mit den Similarity Scores wollte er gar durch die Jahrzehnte springen, um Vergleiche zwischen den Leistungen von Spielern aus unterschiedlichen Zeitaltern anstellen zu können. Er wetterte gegen die Kategorie des Errors, weil er die dabei verwendete Definition von Irrtum für veraltet und zu subjektiv hielt. Er versuchte zu ermitteln, ob bestimmte Stadien für einige Spieler besser waren als andere. Und mit eigenen Statistiken untermauerte er seine Ranglisten der besten Werfer oder Fänger. Seine Lust darauf, jeden Aspekt des Spiels auszuleuchten, war grenzenlos.
Als James 1977 seine erste Schrift veröffentlichte, begannen zwei Entwicklungen, die seine Arbeit mittel- und langfristig beförderten. Einerseits wurden ab dem Ende der siebziger Jahre die Computer beständig leistungsstärker und gleichzeitig billiger. Damit war es für ihn und für seine Epigonen einfacher, immer größere Mengen von Daten zu sammeln und zu analysieren. Außerdem stieg die Bezahlung in der Major League Baseball (MLB) dramatisch, weshalb die Klubs verstärkt vor der Frage standen, was man bei der Verpflichtung von Spielern beachten musste.
1979 entwarf James zum ersten Mal eine Formel, die mehr wollte, als das Augenmerk auf interessante Einzelaspekte des Spiels zu werfen. Er wollte wissen, welche Faktoren dafür entscheidend sind, dass man ein Baseballspiel gewinnt. Nach seiner Ansicht wurden jene Schlagmänner dramatisch unterschätzt, die den Ball nicht spektakulär aus den Stadien droschen, sondern gegnerische Werfer in vielen kleinen Schritten erschöpften. Deshalb errechnete er ein On Base Percentage, bei dem sich nachweisen ließ, dass es in größerem Maße über den Ausgang eines Spiels entschied.
James drang damit zur zentralen Frage vor, die sich die Fans in allen Mannschaftssportarten stellen: Welche Faktoren entscheiden über den Sieg? Ob beim Baseball oder Basketball, Handball oder Fußball streiten Experten darüber, wie man am besten spielt oder welcher Spieler am meisten zum Sieg beiträgt. So verschieden die Sportarten auch sind, weil der Ball geschlagen, geworfen oder getreten wird, weil er in Körbe oder Tore gebracht werden muss, bewegen sich doch alle auf ungesichertem Terrain. Sie ahnen, glauben, fühlen und meinen etwas, aber sie wissen nicht. Auch im Fußball, das werden wir noch sehen, ist es nicht anders.
Mit seinem Beharren auf Wissen gewann James eine nicht nur wachsende, sondern auch hochrangige Leserschaft. Sowohl Physiker in wissenschaftlichen Instituten interessierten sich für seine Überlegungen wie auch Ökonomen, professionelle Statistiker, Analysten an der Wall Street, besessene Mathematiker und andere Zahlenfreaks mit einer Liebe für Baseball. James bekam von ihnen eine Fülle von Hinweisen, Tipps und Korrekturen, die seine Argumentation immer komplexer machte.
1980 begann ein Spiel, das James und seine Statistiken noch populärer machen sollte. Als Rotisserie Baseball wurde in den USA das ein großer Erfolg, was gut zehn Jahre später in Europa unter dem Titel Fußball-Manager oder Fantasy Football populär wurde. Dabei stellen Fans fiktive Teams aus realen Spielern zusammen. Deren reale Leistungen auf dem Platz entscheiden darüber, wie gut die fiktive Mannschaft abschneidet. Baseball hat dabei den großen Vorteil gegenüber Fußball, dass subjektive Bewertungen kaum eine Rolle spielen. Bei den Manager-Spielen im Fußball ist die Spieler-Benotung durch Journalisten oft ein wichtiger Faktor, beim Baseball nimmt man einfach die Spielstatistiken. Die Fantasieligen sorgten in den USA dafür, dass die Baseballfans verstärkt wie Manager zu denken begannen. Außerdem wurden die Statistiken nun zu einem lukrativen Geschäft, weil immer mehr Fernsehsender und Zeitungen für ihre Analysen danach verlangten.
Sabermetrics waren populär und die Bücher von James Bestseller, nur die offizielle Welt des Baseballs zeigte ihm weiter die kalte Schulter. Als er den berühmten Manager Sparky Anderson, immerhin ein Mitglied der Hall of Fame des Baseballs, aufgrund statistischer Berechnungen als »eher glücklich denn talentiert« beurteilte, keilte der zurück. James sei »ein fetter bärtiger Typ, der nichts von gar nichts versteht«. Daran stimmte zweifellos, dass James einen Bart trug und ein paar Kilogramm zu viel hatte.
Der berechnete Spieler
Baseball unterscheidet sich als Sportart ganz grundsätzlich vom Fußball, von den Wettbewerbsbedingungen aber ist es der amerikanische Sport, der Fußball am nächsten ist. Beim American Football oder beim Basketball wird viel Wert darauf gelegt, dass die Ligen möglichst ausgeglichen sind, weshalb es komplizierte Verfahren zur Verteilung der besten Nachwuchsspieler und zur Begrenzung des Personaletats gibt. Dagegen herrschen in der Major League Baseball gewaltige wirtschaftliche Unterschiede, die Personaletats der größten Klubs sind mehr als viermal so groß wie die der wirtschaftlich schwächsten. Das ähnelt der Situation im europäischen Fußball, in der Bundesliga etwa gab der FC Bayern München in der Spielzeit 2008/2009 das ungefähr Fünffache dessen für sein Personal aus wie Arminia Bielefeld, die den niedrigsten Personaletat hatten.
Als Bill James bei den Baseballfans für Aufsehen sorgte, sah kaum einer der Verantwortlichen in der MLB die Möglichkeit, dessen Überlegungen nutzbar zu machen, um finanzielle Nachteile auszugleichen. Eher zur Beruhigung des Publikums, dass man sich auch diesem Aspekt des Spiels widmete, als aus wirklichem Interesse, beschäftigten einige wenige Klubs vereinseigene Statistiker. Eine wirkliche Rolle spielten sie nicht.
Das änderte erst Billy Beane, als er 1997 General Manager der Oakland Athletics wurde. Die Oakland A’s waren damals zwar ein populärer Klub mit vielen Zuschauern, hatten aber ein veraltetes Stadion und geringe Einnahmen. Ihr Etat gehörte regelmäßig zu den niedrigsten im Profibaseball, sie waren eine Art Arminia Bielefeld der MLB.
Beane war entschlossen, die Traditionen seines Sports grundsätzlich in Frage zu stellen. Der ehemalige Baseballprofi krempelte vor allem die Rekrutierung von Spielern grundlegend um, denn diese war für die Oakland A’s entscheidend. Sie mussten die richtigen Spieler finden, bevor sie Stars wurden, später würden sie sich diese nicht mehr leisten können.
Es ging also um eine wissensbasierte Strategie, und diese sah zunächst einmal vor, bei der Auswahl von Nachwuchsspielern den Fokus von der High School zum College zu verlegen. Die älteren College-Spieler galten vielen Scouts als gescheitert, weil sie nicht schon an der High School entdeckt worden waren. Beane teilte diese Einschätzung nicht, außerdem fand er die zur Verfügung stehenden Statistiken bei den älteren College-Spielern aussagekräftiger.
Aus den Berechnungen des On Base Percentage von Bill James zog er ganz praktische Schlüsse. Normalerweise gibt es in der MLB einen Zusammenhang zwischen den Statistiken eines Spielers und seiner Bezahlung. Wenn man aber davon ausging, dass die gängige Interpretation der Statistiken falsch war, wurde eine bestimmte Art von Hittern überbezahlt, während andere zu wenig Geld bekamen. Beane wollte daher von seinen Scouts nichts über »gute Körper« und »feste Arme« hören, sondern schaute sich lieber die Profile an, die seine Informatiker ermittelt hatten. Das hatte erstaunliche Folgen: Beane interessierte sich für Spieler, die seine Scouts, aber auch die Talentsucher der Konkurrenz übersehen hatten. In der Folge verpflichteten die Oakland A’s bessere Spieler für weniger Geld.
Es kam auf diese Weise eine Mannschaft zusammen, die zwischen 2000 und 2006 insgesamt viermal die West Division der American League gewann. Auch wenn es gegen die Sieger der East und Central Division nicht zum Gewinn der Liga oder gar zurWorld Seriesgenannten amerikanischen Meisterschaft reichte, war das für den vergleichsweise wirtschaftsschwachen Klub ein riesiger Erfolg. Die Oakland A’s gehörten 2002 sportlich zu den Top Acht derMLB, obwohl sie von den 30 Klubs die sechstniedrigsten Personalkosten hatten. Sie gewannen 103 der insgesamt 162 Ligaspiele, was ein Vereinsrekord war, obwohl sie nur 42 Millionen Dollar für ihre Spieler ausgaben. Die reichen New York Yankees erreichten die gleiche Zahl von Siegen, gaben aber 126 Millionen Dollar aus.
Vielleicht wäre noch heute den meisten Baseballfans nicht klar, was im Nachbarort von San Francisco genau passierte, wenn sich der Journalist Michael Lewis nicht der Geschichte angenommen hätte. Er begleitete Beane monatelang und verfasste ein Buch mit dem Titel »Moneyball«, das 2003 in den USA erschien. Es wurde zum wohl einflussreichsten Sportbuch, das jemals geschrieben wurde, denn es veränderte nachhaltig eine ganze Sportart. Lewis beschrieb nicht nur, auf welche neue Weise Beane die Auswahl seiner Spieler betrieb. Er konnte auch davon berichten, dass sie in den Spielen selbst anders eingesetzt wurden als zuvor.
So dämmerte es allen Managern, Trainern und Scouts, dass es wohl an der Zeit war, althergebrachte Wahrheiten über Bord zu werfen, die offensichtlich keine mehr waren. Der nach Football populärste Sport in den USA trat in eine neue Ära ein, in der neben den sentimentalen Momenten im sommerlichen Ballpark auch Computerprogramme eine Bedeutung hatten. »Moneyball« löste bei den Besitzern eines der ganz großen Klubs zudem die naheliegende Überlegung aus: Wenn man die Prinzipien der Sabermetrics mit Finanzkraft kombinieren würde, müsste der Erfolg doch eigentlich garantiert sein.