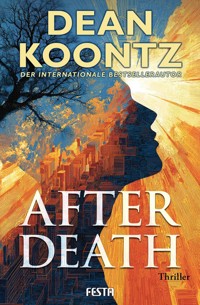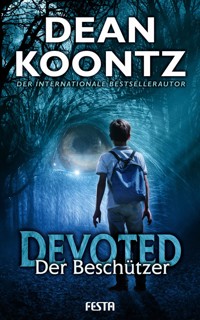Inhaltsverzeichnis
Widmung
Inschrift
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Copyright
Dieses vierte Abenteuer von Odd Thomas ist Bruce, Carolyn und Michael Rouleau gewidmet. Michael, weil er seine Eltern stolz macht. Carolyn, weil sie Bruce glücklich macht. Bruce, weil er in all den Jahren so zuverlässig war und weil er wirklich weiß, welche Gefühle man für einen guten Hund hegen kann.
In dem, was ich nicht fürchten kann, spür’ ich mein Schicksal. Ich lerne gehend, wohin meiner Schritte Gang mich führt.
Theodore Roethke, »Das Erwachen«
1
Es ist nur das Leben. Irgendwie bringen wir es alle hinter uns.
Nicht alle von uns beenden jedoch die Reise in ein und demselben Zustand. Unterwegs verlieren manche bei Unfällen oder gewaltsamen Auseinandersetzungen ihre Beine oder Augen, während andere durch die Jahre gleiten, ohne sich weitere Sorgen machen zu müssen als die, dass an manchen Tagen ihre Frisur nicht richtig sitzt.
Ich besaß noch immer beide Beine und beide Augen, und selbst mein Haar sah akzeptabel aus, als ich an jenem Mittwochmorgen Ende Januar aus dem Bett stieg. Wäre ich sechzehn Stunden nach diesem Augenblick wieder schlafen gegangen, ohne mehr verloren zu haben als alle meine Haare, würde ich den Tag als wahren Triumph bezeichnen. Selbst wenn ich anschließend ein paar Zähne weniger gehabt hätte, wäre es ein Triumph gewesen.
Als ich in meinem Zimmer die Jalousien hochzog, war es windstill und der wolkenverhangene Himmel grau und schwer, doch er ging eindeutig mit einer Veränderung schwanger.
Über Nacht war laut den Radionachrichten in Ohio ein Passagierflugzeug abgestürzt, wobei Hunderte zu Tode gekommen waren. Überlebt hatte nur ein zehn Monate altes Kind. Man hatte es unversehrt in seinem übel zugerichteten Sitz gefunden, der aufrecht inmitten von verkohlten und verbogenen Trümmern stand.
Unter dem erwartungsvollen Himmel schwappten den ganzen Morgen über flache, träge Wellen an den Strand. Der Pazifik war grau und von pechschwarzen Schatten erfüllt, als schwämmen knapp unterhalb der Oberfläche fantastisch geformte Meeresungeheuer dahin.
In der Nacht war ich zweimal aus einem Traum erwacht, in dem eine rote Flut heranrollte, während das Meer in einem schrecklichen Licht pulsierte.
Was Alpträume angeht, habt ihr bestimmt schon schlimmere gehabt. Das Problem besteht darin, dass sich einige meiner Träume bewahrheitet haben und dabei Menschen zu Tode gekommen sind.
Während ich für meinen Arbeitgeber das Frühstück zubereitete, kam im Küchenradio die Nachricht, die Terroristen, die am Vortag im Mittelmeer ein Kreuzfahrtschiff gekapert hätten, seien nun damit beschäftigt, die Passagiere zu enthaupten.
Ich habe schon vor Jahren damit aufgehört, mir Nachrichten im Fernsehen anzuschauen. Worte und das Wissen, das sie vermitteln, kann ich ertragen, aber die Bilder machen mich fertig.
Weil Hutch an Schlaflosigkeit litt und erst in der Morgendämmerung zu Bett ging, ließ er sich sein Frühstück mittags bringen. Er bezahlte mich gut und war ein freundlicher Mensch, weshalb ich meine Arbeit an seinen Lebensrhythmus anpasste, ohne mich zu beklagen.
Seine Mahlzeiten nahm Hutch im Esszimmer ein, wo die Vorhänge immer zugezogen waren. Dazwischen blieb kein einziger heller Streifen sichtbar.
Beim Essen sah er sich oft einen Film an und blieb noch ein wenig bei einer Tasse Kaffee sitzen, bis der Abspann kam. Auch an jenem Tag hatte er keinen Nachrichtensender eingeschaltet, sondern sah sich Carole Lombard und John Barrymore in Napoleon vom Broadway an.
Angesichts seiner achtundachtzig Jahre war Hutch noch in der Zeit des Stummfilms geboren, als Namen wie Lillian Gish und Rudolph Valentino am Kinohimmel glänzten. Auch er war später ein erfolgreicher Schauspieler gewesen. Nicht zuletzt deshalb dachte er weniger in Worten als in Bildern und hielt sich gern in einer Fantasiewelt auf.
Neben seinem Teller stand eine Flasche mit Desinfektionsgel. Damit reinigte er sich nicht nur vor und nach dem Essen ausgiebig die Hände, sondern auch mindestens zweimal im Lauf einer Mahlzeit.
Wie die meisten Amerikaner in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts fürchtete Hutch sich vor allem - außer vor dem, was er hätte fürchten sollen.
Wenn den Machern der Fernsehnachrichten die Geschichten über versoffene, drogensüchtige, mordlüsterne oder anderweitig durchgedrehte Prominente ausgingen (was etwa zweimal pro Jahr vorkam), dann füllten sie die kurze Lücke gelegentlich mit einem Sensationsbericht über gewisse fleischfressende Bakterien.
Infolgedessen hatte Hutch Angst davor, sich diese heißhungrigen Erreger zuzuziehen. Von Zeit zu Zeit hockte er beim Lampenschein in seinem Arbeitszimmer wie eine jener verdrießlichen Gestalten, die die Geschichten von Edgar Allan Poe bevölkern, und grübelte über sein Schicksal nach, über die Anfälligkeit seines Fleisches und den unersättlichen Appetit seiner mikroskopischen Widersacher.
Vor allem fürchtete er sich davor, dass seine Nase aufgefressen werden könnte.
In längst vergangenen Tagen war sein Gesicht berühmt gewesen. Obwohl die Zeit es verändert hatte, war er noch immer stolz auf sein Aussehen.
Ich hatte einige der Filme gesehen, die Lawrence Hutchison in den vierziger und fünfziger Jahren gedreht hatte. Sie gefielen mir. Hutch hatte es verstanden, auf der Leinwand eine echte Präsenz zu entfalten.
Weil er seit fünf Jahrzehnten nicht mehr vor die Kamera getreten war, kannte man ihn inzwischen weniger wegen seiner Schauspielkünste als wegen seiner Kinderbücher über ein draufgängerisches Kaninchen namens Nibbles. Im Gegensatz zu seinem Schöpfer war Nibbles völlig furchtlos.
Die Einkünfte aus seinen Filmen und Büchern sowie die Angewohnheit, Investmentgelegenheiten mit paranoidem Argwohn zu betrachten, hatten dafür gesorgt, dass Hutch im Alter finanziell gesichert war. Dennoch machte er sich Sorgen, ein dramatischer Anstieg des Ölpreises oder dessen totaler Zusammenbruch könnte zu einer weltweiten Finanzkrise führen, die ihn bettelarm machen würde.
Sein Haus stand direkt an der Uferpromenade und damit am Strand. Von der Tür aus war man in einer Minute dort, wo sich die Wellen brachen.
Im Lauf der Jahre hatte er allmählich Angst vor dem Meer entwickelt. Inzwischen ertrug er es nicht mehr, im westlichen Teil des Hauses zu schlafen, wo er womöglich hörte, wie die Brandung an den Strand kroch.
Deshalb war ich im besten Schlafzimmer des Hauses untergebracht, von dem man einen Blick aufs Meer hatte. Hutch schlief in einem nach hinten liegenden Gästezimmer.
Einen guten Monat vor dem Traum mit der roten Flut war ich in Magic Beach eingetroffen, und es hatte nur einen Tag gedauert, bis ich die Stelle als Hutchs Koch gefunden hatte. Wenn er einen Ausflug machen wollte, was selten vorkam, diente ich ihm zudem als Chauffeur.
Bei der Arbeitssuche hatten sich die Erfahrungen, die ich im Pico-Mundo-Grill gesammelt hatte, als sehr nützlich erwiesen. Wer Bratkartoffeln zubereiten kann, die den Mund wässrig machen, wer Frühstücksspeck perfekt knusprig braten kann, ohne ihn auszutrocknen, und wer Pfannkuchen bäckt, die gehaltvoll wie Pudding und doch so locker sind, dass sie fast vom Teller schweben, der findet immer Arbeit.
Es war halb fünf, als ich an jenem Nachmittag Ende Januar ins Wohnzimmer trat, begleitet von meinem Hund Boo. Hutch saß in seinem Lieblingssessel und stierte finster in den Fernseher, dessen Ton er abgestellt hatte.
»Schlechte Nachrichten, Sir?«
Seine tiefe, sonore Stimme verlieh jeder Silbe einen unheilvoll rollenden Ton: »Der Mars erwärmt sich.«
»Wir leben doch gar nicht auf dem Mars.«
»Er erwärmt sich im selben Tempo wie die Erde.«
»Hatten Sie etwa vor, auf den Mars umzuziehen, um der globalen Erwärmung zu entkommen?«
Hutch deutete auf den lautlos sprechenden Moderator im Fernseher. »Das bedeutet, dass die Sonne die Ursache für beides ist. Man kann also nichts dagegen unternehmen. Absolut nichts.«
»Na ja, Sir, schließlich gibt es noch Jupiter und die anderen Planeten, die jenseits des Mars kommen.«
Er fixierte mich mit dem funkelnden grauäugigen Blick, den er vor der Kamera eingesetzt hatte, um engagierten Staatsanwälten und tapferen Offizieren einen Ausdruck unerbittlicher Entschlossenheit zu verleihen.
»Manchmal, junger Mann, habe ich den Eindruck, dass du selber von irgendwo jenseits des Mars kommst.«
»Nicht ganz. Etwas Exotischeres als Pico Mundo, Kalifornien, habe ich leider nicht zu bieten. Sir, wenn Sie mich eine Weile nicht brauchen, dann würde ich gern einen Spaziergang machen.«
Hutch erhob sich. Er war groß und hager. Das Kinn hielt er angehoben, reckte jedoch den Kopf vorwärts wie jemand, der die Augen zusammenkneift, um besser zu sehen. Vielleicht hatte er sich diese Gewohnheit in den Jahren vor seiner Staroperation zugelegt.
»Du willst rausgehen?« Stirnrunzelnd kam er auf mich zu. »In dem Aufzug?«
Ich trug Turnschuhe, Jeans und ein Sweatshirt.
Da er nicht unter Arthritis litt, war er für sein Alter noch recht gelenkig. Dennoch bewegte er sich so achtsam und vorsichtig, als würde er jeden Moment einen Knochenbruch erwarten.
Nicht zum ersten Mal erinnerte er mich an einen durchs Wasser stelzenden Fischreiher.
»Du solltest eine Jacke anziehen. So holst du dir noch eine Lungenentzündung.«
»Heute ist es doch gar nicht so frisch«, beruhigte ich ihn.
»Ihr jungen Leute haltet euch für unverwundbar.«
»So jung bin ich gar nicht mehr, Sir. Ich habe Grund genug, mich zu wundern, dass ich nicht schon für immer unter dem Rasen liege.«
Hutch deutete auf den Schriftzug MYSTERY TRAIN, der auf meinem Sweatshirt prangte. »Was soll das eigentlich bedeuten?«
»Keine Ahnung. Das Shirt habe ich in einem Secondhandladen gefunden.«
»Ich war noch nie in einem Secondhandladen.«
»Da haben Sie nicht viel versäumt.«
»Kaufen eigentlich nur sehr arme Leute dort ein, oder geht es in erster Linie um Sparsamkeit?«
»Da trifft man alle gesellschaftlichen Schichten, Sir.«
»Dann sollte ich auch bald mal so einen Laden aufsuchen. Als eine Art Abenteuer.«
»Einen Flaschengeist werden Sie da aber nicht finden«, sagte ich. Das war eine Anspielung auf seinen Film Der Antiquitätenladen.
»Zweifellos bist du zu modern, um an Flaschengeister und Ähnliches zu glauben. Wie kommt man eigentlich durchs Leben, wenn man nichts hat, woran man glaubt?«
»Ach, da gibt es schon ein paar Sachen, an die ich glaube.«
Daran war Lawrence Hutchison allerdings weniger interessiert als am Klang seiner gut geschulten Stimme. »Ich beispielsweise bin sehr aufgeschlossen für alles Übernatürliche.«
Seine Selbstbezogenheit fand ich einfach liebenswert. Außerdem war sie praktisch, denn wenn er zu neugierig gewesen wäre, was mich anging, dann wäre es mir schwerer gefallen, meine vielen Geheimnisse für mich zu behalten.
»Mein Freund Adrian White«, fuhr er fort, »war mit einer Wahrsagerin verheiratet, die sich Portentia nannte.«
Solche Anekdoten hatte ich auch zu bieten. »Ich kannte ein Mädchen namens Stormy Llewellyn. Als ich mit ihr einmal beim Rummel war, haben wir an einem Wahrsageautomaten, der sich Zigeunermumie nannte, eine Karte gezogen.«
»Portentia hat zwar eine Kristallkugel verwendet und eine Menge Hokuspokus von sich gegeben, aber sie war echt. Adrian hat sie regelrecht verehrt.«
»Auf der Karte stand, Stormy und ich würden für immer zusammen sein. So ist es allerdings nicht gekommen.«
»Portentia konnte den Tod eines Menschen auf die Stunde genau vorhersagen.«
»Hat sie denn Ihren Tod vorhergesagt, Sir?«
»Meinen nicht, aber den von Adrian. Und zwei Tage später hat sie ihn genau zu der Stunde, die sie genannt hatte, erschossen.«
»Unglaublich!«
»Aber wahr, das kann ich dir versichern.« Er warf einen Blick auf eines der Fenster, das nicht zum Meer hinausging und deshalb auch nicht von Vorhängen verhüllt war. »Hast du das Gefühl, heute ist Tsunamiwetter, Junge?«
»Ich glaube nicht, dass Tsunamis etwas mit dem Wetter zu tun haben.«
»Ich spüre etwas. Behalt den Ozean im Auge, während du spazieren gehst.«
Wie ein Reiher stelzte er aus dem Wohnzimmer in den Flur, der zum rückwärtigen Teil des Hauses mit der Küche führte.
Ich ging durch die Haustür, durch die Boo bereits geglitten war. In dem umzäunten Vorgarten wartete der Hund auf mich.
Ein Spalierbogen rahmte das Tor. Durch das weiße Holzgitter wanden sich purpurrote Bougainvilleen, die selbst im Winter einige Blüten hervorbrachten.
Als ich hinter mir das Tor zugezogen hatte, glitt Boo hindurch, während ich einen Augenblick stehen blieb, um tief die frische, salzige Luft einzuatmen.
Nachdem ich einige Monate als Gast eines Klosters hoch oben in den Bergen zugebracht hatte, um mich mit meinem merkwürdigen Leben und allem, was ich verloren hatte, auseinanderzusetzen, wollte ich an Weihnachten eigentlich daheim in Pico Mundo sein. Stattdessen war ich hierhergerufen worden, zu einem Zweck, den ich damals noch nicht kannte und auch jetzt noch nicht erraten hatte.
Meine Gabe - oder mein Fluch - umfasst mehr als einen gelegentlichen prophetischen Traum. Zum Beispiel führt mich eine unwiderstehliche Intuition manchmal an Orte, die ich freiwillig nie im Leben aufsuchen würde. Und dann warte ich geduldig ab, bis ich herausgefunden habe, warum ich dort gelandet bin.
Boo und ich hielten uns Richtung Norden. Die über drei Meilen lange Strandpromenade von Magic Beach war nicht aus Holz gezimmert, sondern betoniert. Als Strandpromenade wurde sie von der Stadtverwaltung trotzdem bezeichnet.
Wörter sind heutzutage äußerst dehnbar. Kleinkredite, die man verzweifelten Leuten zu horrenden Zinsen anbietet, nennt man Gehaltsvorschuss. Ein mieses Hotel, zu dem ein schäbiges Spielcasino gehört, gilt als Resort. Jedes beliebige Sammelsurium aus hektischen Bildern, schlechter Musik und einer disparaten Handlung wird als große Filmkunst gerühmt.
Wir folgten der Strandpromenade aus Beton. Boo war ein Deutscher-Schäferhund-Mischling mit vollständig weißem Fell. Der von einem Horizont zum anderen reisende Mond bewegte sich nicht leiser als er.
Nur ich nahm ihn wahr, denn er war ein Geisterhund.
Nicht selten sehe ich die Geister toter Menschen, die zögern, aus dieser Welt weiterzuziehen. Tiere jedoch sind nach meiner Erfahrung immer gern bereit zu erfahren, was als Nächstes kommt. Boo stellte eine Ausnahme dar.
Warum er sich so verhielt, blieb ein Geheimnis. Die Toten sprechen nicht, und Hunde noch nicht einmal zu Lebzeiten. Deshalb befolgte mein Gefährte also gleich zwei Schweigegelübde.
Womöglich blieb er in dieser Welt, weil er wusste, dass ich ihn in irgendeiner Gefahrensituation brauchte. Darauf musste er vielleicht nicht mehr lange warten, da ich häufig bis zum Hals im Schlamassel steckte.
Rechts von uns kam eine Reihe von Privathäusern mit Meerblick, gefolgt von Läden, Lokalen und dem dreistöckigen Magic Beach Hotel mit seinen weißen Wänden und grün gestreiften Markisen.
Zu unserer Linken ging der Strand in einen Park über. Da es ein sonnenloser Spätnachmittag war, warfen die Palmen keine Schatten auf die Grünfläche.
Der bedrohliche Himmel und die kühle Luft hatten die Strandbesucher abgeschreckt. Auf den Parkbänken saß niemand.
Dennoch wusste ich intuitiv, dass sie hier war, nicht im Park, sondern weit draußen über dem Meer. Sie war in meinem roten Traum vorgekommen.
Bis auf das Rauschen der trägen Brandung war es still. Die Palmwedel warteten auf eine Brise, die sie zum Flüstern bringen würde.
Breite Stufen führten zum Pier hinauf. Da Boo ein Geist war, machte er auch auf den verwitterten Bohlen keinerlei Geräusch, und als zukünftiger Geist war selbst ich in meinen Turnschuhen weitgehend lautlos.
Am Ende des Piers verbreiterte dieser sich zu einer Beobachtungsplattform. Durch mehrere Münzfernrohre konnte man dort die vorbeiziehenden Schiffe, die Küste und den zwei Meilen weiter nördlich gelegenen Hafen ins Visier nehmen.
Die Glockendame saß auf der letzten Bank, dem Horizont zugewandt, wo der mottenkugelgraue Himmel nahtlos mit dem trüben Meer verschmolz.
Ich lehnte mich ans Geländer und tat so, als würde ich über den zeitlosen Marsch der Wellen meditieren. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass die Glockendame mich offenbar noch nicht wahrgenommen hatte, weshalb ich in aller Ruhe ihr Profil studieren konnte.
Sie war weder schön noch hässlich, aber hausbacken sah sie auch nicht aus. Ihre Gesichtszüge waren unauffällig, ihre Haut war rein und ein wenig zu bleich, und doch zog sie mich in den Bann.
Mein Interesse an ihr war nicht romantischer Natur. Eine geheimnisvolle Aura umgab sie, und ich hatte den Verdacht, dass ihre Geheimnisse außergewöhnlich waren. Es war also die Neugier, die mich zu ihr zog - und das Gefühl, dass sie vielleicht einen Freund brauchte.
Obwohl sie in meinem Traum von einer roten Flut erschienen war, bewahrheitete sich dieser vielleicht nicht, und sie musste doch nicht sterben.
Ich hatte sie bereits mehrfach gesehen. Dabei hatten wir sogar einige belanglose Worte gewechselt, hauptsächlich Bemerkungen über das Wetter.
Weil sie redete, wusste ich, dass sie nicht tot war. Manchmal erkenne ich eine Person erst dann als Geist, wenn sie verblasst oder durch eine Wand geht.
In anderen Fällen ist die Sache klar. Ist jemand ermordet worden und will, dass ich den Mörder seiner gerechten Strafe zuführe, dann materialisiert er sich unter Umständen mit seinen Wunden. Wenn ich einem Mann gegenüberstehe, dessen Gesicht durch den Aufprall einer Kugel zerschmettert ist, oder einer Frau, die ihren abgetrennten Kopf unter dem Arm trägt, dann merke ich natürlich gleich, dass ich mich in Gesellschaft eines Geistes befinde.
In dem Traum der vergangenen Nacht hatte ich an einem Strand gestanden. Apokalyptisches Licht flackerte über den Sand, und das Meer pulsierte, als wollte ein Ungetüm aus der Tiefe steigen. Wolken, so rot und orange wie Flammen, erstickten den Himmel.
Von Westen her schwebte die Glockendame mitten in der Luft auf mich zu, die Arme über der Brust gekreuzt, die Augen geschlossen. Als sie näher kam, gingen ihre Augen auf, und ich sah darin eine Spiegelung dessen, was sich hinter mir befand.
Zweimal war ich vor dem Bild, das sich mir in ihren Augen bot, zurückgeschreckt, und beide Male war ich aufgewacht, ohne mich daran erinnern zu können.
Nun trat ich vom Geländer weg und setzte mich neben sie. Auf die Bank hätten vier Personen gepasst, und wir saßen am jeweils äußersten Ende.
Boo rollte sich auf dem Boden zusammen und legte die Schnauze auf meine Schuhe. Ich konnte das Gewicht seines Kopfes auf meinen Füßen spüren.
Wenn ich einen Geist - ob Hund, ob Mensch - berühre, fühlt er sich fest und warm an. Keinerlei Kühle, kein Geruch des Todes haftet daran.
Die Glockendame blickte unverwandt aufs Meer hinaus und schwieg.
Sie trug weiße Sportschuhe, dunkelgraue Hosen und einen weiten rosa Pulli, dessen Ärmel so lang waren, dass sie ihre Hände verbargen.
Weil es sich um eine zierliche Person handelte, war ihr Zustand deutlicher sichtbar als bei einer fülligeren Frau. Auch der geräumige Pulli konnte nicht verbergen, dass sie etwa im achten Monat schwanger war.
Ich hatte sie noch nie mit einem männlichen Begleiter gesehen.
Um den Hals trug sie den Gegenstand, nach dem ich sie benannt hatte. An einer Silberkette hing ein poliertes Silberglöckchen, ungefähr so groß wie ein Fingerhut. An diesem sonnenlosen Tag war das einfache Schmuckstück das Einzige, was glänzte.
Sie war etwa achtzehn, drei Jahre jünger als ich. Wegen ihrer schlanken Figur sah sie eher wie ein Mädchen als wie eine Frau aus.
Dennoch wäre es mir nie in den Sinn gekommen, sie Glocken mädchen zu nennen. Ihre Selbstbeherrschung und ihr ruhiges Verhalten erforderten den Ausdruck Dame.
»Hast du schon jemals eine solche Stille gehört?«, fragte ich.
»Da ist ein Sturm im Anzug.« Ihre Stimme brachte die Worte zum Schweben wie ein sommerlicher Lufthauch das Schirmchen einer Pusteblume. »Vorher lässt der Luftdruck den Wind stocken und drückt die Wellen nieder.«
»Bist du etwa Meteorologin?«
Ihr Lächeln war wunderschön, frei von Voreingenommenheit und Künstlichkeit. »Ich bin bloß eine Frau, die zu viel nachdenkt.«
»Mein Name ist Odd Thomas.«
»Ja«, sagte sie.
Darauf vorbereitet, wie schon so oft die merkwürdigen familiären Umstände erklären zu müssen, die zu meinem Namen geführt hatten, war ich überrascht und enttäuscht, dass sie keine der üblichen Fragen stellte.
»Du kennst meinen Namen?«, fragte ich.
»So, wie du meinen kennst.«
»Aber den kenne ich gar nicht.«
»Ich bin Annamaria«, sagte sie. »Zusammengeschrieben. Ich wäre bald selbst auf dich zugekommen.«
»Wir haben uns zwar schon kurz unterhalten«, sagte ich verwirrt, »aber ich bin sicher, dass wir uns dabei nicht vorgestellt haben.«
Sie lächelte nur und schüttelte den Kopf.
Ein weißer Fleck zog bogenförmig über den trüben Himmel - eine Möwe, die an Land flüchtete, da der Nachmittag sich dem Ende zuneigte.
Annamaria schob die langen Ärmel ihres Pullis zurück, so dass ihre schlanken Hände zum Vorschein kamen. In der rechten hielt sie einen durchscheinenden grünen Stein, so groß wie eine dicke Traube.
»Ist das ein Edelstein?«, fragte ich.
»Meerglas. Eine Flaschenscherbe, die um die ganze Welt gespült wurde, bis sie keine scharfen Kanten mehr hatte. Ich habe sie am Strand gefunden.« Sie drehte die Glasscherbe zwischen den Fingern hin und her. »Was meinst du, was sie wohl bedeutet?«
»Muss sie denn etwas bedeuten?«
»Die Flut hat den Sand so glatt gemacht wie Babyhaut, und als das Wasser sich zurückzog, hat sich das Glas geöffnet wie ein grünes Auge.«
Vogelkreischen zerstörte die Stille. Als ich den Blick hob, sah ich drei aufgeregte Möwen landeinwärts fliegen.
Ihre Schreie verkündeten Gesellschaft, und tatsächlich hörte ich im nächsten Augenblick auf dem Pier hinter uns Schritte.
Drei Männer Ende zwanzig marschierten zur Nordkante der Beobachtungsplattform. Dort blieben sie stehen und blickten die Küste entlang auf den fernen Hafen mit seinen Fischer- und Segelbooten.
Zwei trugen Khakihosen und Daunenjacken, und sie sahen wie Brüder aus. Rotes Haar, Sommersprossen. Ohren, die so deutlich abstanden wie Bierglashenkel.
Die Rotschöpfe blickten zu uns herüber. Ihre Gesichter waren so hart und ihre Augen so kalt, dass ich sie vielleicht für böse Geister gehalten hätte, wären ihre Schritte nicht hörbar gewesen.
Einer der beiden schenkte Annamaria ein rasiermesserscharfes Lächeln. Er hatte die dunklen, lädierten Zähne eines starken Methamphetamin-Users.
Das Duo mit den Sommersprossen machte mich nervös, aber noch beunruhigender war der dritte Mann. Knapp zwei Meter groß, überragte er die beiden anderen ein gutes Stück und besaß eine Muskelmasse, die nur durch regelmäßige Steroid-Spritzen entstanden sein konnte.
Trotz der kühlen Luft trug er Joggingschuhe ohne Socken, weiße Shorts und ein gelb-blaues Hawaiihemd mit Orchideenmuster.
Die Brüder sagten etwas zu ihm, worauf der Koloss uns betrachtete. Unter Neandertalern hätte er womöglich als hübsch gegolten, aber seine Augen sahen so gelb aus wie sein kleiner Kinnbart.
Den prüfenden Blick, mit dem er uns betrachtete, verdienten wir eigentlich nicht. Annamaria war eine ganz normal aussehende schwangere Frau und ich bloß ein Grillkoch, der das Glück gehabt hatte, einundzwanzig Jahre alt zu werden, ohne ein Bein, ein Auge oder seine Haare zu verlieren.
In manchen verdrehten Hirnen wohnten Bosheit und Paranoia eng zusammen, das hatte ich schon oft erfahren. Solche Menschen vertrauten niemandem, denn sie wussten um die Heimtücke, zu der sie selbst fähig waren.
Nach einem langen, argwöhnischen Blick wandte der Muskelberg seine Aufmerksamkeit wieder der Nordküste und dem Hafen zu. Das taten seine Kumpane ebenfalls, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sie uns endgültig in Ruhe lassen würden.
Es blieb noch eine halbe Stunde bis Sonnenuntergang, doch wegen des bedeckten Himmels schien bereits die Dämmerung angebrochen zu sein. Die Laternen am Pier entlang waren automatisch angegangen, während ein feiner Nebelschleier aus dem Nirgendwo gekommen war, um der nahenden Dunkelheit Vorschub zu leisten.
Boos Verhalten bestätigte meine instinktiven Vermutungen. Er war aufgestanden. Mit gesträubtem Nackenfell und angelegten Ohren richtete er den Blick unverwandt auf den Muskelberg am Geländer.
»Ich glaube, wir sollten verschwinden«, sagte ich zu Annamaria.
»Kennst du die drei?«
»Von der Sorte habe ich schon genug gesehen.«
Während sie sich von der Bank erhob, umschloss sie die grüne Glasscherbe mit der rechten Faust. Dann verschwanden beide Hände wieder in den Ärmeln ihres Pullis.
Ich spürte viel Kraft in ihr, doch sie hatte auch etwas Unschuldiges an sich, einen fast kindlichen Anflug von Verletzlichkeit. Die drei Männer gehörten zu dem Typus, für den jemand Verletzliches einen bestimmten Geruch besaß. Den konnten sie so leicht wahrnehmen wie Wölfe, die einen im hohen Gras verborgenen Hasen witterten.
Boshafte Menschen verwunden und zerstören sich zwar oft gegenseitig, aber wenn sie sich bewusst ein Opfer aussuchen, dann am liebsten jemanden, der so unschuldig und rein ist, wie es diese Welt überhaupt zulässt. Sie nähren sich ohnehin von Gewalt, doch ein besonderer Kick ist es für sie, sich an etwas zu vergehen, das ganz anders ist als sie.
Während Annamaria und ich die Plattform verließen und aufs Ufer zugingen, stellte ich erschrocken fest, dass niemand sonst auf den Pier gekommen war. Normalerweise hatten sich dort zu dieser Zeit zumindest schon ein paar Angler mit ihrem Gerät postiert.
Ich drehte den Kopf und sah Boo auf die drei Männer zugehen, die ihn natürlich nicht wahrnahmen. Der Kerl mit dem Kinnbart blickte über die Köpfe der beiden anderen zu Annamaria und mir herüber.
Das Ufer war noch ein gutes Stück weit entfernt. Auf der anderen Seite sank die Sonne hinter dichten Wolken langsam zum Horizont, und der aufsteigende Nebel dämpfte das Laternenlicht.
Als ich mich erneut umsah, kam das rothaarige Duo mit raschen Schritten anmarschiert.
»Geh einfach weiter«, sagte ich zu Annamaria. »Runter vom Pier, irgendwohin, wo du unter Menschen bist.«
Sie war ganz ruhig. »Ich bleibe bei dir«, sagte sie.
»Nein. Das schaffe ich schon.«
Behutsam schob ich sie an, vergewisserte mich, dass sie weiterging, und wandte mich dann den zwei Rotschöpfen zu. Statt dazustehen oder zurückzuweichen, ging ich auf sie zu - lächelnd, was sie so überraschte, dass sie stehen blieben.
Während der mit den schlechten Zähnen an mir vorbei auf Annamaria blickte und während Nummer zwei in seine geöffnete Jacke griff, fragte ich: »Sagt mal, Leute, habt ihr schon von der Tsunamiwarnung gehört?«
Nummer zwei ließ seine Hand in der Jacke, während die wandelnde Mahnung für gute Zahnhygiene den Blick auf mich richtete. »Was für ein Tsunami?«
»Das Ding soll sechs bis neun Meter hoch werden.«
»Hä?«
»Selbst wenn es neun Meter hoch ist«, sagte ich, »wird es den Pier nicht überspülen. Die Kleine da hinten hat Angst bekommen und wollte nicht bleiben, aber ich will es sehen. Schließlich sind wir locker zehn Meter über der Wasseroberfläche, oder? Wird bestimmt ganz schön cool.«
Währenddessen war der Muskelberg allmählich näher gekommen. Als er zu uns trat, fragte Nummer zwei ihn: »Hast du was von’nem Tsunami gehört?«
»Eine sechs Meter hohe Welle kann die Ufermauer gut aushalten«, sagte ich aufgeregt, »aber die restlichen drei Meter - Mann! -, die werden die erste Häuserreihe da hinten einfach plattmachen.«
Als ich mich umblickte, als wollte ich die mögliche Zerstörung einschätzen, sah ich erleichtert, dass Annamaria das Ende des Piers erreicht hatte.
»Aber die Pfähle vom Pier sind tief im Boden versenkt«, fuhr ich fort. »Die werden das aushalten, da bin ich mir ziemlich sicher. Kein Problem. Meint ihr nicht auch, dass der Pier das aushält?«
Die Mutter des Muskelbergs hatte ihm wahrscheinlich gesagt, er habe haselnussbraune Augen. Das stimmte aber nicht. Seine Augen waren nicht braun, sondern scheußlich gelb.
Wären zudem seine Pupillen elliptisch und nicht rund gewesen, dann hätte man ihn für einen humanoiden Roboter halten können, in dessen Schädel ein intelligenter Mutantenkater saß und durch die leeren Augenhöhlen herausblickte. Kein netter intelligenter Mutantenkater natürlich.
Seine Stimme passte allerdings nicht zu dieser Vorstellung, denn ihr Timbre erinnerte nicht an einen Kater, sondern an einen Bären. »Wer bist du?«
Statt zu antworten, tat ich weiter so, als würde ich aufgeregt auf den angeblichen Tsunami warten. »Das Ding kann schon in wenigen Minuten anrollen«, sagte ich und sah auf meine Armbanduhr. »Ich will da vorne auf der Plattform sein, wenn es kommt.«
»Wer bist du?«, wiederholte der Muskelberg und legte mir die rechte Pranke auf die linke Schulter.
Sobald er mich berührte, verschwand die Realität so schlagartig aus meinem Blick, als hätte bei einer Diaschau das Bild gewechselt. Ich stand nicht mehr auf dem Pier, sondern an der Küste, an einem Strand, auf dem der Widerschein von Feuer flackerte. Etwas Grelles, Grässliches stieg aus den Tiefen eines Meers empor, das in höllischem Licht pulsierte. Über der ganzen Szene breitete sich ein bedrohlicher Himmel aus.
Der Alptraum.
Im nächsten Augenblick war die Realität wieder da.
Der Muskelberg hatte die Hand von meiner Schulter genommen. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er auf seine gespreizten Finger, als wäre er von etwas gestochen worden. Vielleicht hatte aber auch er die rote Flut meines Traums gesehen.
Noch nie zuvor hatte ich jemanden, der mich berührte, mit einem Traum, einer Vision oder einem Gedanken angesteckt, nur mit einem gewöhnlichen Schnupfen. Trotzdem erschrak ich nicht, denn solche Überraschungen bewahrten mich regelmäßig vor Langeweile.
Der gelbe Blick richtete sich wieder auf mich wie die kalten Edelsteinaugen eines steinernen Götterbilds. »Wer zum Teufel bist du?«
Der Ton seiner Stimme machte die Rotschöpfe darauf aufmerksam, dass etwas Ungewöhnliches geschehen war. Der mit der Hand in der Jacke zog eine Pistole heraus, und der mit den schlechten Zähnen griff nun ebenfalls in seine Jacke. Kaum, um Zahnseide hervorzuholen.
Ich spurtete die drei Schritte bis zum Rand des Piers, hechtete übers Geländer und fiel wie ein Grillkoch durch Nebel und schwindendes Licht.
Kalt und dunkel verschlang mich der Pazifik. Meine Augen brannten, während ich unter der Oberfläche dahinschwamm und gegen den Auftrieb des Salzwassers ankämpfte. Schließlich sollte das Meer mich nicht in eine von Kugeln durchlöcherte Dämmerung speien.
2
Meine weit offenen Augen brannten, und ich spürte, wie mir die Tränen kamen.
Ich ruderte mit Armen und Beinen, und das schwarze Wasser schien zuerst völlig lichtlos zu sein. Dann nahm ich ein mattgrünes, gleichmäßig verteiltes Phosphoreszieren wahr. Schwache, formlose Schatten bewegten sich darin, vielleicht vom Boden aufgewirbelte Sandwolken oder die langen, wogenden Stängel und Blätter von Seetang.
Plötzlich verwandelte sich das trübe Grün in völlige Schwärze. Zwischen zwei der Betonpfeiler, auf denen die hölzernen Stützpfosten ruhten, war ich unter den Pier geschwommen.
Einen blinden Augenblick später traf ich auf einen weiteren, über und über mit Muscheln bedeckten Pfeiler. Ich folgte ihm zur Oberfläche.
Nach Luft ringend, die nach Jod und Teer roch und nach Salz und Kalk schmeckte, klammerte ich mich an den verkrusteten Beton. Die Muscheln unter meinen Händen waren glatt, aber auch scharfkantig, so dass ich die Ärmel meines Sweatshirts über die Hände zog, um mich vor Schnitten zu schützen.
Träge geworden, wogte der Ozean rhythmisch und ohne Wucht zwischen den Pfeilern auf den Strand zu. So zahm er auch war, versuchte er letztlich doch, mich von meinem Halt wegzuziehen.
Jede Minute, die ich mich festhielt, würde zusätzlich Kraft kosten. Mein nasses Sweatshirt kam mir vor wie eine schwere Bomberjacke.
Auf den flüssigen Monolog des Meeres antwortete ein Murmeln und Flüstern am Boden des Piers, der für mich nun die Decke darstellte. Von oben her hörte ich weder Rufe noch das Donnern eiliger Schritte.
Tageslicht, so trübe und grau wie Bilgewasser, drang in diesen geschützten Raum. Über mir verschwand eine Architektur aus dicken, senkrechten Pfosten, horizontalen Verbindungsbalken und Querstreben im Dunkel.
Die Oberseite meines Pfeilers, auf dem sich einer der Holzpfosten erhob, befand sich weniger als einen Meter über meinem Kopf. Ich presste die Beine an den Beton und zog mich mit den Händen aufwärts. Immer wieder rutschte ich ein Stück zurück, gewann jedoch allmählich mehr an Höhe, als ich verlor.
Die Muscheln am Pfeiler waren von der unbeweglichen Sorte und saßen eng am Beton. Während ich mich Stück für Stück aus dem Wasser zog, splitterten und brachen ihre Schalen, so dass die Luft noch kalkiger roch und schmeckte als vorher.
Für die Muschelkolonie war dies zweifellos eine echte Katastrophe. Ich bedauerte die Zerstörung, die ich anrichtete, durchaus, aber doch weniger, als ich es getan hätte, wenn ich mich, von meinen nassen Kleidern beschwert und geschwächt, im Seetang verfangen hätte und ertrunken wäre.
Der Betonpfeiler hatte einen Durchmesser von etwa achtzig Zentimetern, der Pfosten darauf war halb so dick. Massive Stahlschrauben mit Ösen waren tief ins Holz getrieben worden, wahrscheinlich, um beim Bau als Handgriff und zur Verankerung von Seilen zu dienen. Mit ihrer Hilfe zog ich mich schließlich auf die schmale Kante, die sich durch die unterschiedliche Größe von Pfeiler und Pfosten ergab.
Dann stand ich tropfend und zitternd auf den Zehen und versuchte, die positive Seite meiner aktuellen Lage zu ergründen.
Pearl Sugars, meine Oma mütterlicherseits, eine professionelle Pokerspielerin mit einer Vorliebe für schnelle Autos und Alkohol, hatte mir immer eingeschärft, in jeder Zwangslage das Positive zu sehen.
»Wenn du dir anmerken lässt, dass du dir Sorgen machst«, hatte Oma Sugars gesagt, »dann machen die Schweinehunde dich fertig und marschieren am nächsten Tag in deinen Schuhen durch die Gegend.«
Sie reiste zu privaten Pokerrunden durchs Land, bei denen es um hohe Einsätze ging. Ihre Gegner waren Männer, die großteils nicht gerade nett und in manchen Fällen sogar gefährlich waren. Ich hatte ihren Rat zwar akzeptiert, aber wenn ich daran dachte, kam mir unweigerlich das Bild eines harten Typen in den Sinn, der finster blickend in Omas Stöckelschuhen umherstolzierte.
Während mein Herzschlag sich normalisierte und ich langsam zu Atem kam, fiel mir tatsächlich ein positiver Aspekt meiner Lage ein: Sollte ich wider Erwarten alt und grau werden - wenn auch einäugig, einarmig, einbeinig und haarlos -, dann musste ich mich wenigstens nicht über ein langweiliges Leben beklagen.
Offenbar hatten die Dunkelheit und das trübe Wasser verhindert, dass der Kerl mit Kinnbart und die zwei Brüder gesehen hatten, wie ich unter dem Pier verschwunden war. Wahrscheinlich hatten sie sich deshalb am Strand postiert, um mich in Empfang zu nehmen, wenn ich an Land schwamm.
Ich war zwar in der Nähe der Beobachtungsplattform vom Pier gesprungen, aber danach hatte die Strömung mich näher ans Ufer gedrückt. Die Mitte des Piers hatte ich jedoch noch nicht erreicht.
Von meiner Warte aus sah ich den Strand, aber nur sehr verschwommen. Falls dort tatsächlich jemand patrouillierte, konnte er mich in der zunehmenden Dunkelheit wohl ebenfalls nicht erkennen.
Darauf verlassen wollte ich mich jedoch nicht, denn wenn ich mich nicht gerade Hals über Kopf ins Wasser stürze, bin ich ein vorsichtiger junger Mann. Deshalb hielt ich es für klüger, erst einmal ein Stück weiter nach oben zu klettern.
Hatte ich irgendeinen halbwegs gemütlichen Ort gefunden, wollte ich dort hocken bleiben, bis die drei Schlägertypen überzeugt waren, ich sei ertrunken. Wenn sie sich davonmachten, um in irgendeiner schäbigen Kneipe ein Bier auf meinen Tod zu heben, konnte ich ungefährdet ans Ufer gelangen und nach Hause gehen, wo Hutch auf seinen Tsunami wartete.
Schraube um Schraube erklomm ich den Pfosten.
Anfangs waren die Schrauben fest verankert. Wahrscheinlich sorgte die starke Feuchtigkeit in der Nähe der Wasseroberfläche dafür, dass das Holz aufgequollen war.
Während ich langsam weiterkletterte, stellte ich jedoch fest, dass manche der höher angebrachten Schrauben sich in meinen Händen bewegten. Glücklicherweise trugen sie mein Gewicht, ohne sich zu lockern.
Dann brach unter meinem rechten Fuß doch eine Schraube aus dem Pfosten. Klirrend prallte sie vom Beton unten ab. Ich hörte sogar das leise Klatschen, mit dem sie ins Meer fiel.
An und für sich habe ich keine Angst vor Höhe oder Dunkelheit. Schließlich verbringen wir neun Monate in einem schützenden Dunkel, bevor wir geboren werden, und bei unserem Tod streben wir in die höchste Höhe.
Während ich in dem verlöschenden Tag weiterkletterte, wurden die Schatten tiefer und zahlreicher. Sie flossen ineinander wie die wogenden schwarzen Mäntel der Hexen, die sich in Shakespeares Macbeth um ihren Kessel versammeln.
Seit ich für Hutch arbeitete, hatte ich einige von Shakespeares Dramen gelesen, die im Bücherschrank standen. Der berühmte Kriminalautor Ozzie Boone, mein Freund und Mentor aus Pico Mundo, wäre begeistert gewesen, hätte er gewusst, dass ich auf diese Weise meine Bildung erweiterte.
An der Highschool hatte ich wenig Interesse gezeigt. Teilweise waren meine beschränkten schulischen Leistungen allerdings darauf zurückzuführen, dass ich nicht wie andere Schüler brav zu Hause bei der befohlenen Shakespeare-Lektüre hocken konnte, sondern - zum Beispiel - an zwei tote Männer gekettet und in der Mitte eines Sees von einem Boot geworfen wurde.
Oder ich hing in einem Kühlraum gefesselt an einem Fleischerhaken und wartete in Gesellschaft eines lächelnden japanischen Chiropraktikers darauf, dass vier äußerst unfreundliche Männer zurückkehrten, um uns zu foltern, wie sie es angekündigt hatten.
Oder ich war ins geparkte Wohnmobil eines reisenden Serienkillers eingedrungen, dessen Besitzer jeden Augenblick zurückkehren konnte. Dabei war ich auf zwei grimmige Kampfhunde getroffen, die entschlossen waren, mich am Verlassen des Fahrzeugs zu hindern. Wehren konnte ich mich lediglich mit dem, was ich vorgefunden hatte - mit einem rosa Staubwedel und sechs Dosen warmem Cola, die ich verzweifelt schüttelte, um die mordlüsternen Viecher mit dem hervorquellenden Schaum in die Flucht zu schlagen.
Eigentlich hatte ich immer vorgehabt, meine Hausaufgaben zu machen. Aber wenn ständig Tote ankommen, die nach Gerechtigkeit verlangen, und wenn man zudem noch gelegentlich prophetische Träume hat, dann kommt einem ständig etwas dazwischen.
Während ich nun sechs Meter über der Wasseroberfläche dahing, umhüllten mich die hexenhaften Schatten so vollständig, dass ich nicht einmal die nächste Schraube sehen konnte, die über meinem Kopf aus dem Pfosten ragte. Ich hielt inne und überlegte, ob ich trotzdem weiter in die Finsternis hinaufsteigen oder mich auf den schmalen Betonsims unter mir zurückziehen sollte.
Der ätzende Geruch des Schutzmittels, mit dem man das Holz angestrichen hatte, war beim Klettern immer stärker geworden. Inzwischen roch ich weder das Meer noch die nassen Betonpfeiler, ja, nicht einmal mehr meinen Schweiß, nur noch den Dunst der Chemikalie.
Als ich gerade zu dem Schluss gekommen war, dass ich aus Vorsicht - die, wie ihr inzwischen wisst, zu meinen beständigsten Charaktereigenschaften gehört - wieder absteigen sollte, flammte unter mir Licht auf.
Etwa eineinhalb Meter unterhalb meines Standorts waren an vielen der Holzpfosten Flutlichter befestigt, die aufs Meer gerichtet waren. In einer langen Linie verliefen sie von einem Ende des Piers bis zum anderen.
Ich konnte mich nicht daran erinnern, ob der Pier in anderen Nächten beleuchtet gewesen war. Vielleicht wurden die Lampen ja jeden Abend bei Anbruch der Dämmerung automatisch eingeschaltet.
Es war allerdings auch möglich, dass die Lichter nur für den Notfall gedacht waren, zum Beispiel, wenn jemand ins Wasser fiel. Ob wohl ein verantwortungsbewusster Bürger meinen Sprung beobachtet und die Polizei alarmiert hatte?
Nein. Wahrscheinlich hatten die drei Schläger gewusst, wo sich der Schalter befand. Wenn das der Fall war, dann hatten sie mich doch unter den Pier flüchten sehen und keine Zeit damit vergeudet, vom Strand aus nach einem ankommenden Schwimmer Ausschau zu halten.
Während ich weiterhin da hing und darüber nachgrübelte, ob ich angesichts der neuen Lage weiter nach oben klettern oder ins Wasser zurückkehren sollte, hörte ich in der Entfernung etwas, das ich im ersten Augenblick für eine Kettensäge hielt.
Nach zehn oder fünfzehn Sekunden wurde das Geräusch tiefer, und ich erkannte das charakteristische Tuckern eines Außenbordmotors.
Ich legte den Kopf schief, um herauszufinden, woher das Geräusch kam. Es dröhnte nicht nur verwirrend durch die Pfosten und Querbalken, sondern hallte auch von der Wasseroberfläche wider, aber nach einer halben Minute war ich mir sicher, dass sich das Fahrzeug vom äußeren Ende des Piers aus auf den Strand zubewegte.
Als ich in die betreffende Richtung spähte, konnte ich wegen der Pfostenreihe nichts sehen. Entweder fuhr das Boot parallel am Pier entlang, oder es schlängelte sich zwischen den Pfeilern hindurch, um gründlicher nach mir suchen zu können.
Die Flutlichter befanden sich zwar unter mir und waren abwärts gerichtet, aber das schaukelnde Wasser warf das Licht zurück. Schimmernde Phantome schnellten an den Pfeilern hoch, strichen über die waagrechten Balken und flatterten bis an die Unterseite der Bodenplanken.
Durch diese zitternden Spiegelungen war ich sichtbar. Ein leichtes Ziel.
Wenn ich jetzt hinunterkletterte, wäre das mein sicherer Tod.
Angesichts all dessen, was in den vorangegangenen Jahren passiert war, fühlte ich mich bereit für den Tod, wenn meine Zeit kam, und ich fürchtete ihn nicht. Aber wenn ich zu tollkühn handelte, konnte man das als selbstmörderisch bezeichnen. Bei einem Selbstmord droht der Seele bekanntlich die Verdammnis, und dann würde ich meine Freundin Stormy dort drüben womöglich niemals wiedersehen. Die Aussicht auf baldigen Frieden war es nicht wert, das zu riskieren.
Außerdem hatte ich den Verdacht, dass Annamaria in der Patsche saß und dass ich teilweise deshalb nach Magic Beach gelenkt worden war, um ihr zu helfen.
Rascher als vorher kletterte ich weiter und hoffte, eine Kreuzung aus Balken oder eine andere Struktur zu finden, wo ich nicht nur vom Widerschein des Flutlichts geschützt war, sondern auch vor forschenden Taschenlampen, falls die Männer im Boot welche hatten.
Obwohl ich keine Höhenangst habe, wäre ich lieber an tausend anderen Orten gewesen als ausgerechnet auf diesem Pfosten, wo ich mir vorkam wie eine auf den Baum gejagte Katze. Einerseits musste ich dankbar sein, dass unter mir nicht wie damals im Wohnwagen des Serienkillers zwei fiese Kampfhunde lauerten; andererseits besaß ich zur Verteidigung nicht einmal einen rosa Staubwedel und einen Sixpack warmes Cola.
3
Flink wie ein Affe, doch in meiner Verzweiflung bei weitem nicht so behände, kletterte ich am Pfosten hinauf. Meine Füße traten dorthin, wo sich kurz vorher meine Hände festgeklammert hatten.
Wieder brach eine lose Schraube aus dem morschen Holz und fiel klirrend auf den Beton unter mir. Das Tuckern des nahenden Außenbordmotors übertönte dieses Geräusch ebenso wie das gleich darauf folgende Wasserklatschen.
Ein kleines Stück weiter kam ein massiver Querbalken. Die plumpen Bewegungen, mit denen ich darauf kletterte, hätten jeden Beobachter endgültig davon überzeugt, dass ich bestimmt keiner Spezies angehörte, die auf Bäumen lebte und büschelweise Bananen fraß.
Der Balken war zwar breit, aber nicht so breit wie ich. Noch immer huschten die hellen Reflexionen der Fluchtlichter über meinen Körper und machten mich zu einem leichten Ziel für jeden geübten Schützen, der mich von unten her aufs Korn nahm.
Auf allen vieren zu krabbeln ist wunderbar, wenn alle viere aus Füßen bestehen. Auf Händen und Knien hingegen kommt man nicht gerade schnell vorwärts. In der Hoffnung, dass die Reaktion meines Magens meine mangelnde Höhenangst bestätigte, stand ich vorsichtig auf. Sofort wurde mir flau im Magen.
Als ich in die Tiefe blickte, wurde mir auch noch ein wenig schwindlig, weshalb ich rasch den Kopf hob und in die Richtung schaute, aus der das Motorengeräusch kam. Zu sehen war nichts, denn das Boot war hinter den Pfeilern verborgen.
Es dauert nicht lange, bis mir klarwurde, warum Seiltänzer eine Balancierstange verwenden. So, wie ich dastand, mit eng an die Seite gedrückten Armen und krampfhaft geballten Fäusten, schwankte ich wie ein Säufer, der ein Zwölfschritteprogramm schon nach vier Schritten aufgegeben hat.
Vorsichtig breitete ich die Arme aus und öffnete die Hände. Dabei schärfte ich mir ein, nicht auf meine Füße zu blicken, sondern auf den Balken vor mir, wo meine Füße hintreten sollten.
Bebendes Licht malte imaginäre Wellen auf den Balken und die Pfosten ringsum. Unwillkürlich stieg das Gefühl in mir auf, dass ich jeden Moment heruntergespült werden konnte.
So hoch über dem Meer und direkt unterhalb des Piers war der Geruch von Holzschutzmittel unerträglich. Ich spürte ein Brennen in den Nebenhöhlen und der Kehle. Als ich mit der Zunge über meine trockenen Lippen fuhr, schien sich darauf der Geschmack von Kohlenteer abgesetzt zu haben.
Ich blieb stehen und schloss kurz die Augen, um die hüpfenden Lichtreflexe loszuwerden. Mit angehaltenem Atem kämpfte ich gegen den Schwindel an, und erst als ich ihn losgeworden war, schritt ich weiter.
Als ich die Hälfte des Balkens hinter mir gelassen hatte, sah ich, dass dieser sich dort mit einem anderen Balken kreuzte, der längs unter dem Pier entlanglief.
Der Außenbordmotor war noch lauter geworden, hatte sich also noch weiter genähert. Doch bis jetzt war das Boot nicht in mein Blickfeld gekommen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel ODD HOURS bei Bantam Books, N.Y.
Copyright © 2008 by Dean Koontz Copyright © 2009 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Redaktion: Werner Bauer Herstellung: Helga Schörnig Gesetzt aus der Aldus bei Leingärtner, Nabburg
eISBN : 978-3-641-03422-1
www.heyne.de
Leseprobe
www.randomhouse.de