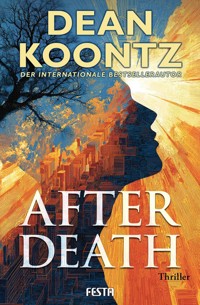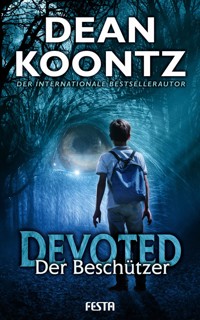9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nie war das Grauen bedrohlicher ...Ein merkwürdiger Fremder kommt in den kleinen Wüstenort Pico Mundo. Ihn umgeben hyänenartige Schatten, Vorboten eines fürchterlichen Todes. Doch nur der etwas einfältige Odd Thomas erkennt sie. Kann er das drohende Massaker verhindern?Odd Thomas lebt bescheiden und zufrieden als Koch in einem kleinen amerikanischen Provinznest. Hochgeistiges ist ihm fremd, doch er hat eine besondere Gabe: Er sieht die Toten und kann mit ihnen kommunizieren. Und er sieht Bodachs, lebende Schatten, die sich von Leid und Verderben nähren. Als ein merkwürdiger Fremder, umflirrt von diesen Schatten, das Restaurant betritt, in dem Odd arbeitet, weiß er, dass Fürchterliches droht. Trotz der Warnungen seiner impulsiven Freundin Stormy wagt er es, dem Mann nachzuspüren und in sein Haus einzudringen. Was er in einem Geheimzimmer findet, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren: einen Schrein, der all den Massenmördern dieser Welt gewidmet ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für die alten Mädels: Mary Crowe, Gerda Koontz, Vicky Page und Jana Prais. Wir kommen zusammen. Wir schlemmen. Wir picheln. Wir plauschen, plauschen, plauschen.
Wer hoffen will, kämpft sich durchs Leben und denkt nicht dran, gleich aufzugeben. Von der Wiege bis ins Grab hinein muss das Herz beharrlich sein.
Das Buch der gezählten Freuden
1
Mein Name ist Odd Thomas. In einer Zeit, in der die meisten Leute ihr Gebet am Altar des Ruhms verrichten, bin ich mir allerdings nicht sicher, weshalb es den Leser kümmern sollte, wer ich bin und dass ich existiere.
Ich bin keine Berühmtheit. Ich bin nicht das Kind einer Berühmtheit. Ich war nie verheiratet mit einer Berühmtheit, wurde nie von einer missbraucht und habe auch nie einer eine Niere zur Transplantation geliefert. Ich habe nicht einmal den Wunsch, eine Berühmtheit zu sein.
Im Grunde bin ich nach den Maßstäben unserer Kultur ein solches Nichts, dass eine Zeitschrift wie People nicht nur nie einen Artikel über mich bringen wird, sondern man womöglich sogar meinen Versuch zurückweisen würde, sie zu abonnieren, weil die Schwerkraft meiner Nichtberühmtheit ein schwarzes Loch darstellt, das mächtig genug ist, ein gesamtes Verlagshaus in den Abgrund zu saugen.
Ich bin zwanzig Jahre alt. Für einen welterfahrenen Erwachsenen bin ich kaum mehr als ein Kind. Für ein Kind hingegen bin ich alt genug, um Misstrauen zu verdienen und für immer von der magischen Gemeinschaft der Kurzen und Bartlosen ausgeschlossen zu werden.
Infolgedessen könnte ein professioneller Demograph zu dem Schluss kommen, mein einziges Publikum bestehe aus jungen Männern und Frauen, die derzeit zwischen ihrem zwanzigsten und einundzwanzigsten Geburtstag vor sich hin treiben.
In Wahrheit habe ich diesem schmalen Publikum nichts zu sagen. Nach meiner Erfahrung sind mir die meisten Dinge, für die sich andere zwanzigjährige Amerikaner interessieren, völlig egal. Bis auf den Wunsch zu überleben natürlich.
Ich führe ein ungewöhnliches Leben.
Damit meine ich nicht, dass mein Leben besser ist als eures. Bestimmt ist euer Leben von so viel Glück, Zauber, Staunen und beständiger Furcht erfüllt, wie man es sich nur wünschen kann. Schließlich seid ihr Menschen, wie auch ich einer bin, und wir wissen, welch eine Freude und Qual das ist.
Ich meine bloß, dass mein Leben nicht typisch ist. Mir stoßen eigentümliche Dinge zu, die anderen Leute nicht regelmäßig, falls überhaupt, begegnen.
Zum Beispiel hätte ich diese Erinnerungen nie geschrieben, hätte es mir nicht ein hundertachtzig Kilo schwerer Mann mit sechs Fingern an der linken Hand befohlen.
Sein Name ist P. Oswald Boone. Jedermann nennt ihn Little Ozzie, weil sein Vater, Big Ozzie, noch am Leben ist.
Little Ozzie hat einen Kater namens Terrible Chester. Er ist in diesen Kater richtig vernarrt. Falls Terrible Chester sein neuntes Leben unter den Rädern eines Sattelschleppers aufbrauchen sollte, wäre sogar zu befürchten, dass Little Ozzies großes Herz diesen Verlust nicht überleben würde.
Ich persönlich empfinde nicht viel Zuneigung zu Terrible Chester, unter anderem weil er mir bei mehreren Gelegenheiten auf die Schuhe gepinkelt hat.
Die Gründe dafür, soweit Ozzie sie mir erläutert hat, erscheinen glaubhaft, aber ich bin von seiner Aufrichtigkeit nicht sonderlich überzeugt. Ich meine nicht die von Ozzie, sondern die von Terrible Chester.
Außerdem habe ich einfach kein volles Vertrauen zu einem Kater, der behauptet, achtundfünfzig Jahre alt zu sein. Obwohl es fotografische Beweise gibt, die diese Behauptung stützen, bleibe ich hartnäckig bei der Meinung, dass alles geschwindelt ist.
Aus Gründen, die ihr bald verstehen werdet, darf dieses Manuskript zu meinen Lebzeiten nicht veröffentlicht werden, weshalb meine Mühe auch nicht mit Honoraren vergolten werden wird, solange ich am Leben bin. Little Ozzie schlägt vor, ich solle mein literarisches Erbe der liebevollen Obhut von Terrible Chester überlassen, der uns seiner Meinung nach allesamt überleben wird.
Ich werde einen anderen Treuhänder wählen. Einen, der mich nicht bepinkelt hat.
Ohnehin schreibe ich das alles nicht für Geld. Ich schreibe es, um meine geistige Gesundheit zu bewahren und um herauszufinden, ob mein Leben tatsächlich genügend Sinn und Zweck hat, um eine weitere Existenz zu rechtfertigen.
Macht euch keine Sorgen – diese Auslassungen werden nicht unerträglich düster sein. P. Oswald Boone hat mich streng angewiesen, einen heiteren Ton anzuschlagen.
»Wenn du das nicht schaffst«, hat Ozzie gesagt, »pflanze ich dir meinen Hundertachtzig-Kilo-Arsch auf die Rübe, und so willst du bestimmt nicht sterben.«
Ozzie neigt zu Prahlerei. Sein Arsch ist zwar eindrucksvoll genug, wiegt jedoch wahrscheinlich nicht mehr als siebzig Kilo. Die anderen hundertzehn sind über den Rest seines strapazierten Knochengerüsts verteilt.
Als ich anfangs nicht in der Lage war, einen heiteren Ton anzuschlagen, gab mir Ozzie den Rat, ich solle mich der Perspektive des unzuverlässigen Erzählers bedienen. »In Der Mord an Roger Ackroyd hat Agatha Christie das erfolgreich vorexerziert«, meinte er.
In diesem aus der Ich-Perspektive erzählten Kriminalroman entpuppt sich der sympathische Erzähler als der Mörder von Roger Ackroyd, was er bis zum Ende vor dem Leser verborgen hält.
Wohlgemerkt, ich bin kein Mörder. Ich habe nichts Böses getan, was ich vor euch verberge. Meine Unzuverlässigkeit als Erzähler hat hauptsächlich mit der Zeitform mancher Verben zu tun.
Macht euch darüber keine Gedanken. Ihr werdet die Wahrheit schnell genug erfahren.
Abgesehen davon, habe ich mich erzählerisch nun leider schon vergaloppiert. Little Ozzie und Terrible Chester treten nämlich erst auf, nachdem die Kuh explodiert ist.
Die Geschichte beginnt an einem Dienstag.
Für euch ist das der Tag nach Montag. Für mich ist es ein Tag, der – wie die anderen sechs – übervoll an Gelegenheiten für Rätsel, Abenteuer und Schrecken ist.
Das soll nicht heißen, dass mein Leben besonders romantisch und magisch wäre. Zu viele Rätsel sind einfach nur noch ärgerlich. Zu viel Abenteuer ist erschöpfend. Wenig Schrecken hat dafür eine Menge Wirkung.
Ohne die Hilfe eines Weckers wachte ich an jenem Dienstagmorgen um fünf Uhr auf, aus einem Traum über das tote Personal einer Bowlingbahn.
Ich stelle nie den Wecker, weil meine innere Uhr überaus zuverlässig ist. Wenn ich pünktlich um fünf aufwachen möchte, dann sage ich mir vor dem Zu-Bett-Gehen drei Mal, dass ich exakt um 4.45 Uhr aufwachen muss.
So zuverlässig mein innerer Wecker ist, er geht aus irgendeinem Grund fünfzehn Minuten nach. Als mir das vor einigen Jahren auffiel, habe ich das Problem bereinigt.
Der Traum über das tote Bowlingbahnpersonal stört seit drei Jahren meinen Schlaf, und zwar ein bis zwei Mal pro Monat. Die Einzelheiten sind noch nicht spezifisch genug, um in Aktion treten zu können. Ich werde warten und hoffen müssen, dass mich die Aufklärung nicht zu spät erreicht.
Ich erwachte also um fünf, setzte mich im Bett auf und sagte: »Verschone mich, damit ich dienen kann.« Das ist das Morgengebet, das meine Oma Sugars mir beigebracht hat, als ich klein war.
Pearl Sugars war die Mutter meiner Mutter. Wäre sie die Mutter meines Vaters gewesen, dann hieße ich Odd Sugars, was mein Leben noch komplizierter machen würde.
Oma Sugars glaubte daran, mit Gott verhandeln zu können. Sie nannte ihn »diesen alten Teppichhändler«.
Vor jedem Pokerspiel versprach sie Gott, als Gegenleistung für ein paar unschlagbare Blätter auf der Hand sein heiliges Wort zu verbreiten oder das erworbene Vermögen mit den Waisen zu teilen. Ihr ganzes Leben lang hat sie sich nicht zuletzt mit dem Gewinn aus Kartenspielen finanziert.
Als trinkfreudige Frau, die neben Poker zahlreiche andere Interessen hatte, hat Oma Sugars nicht immer so viel Zeit damit verbracht, das Wort Gottes zu verbreiten, wie sie es ihm versprochen hatte. Sie war der Meinung, Gott erwarte ohnehin, öfter übers Ohr gehauen zu werden, und nehme das nicht allzu krumm.
Man kann Gott übers Ohr hauen und damit durchkommen, sagte Oma, wenn man es mit Charme und Witz tut. Lebt man sein Leben mit Fantasie und Begeisterung, fuhr sie fort, dann spielt Gott mit, um zu sehen, was für eine unverschämt unterhaltsame Sache man als Nächstes tut.
Außerdem lasse Gott einen an der langen Leine, wenn man sich auf amüsante Weise staunenswert dumm verhalte. Das erkläre, behauptete Oma, weshalb unzählige Millionen atemberaubend dummer Leute ziemlich gut durchs Leben kämen.
Dabei dürfe man anderen natürlich niemals ernsthaft Schaden zufügen, sonst finde Gott das nicht mehr amüsant. Und dann komme die Quittung für die Versprechen, die man nicht gehalten habe.
Obwohl sie Holzfäller unter den Tisch trank und regelmäßig Pokerspiele gegen hartherzige Psychopathen gewann, die gar nicht gern verloren, und obwohl sie mit völliger Verachtung für die physikalischen Gesetze schnelle Wagen fuhr (wenn auch nie alkoholisiert) und eine an Schweinefett reiche Ernährung bevorzugte, starb Oma Sugars im Alter von zweiundsiebzig Jahren friedlich im Schlaf. Als man sie fand, hatte sie ein Lächeln auf dem Gesicht. Auf ihrem Nachttisch stand ein fast leerer Kognakschwenker, daneben lag ein Roman ihres Lieblingsautors, auf der letzten Seite aufgeschlagen.
Allen Anzeichen nach zu urteilen, haben Oma Sugars und Gott sich ziemlich gut verstanden.
An jenem Dienstagmorgen, noch auf der dunklen Seite der Dämmerung, freute ich mich darüber, am Leben zu sein, knipste meine Nachttischlampe an und betrachtete den Raum, der mir als Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Esszimmer dient. Ich stehe nie auf, bevor ich weiß, ob jemand mich erwartet – und wer.
Falls mir wohl oder übel gesinnte Besucher einen Teil der Nacht damit verbracht hatten, mich im Schlaf zu beobachten, dann waren sie nicht zu einem Frühstücksplausch geblieben. Manchmal kann nämlich schon der simple Weg vom Bett zum Bad dem neuen Tag jeglichen Charme rauben.
Nur Elvis war da. Er trug seine Blumenkette um den Hals, lächelte und zeigte mit dem Finger auf mich wie mit einem gespannten Revolver
Obwohl ich gern über der Doppelgarage wohne und mein Domizil gemütlich finde, wird keine Architekturzeitschrift je wegen einer exklusiven Fotostrecke an mich herantreten. Sähe ein Trendscout meine Bleibe, dann würde er wahrscheinlich geringschätzig bemerken, schöner wohnen sehe anders aus.
Die lebensgroße Pappfigur von Elvis, einst Teil eines Kino-Displays für Blaues Hawaii, befand sich noch am selben Ort. Gelegentlich versetzt sie sich im Lauf der Nacht anderswohin – oder sie wird versetzt.
Unter der Dusche verwendete ich Seife und Shampoo mit Pfirsichduft, beides ein Geschenk von Stormy Llewellyn. Ihr echter Vorname lautet Bronwen, aber sie meint, das klinge nach einem Elben.
Mein echter Vorname ist tatsächlich Odd.
Laut meiner Mutter handelt es sich dabei um einen nicht korrigierten Irrtum auf meiner Geburtsurkunde. Manchmal sagt sie, sie habe mich Todd nennen wollen, manchmal, ich sollte nach einem tschechischen Onkel Dobb heißen.
Mein Vater hingegen behauptet steif und fest, sie hätten mich immer schon Odd nennen wollen; allerdings sagt er mir nicht, weshalb. Er weist jedenfalls darauf hin, dass ich gar keinen tschechischen Onkel habe.
Meine Mutter besteht energisch auf der Existenz des Onkels, weigert sich jedoch zu erklären, wieso ich weder ihn noch ihre Schwester Cymry, mit der er angeblich verheiratet ist, je kennen gelernt habe.
Wenngleich mein Vater die Existenz von Cymry einräumt, beharrt er darauf, sie habe nie geheiratet. Er sagt, sie sei nicht ganz normal, aber was er damit meint, weiß ich nicht, mehr sagt er nämlich nicht dazu.
Die Behauptung, ihre Schwester sei irgendwie nicht ganz normal, macht meine Mutter rasend. Sie nennt Cymry ein Geschenk Gottes, verhält sich bezüglich dieses Themas jedoch sonst recht unkommunikativ.
Ich finde es leichter, mit dem Namen Odd zu leben, als ihn anzufechten. Als ich alt genug war, um zu erkennen, dass es sich um einen ungewöhnlichen Namen handelt, hatte ich mich schon daran gewöhnt.
Stormy Llewellyn und ich sind mehr als Freunde. Wir glauben, seelenverwandt zu sein.
Zum einen haben wir eine Karte aus einem Wahrsageautomaten auf dem Rummelplatz, auf der steht, es sei uns bestimmt, für immer zusammen zu sein.
Zum anderen haben wir übereinstimmende Muttermale.
Von den Karten und den Muttermalen einmal abgesehen, liebe ich Stormy innig. Ich würde für sie von einer hohen Klippe springen, wenn sie mich darum bäte. Natürlich müsste ich die Argumente für ihre Bitte begreifen können.
Zu meinem Glück ist Stormy nicht die Sorte Mensch, die leichtfertig so etwas verlangen würde. Sie erwartet von anderen nichts, was sie nicht auch selbst tun würde. In tückischen Strömungen wird sie von einem moralischen Anker festgehalten, der so groß ist wie ein ganzes Schiff.
Einmal hat sie einen ganzen Tag darüber nachgegrübelt, ob sie die fünfzig Cent behalten soll, die sie im Münzfach einer Telefonzelle gefunden hat. Schließlich schickte sie das Geld an die Telefongesellschaft.
Um kurz auf die Klippe zurückzukommen: Ich will nicht sagen, dass ich Angst vor dem Tod hätte. Ich bin nur einfach noch nicht zu einem Stelldichein mit ihm bereit.
Nach Pfirsich duftend, wie Stormy mich mag, ohne Angst vor dem Tod, aber mit einem Blaubeermuffin im Magen, verabschiedete ich mich von Elvis mit einer miserablen Imitation seiner Stimme und den Worten »Taking care of business« und machte mich auf den Weg zu meinem Job im Pico Mundo Grill.
Obwohl die Dämmerung gerade erst eingesetzt hatte, war sie am östlichen Horizont bereits blitzartig zu einem harten, gelben Eidotter gebraten.
Meine Heimatstadt Pico Mundo liegt in jenem Teil von Südkalifornien, in dem man trotz des ganzen Wassers, das über das staatliche Aquäduktsystem herbeitransportiert wird, nie vergessen kann, dass der wahre Zustand der Gegend wüstenhaft ist. Im März backen wir. Im August, um den es sich gerade handelte, brutzeln wir.
Der Ozean liegt so fern im Westen, dass er für uns nicht wirklicher ist als das Meer der Ruhe, jene weite, dunkle Ebene auf dem Antlitz des Mondes.
Wenn Bauarbeiter den Boden am Stadtrand für eine neue Batterie von Fertighäusern aufwühlen, stoßen sie bei tieferen Grabungen gelegentlich auf reiche Adern von Meeresmuscheln. In uralter Zeit sind Wellen an diese Küsten geschwappt.
Hält man eine dieser Muscheln ans Ohr, so hört man nicht die Brandung, sondern nur einen trockenen, traurigen Wind, so als hätte die Muschel ihren Ursprung vergessen.
Am unteren Ende der Außentreppe, die von meiner kleinen Wohnung in den Garten führt, wartete Penny Kallisto in der frühen Sonne wie eine Muschel am Strand. Sie trug rote Turnschuhe, weiße Shorts und eine ärmellose weiße Bluse.
Normalerweise hatte Penny nichts von der vorpubertären Verzweiflung an sich, für die manche Kids heutzutage so empfänglich sind. Sie war eine überschäumende, extrovertierte Zwölfjährige, die gern lachte.
An diesem Morgen sah sie jedoch ernst drein. Ihre blauen Augen verdunkelten sich wie das Meer, wenn eine Wolke darüber zieht.
Ich warf einen Blick auf das fünfzehn Meter entfernte Haus, wo meine Vermieterin Rosalia Sanchez mich jeden Augenblick erwartete, um von mir bestätigt zu bekommen, dass sie im Lauf der Nacht nicht verschwunden ist. Der Blick in einen Spiegel reichte nie aus, um ihre Ängste zu besänftigen.
Ohne ein Wort zu sagen, wandte Penny sich von der Treppe ab. Sie ging auf den vorderen Teil des Grundstücks zu.
Aus Sonnenschein und ihren eigenen Silhouetten woben zwei gewaltige Kalifornische Lebenseichen Schleier aus Gold und Purpur und warfen sie über die Einfahrt.
Penny schien abwechselnd zu schimmern und sich zu verdüstern, als sie durch dieses feine Gewebe aus Licht und Dunkel ging. Den Glanz ihres blonden Haars dämpfte nur ein schwarzes Spitzentuch aus Schatten, dessen kunstvolles Muster sich durch ihre Bewegungen veränderte.
Um sie nicht aus den Augen zu verlieren, eilte ich die letzte Stufe hinunter und folgte ihr. Mrs. Sanchez würde noch eine Weile warten und sich Sorgen um ihre Sichtbarkeit machen müssen.
Penny führte mich am Haus vorbei und von der Einfahrt weg zu einem Vogelbad auf dem Rasen. Rund um den Sockel, der das Becken trug, hatte Rosalia Sanchez eine ganze Sammlung von Muscheln arrangiert, die man aus den Hügeln von Pico Mundo geschaufelt hatte, in allen Größen und Formen.
Penny bückte sich, wählte ein Exemplar von der Größe einer Orange aus, richtete sich wieder auf und streckte es mir hin.
Der Bau ähnelte der einer Schneckenmuschel. Das raue Äußere war braun-weiß, das polierte Innere glänzte in perlenartigem Rosa.
Penny wölbte die rechte Hand, als läge die Muschel noch immer darin, und hielt sie sich ans Ohr. Sie legte lauschend den Kopf schräg, um auszudrücken, was ich tun solle.
Als ich die Muschel ans Ohr hielt, hörte ich nicht das Meer. Auch den melancholischen Wüstenwind, den ich vorhin erwähnt habe, hörte ich nicht.
Stattdessen erklang aus der Muschel das raue Atmen einer Bestie. Der drängende Rhythmus eines grausamen Verlangens, das Grunzen wahnsinniger Begierde.
Inmitten der Sommerwüste kroch mir der Winter ins Blut.
Als Penny an meinem Gesichtsausdruck sah, dass ich gehört hatte, was ich hören sollte, ging sie quer über den Rasen zum Bürgersteig. Am Bordstein blieb sie stehen und blickte zum westlichen Ende der Marigold Lane.
Ich ließ die Muschel fallen, stellte mich neben sie und wartete mit ihr.
Das Böse kam. Ich fragte mich, wessen Gesicht es wohl trug.
Alte Lorbeerfeigen säumen diese Straße. Ihre großen, knorrigen Wurzeln haben den Beton des Bürgersteigs stellenweise aufgebrochen und hochgewölbt.
Nicht einmal der leiseste Lufthauch strich durch die Bäume. Der Morgen war so unheimlich still wie die Dämmerung am Tag des Jüngsten Gerichts einen Atemzug, bevor der Himmel aufreißt.
Wie das Haus von Mrs. Sanchez sind die meisten Gebäude des Viertels im viktorianischen Stil erbaut und mit mehr oder weniger kitschigen Verzierungen versehen. Als Pico Mundo im Jahre 1900 gegründet wurde, kamen viele der ersten Bewohner von der Ostküste und schwärmten für eine Architektur, die eher zu ihrer fernen, kälteren und feuchteren Heimat gepasst hätte.
Vielleicht dachten sie, sie könnten allein die Dinge in dieses Tal mitbringen, die sie liebten, während sie alle Hässlichkeit zurückließen.
Wir sind jedoch keine Spezies, die das Gepäck wählen kann, mit dem sie reisen muss. Trotz unserer besten Absichten stellen wir immer wieder fest, dass wir einen oder zwei Koffer voller Dunkelheit und Elend mitgebracht haben.
Eine halbe Minute lang war ein hoch am Himmel dahinschwebender Habicht das Einzige, was sich bewegte. Man sah ihn durch die Äste der Bäume hindurch.
Der Habicht und ich waren an diesem Morgen Jäger.
Penny Kallisto muss meine Angst gespürt haben. Sie griff mit ihrer linken Hand nach meiner rechten.
Ich war dankbar für ihre Liebenswürdigkeit. Ihr Griff war fest, und ihre Hand fühlte sich nicht kalt an. Aus ihrem starken Geist schöpfte ich Mut.
Weil der Wagen im Leerlauf mit nur ein paar Stundenkilometern dahinrollte, hörte ich nichts, bis er um die Ecke bog. Als ich das Fahrzeug erkannte, überkam mich eine Traurigkeit, die ebenso groß war wie meine Furcht.
Der Pontiac Firebird 400, Baujahr 1968, war liebevoll restauriert worden. Das zweitürige, mitternachtsblaue Cabrio glitt auf uns zu, als schwebten alle Reifen ein winziges Stück über dem Pflaster. Es schimmerte in der Morgenhitze wie ein Trugbild.
Harlo Landerson und ich waren auf der Highschool in derselben Klasse gewesen. Im vorletzten Schuljahr hatte Harlo den Pontiac als Schrotthaufen gekauft und dann so lange daran herumgebastelt, bis er wieder so jungfräulich aussah wie damals, als er zum ersten Mal im Ausstellungsraum eines Autohauses gestanden hatte.
Zurückhaltend und etwas schüchtern, wie Harlo es war, hatte er sich bei seiner Arbeit nicht der Hoffnung hingegeben, der Wagen könne sich als Frauenmagnet entpuppen oder jene, die ihn für langweilig hielten, plötzlich davon überzeugen, er sei cool genug, um das Quecksilber in einem Thermometer gefrieren zu lassen. Er hatte keine gesellschaftlichen Ambitionen, und er machte sich keine Illusionen bezüglich seiner Chancen, je die unteren Ränge des schulischen Kastensystems zu verlassen.
Mit seinem 340 PS starken Achtzylinder konnte der Firebird in unter acht Sekunden von null auf hundert Stundenkilometer beschleunigen. Harlo war aber kein Rennfahrer; er war nicht besonders stolz darauf, einen derart rasanten Schlitten zu besitzen.
Er verwendete so viel Zeit, Mühe und Geld auf den Firebird, weil ihn die Schönheit von dessen Design und Funktion verzauberte. Seine Arbeit war eine Herzenssache, eine Leidenschaft, fast spirituell in ihrer Reinheit und Intensität.
Manchmal dachte ich, der Pontiac spiele eine so große Rolle in Harlos Leben, weil sein Besitzer für die Liebe, die er auf den Wagen verschwendete, keinen geeigneten Empfänger hatte. Seine Mutter war gestorben, als er sechs war. Sein Vater war ein erbärmlicher Säufer.
Ein Auto kann die Liebe, die man ihm entgegenbringt, nicht erwidern. Aber wenn man einsam genug ist, kann man möglicherweise das Blitzen des Chroms, den Glanz des Lacks und das Summen des Motors mit Zuneigung verwechseln.
Auf der Schule waren wir keine richtigen Kumpel, Harlo und ich, nur lose befreundet. Ich mochte den Burschen. Er war ein stiller Typ, aber still zu sein fand ich besser als das großspurige Auftreten, mit dem viele um einen Aufstieg in der schulischen Hackordnung rangelten.
Penny Kallisto an meiner Seite, hob ich die linke Hand und winkte Harlo zu.
Seit er die Schule abgeschlossen hatte, jobbte Harlo wie besessen. Von neun bis fünf lud er am Supermarkt die frisch gelieferte Ware vom Lastwagen oder räumte die Regale ein.
Davor war er ab vier Uhr morgens im Osten von Pico Mundo unterwegs, um hunderte von Zeitungen zu verteilen. Einmal pro Woche bekam jedes Haus außerdem einen Plastikbeutel mit Werbebroschüren und Rabattcoupons.
Heute Morgen verteilte er nur Zeitungen, die er mit einem Schlenker aus dem Handgelenk warf, als wären es Bumerangs. Jede gefaltete und von einer Kunststoffhülle geschützte Dienstagsausgabe der Maravilla County Times segelte durch die Luft und landete mit einem leisen Klatschen auf der Einfahrt oder dem Fußweg zur Haustür, genau da, wo der Abonnent sie am liebsten haben wollte.
Harlo belieferte gerade die andere Straßenseite. Als er das Haus mir gegenüber erreichte, bremste er den dahinrollenden Pontiac ab.
Penny und ich gingen zu seinem Wagen hinüber, und Harlo sagte: »Morgen, Odd. Na, wie fühlst du dich an diesem schönen Tag?«
»Trostlos«, erwiderte ich. »Traurig. Verwirrt.«
Besorgt legte Harlo die Stirn in Falten. »Was ist denn los? Kann ich was für dich tun?«
»Es geht um etwas, was du bereits getan hast«, sagte ich.
Ich ließ Pennys Hand los, beugte mich über die Beifahrertür in den Firebird, stellte den Motor ab und zog den Schlüssel aus der Zündung.
Erschrocken grabschte Harlo nach dem Schlüssel, langte aber daneben. »He, Odd, mach bloß keinen Blödsinn, okay? Ich steh zeitlich ziemlich unter Druck!«
Ich hörte Pennys Stimme nicht, aber mit der reichen und doch stillen Sprache der Seele musste sie zu mir gesprochen haben.
Was ich zu Harlo Landerson sagte, war der Kern dessen, was mir das Mädchen enthüllt hatte: »Du hast ihr Blut in deiner Tasche.«
Ein Unschuldiger wäre von dieser Behauptung verblüfft gewesen. Harlo jedoch starrte mich mit Augen an, deren plötzlich eulenhafter Ausdruck kein Zeichen von Weisheit, sondern von Furcht war.
»In jener Nacht«, sagte ich, »hattest du drei kleine, viereckige Stückchen Filz dabei.«
Eine Hand noch am Lenkrad, wandte Harlo den Blick von mir ab und schaute durch die Windschutzscheibe, als wollte er den Pontiac allein durch Willenskraft in Bewegung setzen.
»Nachdem du das Mädchen missbraucht hast, hast du mit den Filzstückchen etwas von ihrem jungfräulichen Blut aufgefangen. «
Harlo zitterte. Das Blut schoss ihm ins Gesicht, vielleicht vor Scham.
Vor Qual war meine Stimme belegt. »Beim Trocknen ist der Filz steif und dunkel geworden, so spröde wie kleine Cracker.«
Sein Zittern verstärkte sich zu heftigen Zuckungen.
»Ein solches Stückchen trägst du immer bei dir.« Meine Stimme bebte vor Erregung. »Du schnupperst gern daran. Ach Gott, Harlo. Manchmal steckst du es zwischen die Zähne – und beißt darauf.«
Er stieß die Fahrertür auf und floh.
Ich bin kein Polizist. Ich bin kein Befürworter von Selbstjustiz. Ich bin nicht die Vergeltung in Menschengestalt. Eigentlich weiß ich nicht, was ich bin und warum.
In Augenblicken wie diesem muss ich jedoch einfach handeln. Eine Art Raserei überkommt mich, und ich kann mich ebenso wenig von dem abwenden, was getan werden muss, wie ich diese gefallene Welt wieder in den Stand der Gnade zurückverwandeln kann.
Als Harlo aus dem Pontiac sprang, blickte ich auf Penny Kallisto hinab und sah die Male an ihrem Hals, die nicht sichtbar gewesen waren, als sie mir vorhin erschienen war. Die Tiefe der Wunde, die das würgende Tuch in ihr Fleisch geschnitten hatte, verriet die blinde Wut, mit der Penny erdrosselt worden war.
Schmerzhaft ergriff mich tiefes Mitgefühl, und ich nahm die Verfolgung von Harlo Landerson auf, für den ich nicht die leiseste Spur Mitgefühl empfand.
2
Über den Asphalt der Straße und den Beton des Gehsteigs, über den Rasen vor dem Haus auf der anderen Straßenseite, am Haus entlang, durch den hinteren Garten zu einem schmiedeeisernen Zaun und darüber, dann einen engen Durchgang entlang und eine Ziegelmauer hoch rannte und kletterte und warf sich Harlo Landerson.
Ich fragte mich, wohin er wohl wollte. Er konnte weder vor mir noch vor der Gerechtigkeit davonlaufen und schon gar nicht vor dem, was er war.
Hinter der Ziegelmauer lag ein Garten mit Swimmingpool. Scheckig von Morgenlicht und Baumschatten, schimmerte das Wasser in Blautönen von Saphir bis Türkis wie der Juwelenschatz von Seeräubern, die über ein inzwischen verschwundenes Meer gesegelt waren.
Auf der anderen Seite des Pools stand hinter einer verglasten Schiebetür eine junge Frau im Schlafanzug, in der Hand einen Becher mit irgendeinem Gebräu, das ihr den Mut verlieh, dem Tag die Stirn zu bieten.
Als Harlo die erschrockene Beobachterin erblickte, änderte er die Richtung und rannte auf sie zu. Vielleicht glaubte er, einen Schutzschild, eine Geisel zu brauchen. Auf einen Becher Kaffee war er jedenfalls nicht aus.
Ich holte ihn ein, packte ihn am Hemd und riss ihn von den Beinen. Gemeinsam plumpsten wir ins tiefe Ende des Pools.
Das Wasser, das einen ganzen Sommer Wüstenhitze gespeichert hatte, war nicht kalt. Tausende Luftbläschen wirbelten wie ein glänzender Schauer Silbermünzen an meinen Augen vorbei und klingelten mir in den Ohren.
Zappelnd berührten wir den Boden, und auf dem Weg hinauf trat und schlug Harlo um sich. Mit Ellbogen, Knie oder Fuß traf er mich an der Kehle.
Obwohl das träge Wasser dem Schlag den größten Teil seiner Kraft nahm, schnappte ich nach Luft, schluckte und würgte am Geschmack von mit Sonnenöl gewürztem Chlor. Ich musste Harlo loslassen, taumelte in Zeitlupe durch wogende Schleier aus grünem Licht und blauem Schatten und brach durch die Wasseroberfläche in flirrenden Sonnenschein.
Ich befand mich in der Mitte des Pools, und Harlo war am Rand. Er griff nach der Kante und zog sich auf die betonierte Terrasse.
Hustend und zerstäubtes Wasser aus den Nasenlöchern blasend, platschte ich geräuschvoll hinter ihm her. Als Schwimmer habe ich weniger Talent für olympische Wettkämpfe als fürs Ertrinken.
In einer besonders deprimierenden Nacht – ich war gerade sechzehn – hat man mich einmal an zwei tote Männer gekettet und von einem Boot in einen See namens Mala Suerte geworfen. Seither habe ich eine Abneigung gegen Wassersport.
Der genannte See ist künstlich und breitet sich jenseits der Stadtgrenze von Pico Mundo aus. Mala suerte heißt »Unglück«.
Während der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre als Projekt zur Arbeitsbeschaffung angelegt, trug der See zuerst den Namen eines zweitrangigen Politikers. Obwohl man sich unzählige Geschichten über seine tückischen Wasser erzählt, kann niemand in der Gegend mit Sicherheit sagen, wann und weshalb er offiziell in Mala Suerte umbenannt wurde.
Alle Dokumente über den See sind bei dem Brand unseres Rathauses im Jahre 1954 vernichtet worden. Damals protestierte ein Mann namens Mel Gibson gegen die Beschlagnahme seines Grundbesitzes wegen nicht bezahlter Steuern. Seinen Protest drückte Mr. Gibson in Form der Selbstverbrennung aus.
Mit dem australischen Schauspieler desselben Namens, der Jahrzehnte später zum Filmstar wurde, war er nicht verwandt. Soweit bekannt, war er außerdem – im Gegensatz zu diesem – weder besonders talentiert noch attraktiv.
Weil ich diesmal nicht mit zwei Männern belastet war, die zu tot waren, um selbst zu schwimmen, erreichte ich den Rand des Pools mit wenigen kurzen Zügen. Ich stemmte mich aus dem Wasser.
Harlo Landerson, der an der Schiebetür angelangt war, hatte sie verschlossen vorgefunden.
Die Frau im Schlafanzug war verschwunden.
Während ich mich aufrappelte, trat Harlo weit genug von der Tür zurück, um Schwung zu holen. Dann zog er den Kopf ein und benutzte die linke Schulter als Rammbock.
In Erwartung strömenden Bluts, abgetrennter Glieder und eines von Glasscherben guillotinierten Kopfes zuckte ich zusammen.
Natürlich zersplitterte das Sicherheitsglas in Kaskaden aus winzigen, gummierten Stückchen. Als Harlo ins Haus krachte, blieben seine Glieder unversehrt, und sein Kopf saß immer noch fest auf dem Hals.
Glas knirschte und klirrte unter meinen Schuhsohlen, als ich ihm hinterherlief. Ich schnupperte Brandgeruch.
Wir befanden uns in einem Wohnzimmer. Sämtliche Möbel waren auf einen Breitwandfernseher hin ausgerichtet, der so groß wie zwei Kühlschränke nebeneinander war.
Der gewaltige Kopf der Nachrichtenmoderatorin wirkte in derart vergrößertem Detail regelrecht furchterregend. In solchen Dimensionen besaß ihr munteres Lächeln die Wärme eines Barrakuda-Grinsens. Ihre funkelnden Augen, groß wie Zitronen, schienen irre zu glitzern.
Die offene Architektur des Hauses ließ das Wohnzimmer direkt in die Küche übergehen. Nur eine Frühstückstheke bildete eine Barriere.
Die Frau von vorhin hatte sich entschlossen, in der Küche Stellung zu beziehen. Mit der einen Hand umklammerte sie ein Telefon, mit der anderen ein Schlachtmesser.
Harlo stand an der Schwelle zwischen den Räumen und versuchte zu beurteilen, ob eine Hausfrau Mitte zwanzig in einem supersüßen, im Stil eines Matrosenanzugs gehaltenen Pyjama tatsächlich den Mut aufbrachte, ihn bei lebendigem Leib aufzuschlitzen.
Sie schwang das Messer, während sie ins Telefon brüllte: »Er ist im Haus, er steht direkt vor mir!«
Hinter ihr stand auf einer Arbeitsfläche ein Toaster, aus dem Rauch quoll. Irgendein Teilchen zum Aufbacken war verkohlt. Es roch nach Erdbeeren und schwelendem Gummi. Die junge Dame hatte keinen schönen Morgen.
Harlo warf mir einen Barhocker entgegen und rannte aus dem Wohnzimmer in den vorderen Teil des Hauses.
Ich wich dem Hocker aus, sagte: »Ma’am, bitte entschuldigen Sie das Durcheinander«, und nahm die Verfolgung von Pennys Mörder wieder auf.
Hinter mir kreischte die Frau: »Stevie, schließ deine Tür ab! Stevie, schließ deine Tür ab!«
Als ich die offene Treppe im Flur erreicht hatte, war Harlo bereits bis zum mittleren Absatz gelangt.
Ich sah, wieso er nach oben gelockt worden war, statt aus dem Haus zu fliehen: Im Obergeschoss stand ein kleiner Junge mit weit aufgerissenen Augen, etwa fünf Jahre alt, nur mit einer Unterhose bekleidet. Er hielt einen blauen Teddybären am Bein und sah so verletzlich aus wie ein Hündchen, das sich auf den Mittelstreifen einer verkehrsreichen Autobahn verirrt hatte.
Erstklassiges Geiselmaterial.
»Stevie, schließ deine Tür ab!«
Der Junge ließ den blauen Bären fallen und rannte in sein Zimmer.
Harlo stürmte den zweiten Teil der Treppe hoch.
Ich schnäuzte kitzelnden Chlor und den beißenden Geruch von brennender Erdbeermarmelade aus der Nase und erklomm tropfend und mit quietschenden Schuhen die Stufen, mit etwas weniger heroischem Flair als John Wayne in Du warst unser Kamerad.
Ich hatte mehr Angst als meine Beute, weil ich etwas zu verlieren hatte, nicht zuletzt Stormy Llewellyn und unsere gemeinsame Zukunft, die uns der Wahrsageautomat versprochen hatte. Traf ich hier auf einen Ehegatten mit Revolver, so würde der mich ohne Zögern ebenso wie Harlo erschießen.
Über mir schlug eine Tür zu. Stevie hatte getan, was ihn seine Mutter geheißen hatte.
Hätte Harlo Landerson einen Kessel voll kochendem Blei gehabt wie weiland Quasimodo, dann hätte er ihn mir über den Kopf gegossen. Stattdessen kam ein Sideboard herab, das offenbar oben am Ende der Treppe im Flur gestanden hatte.
Überrascht darüber, dass ich die Gewandtheit und Balance eines Affen – wenn auch eines nassen Affen – hatte, hechtete ich von der Treppe aufs Geländer. Das Möbelstück rumpelte Stufe um Stufe an mir vorbei. Dabei öffneten und schlossen sich die Schubladen, als wäre das Ding vom Geist eines Krokodils besessen.
Runter vom Geländer und die Treppe hoch. Ich erreichte den oberen Flur in dem Augenblick, als Harlo damit begann, die Zimmertür des kleinen Jungen einzutreten.
Als er merkte, dass ich kam, trat er fester zu. Das Holz splitterte mit einem trockenen Krachen, und die Tür flog nach innen auf.
Harlo flog mit, als wäre er von einem Energiestrudel aus dem Flur gesaugt worden.
Ich hetzte über die Schwelle, stieß die zurückschnellende Tür beiseite und sah, wie der Junge unters Bett zu kriechen versuchte. Harlo packte ihn am linken Fuß.
Auf dem Nachttisch stand eine Lampe in Form eines lächelnden Pandabären. Ich griff danach und schlug sie Harlo über den Schädel. Ein keramisches Gemetzel aus kecken schwarzen Ohren, einem zerborstenen weißen Gesicht, schwarzen Tatzen und weißen Bauchscherben explodierte durchs Zimmer.
In einer Welt, in der biologische Systeme und die physikalischen Gesetze so zuverlässig funktioniert hätten, wie von der Wissenschaft behauptet wird, wäre Harlo so bombensicher bewusstlos geworden, wie die Lampe zersplittert war. Leider ist das hier keine solche Welt.
So wie die Liebe manchen verzweifelten Müttern die übermenschliche Kraft verleiht, umgestürzte Autos anzuheben, um ihre eingeklemmten Kinder zu befreien, so verlieh die Verworfenheit Harlo den Willen, eine Panda-Attacke ohne nennenswerte Wirkung hinzunehmen. Er ließ Stevie los und stürzte sich auf mich.
Obwohl seine Augen keine elliptischen Pupillen hatten, erinnerten sie mich an die Augen einer Schlange, die bereit war, ihr Gift zu verspritzen, und obwohl sein geblecktes Gebiss keine gekrümmten oder dramatisch verlängerten Eckzähne aufwies, glomm die Raserei eines tollwütigen Schakals in seinem lautlosen Fletschen.
Das war nicht der Mensch, mit dem ich noch vor wenigen Jahren auf der Highschool gewesen war, nicht der schüchterne Junge, der sich geduldig und hingebungsvoll der Restaurierung eines Pontiac Firebird gewidmet hatte.
Das hier war das kranke und verkrümmte Gestrüpp einer Seele, dornig und giftig, das wohl bis vor kurzem in einer tiefen Windung von Harlos mentalem Labyrinth eingekerkert gewesen war. Es hatte die Gitterstäbe seiner Zelle zerbrochen und war durch den Burgfried nach oben geklettert, um den Menschen zu entthronen, der Harlo gewesen war; und nun hatte es endgültig die Herrschaft errungen.
Freigelassen, kroch Stevie ganz unter sein Bett, doch mir bot keine Bettstatt Schutz, und ich hatte keine Decke, die ich mir über den Kopf ziehen konnte.
Ich kann nicht behaupten, mich klar an die folgende Minute zu erinnern. Wir schlugen aufeinander ein, wenn der andere die Deckung sinken ließ. Wir griffen nach allem, was als Waffe dienen konnte, und schwangen oder schleuderten es. Nach einem Hagel von Schlägen gingen wir taumelnd in den Clinch. Auf dem Gesicht spürte ich Harlos heißen Atem samt einem leichten Sprühregen aus Speichel, und ich hörte seine Zähne zuschnappen; sie schnappten nach meinem rechten Ohr, weil er aus Panik in die Taktik einer Bestie verfallen war.
Ich löste mich aus der Umklammerung, um meinen Gegner von mir wegzustoßen. Während mein Ellbogen an Harlos Kinn krachte, verfehlte ich mit dem Knie die Weichteile, auf die ich gezielt hatte.
Gerade in dem Augenblick, als in der Ferne Sirenen zu hören waren, erschien Stevies Mama in der offenen Tür, das funkelnde Schlachtmesser stoßbereit in der Hand. Tatsächlich nahte da die Kavallerie, und das gleich mit zwei Regimentern: das eine im Pyjama, das andere in der blau-schwarzen Uniform der Polizei von Pico Mundo.
An mir und der bewaffneten Frau kam Harlo nicht vorbei, und an Stevie, den ersehnten Schutzschild, kam er unter dem Bett nicht heran. Stieß er ein Fenster auf, um auf das Dach der vorderen Veranda zu klettern, dann floh er direkt in die Arme der eintreffenden Cops.
Während das Geheul der nahenden Sirenen anschwoll, wich Harlo in eine Ecke zurück, wo er keuchend und zitternd stehen blieb. Mit qualvoll grauem Gesicht rang er die Hände und beäugte den Boden, die Wände, die Decke, nicht wie ein in der Falle sitzender Mensch, der die Abmessungen seines Käfigs abschätzte, sondern voll Verwirrung, so als könnte er sich nicht erinnern, wie er an diesen Ort und in diese Lage gekommen war.
Anders als die Tiere der Wildnis kämpfen die vielen grausamen Abarten menschlicher Ungeheuer nur selten mit größerer Wildheit, wenn man sie endlich in die Enge getrieben hat. Stattdessen enthüllen sie die Feigheit im Kern ihrer Brutalität.
Harlo Landerson löste die Hände voneinander und bedeckte sein Gesicht. Hinter den Lücken des zehnfingrigen Visiers sah ich seine Augen vor blankem Entsetzen zucken.
Den Rücken in die Ecke gepresst, rutschte er an der Wand herab und blieb mit gespreizten Beinen auf dem Boden sitzen. Dabei verbarg er sich weiter hinter seinen Händen, als wären sie eine Tarnkappe, mit der er dem Auge der Gerechtigkeit entgehen konnte.
Eine halbe Häuserzeile entfernt erreichten die Sirenen ihre höchste Lautstärke, um dann abzuebben. Aus einem Kreischen wurden ein Knurren und dann ein Stöhnen, das vor dem Haus erstarb.
Der Tag war vor kaum einer Stunde angebrochen, und schon hatte ich jede Minute des Morgens damit verbracht, meinem Namen alle Ehre zu machen.
3
Die Toten reden nicht. Ich weiß nicht, warum.
Harlo Landerson war von den Gesetzeshütern mitgenommen worden. In seiner Brieftasche hatten sie zwei Polaroidaufnahmen von Penny Kallisto gefunden. Auf der ersten war sie nackt und lebendig. Auf der zweiten war sie tot.
Stevie lag unten im Erdgeschoss in den Armen seiner Mutter.
Wyatt Porter, der Polizeichef von Pico Mundo, hatte mich gebeten, in Stevies Zimmer zu warten. Ich saß auf der Kante des ungemachten Betts.
Ich war noch nicht lange allein, als Penny Kallisto durch die Wand kam und sich neben mich setzte. Die Würgemale an ihrem Hals waren verschwunden. Sie sah aus, als wäre sie nie erdrosselt worden, als wäre sie nie gestorben.
Wie vorher blieb sie stumm.
Ich neige dazu, an die traditionelle Konstruktion des Lebens vor und nach dem Tod zu glauben. Diese Welt ist eine Reise der Entdeckung und Reinigung. Die nächste Welt besteht aus zwei Reisezielen. Das eine ist ein Palast für den Geist und ein unendliches Königreich der Wunder, das andere hingegen ist kalt, dunkel und unvorstellbar.
Nennt mich einfältig. Andere tun das sowieso.
Stormy Llewellyn, eine Frau mit unkonventionellen Ansichten, glaubt im Gegensatz zu mir, unsere Reise durch diese Welt sei dazu vorgesehen, uns zäher für das nächste Leben zu machen. Sie sagt, unsere Ehrlichkeit und Integrität, unser Mut und entschlossener Widerstand gegen das Böse würden am Ende unserer Tage hier beurteilt, und wenn wir zum Appell anträten, würden wir in eine Armee von Seelen eingegliedert, die in der nächsten Welt irgendeine große Mission erfüllen müssten. Wer diese Prüfung nicht bestehe, höre einfach auf zu existieren.
Kurz, Stormy sieht dieses Leben als Ausbildungslager. Das nächste Leben nennt sie »Dienst«.
Ich hoffe inständig, dass sie Unrecht hat, eine der Konsequenzen ihrer Kosmologie besteht nämlich darin, dass die vielen Schrecken, mit denen wir hier vertraut sind, eine Impfung gegen noch Schlimmeres in der zukünftigen Welt wären.
Stormy sagt, was immer von uns im nächsten Leben erwartet werde, es sei der Mühe wert, teilweise schon des Abenteuers wegen, vor allem aber, weil der Lohn für den »Dienst« in unserem dritten Leben käme.
Ich persönlich würde es vorziehen, meine Belohnung schon ein Leben früher zu erhalten, als Stormy es vorhersieht.
Stormy jedoch steht auf das, was die Psychologen Belohnungsaufschub nennen. Wenn sie am Montag Appetit auf einen Eisbecher hat, wartet sie bis Dienstag oder Mittwoch, um sich einen zu genehmigen. Sie behauptet steif und fest, durch das Warten würde der Eisbecher besser schmecken.
Mein Standpunkt ist folgender: Wenn man so scharf auf Eisbecher ist, sollte man einen am Montag, noch einen am Dienstag und einen dritten am Mittwoch verspeisen.
Laut Stormy werde ich mich, wenn ich zu lange nach dieser Anschauung lebe, in einen jener dreihundertfünfzig Kilo schweren Männer verwandeln, die von Fachleuten mit dem Baukran aus ihrer Behausung gehievt werden müssen, wenn sie mal krank werden.
»Wenn du die Demütigung hinnehmen willst, auf einem Pritschenwagen ins Krankenhaus geschafft zu werden«, hat sie einmal gesagt, »dann erwarte von mir bloß nicht, auf deinem aufgeblähten Ranzen zu hocken wie Jiminy Grille auf der Stirn des Walfischs und ›Wenn ein Stern in finst’rer Nacht‹ zu singen.«
Ich bin einigermaßen sicher, dass Jiminy Grille in dem Walt-Disney-Film Pinocchio nie auf der Stirn des Walfischs hockt. Genauer gesagt, bin ich noch nicht mal davon überzeugt, dass er den Wal überhaupt zu Gesicht bekommt.
Würde ich Stormy jedoch diese Meinung mitteilen, dann würde sie mir einen jener gequälten Blicke zuwerfen, die bedeuten: Bist du eigentlich hoffnungslos verblödet, oder hast du bloß miese Laune? Das sind Blicke, die man vermeidet, wenn nicht gar fürchtet.
Während ich dort auf der Bettkante im Zimmer des kleinen Jungen wartete, konnten mich auch die Gedanken an Stormy nicht aufheitern. Das schaffte nicht einmal die grinsende Visage von Scooby-Doo, mit der das Bettzeug ausgiebig bedruckt war, und das war gar kein gutes Zeichen.
Ich musste ständig daran denken, dass Harlo mit sechs Jahren seine Mutter verloren hat. Sein Leben hätte ein Denkmal für sie werden können, doch stattdessen hatte er Schande über ihr Andenken gebracht.
Und natürlich dachte ich auch über Penny nach: über ihr Leben, das so früh beendet worden war, den schrecklichen Verlust für ihre Angehörigen und den bleibenden Schmerz, der deren Leben für immer verändert hatte.
Penny legte ihre linke Hand in meine rechte und drückte sie beruhigend.
Ihre Hand fühlte sich so wirklich an wie die eines lebendigen Kindes, so fest, so warm. Ich begriff nicht, wie sie mir so wirklich vorkommen und doch durch Wände gehen konnte, so wirklich für mich und doch unsichtbar für andere.
Ich weinte ein bisschen. Das tue ich manchmal. Ich schäme mich meiner Tränen nicht. In Augenblicken wie diesem vertreiben Tränen Gefühle, die mich sonst verfolgen und dadurch verbittern würden.
Während mir bei den ersten, noch kaum vergossenen Tränen der Blick verschwamm, ergriff Penny meine Hand mit beiden Händen. Sie lächelte und zwinkerte mir zu, als wollte sie sagen: Ist schon gut, Odd Thomas. Lass es raus, befrei dich davon.
Die Toten haben ein feines Gespür für die Lebenden. Sie sind uns auf diesem Pfad vorangegangen und kennen unsere Ängste, unsere Schwächen, unsere verzweifelten Hoffnungen; und sie wissen, wie sehr wir uns an das klammern, was nicht von Dauer sein kann. Sie bemitleiden uns, glaube ich, und damit haben sie zweifelsohne Recht.
Als meine Tränen getrocknet waren, stand Penny auf, lächelte noch einmal und strich mir mit der Hand das Haar aus der Stirn. Leb wohl, schien diese Geste auszudrücken, danke und leb wohl.
Sie ging quer durchs Zimmer und durch die Wand in den Augustmorgen, ein Stockwerk hoch über dem Vorgarten – oder in ein anderes Reich, das noch heller war als der Sommer in Pico Mundo.
Einen Augenblick später tauchte Wyatt Porter im Türrahmen auf.
Unser Polizeichef ist zwar ein imposanter Mann, aber keine bedrohliche Erscheinung. Sein Gesicht, das sich durch die Augen eines Bassets und die Hängebacken eines Bluthunds auszeichnet, ist von der Schwerkraft stärker in Mitleidenschaft gezogen worden als sein übriger Körper. Ich habe durchaus schon beobachtet, wie er sich behände und entschieden bewegte, doch auch dann schien er ein großes Gewicht auf den kräftigen, runden Schultern zu tragen.
Während man die niedrigen Hügel rund um unsere Stadt mit Fertighäusern gepflastert hat, während die Bevölkerung angeschwollen ist, und während sich die Niedertracht einer immer grausameren Welt auch in die letzten Oasen der Wohlanständigkeit – wie Pico Mundo – geschlichen hat, sind Jahre vergangen, in denen Chief Porter vielleicht zu viel menschliche Heimtücke gesehen hat. Vielleicht ist das Gewicht, das er trägt, eine Last aus Erinnerungen, die er lieber abwerfen würde, es aber nicht kann.
»Da wären wir wieder«, sagte er, als er ins Zimmer kam.
»Da wären wir«, stimmte ich ihm zu.
»Ruinierte Terrassentür, ruiniertes Mobiliar.«
»Das meiste hab ich nicht selbst ruiniert. Außer der Lampe.«
»Aber du hast die Situation geschaffen, die dazu geführt hat.«
»Ja, Sir.«
»Wieso bist du nicht zu mir gekommen, damit ich ’ne Chance hatte, mir auszudenken, wie Harlo sich selbst eine Falle stellt?«
So hatten wir in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet.
»Mein Gefühl«, sagte ich, »hat mir gesagt, dass man ihn sofort stellen musste, weil er es vielleicht sehr bald wieder tun würde.«
»Dein Gefühl.«
»Ja, Sir. Das hat Penny mir nämlich mitteilen wollen, glaube ich. Sie hat so eine stille Dringlichkeit ausgestrahlt.«
»Penny Kallisto.«
»Ja, Sir.«
Der Polizeichef seufzte. Er ließ sich auf dem einzigen Stuhl im Zimmer nieder, einem lila gepolsterten Kindermöbel, dem Kopf und Rumpf von Dino Barney als Rückenstütze dienten. Es sah so aus, als säße er auf Barneys Schoß. »Junge, du machst mir ganz schön das Leben schwer.«
»Es sind andere, die Ihnen das Leben schwer machen, und meines noch viel mehr als Ihres«, sagte ich, womit ich die Toten meinte.
»Wohl wahr. An deiner Stelle wäre ich schon vor Jahren verrückt geworden.«
»Das hab ich auch durchaus in Erwägung gezogen«, gab ich zu.
»Hör mal, Odd, ich will einen Weg finden, dir diesmal einen Auftritt vor Gericht zu ersparen, falls es überhaupt dazu kommen sollte.«
»Ganz in meinem Sinne.«
Wenige Menschen kennen eines meiner seltsamen Geheimnisse. Nur Stormy Llewellyn kennt sie alle.
Ich will anonym bleiben und ein einfaches, ruhiges Leben führen, soweit es die Geister erlauben jedenfalls.
»Ich nehme an, er wird in Anwesenheit seines Anwalts ein Geständnis ablegen«, sagte der Polizeichef. »Womöglich gibt’s deshalb gar kein ausführliches Verfahren. Aber falls doch, werden wir sagen, dass er seine Brieftasche aufgeklappt hat, um eine Wette zu begleichen, die er mit dir abgeschlossen hatte, zum Beispiel auf ein Baseballspiel, und dabei sind die Fotos von Penny herausgefallen.«
»Das kann ich rüberbringen«, versicherte ich ihm.
»Ich spreche mit Horton Barks, damit er deine Beteiligung herunterspielt, wenn er über die Sache schreibt.«
Horton Barks ist der Herausgeber der Maravilla County Times. Vor zwanzig Jahren ist er in den Wäldern von Oregon beim Wandern auf Bigfoot getroffen und hat ihn zum Dinner eingeladen – falls man eine Tüte Studentenfutter und eine Dose Würstchen als Dinner bezeichnen kann.
In Wahrheit weiß ich nicht sicher, ob Horton mit Bigfoot diniert hat; er behauptet es jedenfalls. Und angesichts meiner täglichen Erfahrungen habe ich keinerlei Recht, Horton oder irgendjemand anderem zu misstrauen, der Geschichten über Begegnungen mit Aliens, Kobolden und Ähnlichem zu erzählen hat.
»Alles in Ordnung?«, erkundigte sich Chief Porter.
»Mehr oder weniger. Abgesehen davon, dass ich nicht gern zu spät zur Arbeit komme. Jetzt ist im Grill am meisten los.«
»Hast du schon angerufen?«
»Klar.« Ich hielt mein Handy hoch, das bei meinem Sturz in den Pool an den Gürtel geklemmt gewesen war. »Funktioniert noch.«
»Wahrscheinlich komme ich später vorbei, auf ’ne große Portion hausgemachte Pommes mit Rührei.«
»Frühstück den ganzen Tag«, sagte ich. Das ist das feierliche Motto des Pico Mundo Grill, und zwar schon seit 1946.
Chief Porter verlagerte sein Gewicht von einer Pobacke auf die andere, was Barney ächzen ließ. »Sag mal, Junge, willst du eigentlich immer als Grillkoch arbeiten?«
»Nein, Sir. Ich hab darüber nachgedacht, meiner Karriere eine neue Richtung zu geben: Autoreifen.«
»Autoreifen?«
»Vielleicht zuerst Verkauf und dann Montage. Bei Tire World draußen ist immer eine Stelle frei.«
»Wieso Autoreifen?«
Ich zuckte die Achseln. »Die Leute brauchen sie. Und es ist etwas, was ich nicht kenne, was Neues. Ich würde gern sehen, was das für ein Leben ist, das Reifenleben.«
Etwa eine halbe Minute saßen wir schweigend da. Dann fragte er: »Und das ist das Einzige, was du für die Zukunft im Blick hast? Reifen, meine ich.«
»Die Wartung von Swimmingpools ist auch ’ne interessante Branche. Bei den ganzen Neubauvierteln, die rundum aus dem Boden schießen, gibt’s fast jeden Tag einen neuen Pool.«
Chief Porter nickte nachdenklich.
»Abgesehen davon, ist es bestimmt schön, in einer Bowlingbahn zu arbeiten«, sagte ich. »Das ganze Kommen und Gehen, die prickelnde Wettkampfatmosphäre.«
»Was würdest du denn in einer Bowlingbahn tun?«
»Mich beispielsweise um die Leihschuhe kümmern. Die müssen zwischendrin bestrahlt werden oder so ähnlich. Und gewienert. Die Schnürsenkel muss man auch regelmäßig kontrollieren. «
Der Chief nickte, und der lila Barney-Stuhl quietschte, allerdings eher wie eine Maus als wie ein Dinosaurier.
Meine Kleider waren inzwischen fast trocken, aber übel zerknittert. Ich sah auf die Uhr. »Ich sollte los. Bevor ich zum Grill kann, muss ich mich erst mal umziehen.«
Wir standen beide auf.
Der Barney-Stuhl brach in sich zusammen.
Chief Porter betrachtete die lila Trümmer. »Das könnte passiert sein, als du dich mit Harlo geprügelt hast.«
»Durchaus«, sagte ich.
»Die Versicherung wird’s schon bezahlen, zusammen mit dem anderen Zeug.«
»Gut, dass es Versicherungen gibt«, stimmte ich zu.
Wir gingen hinunter in die Küche, wo Stevie auf einem Hocker saß und vergnügt ein Zitronentörtchen futterte.
»Es tut mir Leid, aber ich hab deinen Stuhl kaputtgemacht«, erklärte ihm Chief Porter, denn der Polizeichef ist kein Lügner.
»Ach, das war bloß ein blöder alter Barney-Stuhl«, sagte der Junge. »Für dieses blöde alte Barney-Zeug bin ich schon laaange viel zu alt.«
Stevies Mutter war damit beschäftigt, mit Besen und Kehrschaufel die Glassplitter zusammenzufegen.
Chief Porter berichtete ihr von dem Stuhl, was sie als unwichtig abtun wollte, aber er nahm ihr das Versprechen ab, die Anschaffungskosten nachzuschauen und ihm mitzuteilen.
Dann bot er mir an, mich nach Hause zu fahren, aber ich sagte: »Am schnellsten ist es, wenn ich genau so zurückkehre, wie ich gekommen bin.«
Ich verließ das Haus durch das Loch, wo die Glastür gewesen war, ging um den Pool, statt hindurchzuplanschen, kletterte über die Ziegelmauer, lief durch den engen Gang, stieg über den schmiedeeisernen Zaun, ging über den Rasen rund um das nächste Haus, überquerte die Marigold Lane und kehrte in meine Wohnung über der Garage zurück.
4
Ich sehe tote Menschen. Und dann handle ich eben, wenn es nötig sein sollte.
Diese aktive Strategie ist lohnend, wenn auch gefährlich. An manchen Tagen führt sie zu einer ungewöhnlichen Menge Wäsche.
Nachdem ich saubere Jeans und ein frisches weißes T-Shirt angezogen hatte, machte ich einen Abstecher zur hinteren Veranda von Mrs. Sanchez, um ihr zu bestätigten, dass sie sichtbar sei. Das tat ich jeden Morgen. Durch das Fliegengitter der Tür sah ich sie am Küchentisch sitzen.
Ich klopfte, und sie fragte: »Kannst du mich hören?«
»Ja, Ma’am«, sagte ich, »ich höre Sie ganz prima.«
»Wen hörst du?«
»Sie. Rosalia Sanchez.«
»Na, dann komm rein, Odd Thomas«, sagte sie.
Ihre Küche roch nach Chili und Maismehl, Spiegeleiern und Käse. Ich bin ein fantastischer Grillkoch, aber Rosalia Sanchez ist die geborene Feinschmeckerköchin.
Alles in ihrer Küche ist alt und abgenutzt, aber makellos sauber. Antiquitäten sind wertvoller, wenn Zeit und Verschleiß sie mit einer warmen Patina überzogen haben. Die Küche von Mrs. Sanchez ist so schön wie die kostbarste Antiquität; sie besitzt die unschätzbare Patina eines arbeitsreichen Lebens, in dem jemand mit Vergnügen und Liebe gekocht hat.
Ich setzte mich zu Mrs. Sanchez an den Tisch.
Sie umklammerte den Kaffeebecher mit beiden Händen, damit sie nicht zitterten. »Du bist heute Morgen aber spät dran, Odd Thomas.«
Sie benutzt stets beide Namen. Manchmal habe ich den Verdacht, dass sie meint, Odd sei kein Name, sondern ein Adelstitel wie Prinz oder Herzog, den jeder Bürgerliche verwenden müsse, wenn er mich anrede.
Vielleicht glaubt sie, ich sei der Sohn eines entthronten Königs, der gezwungen ist, in misslichen Umständen zu leben, aber dennoch Respekt verdient.
»Spät, ja, tut mir Leid«, sagte ich. »Es war ein merkwürdiger Morgen.«
Sie weiß nichts von meiner besonderen Beziehung zu den Verstorbenen. Schließlich hat sie schon genug Probleme, ohne sich auch noch Sorgen wegen toter Leute zu machen, die zu ihrer Garage pilgern.
»Kannst du sehen, was ich trage?«, fragte sie besorgt.
»Blassgelbe Hosen. Eine Bluse in Dunkelgelb und Braun.«
Sie stellte mir eine Falle. »Gefällt dir die Schmetterlingsspange in meinem Haar, Odd Thomas?«
»Da ist keine Haarspange. Ihr Haar wird von einem gelben Band zusammengehalten. Schaut hübsch aus.«
Als junge Frau muss Rosalia Sanchez auffällig schön gewesen sein. Mit dreiundsechzig hat sie ein paar Pfund zugelegt und sich die Fältchen und Runzeln einer reichen Erfahrung erworben. Nun strahlt sie die freundliche Demut und Sanftheit aus, die uns die Zeit lehren kann, und die liebenswerte Wärme eines fürsorglichen Charakters – Eigenschaften, die zweifellos auch die alternden Gesichter jener besonderen Menschen geprägt haben, die man später heilig gesprochen hat.
»Als du nicht zur üblichen Zeit gekommen bist«, sagte sie, »da dachte ich, du wärst hier gewesen, ohne mich sehen zu können. Und ich dachte, ich könnte dich auch nicht mehr sehen, weil du in dem Moment, als ich für dich unsichtbar geworden bin, auch für mich unsichtbar geworden bist.«
»Hab mich bloß verspätet«, beruhigte ich sie.
»Es wäre schrecklich, unsichtbar zu sein.«
»Also, ich bräuchte mich dann nicht mehr so oft rasieren.«
Wenn es um Unsichtbarkeit geht, verweigert Mrs. Sanchez sich jedem Humor. Ihr gutmütiges Gesicht verzog sich zu einem missbilligenden Stirnrunzeln.
»Wenn ich Angst davor gehabt hab, unsichtbar zu werden«, sagte sie, »hab ich bisher immer gedacht, ich würde die anderen Leute immer noch sehen können, bloß die könnten mich nicht mehr sehen und hören.«
»In diesen alten Filmen mit dem ›Unsichtbaren‹«, sagte ich, »kann man seinen Atem sehen, wenn er in richtig kaltem Wetter rausgeht.«
»Aber wenn andere Leute für mich unsichtbar werden, sobald ich für sie unsichtbar bin, dann ist es so, als wäre ich der letzte Mensch auf der Welt, die ganz leer ist außer mir, und ich muss ganz allein umherwandern.«
Sie schauderte. Der Kaffeebecher im Klammergriff ihrer Hände klapperte auf dem Tisch.
Wenn Mrs. Sanchez über Unsichtbarkeit spricht, dann spricht sie über den Tod, wenngleich ich mir nicht sicher bin, ob ihr das klar ist.
Das wahre erste Jahr des neuen Millenniums, 2001, ist für die Welt im Allgemeinen schon nicht gut gewesen, für Rosalia Sanchez war es eine reine Katastrophe. Es begann mit dem Tod ihres Mannes Herman in einer Aprilnacht. In jener Nacht ist sie neben dem Mann, den sie über vierzig Jahre lang geliebt hat, eingeschlafen – und neben einer kalten Leiche aufgewacht. Zu Herman war der Tod so sanft gekommen wie nur möglich, im Schlaf, aber bei Rosalia hat der Schock, neben einem Toten aufzuwachen, ein Trauma ausgelöst.
Weil sie später im selben Jahr immer noch um ihren Mann trauerte, verzichtete sie darauf, ihre drei Schwestern und deren Familien zu einer lange geplanten Reise nach Neuengland zu begleiten. Als sie am Morgen des 11. September aufwachte, hörte sie in den Nachrichten, dass die Maschine, mit der ihre Verwandten aus Boston zurückkehren sollten, bei einer der infamsten Schandtaten der Geschichte als Lenkflugkörper benutzt worden war.
Kinder hatte Rosalia sich zwar gewünscht, aber Gott hatte ihr keine geschenkt. Herman, ihre Schwestern, ihre Nichten und Neffen waren der Mittelpunkt ihres Lebens gewesen. Nun hatte sie alle verloren, während sie schlief.
Irgendwann zwischen September und Weihnachten ist Rosalia dann vor Gram etwas verrückt geworden. Auf stille Weise verrückt, weil sie ihr ganzes Leben still vor sich hin gelebt hatte und kein anderes Verhalten kannte.
Seither weigert sie sich in ihrem sanften Wahnsinn zuzugeben, dass ihre Angehörigen tot sind. Sie sind für Rosalia nur unsichtbar geworden. In einer albernen Laune hat die Natur zu einem seltenen Phänomen gegriffen, das jeden Augenblick wie ein Magnetfeld aufgehoben werden kann, sodass all ihre verlorenen Lieben für sie wieder sichtbar werden.
Was das Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen im Bermuda-Dreieck angeht, kennt Rosalia Sanchez sämtliche Einzelheiten. Sie hat jedes Buch über das Thema gelesen, das sie auftreiben konnte.
Sie weiß von dem unerklärlichen, offenbar urplötzlichen Verschwinden hunderttausender Maya aus den Städten Copán, Piedras Negras und Palenque im Jahr 610 n. Chr.
Wenn man Rosalia das Ohr zu einer ernsthaften Diskussion über solche historischen Fälle leiht, dann gibt sie es nicht mehr so leicht frei. Zum Beispiel weiß ich mehr, als mir lieb ist – und unendlich viel mehr, als ich wissen muss – über eine Division aus dreitausend chinesischen Soldaten, die sich 1939 bei Nanking bis zum letzten Mann in Luft aufgelöst hat.
»Na ja«, sagte ich, »immerhin sind Sie heute Morgen sichtbar. Sie können sich auf einen ganzen weiteren Tag Sichtbarkeit freuen, und das ist doch ein Segen.«
Rosalias größte Angst ist es, an eben dem Tag, an dem ihre Lieben wieder sichtbar gemacht werden, selbst zu verschwinden.
Obwohl sie sich nach deren Rückkehr sehnt, fürchtet sie sich vor den Folgen.
Sie bekreuzigte sich, sah sich in ihrer gemütlichen Küche um und lächelte endlich. »Ich könnte irgendetwas backen.«
»Sie könnten alles backen«, sagte ich.
»Was soll ich denn für dich backen, Odd Thomas?«
»Wenn ich das sage, ist es nachher keine Überraschung.« Ich sah auf meine Armbanduhr. »Jetzt muss ich aber zur Arbeit.«
Sie begleitete mich zur Tür und drückte mich zum Abschied. »Du bist ein guter Junge, Odd Thomas.«
»Und Sie erinnern mich an meine Oma Sugars«, sagte ich, »außer dass Sie nicht Poker spielen, nicht Whiskey trinken und nicht schnelle Autos fahren.«
»Das ist aber lieb«, sagte sie. »Ich hab Pearl Sugars nämlich unheimlich bewundert. Sie war so weiblich, aber auch so …«
»Schlagkräftig«, schlug ich vor.
»Genau. Beim Erdbeerfest der Kirche hat einmal jemand randaliert, wahrscheinlich war er bis oben voll mit Drogen oder Schnaps. Pearl hat ihn mit gerade mal zwei Schlägen zu Boden gestreckt.«
»Sie hatte einen tollen linken Haken.«
»Allerdings hat sie ihm zuerst in die Weichteile getreten. Aber ich glaube, sie wäre auch mit ihm fertig geworden, wenn sie bloß die Fäuste verwendet hätte. Manchmal hab ich mir gewünscht, mehr so zu sein wie sie.«
Von Mrs. Sanchez’ Haus ging ich sechs Straßen weit bis zum Pico Mundo Grill, der mitten im Stadtzentrum von Pico Mundo steht.
Mit jeder Minute, die sich der Morgen vom Sonnenaufgang entfernte, wurde er heißer. Von der Bedeutung des Wortes Mäßigung haben die Götter der Mojavewüste offenbar nie gehört.
Die langen Morgenschatten wurden vor meinen Augen kürzer; sie zogen sich von immer wärmer werdenden Rasenflächen zurück, von schmorendem Asphalt, von betonierten Gehsteigen, die zum Braten von Spiegeleiern so geeignet waren wie die Bratplatte, vor der ich bald stehen würde.
Die Luft hatte nicht genug Energie, um sich zu bewegen. Die Bäume hingen schlaff da. Die Vögel verzogen sich entweder in belaubte Verstecke oder flogen höher dahin, als sie es in der Dämmerung getan hatten, weit oben, wo die dünnere Luft weniger Hitze speichern konnte.
In dieser welken Stille sah ich auf dem Weg von Mrs. Sanchez’ Haus zum Grill drei sich bewegende Schatten. Alle waren unabhängig von einer Quelle, weil es keine gewöhnlichen Schatten waren.
Als ich jünger war, habe ich diese Gebilde als Schemen bezeichnet. Aber das ist bloß ein anderes Wort für Geister, und sie sind keine Geister wie Penny Kallisto.
Ich glaube nicht, dass sie je in menschlicher Gestalt durch diese Welt gezogen sind oder das Leben kannten, wie wir es kennen. Ich vermute, dass sie nicht hierher gehören und dass ihre eigentliche Heimat ein Reich der ewigen Dunkelheit ist.
Ihre Gestalt ist fließend, ihre Substanz nicht stärker als die von Schatten. Ihre Bewegung ist geräuschlos. Ihre Absichten sind zwar geheimnisvoll, doch sicher nicht von guter Art.
Oft schleichen sie dahin wie Katzen, die Menschengröße haben. Gelegentlich laufen sie auch halb aufrecht wie Traumwesen, die halb Mensch, halb Hund sind.
Ich sehe sie nicht oft. Wenn sie erscheinen, kündigt ihre Anwesenheit immer Unheil an, das schlimmer ist als gewöhnlich und eine dunklere Dimension hat.
Für mich sind sie jetzt keine Schemen mehr. Ich nenne sie Bodachs.
Das Wort Bodach habe ich von einem sechsjährigen Jungen aus England gelernt, der hier zu Besuch war. Er hat es verwendet, als er ein Rudel solcher Wesen durchs Zwielicht von Pico Mundo streifen sah. In den Märchen der Britischen Inseln ist der Bodach eine kleine, boshafte Kreatur, die durch den Schornstein kommt, um ungezogene Kinder zu holen.
Ich glaube nicht, dass diese Gestalten, die ich sehe, tatsächlich Bodachs sind. Das hat der englische Junge wohl auch nicht geglaubt. Das Wort ist ihm nur deshalb in den Sinn gekommen, weil er keinen besseren Namen für sie kannte. Auch ich kenne keinen.
Unter den Menschen, die ich kennen gelernt habe, ist er der einzige, der denselben besonderen Blick hatte wie ich. Wenige Minuten nachdem er in meiner Gegenwart das Wort Bodach ausgesprochen hatte, wurde er zwischen einem außer Kontrolle geratenen Lastwagen und einer Betonmauer zu Tode gequetscht.
Als ich den Grill erreichte, hatten die drei Bodachs sich zu einem Rudel zusammengetan. Sie rannten weit vor mir her, glitten schimmernd um eine Ecke und verschwanden, als wären sie nichts gewesen als Hitzekobolde, als Täuschungen der Wüstenluft und der mörderischen Sonne.
Denkste.